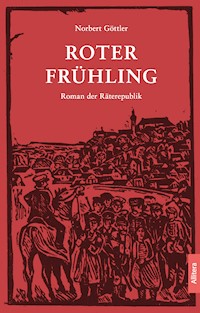
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
München im Herbst 1918. In der Stadt brodelt es. Nach dem verlorenen Krieg drängen sich verarmte Kleinbürger, entwurzelte Soldaten, Deserteure und Schwarzhändler in den Straßen. Vor den öffentlichen Suppenküchen stehen die Menschen Schlange, der Unmut wächst. Während das Bürgertum Münchens wie gelähmt ist, wird in Schwabing der Weg in die Räterepublik bereitet. Künstler und Intellektuelle wie Kurt Eisner, Erich Mühsam und Ernst Toller rufen zur Revolution auf. Der letzte bayerische König Ludwig III. flieht heimlich aus dem Land. In Dachau kommt es zur Schlacht zwischen Revolutionären und den Regierungstruppen. Während in der fiebrigen Welt der Schwabinger Boheme Entwicklungen diskutiert werden, erprobt der Psychologe Dr. Sitty die Theorien des jungen Wiener Nervenarztes Sigmund Freud an einer Patientin. Norbert Göttler zeichnet in seinem Roman ein brillantes und vielschichtiges Bild der revolutionären Geschehnisse nach und blickt auf die kleinen Leute, deren Biografien sich nicht in den Geschichtsbüchern finden lassen. Mit seinen Illustrationen liefert Klaus Eberlein bestechende Momentaufnahmen aus einer der packendsten Episoden der jüngeren Geschichte Münchens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Göttler
ROTER FRÜHLING
Roman der Räterepublik
Mit Illustrationen von Klaus Eberlein
Informationen über den Verlag und sein Programm unter:
www.allitera.de
Juli 2018
Allitera Verlag
Ein Verlag der Buch&media GmbH
© 2018 Buch&media GmbH, München
Wir danken dem St. Michaelsbund für das freundliche Überlassen der Rechte.
Satz und Umschlaggestaltung (unter Verwendung einer Illustration von Klaus Eberlein): Franziska Gumpp
Gesetzt aus der Sabon LT
Printed in Europe
ISBN print 978-3-96233-047-7
ISBN epub 978-3-96233-067-5
Allitera Verlag
Merianstraße 24 · 80637 München
info@allitera.de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Epilog
1Welche Farbe hat das Mündungsfeuer eines Erschießungskommandos? Kadmiumgelb und Titanweiß, mit einem Hauch von Karmesinrot? Oder doch eher Orange und Kobaltviolett? Ist der Pulverdampf von leichtem Schwefelgelb durchsetzt oder von einem Schleier aus Anthrazit und Ultramarin? Davon hängt viel ab. Man muss den Schwefel des verbrannten Pulvers riechen, den Knall der Explosion hören können! Die sechs Soldaten neigen ihre Köpfe nach rechts. Sie tragen blaue Drilliche und leuchtend weiße Gürtel. Die Säbel daran baumeln bis zu den Waden der Männer. Die Soldaten haben ihre Köpfe deshalb so weit nach rechts geneigt, weil sie durch die Zieleinrichtung ihrer Karabiner blicken. Ihre Mienen sind nicht zu erkennen. Vermutlich blicken sie angestrengt, vielleicht sogar verkniffen. Nur das Gesicht des Offiziers kann man sehen. Er steht hinter seinen Leuten und prüft im Moment des Knalles gelangweilt das Schloss seines Gewehres. Ist das Rot seiner Uniformmütze so rot wie das Mündungsfeuer? Sophies Augen wandern lange hin und her. Über der grauen Kasernenmauer sieht man die Köpfe einer Horde Neugieriger. Sie drängen und stoßen, nur zwei von ihnen haben sich einen bequemen Zuschauerplatz erobern können. Die Soldaten kümmern sich nicht darum. Die Gesichter in der Menge sind undeutlich. Junge Leute, neugierig und sensationslüstern. Sophie stutzt. Das Mädchen auf der linken Seite, gleicht es nicht ihr selbst? Ein schlankes Frauengesicht, kurzer Pagenschnitt, leicht angedeutete Wangenknochen? Man kann sich täuschen, gerade auf diese Entfernung! Wäre sie selbst neugierig genug, einer Erschießung beizuwohnen? Vielleicht, Sophie weiß es nicht. Könnte sie in die Augen der Todgeweihten blicken, wenn die Schüsse die Stille zerreißen?
Die Soldaten fixieren ihre Opfer. Sie sehen die Körper von drei Männern, die man vor die Kasernenwand gestellt hat. Ernst und gefasst blicken die Männer in die Gewehrläufe. Ihre Hände sind nicht gefesselt und ihre Augen nicht verbunden. Noch stehen sie in der prallen Sonne, ihre Schatten liegen bereits hart auf dem Lehmboden. Die weiß lackierten Gürtel der Soldaten reflektieren das Licht. Noch fließt kein Blut. Rot ist nur das Mündungsfeuer der Gewehre und das Käppchen des Offiziers. Erst jetzt, in diesem Moment haben alle sechs Soldaten abgedrückt. Die elend lange Stille zwischen den letzten Schritten und dem scharfen Kommando des Offiziers ist zu Ende. Einer der drei Männer ist tödlich getroffen, die beiden anderen stehen aufrecht, wie betäubt. Sieht man eigentlich die Farbe des Mündungsfeuers auf sich zukommen? Spürt man die Hitze der Metallkugel?
Sophie kneift die Augen zusammen. In ihrem Kopf findet ein Perspektivenwechsel statt. Plötzlich ist sie nicht mehr Teil der johlenden Menge, sondern steht mitten unter den Delinquenten. Mit jedem Pinselstrich, mit dem sie über die Leinwand fährt, wird sie mehr Teil des Geschehens. Um sie herum ist die gleiche konzentrierte Stille wie vor dem Kommando des Offiziers. Zwölf junge Männer und Frauen sitzen in weißen Malerkitteln vor Édouard Manets Ölbild »Die Erschießung Kaiser Maximilians«. Nur die Schritte des Professors, der seinen Schülern im Übungssaal der Pinakothek über die Schultern blickt, sind zu hören. Er lässt in diesen Zeiten das Werk eines Franzosen kopieren. Mutig, findet Sophie, mutig und ein wenig trotzig. Die Exekution des Habsburgers Maximilian von Mexiko und seiner beiden Begleiter: Manet hat sie wie in einer Momentaufnahme festgehalten. Doch für Sophie ist sie erst an diesem verregneten Vormittag zur Gegenwart geworden. Warum diese Männer zum Tod verurteilt wurden, interessiert sie nicht. Die Schüsse, sie gelten ihr. Nur das fühlt sie. Die graue Kasernenwand, die gaffende Menge, die unbeteiligte Miene des Offiziers, sie wird diese Bilder nicht mehr loswerden. Irgendetwas daran bedroht sie. Sophie Sitty wird die beste Kopie malen und ein Sonderlob vom Professor erhalten. Sie wird das Bild hinter ihren Kleiderschrank schieben und nie mehr in ihrem kurzen Leben hervorholen …
Die hellenistische Begeisterung von Doktor Vinzent Sitty manifestierte sich nicht nur in einer umfangreichen Sammlung antiker Autoren, nicht nur in dem Umstand, dass seine drei Töchter auf griechische Vornamen hörten, Nike, Daphne und Sophie, sondern vor allem darin, dass er seinen Familiennamen seit seiner Hochzeit mit einem schwungvollen Ypsilon zu beenden pflegte. Doktor Sitty saß am Schreibtisch seines Behandlungszimmers und unterzeichnete einen Stapel Liquidationen. Nachdem er wohl ein Dutzend Mal seinen Schriftzug unter die Bögen gesetzt hatte, stutzte er und ließ den Federhalter sinken. »Sitty … Sitty …«, murmelte er in seinen kurzgeschnittenen Bart. »Genau betrachtet, ein sonderbarer Name! Sonderbar und selten.« Er konnte sich in diesem Augenblick nicht entsinnen, je einen Namensvetter außerhalb seiner eigenen Familie kennengelernt zu haben. Eigenartig, dieser Gedanke war ihm in den fast 50 Jahren seines bisherigen Lebens niemals gekommen. Warum gerade heute?
Doktor Vinzent Sitty wollte seine unterbrochene Tätigkeit wieder aufnehmen, zögerte dann aber, räusperte sich und steckte den Federhalter in die Hülle zurück. Energisch stemmte er sich aus seinem Stuhl und trat an einen der Bücherschränke, die nahezu alle Wände des geräumigen Arbeitszimmers verdeckten. Mit ausgestrecktem Zeigefinger visitierte er eine Reihe lederner Bandrücken. Schließlich fand er das gewünschte Büchlein und zog es hervor. »Adressund Telefonbuch der Hauptund Residenzstadt München aus dem Jahre 1899« stand in golden geprägten Lettern auf dem Einband. Er blätterte umständlich, leckte sich gewohnheitsmäßig nach jeder Seite den Zeigefinger, bis er schließlich die gesuchte Stelle fand. Singer, Elise, Putzmacherin … Sittner, Ferdinand, Cafetier … Richtig, hier: Sitty, Dr. med. Vinzent, praktischer Arzt, Rindermarkt Nr. 14. Und dann? Nichts. Keine weiteren Sittys oder Sittis waren in ganz München und Umgebung zu finden! Der nächste Eintrag des Adressbuches lautete schon auf einen Privatier namens Joseph-Maria Sommer.
Doktor Sitty steckte das Adressbuch nachdenklich an seinen Platz zurück. Sein Blick fiel auf eine kleine Fotografie, die, silbern eingerahmt, zwischen den Büchern stand. Das verblasste Bild zeigte seine Eltern am Tag ihrer Hochzeit, aufgenommen und daguerreotypiert beim Königlichen Lichtbildmaler Fenzl in der Theresienstraße. Ja, dieser seltene und eigenartige Name seiner Familie würde aussterben, zumindest hier in München. Schade eigentlich. Seine beiden älteren Töchter hatten mit der Heirat ihre Mädchennamen abgelegt, sein Bruder Luitpold war so gut wie verschollen. Draußen auf dem Land, da dürfte es noch einige Familien dieses Namens geben, Bauern und Händler. Vielleicht sollte er doch einmal hinausfahren aufs Land? Ach was! Er hatte sich nie sonderlich viel um seine Vorfahren und ihre Geschicke gekümmert. Und jetzt plötzlich diese Gedanken? Sitty legte das Hochzeitsfoto seiner Eltern ein wenig abrupt beiseite. Vielleicht doch eine Verschrobenheit des alternden Gehirns, das sich urplötzlich mehr der Vergangenheit zuwendet als der Zukunft? Eine physiologische Schutzfunktion vielleicht? Im Österreichischen sollte es sogar ein Adelsgeschlecht dieses Namens geben, hatte einmal ein Patient erzählt. Graf von Sitty, Freiherr von Sitty? Verarmter Landadel vermutlich!
Der Arzt musste unwillkürlich schmunzeln. Blaublütig sind sie hier in München beileibe nicht geworden, die Sittis. Sein Großvater Balthasar hatte einen kleinen Gemischtwarenhandel geführt, drüben in der Sendlinger Straße. Dort gab es alles, was zu einem kleinbürgerlichen Leben in der Stadt nötig war: eingelegtes Kraut in Fässern, Kartoffeln und Bohnen, Scheuerpulver und Bürsten, aber auch Mausefallen, Rattengift und Wagenschmiere. Ein Sammelsurium sondergleichen, wie sich Vinzent Sitty aus Kindheitstagen dumpf erinnern konnte. Erst der Vater, ein ernster und schweigsamer Mensch, hatte das Geschäft auf Drogerieartikel begrenzt und damit den Zeitgeschmack des Münchner Fin de Siècle getroffen. Statt Bottiche mit sauren Heringen fanden nun Seifenkistchen und Gewürzdosen den Weg in die Regale, Parfümflakons ersetzten die alten Petroleumflaschen, feine Zahnbürsten die Pferdestriegel und Flederwische. Auch das Publikum änderte sich: An der unverändert gebliebenen Ladentheke drängten sich nicht mehr fluchende Rossknechte und verhärmte, bucklige Arbeiterfrauen, sondern soignierte Herren in Frack und Zylinder sowie bürgerliche Damen mit weit ausladenden Federhüten. Durch solcherlei Geschäftssinn, aber auch durch emsigen Fleiß war der Drogist Balthasar Sitti jr. in wenigen Jahren zu bescheidenem Wohlstand gekommen. In diesen Jahren lockerten sich auch seine Strenge und Unnahbarkeit. Die knappe Konversation mit Kunden entfaltete sich immer öfter – vor Jahren noch undenkbar! – zu einer launigen Plauderei, seine einstmals schmucklose Arbeitskleidung nahm bürgerliche Formen an und bisweilen hielt vor der »Sitti’schen Drogeriewarenhandlung« gar ein Fiaker mit lautem Schnalzen, um das Ehepaar Balthasar und Josephine zum Königlichen Hoftheater zu chauffieren.
Der geschickteste Schachzug Balthasar Sittis aber war die Erweiterung des bereits florierenden Geschäfts um eine Apotheke. Schon seit geraumer Zeit hatte er sich mit Heilmitteln einfachster Art beschäftigt. Kräuterkissen und Rheumapflaster, Waschbenzin und Heilerde, Wadenwickel und Wundsalben stapelten sich in einer kleinen Ecke des Ladens. Aber zum einen fehlten dem rührigen Händler für pharmazeutischen Handel größeren Stils Ausbildung und Lizenz – Balthasar Sitti jr. war ein gesetzestreuer Mensch und hätte niemals wissentlich eine Anordnung des »Königlichen Amtes für die Gewerbeordnung« übertreten – und zum Zweiten war der Laden durch drogistische Produkte bereits so überfüllt, dass an eine Ausweitung der Geschäftstätigkeit vorerst nicht zu denken war.
Da kam ihm eines Tages ein Zufall, genauer gesagt ein doppelter Zufall zu Hilfe. Der erste Teil des Zufalles – oder der günstigen Konstellation der Gestirne, wie die Interpretation seiner Gattin Josephine lautete – begegnete Balthasar Sitti jr. in Form einer Zeitungsannonce, die er der morgendlichen Lektüre der »Münchner Neuesten Nachrichten« entnahm. Eine umrandete Annonce offerierte ein Geschäftslokal, das von den bisherigen Betreibern aus Altersgründen verkauft werden sollte. Die Adresse lautete: Sendlinger Straße 19. Balthasar Sitti jr. war bereits im Begriff weiterzublättern, als ihm die Tragweite dieser Ankündigung bewusst wurde. Die an seine Drogerie grenzende Flickschusterei stand zu Gebote! Da er aus alter Gewohnheit wenig Kontakt zur Nachbarschaft pflegte, war ihm völlig entgangen, dass die kinderlosen Flickschustersleute bereits seit geraumer Zeit nur mehr apathisch darauf harrten, von den Behörden in das städtische Siechenhaus eingeliefert zu werden.
Teil zwei der unternehmerischen Glückssträhne nahm seinen Ausgang im monatlichen Kaffeeklatsch Josephine Sittis. Dort kam die Rede auf einen wissenschaftlich eifrigen, in wirtschaftlichen Dingen aber völlig unfähigen Apotheker der weiteren Nachbarschaft, der im Lauf weniger Jahre einen so großen Berg Schulden aufgehäuft hatte, dass er vor dem Ruin stand. Vor die Wahl gestellt, sich ehrbar einen Strick zu besorgen oder einen schändlichen Offenbarungseid zu leisten, wählte der verzweifelte Mann das zweite, und so wurde die Sache ruchbar. Balthasar Sitti jr., von seiner Gattin in Kenntnis gesetzt und von gründerzeitlichem Unternehmergeist beseelt, fackelte nicht lange. Er suchte den kreidebleichen Apotheker auf, redete eine Zeit lang energisch auf ihn ein und unterschrieb dann ein Papier, worauf er sich verpflichtete, die größten Verbindlichkeiten des Unglücklichen zu übernehmen. Sodann erwarb er die anliegenden Räumlichkeiten der aufgelassenen Flickschusterei, ließ einen Durchgang zu seiner Drogerie herausbrechen und renovierte den ganzen Komplex gründlich. Stolz und mit eigener Hand montierte er das neue Geschäftsschild, auf dem in goldener Frakturschrift zu lesen stand: »Sitti’sche Drogerieund Apothekenwarenhandlung«. Hinter der neu eingerichteten Apotheke stand in schneeweißem Kittel der ehemalige Bankrotteur, der sich im Gegenzug zu den Sitti’schen Zuwendungen verpflichtet hatte, amtliche Lizenz, Sachverstand und Tatkraft dem expandierenden Unternehmen in der Sendlinger Straße zur Verfügung zu stellen. Dieser Verkettung von Lebensschicksalen hatte also der kleine Vinzent seinen ersten Kontakt zu Medizin und Pharmazie zu verdanken. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit suchte er der strengen Aufsicht des Fräulein Fanny zu entwischen und in das geheimnisvolle Reich des Apothekers im Erdgeschoss zu gelangen. Fräulein Fanny war eine dürre Person unbestimmten Alters und nahezu unbestimmten Geschlechts, die sich seit einiger Zeit um Haushalt und Kindererziehung im Hause Sitti bemühte. Da seine Gattin immer mehr von den Belangen des Ladens in Beschlag genommen wurde, hatte Balthasar Sitti jr. zögernd ihrem Vorschlag zugestimmt, diese unverheiratete Verwandte in Stellung zu nehmen. Fräulein Fanny war in ihrer Jugend drauf und dran gewesen, den Schleier der Servitinnen zu nehmen und sich als Ordensfrau und Lehrerin ausbilden zu lassen. Eine hartnäckige Erkrankung hatte den Plan damals zunichtegemacht. Aus dieser Zeit waren Fräulein Fanny eine Handvoll verstaubter Lehrbücher geblieben und einige nicht minder antiquierte pädagogische Grundsätze, die immerhin dazu beitrugen, dass sie im Hause Sitti als erste Instanz in Erziehungsfragen anerkannt wurde. Das schmale Gehalt, das ihr Balthasar Sitti jr. jeden Monat mit saurer Miene auszahlte, kam zwar nicht direkt dem Aufbau des Geschäftes zugute, aber immerhin – so tröstete er sich – ging es um seine Söhne, also um die Zukunft seiner ökonomischen Vision. Balthasar Sitti jr. hatte große Pläne, aber sie nisteten nur in den hintersten Winkeln seines Gehirns. Kaum einmal kamen sie zu Wort, am allerwenigsten im Familienkreis. Der Drogist war ein schweigsamer, grüblerischer Mensch. Die langen Jahre, die er unter der provinziellen Engstirnigkeit seines Vaters, des Kolonial- und Gemischtwarenhändlers Balthasar Sitti sen., zu leiden hatte, waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen und er hatte gelernt, seine Lebensträume hinter einer dicken Fassade aus Unnahbarkeit und Verschrobenheit zu verbergen.
In seiner Schuluniform, die Finger voller Tintenkleckse, tauchte Vinzent also fast tagtäglich hinter dem Rücken des bleichen Apothekers auf. Mit einem Türgriff erwartete ihn da eine andere, fremde Welt. Weit entfernt waren plötzlich die stupiden Exerzitien der Schule, noch weiter das rohe Gelächter der Bubenschar, die sich oft genug über den jüngeren und schmächtigeren der beiden Drogistensöhne lustig machte. Auf einen Schlag nur mehr Stille, Kühle, Nachdenklichkeit, Faszination. Während sich sein Bruder immer noch auf der Straße um Schweinsblasen, Luftballons oder Glasschusser balgte, strich Vinzent bereits an dicht gefüllten Vitrinen und Regalen entlang und betastete staunend all die silbern glitzernden Gerätschaften, die Glaskolben, Medizinflaschen und Pillendosen. Der Apotheker ließ ihn gewähren. Er erkannte von der ersten Begegnung an die Begabung des Jungen, der nicht auf Streiche und albernen Schabernack sann. Selbst wenn sie allein im Laden standen, wechselten sie nur wenige Worte. Sie verstanden sich schweigend. Der erstaunte Blick des Jungen in ein Reagenzglas mit brodelnden Chemikalien oder sein Schnuppern an einer frisch gerührten Salbe, dann kurze Erklärungen des Naturwissenschaftlers, das war alles. Es genügte beiden.
»Vinzent …? Vinzent? Wo steckt dieser vermaledeite Bengel denn wieder?«
Die Vertreibung aus dieser Welt des Rätselhaften nahte meist in Gestalt von Fräulein Fanny, die mit schriller Stimme in die Apothekenräume stürmte und Vinzent zwangsweise einem halbvollen Suppenteller oder einer nicht beendeten Hausaufgabe zuführen wollte.
»Aber Fräulein Fanny …«, flüsterte der Apotheker erschrocken, »lassen Sie den Jungen doch noch einen Moment bleiben. Wir beide wollten doch eben noch diese Tinktur …«
»Herr Apotheker!« Fräulein Fanny straffte sich in ihrem mausgrauen Tageskostüm und warf dem bleichen Mann zwischen den chemischen Instrumentarien einen strengen Blick zu. »Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit ruhig Ihrer werten Arbeit zu und mischen Sie sich nicht ein in pädagogische Fragen, die Sie nichts angehen und von denen Sie – mit Verlaub – nichts verstehen! Vinzent, komm jetzt bitte!«
Der Apotheker verstummte augenblicklich. Auch das Bitten und Betteln Vinzents half in solchen Fällen nichts, denn die Mutter hatte alle Erziehungsvollmachten in die Hand ihrer Großcousine gelegt. Rettung war allenfalls vom Auftauchen des Vaters zu erwarten, der die häufige Anwesenheit des Jungen als gesundes Interesse für das Geschäft interpretierte. In solchen Momenten legte Balthasar Sitti jr. seine übliche Zurückhaltung in Fragen der Kindererziehung ab, hielt Fräulein Fanny einen längeren Vortrag über die Wichtigkeit der praktischen Erfahrung in der Geschäftswelt und ließ Vinzent hinter den weißen Kittel des Apothekers flüchten.
Nun also Wohlstand im Hause Sitti. Die Zahl der Angestellten mehrte sich ständig, viele Weißkittel waren darunter, dazu Sekretäre und Prokuristen. Auch für den Haushalt zusätzliches Personal. Obwohl das dreistöckige Gebäude längst aus allen Nähten platzte, wurden die Pläne, ein neues, repräsentativeres Haus zu beziehen, von Jahr zu Jahr verschoben. »Zu überlastet!«, führte Balthasar Sitti jr. mürrisch ins Feld, außerdem seien keine guten Häuser im Angebot! In Wirklichkeit aber war es eine uralte, archaische Angst, die da im Inneren des Geschäftsmannes nagte. Die Angst, Glück und Erfolg seiner Firma könnten etwas mit dem alten Haus zu tun haben, das sie beherbergte. Die Heimat seiner biederen Vorfahren, seit Generationen auf ihn zugekommen, der Ort, wo ihn seine Mutter nach dreitägigen Wehen auf die Welt gebracht hatte. Die tiefe Angst, dass sich das Lebensglück abwenden könnte, wenn man diesen Ort verlassen würde …
Nur selten gestattete sich Sitti, solchen Ängsten nachzuspüren. Noch weniger sprach er mit seiner Frau Josephine darüber, die ihm wohl sofort beigepflichtet hätte. Diese Peinlichkeit wollte er vermeiden. Viel lieber führte er sich und anderen rationale Gründe vor Augen: Die Kundschaft fühlte sich doch wohl in den altbürgerlichen Verkaufsräumen, im Kontor und in der soliden Apotheke! Warum also etwas ändern und das Publikum verschrecken? Wenn erst mal die Jungen außer Haus waren, würden auch die Wohnräume wieder in jeder Hinsicht genügen. In Luxus zu schwelgen war Balthasar Sitti jr. trotz allen geschäftlichen Erfolges immer fremd geblieben, da mochte Josephine – was bisweilen ihre Art war – noch so zetern und murren!
Eines nebligen Novembernachmittags dann die Belohnung für jahrelanges zähes Arbeiten, für ungezählte Stunden des Rechnens, Kalkulierens und Feilschens: der eingeschriebene Brief mit dem Wittelsbacher Wappen auf der Rückseite. Die knappe Nachricht, dass sich die »Sitti’sche Drogerie- und Apothekenwarenhandlung« von nun an mit dem Titel »Königlicher Hoflieferant« schmücken dürfe! Balthasar Sitti jr. zitterte ein wenig, als er die Zeilen überflog. Sagte kein Wort, sondern faltete andächtig das Schreiben wieder zusammen und zog die Schreibtischschublade auf. Eine vergilbte Fotografie kam zum Vorschein, darauf abgebildet das schmale Häuschen, das einst an diesem Fleck der Sendlingerstraße gestanden hatte. Davor Balthasar Sittis Großeltern. Armselige Kohlenhändler, klein, geduckt, misstrauisch in das Objektiv des Fotografen blinzelnd. Lange blickte er auf die Aufnahme. Dann nahm er nochmals den Brief des königlichen Hofamtes zur Hand, las ihn mehrfach und streichelte ihn dabei ungläubig mit den Fingern. Schließlich schnäuzte er sich vernehmlich und verließ sein Arbeitszimmer.
»Fini, Fini … Josephine, Herrgott Sakrament noch mal, wo steckst du denn?« Aufgeregtes Rufen nach seiner Frau, dass die wenigen Kunden im angrenzenden Laden sich erstaunt umblickten. Auch die Gattin, nur in außergewöhnlichen Situationen beim Kosenamen gerufen, war etwas verstört, als sie Balthasar auf sich zustürmen sah. Erst als sie ihrem Ehemann den Brief entwunden und selbst die königlichen Zeilen überflogen hatte, wich ihr Misstrauen einem hellen Lachen. Rasch wurde die gesamte Belegschaft zusammengetrommelt und die Buben von der Straße hereingerufen. Mit einer pathetischen Rede, die ihm freilich vollkommen missglückte, versuchte sich Balthasar in der improvisierten Festversammlung Gehör zu verschaffen, währenddessen Josephine – erstmalig während ihres gesamten Geschäftslebens – roten Erdbeersekt für alle ausschenkte.
Nach seiner Ansprache war Balthasar Sitti jr. wieder in die gewohnte Schweigsamkeit zurückgefallen. Er hatte sich in eine stille Ecke verzogen und beobachtete den Trubel in seinem Laden. Kein Zucken seines Gesichts verriet in diesem Moment, dass die gute Nachricht des königlichen Hofamtes keineswegs aus heiterem Himmel in die Sendlingerstraße gekommen war. Dass der Name Sitti seit Jahren auf der entsprechenden Liste gestanden und der Drogist selbst im Kaufmannscasino systematisch Fäden gesponnen hatte. Dass so mancher Beamte bisweilen ein verschlossenes Kuvert aus seiner Hand empfangen hatte. Nein, nichts dergleichen war in diesem Moment aus seinen Zügen zu lesen. Nur wenige Minuten lang hatten ihn die Gefühle übermannt, jetzt schon war er zurückgekehrt zu Kalkulation und Planung. Er war bereit, den immer steiler werdenden Weg hinauf in die höheren Schichten der Münchner Kaufmannschaft anzutreten! Balthasar Sitti jr. blieb freilich als Geschäftsmann nüchtern genug, um sich auszurechnen, dass seine eigenen Lebensjahre selbst bei eiserner Gesundheit nicht reichen würden, die ehrgeizige Zukunftsplanung seiner Firma verwirklichen zu können. Nein, ein solch weitreichendes Projekt musste von den Schultern mehrerer Generationen getragen werden. So engstirnig sein Vater auch gewesen sein mochte, so hatte dieser mit seinem bescheidenen Laden doch den Grundstein für den heutigen Erfolg gelegt. Und so war es nun an der Zeit, die richtigen Gleise für die Zukunft seiner eigenen Söhne zu legen. Kaum waren sie dem Rockzipfel der Mutter entwachsen, wurde ihnen eine ehrgeizige höhere Schulbildung zuteil. Neben der Volksschule und der sonntäglichen Feiertagsschule kam zweimal die Woche ein Hauslehrer in die Sendlinger Straße Nr. 17, um den Buben im Voraus den Stoff der gefürchteten Lateinschule einzupauken. Da die zwei neben dem üblichen Gehorsam zumindest ein durchschnittliches Maß an Intelligenz aufwiesen und der Hauslehrer auf drakonische vier Nachmittage einbestellt wurde, überstanden sie das Gymnasium mit seinen lateinischen und griechischen Fußangeln und landeten schließlich an Münchens Hoher Schule, der Ludwig-Maximilians-Universität.
Auf die Ökonomie sollte sich Luitpold, der ältere, stürzen und damit das wirtschaftliche Fundament des zukünftigen Großunternehmens Sitti legen helfen. Vinzent hingegen sollte sich der Pharmazie widmen. Balthasar Sitti jr. wollte die Zukunft seines Unternehmens keinesfalls dem Zufall respektive dem Gusto seiner Sprösslinge überlassen. Der Kauf der alten Villa am Rindermarkt, die Doktor Vinzent Sitty heute noch bewohnte, war übrigens das einzige Zugeständnis an den hedonistischen Zeitgeist, das sich sein Vater jemals geleistet hatte. Da er sich beim besten Willen nicht dazu entschließen konnte, den alten Firmensitz in der Sendlingerstraße umzubauen, hatte er seine inzwischen beträchtlichen Rücklagen dafür verwendet, seiner Familie großzügigere, wenngleich karg möblierte und kaum beheizbare Wohnmöglichkeiten zu bieten.
Doch lange war Balthasar Sitti jr. die Freude an seinem Nachwuchs nicht gegönnt. War es das Zuviel an väterlicher Gängelung oder das Zuwenig an eigenem Durchsetzungswillen, auf jeden Fall ließen die akademischen Erfolge der beiden Sittis bald zu wünschen übrig. Als reichlich verbummelte Studenten waren sie mehr auf Mensurfeiern und Burschenschaftstreffen zu finden als im Hörsaal, die Vakanzen häuften sich, und so kam es, wie es kommen musste. Luitpold hatte sich bei Kommilitonen bald dermaßen verschuldet und in Ehrstreitigkeiten verwickelt, dass er Hals über Kopf das Studium an den Nagel hängte. Als Jäger, Farmer und Drugstorebesitzer wanderte er in die deutsche Kolonie Südwestafrika aus, in der man offenbar in kürzester Zeit zum reichen Mann werden konnte. Den entscheidenden Schlag aber versetzte Vinzent seinem Vater, der mit düsteren Ahnungen durch die Geschäftsräume hinkte, immer schweigsamer wurde und vorzeitig alterte. Die Vorsehung hatte Vinzent zwar mit größeren Geistesgaben ausgestattet als seinen Bruder, doch auch mit einem erheblich größeren Maß an Eigenbrötlerei und Starrsinn. Ständige Querelen mit den Vorgesetzten seiner Fakultät waren die Folge. Nach einem üblen Krach mit einem akademischen Oberrat entschied er sich kurzerhand, die Pharmazie und damit auch sämtliche familiären Geschäftspläne an den Nagel zu hängen und sich stattdessen der Psychiatrie zuzuwenden. Ein Fach, das fast ausschließlich junge Männer studierten, die eine väterliche Praxis übernehmen sollten, und das darüber hinaus kaum gesellschaftliches Renommee besaß. Den Heilungsversuchen an Verrückten war zu dieser Zeit noch kaum Erfolg beschieden und so galten die Psychiater selbst in Fachkreisen als Sonderlinge und Querköpfe. Nicht ohne Mühe erlangte Vinzent schließlich die akademischen Weihen der Medizin und errichtete eine Praxis, in der es nach Auffassung der Nachbarschaft nicht immer mit rechten Dingen zuging! Diese Folge von Kränkungen konnte Balthasar Sitti jr. sein restliches Leben lang nicht verwinden. Er zog sich bald aus der Geschäftsleitung zurück, die er einem resoluten Prokuristen überließ, und starb nach wenigen Jahren Pensionärsdasein voller Verbitterung.
Während er seinen Gedanken nachhing, hatte Doktor Vinzent Sitty die Zeit vergessen. Noch lagen fünf Liquidationen vor ihm auf dem Schreibtisch, die er jetzt zögernd unterzeichnete. Der Familienname »Sitty« würde zweifelsohne aussterben, dachte er, und griff zum Federhalter. Während der Psychiater noch überlegte, ob ihn diese Überlegung traurig stimmte oder ob sie ihm letztlich gleichgültig war, öffnete sich hinter seinem Rücken die Türe zum Ordinationszimmer und eine junge Frau mit kurz geschnittenem schwarzen Haar wurde sichtbar.
»Hallo, Vati, hast du gerade Zeit für mich? Oder bist du zu beschäftigt?«
Doktor Sitty drehte sich überrascht um und erblickte das Gesicht der jüngsten Tochter. Mit einem leisen Ächzen erhob er sich von seinem Sessel und umarmte das Mädchen, das temperamentvoll auf ihn zugestürmt war.
»Aber Sophie«, mahnte er sie zärtlich, »wie kannst du so etwas fragen? Du weißt doch, dass du jederzeit zu mir kommen kannst.« Dann fasste er das Mädchen an der Schulter und schaute ihm ein wenig sorgenvoll ins Gesicht. »Mir scheint, Kleines, es wird immer seltener, dass du dieses hochherzige Angebot annimmst. Du hast dich schon wieder tagelang nicht bei uns blicken lassen. Mutter hat sich schon ernsthaft Sorgen gemacht.«
»Tatsächlich nur Mutter?«, rief Sophie, die vor Kurzem 22 Jahre alt geworden war, mit heller, ironischer Stimme.»Mein lieber, lieber alter Vati! Das sagst du jedes Mal, wenn ich heimkomme. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Das ganze letzte Wochenende haben wir gemeinsam verbracht. Ich pass’ schon auf mich auf. Außerdem müssen Absprachen eingehalten werden. Das hast du uns doch immer eingebläut oder etwa nicht?«
Doktor Sitty knurrte etwas Unverständliches. Tatsächlich hatten seine Frau und er mit Sophie ein Abkommen getroffen. Nach vier Semestern an einer privaten Malschule – die Tore der Kunsthochschulen waren den weiblichen Kandidatinnen ja verschlossen – hatte seine jüngste Tochter darauf bestanden, von zu Hause ausziehen zu dürfen, weil sie mit zwei Freundinnen eine kleine Atelierwohnung in der Türkenstraße anmieten wollte. Nach einer ebenso kurzen wie sinnlosen Phase des Widerstrebens hatten sie ihr Einverständnis dazu gegeben, unter der Voraussetzung, Sophie müsse sich alle paar Tage in ihrem Elternhaus sehen lassen und hin und wieder ein Wochenende dort verbringen.
Sitty schaute seine Tochter liebevoll an. Sie war schlank, hoch gewachsen und trug ein lindgrünes Reformkleid. Aufsehen erregte sie, seit sie vor einem Jahr ihre langen pechschwarzen Haare dem Friseur geopfert hatte und nun einen frechen Bubikopf trug. Damit hatte sie sich auch äußerlich von der Rolle der bürgerlichen Arzttochter verabschiedet und ihre Sympathie für die Münchner Bohème bekundet. Nur Künstlerinnen und Modelle, Journalistinnen und Schriftstellerinnen trugen eine so provozierende Haartracht. Doktor Sitty seufzte. Ihm war dieser Hang zur Widerspenstigkeit, zum Nonkonformismus nur allzu bekannt. Er konnte der Tochter nicht böse sein, zumal ihr kindlicher Charme jeden väterlichen Widerspruch schmelzen ließ. Sorge machte ihm allerdings der Freundeskreis seiner Tochter: leichtsinnige, anarchistisch angehauchte Kunststudenten, von denen die meisten wenig Talent, aber wirre Zukunftsfantasien besaßen. Die kleine Wohnung seiner Tochter, soviel hatte er schon mitbekommen, war zum ständigen Treffpunkt der Clique geworden, wenn diese nicht gerade durch die Kneipen, Cafés und Kabaretts Münchens zog. Na, und wennschon, suchte er sich zu beruhigen. Sophie sollte eine heitere Jugend verleben, trotz dieses elenden Krieges, der nicht zu Ende gehen wollte. Er selbst konnte sich noch zu gut an die spießige Enge seiner Kindheit erinnern und an den ständigen Erwartungsdruck des Elternhauses. Jetzt, wo der Krieg blutige Wunden in die Familien riss, wo schon die 17-jährigen Burschen an die Front mussten, war er froh, dass ihm seine Frau drei Töchter geboren hatte. Die beiden älteren waren längst aus dem Haus, hatten geheiratet und eigene Familien gegründet. Die Schwiegersöhne waren zwar beim Militär, doch aufgrund des Einflusses eines alten Freundes der Familie, des allgegenwärtigen Obersts Geismeier, durften sie in der Etappe bleiben.
Alles in allem konnte Doktor Vinzent Sitty seinem Schicksal dankbar sein. Wie fast alle Großstadtbewohner hatte seine Familie zwar unter den Bedingungen des Krieges, den Notverordnungen und der Lebensmittelknappheit zu leiden, doch dank des Improvisationstalentes seiner Frau und seiner Töchter waren sie immer gut über die Runden gekommen. So hatte sich der alte Geräteschuppen in einen Stall verwandelt, in dem Hühner gackerten und mehrere Kaninchenpaare für ständigen Nachwuchs sorgten. In dem verwilderten Garten dahinter gediehen auf einmal Kartoffeln, Kraut und Rüben, Salat und Beeren – Kostbarkeiten, die man früher kaum geschätzt und sich einfach vom nahen Viktualienmarkt hatte bringen lassen.
Auch Doktor Sitty selbst trug Wesentliches zum Unterhalt der drei Familien bei. Er war einer der wenigen Psychiater, die in München noch frei praktizierten, und so konnte er sich über mangelnde Nachfrage nicht beklagen. Noch gab es genügend wohlhabende Familien, die fast täglich nach seelischem Beistand riefen. In einer Zeit wie dieser, in der die alten Ordnungen immer fragwürdiger und die gewohnten Sicherheiten immer brüchiger zu werden schienen, blühten Depressionen, Ängste und Neurosen. Es verging kein Tag mehr, an dem Doktor Sitty nicht mit Nervenzusammenbrüchen und Selbstmordabsichten konfrontiert wurde. Jetzt zahlte sich seine Menschenkenntnis und seine lange belächelte Beschäftigung mit der Lehre des Wiener Psychiaters Sigmund Freud aus, denn seine Gesprächssitzungen mit den Patienten erwiesen sich den Rosskuren der klinischen Psychiatrie gegenüber als überlegen. Erstmals in seinem Leben hatte Doktor Sitty das Gefühl, ein gefragter und geschätzter Arzt zu sein, wenngleich viele Kollegen seinen Methoden nach wie vor unverhohlene Skepsis entgegenbrachten.
Sophie Sitty war immer ein fröhliches Mädchen gewesen. Sie lebte sorglos, fast leichtsinnig in den Tag hinein. Während ihre beiden älteren Schwestern sich schon früh im Haushalt nützlich gemacht hatten und der Mutter zur Hand gegangen waren, streunte Sophie liebend gerne in der Nachbarschaft umher, rauchte mit älteren Jungen Zigarettenkippen und blieb oft stundenlang verschollen, sodass mehrmals die ganze Familie die umliegende Gegend nach der Kleinen absuchen musste. Auch als Kunststudentin, deren Weiblichkeit längst die bewundernden Blicke der Kommilitonen auf sich zog, hatte sie ihre bubenhafte Ausgelassenheit nicht verloren. Voller Neugierde tauchte sie in die Welt der Künste ein, malte, modellierte, zeichnete nach Modellen und stand ihren Freundinnen, splitternackt und prustend vor Lachen, selber Modell. Es störte sie nicht, dass Lebensmittel, Farben und Leinwand rar, die Künstlerfeste karg und die Sperrstunden der Kneipen früh waren. Man behalf sich, improvisierte, trank Zichorienkaffee und rauchte selbst gedrehte Zigarren aus Eichenblättern, feierte mit Dünnbier und Kerzen in verdunkelten Kellerräumen und schlief bis in die Nachmittagsstunden hinein. Dass es neben diesem Bohèmeleben einen entsetzlichen Krieg gab, dass an ihrer Schule kaum mehr männliche Gesichter auftauchten, dass das Elend in den Straßen Münchens immer unübersehbarer wurde, all das schien sie kaum wahrzunehmen. In ihrer überströmenden Heiterkeit hatte sie beschlossen, das Bedrohliche, Bedrückende, Ängstigende ihrer Umgebung zu ignorieren, dem Dunklen keinen Einlass in ihr Herz zu gewähren.
Umso überraschter war Doktor Vinzent Sitty, als sich seine Tochter nach dem kurzen Begrüßungszeremoniell der väterlichen Umarmung entzog und sich mit bekümmerter Miene auf einen Stuhl setzte.
»Nanu, mein Herz«, fragte der Arzt und legte seine Schreibfeder beiseite, »was ist denn heute in dich gefahren? Kummer?«
Seine Tochter nickte und blickte stumm aus dem Fenster.
»Lass mich eine Diagnose stellen«, fuhr Doktor Sitty mit ärztlicher Miene fort, »Es kann nur eines sein … Liebeskummer!«
Sophie schüttelte schweigsam den Kopf.
»Dann geht dir langsam das Geld aus, stimmt’s?«
Abermaliges Kopfschütteln, verbunden mit einem vernehmbaren Schnupfen. Vinzent Sitty zuckte mit den Schultern.
»Dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, was einer jungen, klugen Künstlerin von Welt sonst noch die Laune vergällen sollte?«
»Ach, lass doch die Späße!«, platzte es jetzt aus seiner Tochter heraus. »Mir gefällt es auf dieser sogenannten Malschule nicht mehr, wenn du es genau wissen willst. Es ist ein Kindergarten! Eine Aufbewahrungsanstalt für uns Künstlerinnen! Alle meine Freunde gehen auf die Kunstakademie. Wir werden von euch Männern überhaupt nicht ernst genommen. Weißt du, wie sie uns alle nennen? Malweiber! Das wird sich erst ändern, wenn wir auch auf die Akademie dürfen.«
Doktor Sitty kratzte sich am Kinn.
»Sehr freundlich von dir, mich unter die Männer im Allgemeinen wie im Besonderen zu subsumieren. Ich glaube, ich habe noch nie Malweib zu dir gesagt. Im Übrigen hast du sicher nicht ganz unrecht, Sophie«, antwortete er bedächtig, »aber man muss die Realitäten zur Kenntnis nehmen und halt das Beste daraus machen.«
Kampfeslustig sprang Sophie von ihrem Stuhl auf und rief:»Dazu habe ich nicht die geringste Lust! Ich schwöre es dir, Vati, es vergeht kein Jahr und ich werde auf der Akademie weiterstudieren!«
»Sei nicht albern, Kleines. Du weißt doch, dass Frauen in Deutschland kaum irgendwo in Kunstakademien aufgenommen werden.«
Mit Schwung setzte sich Sophie auf den Schoß ihres Vaters. Von einem Moment auf den anderen war ihre trübe Laune wie weggeblasen.
»Noch nicht, aber vielleicht bald«, flüsterte sie ihrem Vater sibyllinisch ins Ohr. Sitty runzelte verständnislos die Augenbrauen. »Ich weiß nicht, was du dir vorstellst? Das Hochschulgesetz sagt eindeutig …«
»Dann werden wir das Hochschulgesetz eben ändern.«
»Wer ist wir?«
»Wir Marxisten, Vati.«
Jetzt war es an Doktor Sitty, einen Moment lang erschrocken zu verstummen. »Wir … was?« flüsterte er dann ungläubig.
»Wir Marxisten. Ich bin zusammen mit den anderen der Unabhängigen Sozialistischen Partei beigetreten. Wir treffen uns regelmäßig bei uns im Atelier. Irgendwann muss sich ja schließlich etwas ändern …«
Der Arzt fuhr sich durch den Bart. Er schien immer noch nicht ganz zu begreifen. »Was in aller Welt soll sich ändern?«, fragte er dann unsicher.
»Na, alles. Sei doch nicht so begriffsstutzig, Vati. Wenn dieser Krieg zu Ende ist, muss unser Land doch ganz neu aufgebaut werden. Das Volk wird sein Schicksal endlich in die eigene Hand nehmen!«
»Aber Kind, du hast dich doch nie mit Politik beschäftigt …«
»Dann tu ich es eben jetzt! Außerdem nenne mich nicht immer Kind. Es genügt schon, wenn mich Mutter wie ein kleines Mädchen behandelt. Unsere Partei ist jedenfalls die einzige, die sich wirklich für uns Frauen einsetzt.«
»Und für die Künstlerinnen …«, stöhnte Sitty kraftlos.
»Jawohl, für die Künstlerinnen! Oder für uns Malweiber, wenn dir das lieber ist«, wiederholte Sophie mit Bestimmtheit.
»Würdest du deinen verkalkten alten Herrn vielleicht noch darüber aufklären, um wen es sich bei den anderen handelt?«, fragte Sitty ein wenig ungehalten.
»Welche anderen?«
»Deine … wie sagt ihr … Genossen? Oder sind es Genossinnen? Du sagtest, ihr trefft euch in deinem Zimmer?«
»In unserem Atelier, ja. Na, die ganze Malerclique eben, Therese, Veronika, Franziska, Ludwig und alle anderen. Aber es kommen auch fremde Jungs dazu. Meist Studenten von der Uni. Philosophie und so. Und ein paar ältere Männer …«
»Ältere Männer?«
»Ja, Leute von der Partei. Ludwig hat sie kennengelernt. Kennen sich halt besser aus in all diesem Politikzeugs …«
»Und die erklären euch die Weltrevolution, was?«, knurrte Sitty misstrauisch.
»Ja, sie machen sich furchtbar wichtig. Expropriation der Expropriateure, Kapitalismuskritik und andere komplizierte Sachen. Aber keine Sorge, wir nehmen ihr Gerede nicht so wichtig. Uns geht es hauptsächlich um die Öffnung der Hochschulen für uns Frauen. Und sie bringen immer etwas zu futtern mit. Wein und Käse. Es gibt immer viel Spaß, wenn wir alle zusammen sind. Das verstehst du doch?«
»Ja, das verstehe ich gut …«, murmelte Doktor Sitty leise. »Ich hoffe nur, dass du gut auf dich aufpasst.«
»So, jetzt muss ich mich aber sputen«, zwitscherte Sophie unbekümmert und stand auf, »ich will noch in den Englischen Garten gehen und einige Skizzen machen. Schließlich möchte ich in diesem Semester noch die Zwischenprüfung ablegen.«
Doktor Sitty erhob sich ebenfalls. Er nickte und strich seiner Tochter über die Haare. Dann wandte er sich dem Fenster zu und blickte nachdenklich hinaus. Draußen lockte die Frühlingssonne die ersten Triebe aus den Bäumen. Von der nahen Peterskirche läuteten Glocken herüber. Zu dieser Tageszeit konnte es sich nur um die Totenglocke handeln. Fast täglich ließen Angehörige Messen für ihre Gefallenen lesen.
»Vati?«
Doktor Sitty fuhr aus seinen Gedanken. Er drehte sich um. Seine Tochter stand unschlüssig in der Türe. »Du bist so schweigsam«, sagte sie etwas zaghaft. »Bist du etwa böse wegen dieser Sache?«
»Böse? Nein, Kleines, ich bin nur etwas – überrascht.«
»Würdest du mit Mutter darüber sprechen? Du weißt, wie schnell wir beide aneinander geraten.«
»Allerdings. Also, meinetwegen. Ich werde es ihr schonend beibringen …«
Sophie ging einen Schritt auf ihren Vater zu und gab ihm einen Kuss auf die bärtige Wange.
»Deutsche Männer, deutsche Frauen! Volk der Dichter und Denker! Wisst Ihr, was Bolschewismus ist? Kennt Ihr seine Gefahren? Kennt Ihr seine Anhänger und Verbreiter in Deutschland? Bolschewismus ist die Erhebung des Verbrechertums zur Herrschaft am hellen Tage. Die Organisation des Diebstahls und der Beraubung unter dem Stichwort Kommunismus. Die Zersetzung des Staates und des Familienlebens. Der Stillstand des Verkehrs und der Betriebe! Die Entwertung des Geldes! Seine Gefahren sind: Arbeitslosigkeit! Hunger! Raub, Mord, Plündern! Entkräftung! Seuchen! Verzweiflung! Beweis: die heutigen Zustände in Russland. Seine Anhänger und Verbreiter: die Leute des Spartakus und deren russische Freunde. Der Weg von Spartakus führt nicht ins Schlaraffenland, sondern in die Hölle auf Erden. Arbeit allein kann uns retten!«
Flugblatt in München, 1918
Seine Tochter also politisch aktiv, und das bei den Sozialisten! Doktor Vinzent Sitty ging in seinem Arbeitszimmer auf und ab und grübelte. Unter seinen Patienten befanden sich einige Mitglieder der bayerischen Sozialdemokratie, allesamt honorige Herren, die im Landtag gelegentlich scharfe Reden hielten, ansonsten aber treue Untertanen der Monarchie waren. Dass sich Sophie und ihre aufmüpfigen Kommilitoninnen dieser Altherrengesellschaft angeschlossen hatten, war höchst unwahrscheinlich. Um welchen Klüngel handelte es sich dann? Sagte sie nicht etwas von »unabhängig«? Unabhängig – von was? Oder von wem? Hilflos ließ Vinzent Sitty seinen Blick über die ordentlichen Reihen der Bibliothek schweifen. Zögernd nahm er den einen oder anderen Band zur Hand. Vergeblich. Herodot, Euklid und Aristoteles zeigten ihm die kalte Schulter und gewährten ihm bei der Bewältigung aktueller politischer Probleme keinerlei Hilfestellung. Der Psychiater musste wohl oder übel einräumen, sich in den letzten Jahren kaum um Politik gekümmert zu haben. Jetzt hatte man ihn kalt erwischt! Er wollte und konnte seiner volljährigen Tochter nichts mehr verbieten, aber ein Gefühl des Unwohlseins überkam ihn doch, solange er nicht näher über die »Unabhängigen« Bescheid wusste. In dieser schlimmen Zeit musste man mit allem rechnen. Auch wenn die bayerischen Behörden mit Restriktion und Gewaltanwendung bisher zurückhaltend waren, so war jede Art von Opposition, gar von marxistischer Seite, höchst ungern gesehen. Seine Tochter hatte doch keinerlei Erfahrung in solchen Dingen! Er musste zumindest in Erfahrung bringen, welch Geistes Kind diese »älteren Herren« waren, die das bisher tief schlummernde politische Gewissen seiner Jüngsten so nachhaltig geweckt hatten. Entschlossen trat Doktor Sitty an das anthrazitfarbene Telefongerät und kurbelte. Nach mehreren erfolglosen Versuchen meldete sich das Fräulein vom Vermittlungsamt. »Hallo, Auskunft, geben Sie mir bitte eine Verbindung zum Landtagsabgeordneten Deisinger, Telefonnummer 213.«
Nach einigen Augenblicken knackte es in der Leitung und am anderen Ende ertönte die blecherne Stimme des sozialdemokratischen Abgeordneten. Nach einigen Höflichkeitsfloskeln rückte Doktor Sitty mit seinem Anliegen heraus, nähere Aufschlüsse über sogenannte Unabhängige Sozialdemokraten oder so ähnlich zu erbitten. Einige Momente herrschte erstauntes Schweigen bei seinem Gegenüber. Dann setzte ein erregter Redeschwall des Politikers ein, so dass Sitty nicht mehr zu Wort kam und nur hin und wieder ein nachdenkliches »Aha« und »So, so« beisteuern konnte. Schließlich nutzte er eine kurze Atempause seines Gesprächspartners, um sich rasch für dessen Auskünfte zu bedanken und den Hörer in die Gabel zu hängen. Dann blieb er eine Zeitlang an seinem Platz stehen und starrte auf das Telefon. »So ist das also! Die Monarchie wollen die stürzen!«, murmelte er tonlos. »Enteignungen, standrechtliche Erschießungen, kommunistische Umtriebe … Und das Sowjetsystem nach russischem Vorbild wollen die in Bayern einführen. So ist das also, aha. So ist das …«
Schweigend ging Doktor Sitty hinüber zum Fenster, durch das jetzt ein kalter Luftzug hereinströmte, und schloss es. Noch immer klangen ihm die Worte des Abgeordneten im Ohr, wonach dieses Gesindel von der USPD am Galgen enden würde! Man würde es schon sehen, man würde es sehen …
2»Nieder mit den Kriegsgewinnlern! Nieder mit der Monarchie! Alle Macht dem Volke!« Verständnislos starrte Alex auf das rote Flugblatt, das wie eine welke Mohnblume von seinen Fingern hing. Müde hob er den Kopf und blickte sich um. Die Gesichter der Menschen, die hier auf dem Bahnhofsvorplatz an ihm vorüberhasteten, waren grau und verschlossen. Keines von ihnen gehörte jenem abgerissenen Burschen, der ihn angesprochen und ihm das Pamphlet in die gesunde linke Hand gedrückt hatte. Ebenso rasch wie der Kerl aus der Menge aufgetaucht war, war er auch wieder verschwunden. Alex konnte sich weder an die hastigen Worte des Fremden noch an seine Gesichtszüge erinnern. Nur dass er an seinen bandagierten Arm in der Schlinge getippt und ihn als Genosse Soldat angeredet hatte, wusste er noch.
Genosse Soldat? Was sollte das bedeuten? Verwirrt hob Alex die linke Hand und überflog nochmals die wenigen Zeilen auf dem Papier. Vom verlorenen Krieg war die Rede und von der Notwendigkeit, dass sich die Soldaten mit den Arbeitern verbündeten. Der junge Leutnant schnaufte verächtlich. Welche Ahnung hatten sie hier – tausend Kilometer von der Front entfernt – schon vom Krieg? Und was hatten die Soldaten mit den Arbeitern zu schaffen? Die dumpfe Benommenheit in seinem Kopf, die ihn seit Tagen kaum einen klaren Gedanken fassen ließ, verursachte jetzt einen leichten Schwindelanfall. Die verdammte Soldatenkrankheit! Alex taumelte ein wenig und schloss die Augen. Einige tiefe Atemzüge, dann war ihm wieder wohler. Wütend zerknüllte er den roten Fetzen in seiner Hand und warf ihn zu Boden. Warum war der junge Kerl gerade auf ihn zugegangen? Was wollten sie bloß alle von ihm? Sein einziger Wunsch war, dass niemand mehr etwas von ihm wollte. Keine vorgesetzten Offiziere, keine Feldärzte, keine Familienmitglieder. Niemand. Nur Ruhe, Frieden, endlos schlafen …
»Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Drum auf! Zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, das unsere Väter neu sich gründeten. Um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie ward Deutschland überwunden, wenn es einig war.«
Kaiser Wilhelm II, 6. August 1914
Alex wollte nicht nach Hause. Zumindest nicht sofort. Warum, das konnte er nicht beantworten. War es nicht absurd, nach all dem Geschehenen sich nicht nach Hause zu sehnen? Von den vielen verwundeten Kameraden, die mit ihm aus dem Militärzug gestiegen waren, hatte er nichts mehr gehört. Sie waren alle auf dem kürzesten Weg zu ihren Angehörigen geeilt. Vielleicht hatte ihm der eine oder andere auf die Schulter geklopft, ihm einen letzten Gruß zugerufen, Alex hatte es nicht bemerkt. Schon eine kleine Dosis des Pulvers verwandelte den Schmerz in seinem Arm in eine rauschartige Benommenheit. Er blickte um sich. Eigentlich war es kein richtiger Zug gewesen, in dem er die letzten 48 Stunden zugebracht hatte, eher eine Ansammlung von stinkenden Viehwaggons, in die Soldaten des Ersten Münchner Train-Bataillons grobe, hölzerne Bänke montiert hatten. An Schlaf war kaum zu denken gewesen. Unschlüssig packte Alex den schweren Armeerucksack und warf ihn über die gesunde Schulter. Langsam begann er sich durch die Menschenmenge des Bahnhofsvorplatzes einen Weg in Richtung Innenstadt zu bahnen. Alex streifte lange und ziellos durch die Straßen Münchens. Der heitere Föhnhimmel, die zarten Knospen an den Kastanien und Linden, der süß-würzige Duft des Frühlings, sie belebten seine Sinne und standen in herbem Gegensatz zu den grauen Gestalten, die Straßen und Plätze bevölkerten. Alte Frauen, die an den wenigen Läden um Kartoffeln und Brot Schlange standen. Blasse Mädchen mit Säuglingen auf dem Arm. Männer, die sich immer wieder bückten, um auf dem Pflasterboden alte Zigarettenkippen aufzuheben. Und an vielen Ecken bettelnde Krüppel.
Vereinzelt hingen Plakate an den Wänden und riefen zu Versammlungen und Demonstrationen auf. Nur wenige Leute beachteten sie. Vielleicht hatten sie auch Angst vor den Gendarmen, die an vielen Stellen der Stadt postiert waren. Früher war es in den Straßen lauter und betriebsamer zugegangen, fand Alex. Nur wenige Gesprächsfetzen drangen an das Ohr des jungen Soldaten, die meisten Menschen schienen stumm einherzugehen. Plötzlich stutzte Alex. Von ferne hörte er Musik, die langsam näher zu kommen schien und in dieser düsteren Stille gespenstisch wirkte. Es waren die Klänge einer Militärkapelle. Von weit her stiegen Erinnerungen in Alex hoch. Wie lange hatte er diese Klänge nicht mehr gehört? Da, wo er herkam, hatte man keinen Sinn mehr für Trompeten und Klarinetten, Tschinellen und Glockenspiele. Er blinzelte gegen die tiefstehende Sonne. Tatsächlich kam da eine Abteilung des Schwere-Reiter-Regiments herangeritten, etwa 20 Soldaten in bunten Paradeuniformen und weißblauen Wimpeln an den Lanzen. Auf ihren Helmen wehten weiße Buschen im Frühlingswind. Voraus ritt eine Musikkapelle mit roten Helmbuschen. Ihre Instrumente blitzten wie Gold. An ihrer Spitze der Kommandant, unbewegt, wie versteinert.
Das Blech der Militärmusik hallte in den Häuserzeilen wieder. Vereinzelt wurden Fenster geöffnet. Passanten blieben stehen. Doch niemand winkte oder applaudierte, wie es vor dem Krieg noch üblich gewesen war. Hatte diese Musik früher nicht Scharen von Kindern angelockt? Auch die Gesichter der Soldaten wirkten alt und müde. Alex schüttelte den Kopf, als wolle er aus einem Tagtraum erwachen. Was hatten diese Operettenfiguren noch mit der Wirklichkeit zu tun? Wo er herkam, herrschte das Feldgrau und seit Neuestem der Stahlhelm. Das hier kam ihm vor wie eine Theateraufführung oder ein Faschingsumzug. Er hatte die Formation sofort erkannt, war er doch selbst vor Kurzem noch Offizier des Regiments »Prinz Karl von Bayern« gewesen. Vor Kurzem? Es schien Alex, als wären bereits Jahre seit seiner Verwundung vergangen. Jetzt erst bemerkte er, dass hinter den Uniformierten eine Gruppe Männer ging. Nein, Männer waren sie noch nicht, junge Burschen, gerade der Schule oder der Lehrzeit entwachsen. Sie hatten grobe Arbeitskleidung an und trugen in Bündeln ihre Habseligkeiten unter dem Arm. Es handelte sich also um ein Rekrutierungskommando. Die Armee brauchte frische Kräfte. Schweigend liefen die jungen Burschen hinter dem Kommando her. Vor ein paar Monaten noch hätten sie lauthals gesungen und Blumensträuße geschwenkt, dachte Alex. Mit leeren Augen blickte er den Vorüberziehenden nach. Man sah ihnen an, dass der Hunger sie in die Armee getrieben hatte. Einer von diesen Bengeln würde bald seinen Platz einnehmen, draußen. Vielleicht waren sie begabter für den Waffengang als er. Es sei ihnen vergönnt, dachte Alex bitter. Nun, ihn ging das alles nichts mehr an.
Für’s Erste war der Krieg für ihn zu Ende. Knochenabsplitterungen und ewig nässende Eiterungen am rechten Arm. Freilich ohne Feindeinwirkung zugezogen. Sturz von einem scheuenden Pferd während einer Übung im Hinterland. Das unverhohlene Feixen seiner ihm unterstellten Soldaten, die Verachtung in den Augen der Offiziere! Und dann die Folgen des Lazaretts! Alex zuckte gleichgültig mit den Schultern. Militärischer Ehrgeiz war ihm in den letzten Monaten immer fremder geworden. Die ganze Offizierslaufbahn, eine fixe Idee! Der Gedanke war in den nationalistisch überhitzten Herrenabenden seines Vaters geboren worden, er wusste es wohl. Die pathetischen Reden des Bezirksamtmannes Tresske, das anerkennende Schulterklopfen des Obristen Geismeier, sie hatten dem alten Kommerzienrat geschmeichelt und seinen dumpfen Patriotismus erst richtig angestachelt. Einen Sohn zum Offizier zu machen, das war die großbürgerliche Industriellenfamilie der Abstreiters dem Vaterland einfach schuldig. Die Schweren Reiter, entstanden aus den Kürassieren der alten Zeit, galten neben dem Ersten Infanterie-Leib-Regiment als Eliteeinheit der Bayerischen Armee. Für Alexander kam nichts anderes in Betracht. Der Kommerzienrat setzte alle Hebel in Bewegung um ihn dort unterzubringen. Zumal sich der scheue und linkische Jüngste der Abstreiters, wie immer deutlicher wurde, für das Geschäftliche kaum eignete. Dieser Umstand spielte auch in den kühlen Überlegungen des älteren Bruders und Juniorchefs Georg jr. eine Rolle, der Alexander so vom Kontor der elterlichen Firma fernzuhalten hoffte.
Jetzt kam er also heim. Ohne Tapferkeitsauszeichnung und Eisernes Kreuz. Ausgemustert und arbeitslos. Was würde sein Vater sagen? Wie stand die Familie jetzt da? Besonders vor Oberst Geismeier, der seine Laufbahn unermüdlich unterstützt hatte. Der dem objektiv Ungeeigneten so manch vernichtendes Prüfungsergebnis erspart und an höchsten Stabsstellen persönlich vorgesprochen hatte. Nur die sich überstürzende Kriegsentwicklung hatte eine Offizierslaufbahn überhaupt noch möglich gemacht. Alex hielt inne, um Atem zu schöpfen. Sollte er sich diesen trübsinnigen Überlegungen weiter hingeben? Der ganze Militärkram war nicht seine Idee gewesen, er hatte sich nie danach gedrängt. Freilich musste er sich eingestehen, dass er selber überhaupt keine Vorstellung von seiner beruflichen Zukunft hatte. Vor dem Krieg so wenig wie heute. Sich einfach treiben lassen wie die Papierschiffchen in der Isar, deren Ufer Spielplatz seiner Kindheit gewesen waren? Was nun kommen würde, war ihm unklar. Auf jeden Fall bot ihm das Elternhaus ein Dach über dem Kopf, ein Bett für den bleiernen Schlaf, nach dem er sich sehnte. Tagelang, ja wochenlang wollte er schlafen, nichts mehr hören und sehen von der Welt! Ein schmerzlicher Stich in seinem Rücken riss Alex in die rüde Wirklichkeit zurück. Der schwere Armeerucksack drückte erbärmlich. Mühsam versuchte sich Alex zu orientieren und machte sich schließlich auf den Weg in die Brienner Straße Nr. 18.
»Das Gefühl der Unwiderstehlichkeit, das bei Beginn der Schlacht unsere Truppen begleitete, lässt sich nicht beschreiben. Die jahrelange Erstarrung an der Front löste sich. Der Glaube an Führung und Sieg war nie größer …«
Reichskanzler Prinz Max von Baden im März 1918
»Ich sage es Ihnen nicht gerne, meine Herren, aber die allgemeine Wirtschaftslage wird auch uns zu Kündigungen zwingen, wenn nicht bald eine Besserung der Auftragslage eintritt! Sehen Sie nur …«
Mit zornrotem Gesicht nahm Kommerzienrat Georg von Abstreiter sen. ein Schriftstück von seinem Schreibtisch und reichte es den Herren, die in schwarzen Geschäftsanzügen vor ihm saßen und betreten dreinblickten. Die Luft war erfüllt vom Qualm einer schweren Virginier, die der Unternehmer immer wieder nervös zu seinen Lippen führte.
»Jetzt haben wir schon die fünfte Auftragsstornierung in diesem Monat! Ich weiß wirklich nicht mehr, wohin das führen soll.«





























