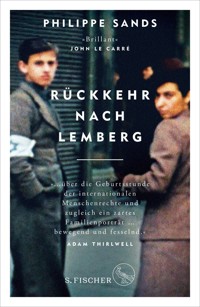
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Kein Roman kann sich mit einem solch wichtigen Werk der Wahrheit messen.« Antony Beevor Als der bekannte Anwalt für Menschenrechte Philippe Sands eine Einladung nach Lemberg erhält, ahnt er noch nicht, dass dies der Anfang einer erstaunlichen Reise ist, die ihn um die halbe Welt führen wird. Er kommt einem bewegenden Familiengeheimnis auf die Spur, und stößt auf die Geschichte zweier Männer, die angesichts der ungeheuren NS-Verbrechen alles daran setzten, diese juristisch zu fassen. Sie prägten die zentralen Begriffe, mit denen seitdem der Schrecken benannt und geahndet werden kann: »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »Genozid«. Meisterhaft verwebt Philippe Sands die Geschichte von Tätern und Anklägern, von Strafe und Völkerrecht zu einer kraftvollen Erzählung darüber, wie Verbrechen und Schuld über Generationen fortwirken. »Ein Buch wie kein anderes, das ich gelesen habe – man kann es nicht weglegen und vergessen.« Orlando Figes »Über die Geburtsstunde der internationalen Menschenrechte und zugleich ein zartes Familienporträt … bewegend und fesselnd.« Adam Thirlwell »Erstaunlich und wichtig.« Louis Begley »Überwältigend, erschütternd ... ›Rückkehr nach Lemberg‹ ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, das ich je gelesen habe.« Antonia Fraser »Ein schönes und notwendiges Buch.« A. L. Kennedy
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Philippe Sands
Rückkehr nach Lemberg
Über die Ursprünge von Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine persönliche Geschichte
Über dieses Buch
»Fesselnd … Sands hat ein bemerkenswertes und unterhaltsames Buch geschrieben, indem er seine eigene Familiengeschichte mit einem lebendigen Bericht über die Mühen der Vorkämpfer für die internationalen Menschenrechtsgesetze verwoben hat.«
Literary Review
Als der bekannte Anwalt für Menschenrechte Philippe Sands eine Einladung nach Lemberg erhält, ahnt er noch nicht, dass dies der Anfang einer erstaunlichen Reise ist, die ihn um die halbe Welt führen wird. Er kommt einem bewegenden Familiengeheimnis auf die Spur, und er stößt auf die Geschichte zweier Männer, die angesichts der ungeheuren NS-Verbrechen alles daran setzten, diese juristisch zu fassen. Sie prägten die zentralen Begriffe, mit denen seitdem der Schrecken benannt und geahndet werden kann: »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« und »Genozid«. Meisterhaft verwebt Philippe Sands die Geschichte von Tätern und Anklägern, von Strafe und Völkerrecht zu einer kraftvollen Erzählung darüber, wie Verbrechen und Schuld über Generationen fortwirken.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Philippe Sands, geboren 1960, ist Anwalt und Professor für Internationales Recht und Direktor des Centre on International Courts and Tribunals am University College London. Immer wieder setzt er sich leidenschaftlich für humanitäre Ziele und Völkerrecht ein. Er formulierte die Anklage gegen den chilenischen Diktator Pinochet, und er beschuldigte George W. Bush und Tony Blair der Verletzung des Internationalen Rechts im 2. Irakkrieg.
Er hat selbst Wurzeln in Lemberg, wo 1904 sein Großvater geboren wurde. Seine Mutter konnte 1938 als Kind aus Wien flüchten, der Großteil der Familie wurde während des Krieges in Lemberg ermordet.
»East West Street« wurde 2016 mit dem Samuel-Johnson-Preis ausgezeichnet, 2017 mit dem Wingate Literaturpreis der »Jewish Quarterly«.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe ist 2016 unter dem Titel »East West Street. On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity« bei Weidenfeld & Nicolson, London, erschienen.
© Philippe Sands 2016
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Schiller Design, Frankfurt, nach einer Idee von Sinem Erkas
Coverabbildung: mit freundlicher Genehmigung von Niklas Frank
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490456-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motti]
[Karten]
Mitteilung an den Leser
Hauptpersonen
Prolog Eine Einladung
Dienstag, 1. Oktober 1946, Justizpalast in Nürnberg
Donnerstag, 16. Oktober 2014, Justizpalast in Nürnberg
Teil I Leon
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Teil II Lauterpacht
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
Teil III Miss Tilney aus Norwich
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
Teil IV Lemkin
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
Teil V Der Mann mit der Fliege
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
Teil VI Frank
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
105. Kapitel
106. Kapitel
107. Kapitel
108. Kapitel
109. Kapitel
110. Kapitel
Teil VII Das Kind, das allein dasteht
111. Kapitel
112. Kapitel
113. Kapitel
114. Kapitel
Teil VIII Nürnberg
115. Kapitel
116. Kapitel
117. Kapitel
118. Kapitel
119. Kapitel
120. Kapitel
121. Kapitel
122. Kapitel
123. Kapitel
124. Kapitel
125. Kapitel
126. Kapitel
127. Kapitel
128. Kapitel
129. Kapitel
130. Kapitel
Teil IX Das Mädchen, das sich nicht erinnern wollte
131. Kapitel
132. Kapitel
133. Kapitel
134. Kapitel
Teil X Urteil
135. Kapitel
136. Kapitel
137. Kapitel
138. Kapitel
139. Kapitel
140. Kapitel
141. Kapitel
142. Kapitel
143. Kapitel
144. Kapitel
145. Kapitel
146. Kapitel
147. Kapitel
148. Kapitel
149. Kapitel
150. Kapitel
151. Kapitel
152. Kapitel
153. Kapitel
154. Kapitel
155. Kapitel
156. Kapitel
157. Kapitel
158. Kapitel
Epilog In die Wälder
Dank
Quellen
Bildnachweise
Register
Für Malke und Rosa,
für Rita und Leon,
für Annie,
für Ruth
Die kleine Stadt[1] liegt mitten im Flachland … Sie fängt mit kleinen Hütten an und hört mit ihnen auf. Die Häuser lösen die Hütten ab. Da beginnen die Straßen. Eine läuft von Süden nach Norden, die andere von Osten nach Westen.
Joseph Roth, Juden auf Wanderschaft, 1927
Nicht die Gestorbenen[2] sind es, die uns heimsuchen, sondern die Lücken, die aufgrund von Geheimnissen anderer in uns zurückgeblieben sind.
Nicolas Abraham, Aufzeichnungen über das Phantom, 1975
Mitteilung an den Leser
Die Stadt Lwiw nimmt in dieser Geschichte einen wichtigen Platz ein. Während des 19. Jahrhunderts war sie als Lemberg bekannt und lag am östlichen Rand der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie Teil des unabhängig gewordenen Polens und hieß Lwów, bis sie nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von den Sowjets besetzt und in Lwow umbenannt wurde. Im Juli 1941 eroberten die Deutschen die Stadt, die sie wieder Lemberg nannten und zur Hauptstadt des Distrikts Galizien im Generalgouvernement machten. Nachdem die Rote Armee im Sommer 1944 die Nazis vertrieben hatte, wurde die Stadt Teil der Ukraine und trägt seitdem den Namen Lwiw.
Lemberg, Lwiw, Lwow und Lwów sind derselbe Ort. Der Name änderte sich wie die Zusammensetzung und Nationalität seiner Bewohner, doch seine Lage und seine Gebäude blieben dieselben. Und das, obwohl die Stadt zwischen 1914 und 1945 nicht weniger als achtmal den Besitzer wechselte. Wie die Stadt auf den Seiten dieses Buches genannt werden sollte, war eine schwierige Frage. Daher habe ich mich an den jeweiligen Namen gehalten, den diejenigen benutzten, die sie zu der Zeit beherrschten, über die ich schreibe. (Entsprechend verfahre ich mit anderen Orten: Das nahe gelegene Zółkiew heißt jetzt Schowkwa, während es von 1951 bis 1991 zu Ehren eines russischen Helden aus dem Ersten Weltkrieg, des ersten Piloten, der einen Looping geflogen ist, Nesterow genannt wurde.)
Ich habe daran gedacht, sie durchgängig Lemberg zu nennen, aufgrund der historischen Anklänge des Wortes und auch weil es der Name der Stadt ist, in der mein Großvater seine Kindheit verbracht hat. Doch hätte eine solche Entscheidung leicht als ein falsches Signal aufgefasst werden können, zumal in einer Zeit, in der die Ukraine in kriegerische Auseinandersetzungen mit Russland um ihr eigenes Territorium verwickelt ist. Das Gleiche traf auch auf Lwów zu, wie die Stadt zwei Jahrzehnte lang genannt wurde, und ebenso auf Lviv, ihren kurzlebigen Namen während einiger turbulenter Tage im November 1918. Italien hat die Stadt nie beherrscht, aber wenn das der Fall gewesen wäre, dann wäre sie Leopolis genannt worden, die Stadt der Löwen.
Hauptpersonen
Hersch Lauterpacht, Professor für Internationales Recht, geboren im August 1897 in der Kleinstadt Zółkiew, wenige Kilometer von Lemberg entfernt, wohin die Familie 1911 zog. Sohn von Aron und Deborah (geb. Turkenkopf); er war das zweite von drei Kindern, zwischen seinem Bruder David und seiner Schwester Sabina. 1923 heiratete er in Wien Rachel Steinberg, ihr Sohn Elihu wurde in Cricklewood, London, geboren.
Hans Frank, Rechtsanwalt und Reichsminister, geboren im Mai 1900 in Karlsruhe. Er hatte einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. 1925 heiratete er Brigitte Herbst, sie hatten zwei Töchter und drei Söhne, deren jüngster Niklas genannt wurde. Im August 1942 verbrachte er zwei Tage in Lemberg, wo er mehrere Reden hielt.
Raphael Lemkin, Staats- und Rechtsanwalt, geboren im Juni 1900 in Ozerisko bei Białystok. Sohn von Josef und Bella, er hatte zwei Brüder (der ältere hieß Elias und der jüngere Samuel). 1921 zog er nach Lwów. Er heiratete nie und hatte keine Kinder.
Leon Buchholz, mein Großvater, geboren im Mai 1904 in Lemberg. Sohn von Pinkas, einem Spirituosenfabrikanten und späteren Gastwirt, und Malke (geb. Flaschner); er war das jüngste von vier Geschwistern, nach seinem älteren Bruder Emil und zwei Schwestern, Gusta und Laura. Er heiratete 1937 in Wien Regina »Rita« Landes, ein Jahr später wurde ihre Tochter Ruth, meine Mutter, dort geboren.
PrologEine Einladung
Dienstag, 1. Oktober 1946, Justizpalast in Nürnberg
Kurz nach 15 Uhr öffnete sich die Holztür hinter der Anklagebank, und Hans Frank betrat den Gerichtssaal 600. Er trug einen grauen Anzug, dessen Farbe sich vom Weiß der Helme zweier ernst blickender Militärpolizisten abhob, die ihn begleiteten. Die Gerichtsverhandlungen hatten ihren Tribut gefordert von dem Mann, der Adolf Hitlers persönlicher Anwalt und dann sein Statthalter im von Deutschland besetzten Polen gewesen war, einem Mann mit rosigen Wangen, einer scharfen kleinen Nase und straff zurückgekämmtem Haar. Frank war nicht mehr der fesche, schlanke Minister, als den ihn sein Freund Richard Strauss gefeiert hatte. Tatsächlich befand er sich in einem Zustand beträchtlicher Verwirrung, und zwar so sehr, dass er sich nach Betreten des Raumes in die falsche Richtung drehte und den Richtern den Rücken zuwandte.
In dem vollen Gerichtssaal saß an diesem Tag ein Professor für Internationales Recht an der Universität Cambridge. Hersch Lauterpacht, mit schütterem Haar und Brille, hockte rund wie eine Eule am Ende eines langen Holztisches, eingerahmt von angesehenen Kollegen aus dem Team der britischen Anklagevertretung. Lauterpacht, der in seinem schwarzen Anzug nur wenige Schritt von Frank entfernt saß, war derjenige, der die Idee gehabt hatte, den Begriff »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« in das Nürnberger Statut einzubringen, vier Wörter, um die Ermordung von vier Millionen Juden und Polen auf polnischem Territorium zu beschreiben. Lauterpacht sollte später einmal als der bedeutendste Völkerrechtler des 20. Jahrhunderts und als ein Vater der modernen Menschenrechtsbewegung gelten, doch sein Interesse an Frank war nicht nur beruflicher Natur. Fünf Jahre lang war Frank Gouverneur eines Gebiets gewesen, zu dem auch Lemberg gehörte, die Heimat von Lauterpachts großer Familie, darunter seine Eltern, ein Bruder, eine Schwester und deren Kinder. Als der Prozess ein Jahr zuvor eröffnet worden war, war über ihr Schicksal im Reich des Hans Frank nichts bekannt.
Ein anderer Mann, der sich für den Prozess interessierte, war an diesem Tag nicht anwesend. Raphael Lemkin lag in einem amerikanischen Militärkrankenhaus in Paris im Bett und hörte sich das Urteil im Radio an. Er war Staatsanwalt und Rechtsanwalt in Warschau gewesen, 1939 bei Ausbruch des Krieges aus Polen geflohen und schließlich in Amerika gelandet. Dort arbeitete er für die amerikanische Anklagevertretung des Prozesses, Seite an Seite mit den Briten. Auf seiner langen Flucht führte er eine Reihe von Handkoffern mit sich, vollgestopft mit Dokumenten, darunter viele von Frank unterzeichnete Erlasse. Beim Studium dieser Unterlagen entdeckte Lemkin ein Verhaltensmuster, das er mit einem Etikett versah, um das Verbrechen zu beschreiben, dessen Frank angeklagt werden konnte. Er nannte es »Genozid«. Während Lauterpacht sich auf »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« konzentrierte, und somit auf den Schutz von Individuen, ging es ihm um den Schutz ganzer Bevölkerungsgruppen. Er hatte unermüdlich dafür gearbeitet, Frank des Genozids anklagen zu können, aber an diesem letzten Prozesstag war er zu krank, um dabei zu sein. Auch er hatte ein persönliches Interesse an Frank: Er hatte jahrelang in Lwów gewohnt, und seine Eltern und sein Bruder waren von den Verbrechen betroffen, die auf Franks Gebiet begangen worden sein sollten.
»Angeklagter Hans Frank«, verkündete der Gerichtspräsident. Frank sollte nun erfahren, ob er zu Weihnachten noch am Leben und in der Lage sein würde, das Versprechen einzulösen, das er kürzlich seinem siebenjährigen Sohn gegeben hatte: dass alles gut war und er zum Fest zu Hause sein würde.
Donnerstag, 16. Oktober 2014, Justizpalast in Nürnberg
Achtundsechzig Jahre später besuchte ich den Gerichtssaal 600 in Begleitung von Hans Franks Sohn Niklas, der ein kleiner Junge gewesen war, als sein Vater ihm dieses Versprechen gegeben hatte.
Niklas und ich begannen unseren Besuch in dem trostlosen, leeren Flügel des nicht mehr genutzten Gefängnisses hinter dem Justizpalast, dem einzigen der vier Flügel, der noch stand. Wir saßen gemeinsam in einer kleinen Zelle, ähnlich der, in der sein Vater fast ein Jahr verbracht hatte. Zum letzten Mal war Niklas im September 1946 in diesem Gebäudeteil gewesen. »Es ist der einzige Raum auf der Welt, wo ich meinem Vater ein klein wenig näher bin«, sagte er zu mir, »wenn ich hier sitze und an ihn denke, wie er ungefähr ein Jahr lang hier drinnen gewesen ist, mit einer offenen Toilette, einem kleinen Tisch und Bett und sonst nichts.« Die Zelle war gnadenlos, und das war auch Niklas im Hinblick auf die Taten seines Vaters. »Mein Vater war Rechtsanwalt; er wusste, was er tat.«
Der Gerichtssaal 600, der immer noch benutzt wird, hatte sich seit der Zeit des Prozesses nicht wesentlich verändert. Damals im Jahr 1946 musste jeder der einundzwanzig Angeklagten auf dem Weg von den Zellen in den Gerichtssaal einen engen Fahrstuhl benutzen, eine Vorrichtung, die Niklas und ich sehen wollten. Sie war noch vorhanden, hinter der Bank, auf der die Angeklagten saßen. Man betrat den Fahrstuhl durch eine alte Holztür, die sich so geräuschlos wie je öffnete. »Auf, zu[1], auf, zu«, schrieb R.W. Cooper von The Times, London, der frühere Tennisreporter, der täglich über den Prozess berichtete. Niklas ließ die Tür aufgleiten, betrat den engen Raum und schloss dann die Tür hinter sich.
Als er wieder herauskam, ging er zu dem Platz, auf dem sein Vater während des Prozesses gesessen hatte, in dem er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozids angeklagt worden war. Niklas setzte sich und stützte sich vorn auf das Holzgeländer. Er sah mich an, blickte sich im Saal um und seufzte dann. Ich hatte mir oft Gedanken gemacht über den Augenblick, als sein Vater das letzte Mal durch die Tür des Aufzugs getreten und zur Anklagebank gegangen war. Es existiert kein Filmmaterial, denn am letzten Nachmittag des Prozesses, am Dienstag, dem 1. Oktober 1946, durfte nicht gefilmt werden. Das geschah, um die Würde der Angeklagten zu wahren.
Niklas’ Stimme unterbrach meine Gedanken. Er sprach leise und bestimmt: »Das ist ein glücklicher Raum[2], für mich und für die Welt.«
Dass Niklas und ich uns gemeinsam im Gerichtssaal 600 befanden, verdankte sich einer überraschenden Einladung, die ich einige Jahre zuvor erhalten hatte. Sie stammte von der juristischen Fakultät der Universität jener Stadt, die heute unter dem Namen Lwiw bekannt ist. Man lud mich ein, einen öffentlichen Vortrag über meine Arbeit zu halten, die sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid dreht. Die Fakultät bat mich, über die Fälle zu berichten, an denen ich beteiligt gewesen war, sowie über meine Forschungen zum Nürnberger Kriegsverbrecherprozess und dessen Folgen für unsere heutige Welt.
Mich hatten der Prozess und der Mythos von Nürnberg seit langem fasziniert als der Moment, der als die Geburtsstunde unserer modernen internationalen Gerichtsbarkeit gilt. Ich war gebannt von den seltsamen Details, die man in den umfangreichen Protokollen finden konnte, und von den grauenhaften Beweisen, mich interessierten die vielen Bücher, Lebenserinnerungen und Tagebücher, die in forensischer Genauigkeit die Zeugenaussagen vor Gericht wiedergaben. Mich fesselten die Bilder, Fotos, Wochenschauen und Filme wie Judgment at Nuremberg (Das Urteil von Nürnberg), der 1962 den Oscar gewann und durch sein Thema und durch Spencer Tracys Flirt mit Marlene Dietrich unvergesslich blieb. Ein praktischer Grund für mein Interesse war, dass der Prozess nachhaltigen Einfluss auf meine Arbeit gehabt hatte: Denn der Urteilsspruch von Nürnberg verschaffte der aufkeimenden Menschenrechtsbewegung kräftigen Auftrieb. Ja, es gab einen starken Beigeschmack von »Siegerjustiz«, doch hatte der Fall zweifellos eine katalytische Wirkung, weil er erstmals die Möglichkeit eröffnete, den Führern eines Landes vor einem internationalen Gerichtshof den Prozess zu machen.
Sehr wahrscheinlich hatte ich die Einladung aus Lwiw eher meiner Arbeit als Anwalt zu verdanken als meinen Büchern. Im Sommer 1998 war ich am Rande an den Verhandlungen in Rom beteiligt, die zur Schaffung des Internationalen Strafgerichtshofes (ISTGH) führten, und einige Monate später arbeitete ich am Pinochet-Fall in London mit. Der frühere Präsident Chiles, der von einem spanischen Staatsanwalt wegen Genozids und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt worden war, hatte sich vor britischen Gerichten auf Immunität berufen und war gescheitert. In den Jahren danach sorgten andere Fälle dafür, dass sich die Pforten der internationalen Strafjustiz nach einer Periode des Stillstands während des Kalten Krieges, der auf den Nürnberger Prozess folgte, allmählich wieder öffneten.
Fälle aus dem früheren Jugoslawien und aus Ruanda landeten bald auf meinem Schreibtisch in London. Es folgten Fälle aus dem Kongo, aus Libyen, Afghanistan und Tschetschenien, aus dem Iran, Syrien und dem Libanon, aus Sierra Leone, Guantánamo und dem Irak. Die lange, traurige Liste zeigte deutlich, dass die guten Absichten aus dem Gerichtssaal 600 in Nürnberg erfolglos geblieben waren.
Ich bekam es mit mehreren Fällen von Massenmord zu tun. Einige wurden als Verbrechen gegen die Menschlichkeit – die Tötung einzelner Menschen im großen Maßstab – behandelt, und andere führten zur Anklage wegen Genozids – der gezielten Vernichtung von nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Bevölkerungsgruppen. Diese zwei unterschiedlichen Straftatbestände, mit ihren jeweiligen Schwerpunkten auf dem Individuum und der Gruppe, entwickelten sich parallel, doch im Laufe der Zeit erschien vielen Menschen der Genozid als das Verbrechen aller Verbrechen. Ganz so, als gäbe es eine interne Rangfolge und als wäre es weniger schrecklich, eine große Anzahl von Individuen zu töten. Gelegentlich erhielt ich Hinweise auf die Herkunft und den Zweck der beiden Begriffe sowie auf ihren Zusammenhang mit den Verhandlungen im Gerichtssaal 600. Doch stellte ich nie allzu gründliche Nachforschungen darüber an, was in Nürnberg geschehen war. Ich wusste, wie diese neuen Straftatbestände entstanden waren und wie sie sich später entwickelt hatten, doch ich wusste wenig über die damit verbundenen persönlichen Geschichten oder wie es dazu kam, dass die beiden Verbrechen im Strafverfahren gegen Hans Frank zur Anklage kamen. Auch über die persönlichen Umstände, unter denen Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin ihre unterschiedlichen Ideen entwickelten, wusste ich nichts.
Die Einladung aus Lwiw bot eine Chance, diese Geschichte zu erforschen.
Ich ergriff sie aus noch einem anderen Grund: Mein Großvater Leon Buchholz wurde dort geboren. Ich kannte den Vater meiner Mutter viele Jahre lang – er starb 1997 in Paris, einer Stadt, die er liebte und Heimat nannte –, doch ich wusste wenig über die Jahre vor 1945, weil er nicht über sie sprechen wollte. Sein Leben umspannte das gesamte 20. Jahrhundert, und als ich ihn kennenlernte, war seine einstmals große Familie zusammengeschrumpft. Das begriff ich, aber nicht in welchem Ausmaß oder unter welchen Umständen. Eine Reise nach Lwiw bot die Möglichkeit, mehr über jene schmerzlichen Jahre zu erfahren.
Ein paar wenige Informationen hatte er preisgegeben, doch zum größten Teil hatte Leon die erste Hälfte seines Lebens in einer Gruft verschlossen. Die damaligen Ereignisse mussten in den Nachkriegsjahren große Auswirkungen auf meine Mutter gehabt haben, doch sie waren auch für mich wichtig, hatten sie doch folgenreiche Spuren und viele unbeantwortete Fragen hinterlassen. Warum hatte ich mich für eine juristische Laufbahn entschieden? Und warum für ein juristisches Gebiet, das offenbar mit einer unausgesprochenen Familiengeschichte verbunden war? »Nicht die Gestorbenen[3] sind es, die uns heimsuchen, sondern die Lücken, die aufgrund von Geheimnissen anderer in uns zurückgeblieben sind«, schrieb der Psychoanalytiker Nicolas Abraham über die Beziehung zwischen Enkeln und Großeltern. Die Einladung nach Lwiw war eine Möglichkeit, diese verstörenden Lücken zu erkunden. Ich nahm sie an und brachte dann einen Sommer damit zu, den Vortrag zu verfassen.
Eine Karte zeigte Lwiw genau in der Mitte Europas; die von London aus nicht leicht zu erreichende Stadt lag am Schnittpunkt gedachter Linien, die Riga mit Athen verbanden, Prag mit Kiew, Moskau mit Venedig. Hier kreuzten sich die Verwerfungslinien, die den Osten vom Westen und den Norden vom Süden trennen.
Einen Sommer lang vertiefte ich mich in die Literatur über Lwiw. In Bücher, Karten, Fotos[4], Wochenschauen, Gedichte, Lieder – eigentlich alles, was ich über die Stadt der »verwischten Grenzen«, wie Joseph Roth sie nannte, finden konnte. Mich interessierten besonders[5] die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts, als Leon in dieser Stadt der »polyglotten Farbigkeit« lebte, dem »Rot-Weiß, Blau-Gelb und einem bißchen Schwarz-Gelb« des polnischen, ukrainischen und österreichischen Einflusses. Ich entdeckte eine Stadt der Mythen, einen Ort tiefer intellektueller Traditionen, wo die vielfältigen Kulturen, Religionen und Sprachen der Völker, die im großen Haus der Österreichisch-Ungarischen Monarchie zusammenlebten, aufeinanderprallten. Der Erste Weltkrieg brachte das Haus zum Einstürzen, zerstörte ein Reich und setzte gefährliche Kräfte frei: Rechnungen wurden beglichen, und es kam zu großem Blutvergießen. Der Versailler Vertrag, die Okkupation durch die Nazis und die Sowjetherrschaft folgten einander in kurzem Abstand und richteten gemeinsam Unheil an. Das »Rot-Weiß« und das »Schwarz-Gelb« verblassten und ließen das moderne Lwiw mit einer überwiegend ukrainischen Bevölkerung zurück, als eine nun von »Blau-Gelb« beherrschte Stadt.
Zwischen September 1914 und Juli 1944 wechselte die Herrschaft über die Stadt achtmal. Nachdem sie lange Zeit die Hauptstadt des »Königreichs Galizien und Lodomerien mit dem Großherzogtum Krakau und den Herzogtümern Auschwitz und Zator« innerhalb der Österreichisch-Ungarischen Monarchie gewesen war – ja, es ist das Auschwitz –, fiel die Stadt zunächst an Russland, dann zurück an Österreich, dann kurz an die Westukraine, dann an Polen, dann an die Sowjetunion, dann an Deutschland, dann erneut an die Sowjetunion und schließlich an die Ukraine, zu der es noch heute gehört. Im Königreich Galizien, auf dessen Straßen Leon als kleiner Junge herumlief, lebten einst Polen, Ukrainer, Juden und viele andere. Doch als Hans Frank am letzten Tag des Nürnberger Prozesses den Gerichtssaal 600 betrat – weniger als dreißig Jahre später –, war die gesamte jüdische Volksgruppe ausgelöscht, die Polen waren vertrieben worden.
Die Straßen von Lwiw sind ein Mikrokosmos des turbulenten 20. Jahrhunderts in Europa, der Mittelpunkt blutiger Konflikte, die Kulturen auseinandergerissen haben. Inzwischen liebe ich die Landkarten jener Jahre, mit Straßen, deren Namen oft wechselten, obwohl ihr Verlauf unverändert blieb. Eine Parkbank, ein schönes Jugendstilrelikt aus der österreichisch-ungarischen Zeit, wurde mir mit der Zeit zu einem vertrauten Freund. Von hier aus konnte ich die Welt vorüberziehen sehen, sie war ein guter Aussichtspunkt auf die wechselvolle Stadtgeschichte.
1914 befand sich die Bank im Stadtpark, gegenüber des großartigen Landtagsgebäudes, des Parlaments von Galizien in der östlichsten Provinz der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Ein Jahrzehnt später hatte sich die Bank nicht wegbewegt, aber sie stand nun in einem anderen Land, in Polen, im Kościuszko-Park. Das Parlament war verschwunden[6], aber nicht das Gebäude, das jetzt die Jan-Kazimierz-Universität beherbergte. Im Sommer 1941, als Hans Franks Generalgouvernement die Macht in der Stadt übernahm, wurde die Bank germanisiert, sie befand sich jetzt im Jesuitengarten gegenüber einem früheren Universitätsgebäude, das seiner polnischen Identität beraubt worden war.
Diese Zwischenkriegsjahre sind der Gegenstand einer beträchtlichen Literatur, aber kein Werk beschreibt plastischer, was verlorengegangen ist, als Mój Lwów (Mein Lemberg). »Wo seid ihr[7], Lemberger Parkbänke, geschwärzt von Alter und Regen, rauh und gesprungen wie die Borke mittelalterlicher Ölbäume?«, fragte der polnische Dichter Józef Wittlin 1946.
Galizischer Landtag in Lemberg
Als ich nun, sechs Jahrzehnte später[8], bei der Bank ankam, auf der mein Großvater vor einem Jahrhundert gesessen haben könnte, befand ich mich im Iwan-Franko-Park, benannt zu Ehren eines ukrainischen Schriftstellers, der Gedichte und sozialkritische Romane schrieb und dessen Name nun das Universitätsgebäude zierte.
Wittlins Hommage an Lemberg wurde in seinen spanischen und deutschen Übersetzungen mein Begleiter, ein Führer durch die alte Stadt mit ihren Gebäuden und Straßen, die gezeichnet waren von den im November 1918 ausgebrochenen Kämpfen. Dieser brutale Konflikt zwischen der polnischen und der ukrainischen Bevölkerung, bei dem die Juden zwischen allen Stühlen saßen oder zur Zielscheibe wurden, war besorgniserregend genug gewesen, dass in der New York Times darüber berichtet wurde. Er hatte den Präsidenten der USA Woodrow Wilson veranlasst, eine Untersuchungskommission einzusetzen. »Ich will keine Wunden[9] am lebendigen Leibe dieser Erinnerungen berühren und spreche deshalb nicht vom Jahr 1918«, schrieb Wittlin und tat dann genau das. Er erinnerte an die »brudermörderischen polnisch-ukrainischen Kämpfe«, deren Frontlinien sich quer durch die Stadt zogen, wodurch viele zwischen den kriegführenden Parteien festsaßen. Doch waren auch die Grundregeln der Höflichkeit noch immer befolgt worden, etwa als ein ukrainischer Schulfreund das Kampfgeschehen in der Nähe der Bank, auf der ich nun saß, kurz unterbrochen hatte, damit der junge Wittlin nach Hause gelangen konnte.
»Unter meinen Kollegen herrschte Harmonie, obgleich viele von ihnen zu verschiedenen, miteinander verfeindeten Nationen gehörten und abweichende Glaubenslehren und Anschauungen bekannten«, schrieb Wittlin. Hier war die mythische Welt Galiziens, wo Nationaldemokraten Juden liebten, Sozialisten mit Konservativen Tango tanzten, Altruthenen und Russophile mit ukrainischen Nationalisten weinten. »Spielen wir die Idylle«, schrieb Wittlin, indem er »das Wesen des Lembergertums« heraufbeschwor. Er schilderte eine Stadt, die erhaben und gaunerhaft war, weise und idiotisch, poetisch und mittelmäßig. »Herb ist der Geschmack des Lembergertums«, schloss er wehmütig, wie der Geschmack einer ungewöhnlichen Frucht, der czeremcha, einer wilden Kirsche, die nur in der Vorstadt Kleparów gedieh. Wittlin nannte die Frucht eine cerenda, bitter und süß. »Das Heimweh verfälscht gern auch den Geschmack, indem es uns heute nur Lembergs Süße zu empfinden heißt. Doch kenne ich Menschen, für die Lemberg eine Schale voll Bitterkeit war.«
Die Bitterkeit schwärte nach dem Ersten Weltkrieg weiter, der in Versailles ausgesetzt, doch nicht beigelegt worden war. Periodisch flammte sie mit voller Kraft auf, zum Beispiel, als die Sowjets im September 1939 auf weißen Pferden in die Stadt galoppierten, und noch einmal zwei Jahre später mit der Ankunft der Deutschen in ihren Panzern. »Im zeitigen August 1942 kam Generalgouverneur Dr. Frank in Lwow an«, berichtete ein jüdischer Einwohner in einem der seltenen erhaltenen Tagebücher. »Wir wussten[10], dass sein Besuch nichts Gutes bedeutete.« In jenem Monat stieg Hans Frank, Hitlers persönlicher Anwalt und nun Generalgouverneur des besetzten Polens, die Marmortreppe des Universitätsgebäudes hoch, um in der Aula einen Vortrag zu halten, in dem er die Vernichtung der jüdischen Einwohner ankündigte.
Ich kam im Herbst 2010 nach Lwiw, um meinen Vortrag zu halten. Inzwischen hatte ich eine merkwürdige und bisher offensichtlich unbemerkte Tatsache entdeckt: Die beiden Männer, die die Straftatbestände des Verbrechens gegen die Menschlichkeit und des Genozids in den Nürnberger Prozess einführten, Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin, waren in der Zeit, von der Wittlin schrieb, Einwohner der Stadt gewesen. Beide studierten an der Universität und durchlebten jene bitteren Jahre.
Das sollte nicht der letzte von vielen Zufällen sein, die mir auf den Schreibtisch kamen, aber es blieb der einschneidendste. War es nicht erstaunlich, dass ich bei der Vorbereitung meiner Reise nach Lwiw, wo ich über die Entstehung des Völkerstrafrechts sprechen sollte, erfuhr, dass die Stadt selbst eng mit dessen Entstehung verknüpft war? Es schien mehr als ein bloßer Zufall zu sein, dass die beiden Männer, die mehr als jeder andere zu unserem modernen System der internationalen Strafgerichtsbarkeit beigetragen hatten, aus ebendieser Stadt stammten. Ebenso bemerkenswert war, dass niemand, den ich im Lauf dieses ersten Besuchs an der Universität oder irgendwo in Lwiw traf, etwas über die Rolle der Stadt dabei wusste.
Die Fragen nach dem Vortrag bezogen sich meist auf das Leben der beiden Männer. In welchen Straßen hatten sie gewohnt? Welche Kurse hatten sie an der Universität belegt und wer waren ihre Lehrer gewesen? Waren sie sich begegnet, oder hatten sie sich gekannt? Was war in den Jahren nach ihrem Weggang aus der Stadt geschehen? Warum sprach heute niemand an der juristischen Fakultät von ihnen? Warum konzentrierte der eine von ihnen sich auf den Schutz von Individuen und der andere auf den Schutz von Gruppen? Wie kam es, dass sie beim Nürnberger Prozess mitwirkten? Was geschah mit ihren Familien?
Ich hatte keine Antworten auf diese Fragen zu Lauterpacht und Lemkin.
Dann stellte jemand eine Frage, die ich beantworten konnte:
»Was ist der Unterschied zwischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid?«
»Stellen Sie sich die Ermordung von 100000 Menschen vor, die derselben Bevölkerungsgruppe angehören«, erklärte ich, »Juden oder Polen in der Stadt Lwiw. Für Lauterpacht wäre die Ermordung von Individuen, wenn sie Teil eines systematischen Plans ist, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Für Lemkin lag der Fokus auf Genozid, der Ermordung vieler Menschen mit der Absicht, die Gruppe auszulöschen, zu der sie gehören. Für einen heutigen Ankläger besteht der Unterschied zwischen beiden Straftatbeständen hauptsächlich darin, ob eine Absicht beweisbar ist: Um Genozid zu beweisen, muss man belegen, dass die Mordtaten in der Absicht begangen wurden, die Gruppe zu vernichten, während dies für Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht nötig ist.« Ich erklärte, dass es notorisch schwierig sei, eine entsprechende Absicht nachzuweisen, da die Beteiligten an solchen Morden nicht dazu neigten, Spuren in Gestalt von relevanten Unterlagen zu hinterlassen.
Ob denn die Unterscheidung überhaupt eine Rolle spiele, fragte ein anderer. Spielt es eine Rolle, ob das Gesetz dich schützen will, weil du ein Individuum bist oder weil du zufällig zu einer Gruppe gehörst? Diese Frage stand im Raum und hat mich seither nicht losgelassen.
Später am Abend trat eine Studentin an mich heran. »Können wir privat miteinander sprechen, außer Hörweite der anderen?«, flüsterte sie. »Es ist etwas Persönliches.« Wir begaben uns in eine Ecke. Keiner in der Stadt kenne Lauterpacht und Lemkin oder mache sich etwas aus ihnen, sagte sie, weil sie Juden waren. Ihre Identität sei ihr Makel.
Mag sein, antwortete ich, da ich nicht wusste, worauf sie hinauswollte.
Sie sagte: »Ich wollte, dass Sie wissen, wie wichtig Ihre Vorlesung für mich gewesen ist, persönlich wichtig.«
Ich verstand, was sie mir mitteilen wollte und dass sie mir einen Hinweis auf ihre eigenen Wurzeln gab. Ob Polin oder Jüdin, darüber konnte man nicht offen sprechen. Fragen der individuellen Identität und Gruppenzugehörigkeit waren in Lwiw heikel.
»Ich habe Ihr Interesse an Lauterpacht und Lemkin verstanden«, fuhr sie fort, »aber ist nicht Ihr Großvater derjenige, dessen Spuren Sie verfolgen sollten? Ist er Ihrem Herzen nicht am nächsten?«
Teil ILeon
1
Meine früheste Erinnerung an Leon geht zurück auf die 1960er Jahre, als er mit seiner Frau Rita, meiner Großmutter, in Paris lebte. Ihre Wohnung hatte zwei Schlafzimmer und eine winzige Küche und befand sich in der dritten Etage eines leicht heruntergekommenen Hauses aus dem 19. Jahrhundert in der Mitte der Rue de Maubeuge. Ein muffiger Geruch sowie der Lärm der Züge von der nahen Gare du Nord beherrschten ihr Zuhause.
Hier sind einige Dinge, an die ich mich erinnern kann: Es gab ein Bad mit rosafarbenen und schwarzen Kacheln. Dort verbrachte Leon viel Zeit ganz allein hinter einem Plastikvorhang in einem kleinen Abteil sitzend. Das war für mich und meinen neugierigeren jüngeren Bruder eine verbotene Zone. Gelegentlich, wenn Leon und Rita einkaufen waren, schlichen wir uns an den verbotenen Ort. Mit der Zeit wurden wir mutiger und untersuchten die Gegenstände auf dem Holztisch, der ihm in seinem Badezimmerwinkel als Schreibtisch diente, unentzifferbare Schriftstücke in Französisch oder noch fremderen Sprachen (Leons Handschrift unterschied sich von allen, die wir je gesehen hatten, spinnenbeinige Wörter krochen über die Seite). Der Tisch war auch übersät mit alten und kaputten Uhren, was unseren Glauben nährte, dass unser Großvater ein Schmuggler von Chronometern war.
Ab und zu kamen Besucher, ältere Damen mit seltsamen Namen und Gesichtern. Madame Scheinmann war besonders bemerkenswert, schwarzgekleidet mit einer braunen Pelzstola, die ihr von der Schulter hing, einem winzigen weißgepuderten Gesicht und verschmiertem roten Lippenstift. Sie sprach im Flüsterton mit einem seltsamen Akzent und meist von der Vergangenheit. Ich kannte die Sprache nicht (es war Polnisch, wie ich später erfuhr).
Auch erinnere ich mich, dass es keine Fotos gab, außer einem gerahmten Schwarzweißfoto, das stolz über dem unbenutzten Kamin stand, Leon und Rita an ihrem Hochzeitstag 1937. Rita lächelte auf dem Foto nicht, und auch später nicht, als ich sie kannte. Das war etwas, was ich früh wahrnahm und nie vergaß. Es schien keine Alben zu geben, keine Fotos von Eltern oder Geschwistern (längst verstorben, wurde mir gesagt) und keine zur Schau gestellten Familienerinnerungen. Es gab einen Schwarzweißfernseher, einzelne Exemplare des Paris Match, die Rita gern las, aber keine Musik.
Die Vergangenheit hing wie eine dunkle Wolke über Leon und Rita, eine Zeit vor Paris, über die in meiner Gegenwart nicht gesprochen werden durfte oder nicht in einer Sprache, die ich verstand. Heute, vierzig Jahre später, stelle ich mit einem gewissen Schamgefühl fest, dass ich Leon und Rita nie nach ihrer Kindheit gefragt habe. Doch selbst wenn ich Neugier empfunden hätte, hätte ich ihr nicht nachgehen dürfen.
In der Wohnung herrschte Schweigen. Leon war umgänglicher als Rita, die einen auf Distanz zu halten schien. Sie verbrachte viel Zeit in der Küche, wo sie oft mein Lieblingsessen, Wiener Schnitzel mit Kartoffelbrei, zubereitete. Leon wischte seinen Teller gern mit einem Stück Brot so sauber, dass man ihn nicht mehr abwaschen musste.
Es herrschte eine Atmosphäre von Ordnung und Würde, und von Stolz. Ein Freund der Familie, der Leon seit den 1950er Jahren kannte, erinnerte sich an meinen Großvater als einen zurückhaltenden Mann. »Immer im Anzug, elegant gekleidet, diskret, er wollte sich nie aufdrängen.«
Leon ermutigte mich zum Jurastudium. 1983, als ich meinen Universitätsabschluss machte, schenkte er mir ein englisch-französisches juristisches Wörterbuch. »Für deinen Eintritt ins Berufsleben«, kritzelte er auf das Vorsatzblatt. Ein Jahr später sandte er mir einen Brief mit einem Ausschnitt aus Le Figaro, eine Stellenanzeige für einen englischsprachigen internationalen Rechtsanwalt in Paris. »Mon fils«, pflegte er zu sagen, wie wär’s damit? »Mein Sohn« – so nannte er mich.
Erst jetzt, viele Jahre später, habe ich begriffen, wie schrecklich die Ereignisse waren, die Leon vor dieser Zeit durchlebt hatte und aus denen er mit intakter Würde, mit menschlicher Wärme und einem Lächeln hervorgegangen war. Er war ein großzügiger, leidenschaftlicher Mann mit hitzigem Temperament, das manchmal unerwartet und brutal hervorbrach, ein lebenslanger Sozialist, der den französischen Premierminister Léon Blum bewunderte und Fußball liebte, ein praktizierender Jude, für den die Religion Privatsache war, die anderen nicht aufgedrängt werden durfte. Er interessierte sich nicht für Materielles und wollte keinem zur Last fallen. Drei Dinge waren für ihn wichtig: Familie, Essen und sein Zuhause.
Ich habe viele glückliche Erinnerungen, und doch wirkte Leons und Ritas Zuhause auf mich nie wie ein Ort der Freude. Selbst als kleiner Junge spürte ich die Spannung aus düsterer Vorahnung und Schweigen, die schwer auf den Räumen lastete. Ich kam einmal im Jahr zu Besuch, und ich erinnere mich immer noch, dass dort nie jemand lachte. Es wurde Französisch gesprochen, doch wenn es um Privates ging, wechselten die Großeltern zu Deutsch, der Sprache des Verschweigens und der Geschichte. Leon schien keine Arbeit zu haben, oder keine, die einen Aufbruch früh am Morgen erforderte. Rita arbeitete nicht. Sie sorgte für Ordnung im Haus, der Teppich im Wohnzimmer lag immer gerade. Wie sie ihren Lebensunterhalt bestritten, war ein Rätsel. »Wir dachten, dass er im Krieg Uhren geschmuggelt hat«, erzählte mir die Cousine meiner Mutter.
Was wusste ich sonst noch?
Dass Leon in einem weitentfernten Ort namens Lemberg geboren worden und als Junge nach Wien gezogen war. Das war eine Zeit, über die er nicht sprach, nicht mit mir. »C’est compliqué, c’est le passé, pas important.« Mehr sagte er nicht: Es ist kompliziert, es ist die Vergangenheit, nicht wichtig. Es war besser, keine Neugier zu zeigen, sagte mir ein schützender Instinkt. Über seine Eltern, den Bruder und die beiden Schwestern herrschte völliges und undurchdringliches Schweigen.
Was noch? Er heiratete Rita 1937 in Wien. Ihre Tochter Ruth, meine Mutter, kam ein Jahr später zur Welt, ein paar Wochen nachdem die Deutschen in Wien erschienen waren, um Österreich zu annektieren und den Anschluss zu vollziehen. 1939 ging er nach Paris. Nach dem Krieg hatten er und Rita ein zweites Kind, einen Sohn, den sie Jean-Pierre nannten, ein französischer Name.
Rita starb 1986, als ich fünfundzwanzig war.
Jean-Pierre starb vier Jahre danach bei einem Autounfall mit seinen beiden Kindern, meinen einzigen Cousins.
Leon kam 1993 zu meiner Hochzeit nach New York und starb vier Jahre später mit vierundneunzig Jahren. Er nahm Lemberg mit ins Grab, zusammen mit einem Schal, den ihm seine Mutter im Januar 1939 geschenkt hatte. Es war ein Geschenk bei seiner Abreise aus Wien, erzählte mir meine Mutter, als wir uns von ihm verabschiedeten.
Das war so ungefähr alles, was ich wusste, als ich die Einladung aus Lwiw bekam.
2
Ein paar Wochen vor der Reise nach Lwiw saß ich mit meiner Mutter in ihrem hellen Wohnzimmer in Nord-London, vor uns zwei alte Aktenmappen. Sie waren vollgestopft mit Leons Fotos und Papieren, Zeitungsausschnitten, Telegrammen, Pässen, Ausweisen, Briefen, Notizen. Vieles ging auf Wien zurück, doch einige Dokumente waren noch älter und stammten aus Lemberger Zeiten. Ich untersuchte alles sorgfältig, als Enkel, doch auch als Rechtsanwalt, der gern in Beweisstücken herumstöbert. Leon musste gewisse Dinge aus gutem Grund aufgehoben haben. Diese Erinnerungsstücke schienen geheime Informationen zu enthalten, verschlüsselt durch Sprache und Kontext.
Ich legte ein paar Dinge, die von besonderem Interesse waren, zur Seite. Da war Leons Geburtsurkunde, die seine Geburt am 10. Mai 1904 in Lemberg bestätigte. Das Dokument enthielt auch eine Adresse. In der Familie war bekannt, dass sein Vater (mein Urgroßvater) Gastwirt war und Pinkas genannt wurde, was man als Philip oder Philippe übersetzen kann. Leons Mutter, meine Urgroßmutter, hieß Amalie, genannt Malke. Sie wurde 1870 in Zółkiew, ungefähr 25 Kilometer nördlich von Lemberg, geboren. Ihr Vater Isaac Flaschner war Getreidehändler.
Andere Dokumente kamen zu dem Stapel.
Ein abgegriffener polnischer Pass, alt und verblichen, hellbraun, mit einem gekrönten Adler auf dem Einband. Er wurde im Juni 1923 in Lwów an Leon ausgehändigt und wies ihn als Einwohner der Stadt aus. Ich war überrascht, hatte ich ihn doch für einen Österreicher gehalten.
Der Anblick eines anderen Passes, diesmal dunkelgrau, versetzte mir einen Schock. Er war im Dezember 1938 in Wien vom Deutschen Reich ausgestellt und hatte einen anderen Adler auf dem Einband: einen, der auf einem goldenen Hakenkreuz hockte. Es war ein Fremdenpass, ein Reisedokument, das Leon benötigte, weil er seiner polnischen Identität, seiner Staatsbürgerschaft und der damit verbundenen Rechte beraubt worden war – weil er nun staatenlos war. Es existierten drei solche Pässe unter Leons Papieren: ein zweiter wurde im Dezember 1938 für meine Mutter ausgestellt, als sie sechs Monate alt war, und ein dritter drei Jahre später, im Herbst 1941, für meine Großmutter Rita in Wien.
Ich legte weitere Dinge zu dem Stapel.
Einen kleinen Zettel aus dünnem gelben Papier, einmal gefaltet. Die eine Seite war leer; die andere enthielt einen Namen und eine Adresse, in einer eckigen Schrift energisch mit dem Bleistift niedergeschrieben. »Miss E.M. Tilney, Norwich, Angleterre.«
Drei kleine Fotos, die alle den gleichen Mann in förmlicher Pose zeigten. Er hatte schwarzes Haar, kräftige Augenbrauen und eine leicht verschmitzte Miene, trug einen Nadelstreifenanzug und hatte eine Vorliebe für Fliegen und Einstecktücher. Auf der Rückseite hatte offenbar immer dieselbe Hand ein jeweils anderes Datum notiert: 1949, 1951, 1954. Ein Name stand nicht dabei.
Meine Mutter sagte mir, dass sie nicht wisse, wer Miss Tilney sei, und auch die Identität des Mannes mit der Fliege nicht kenne.
Ich fügte zu dem Stapel noch ein viertes Foto, ein größeres, ebenfalls in Schwarzweiß. Es zeigt eine Gruppe Männer, einige davon in Uniform, die zwischen Bäumen und großen weißen Blumen einherschreiten. Einige blicken in die Kamera; andere wirken verstohlener, und einen erkannte ich sofort, den großen Mann direkt in der Bildmitte, einen Anführer in einer Militäruniform, die ich mir grün vorstelle, und einem engen schwarzen Gürtel um die Taille. Ich kenne diesen Mann und den, der hinter ihm steht, mit dem undeutlichen Gesicht meines Großvaters Leon. Hinten auf das Foto schrieb Leon »de Gaulle, 1944«.
Ich nahm diese Dokumente mit nach Hause. Miss Tilney und ihre Adresse hingen an der Wand über meinem Schreibtisch, daneben das Foto von 1949, der Mann mit der Fliege. De Gaulle ehrte ich mit einem Rahmen.
3
Im späten Oktober machte ich mich von London aus auf die Reise nach Lwiw. Ich nutzte eine Lücke in meinem Terminplan nach einer Gerichtsverhandlung in Den Haag – ein Fall von Rassendiskriminierung, den Georgien gegen Russland vorgebracht hatte. Georgien, mein Mandant[1], erklärte, dass ethnische Georgier in Abchasien und Südossetien schlecht behandelt würden, was die Verletzung einer entsprechenden internationalen Konvention darstellte. Einen großen Teil der ersten Flugetappe von London nach Wien verbrachte ich damit, die Schriftsätze in einem anderen Fall noch einmal durchzugehen – er war von Kroatien gegen Serbien vorgebracht worden –, in dem mit dem Begriff des Genozid argumentiert wurde. Die Anschuldigungen bezogen sich auf die Morde von Vukovar 1991, die zu einem der größten Massengräber in Europa seit 1945 geführt hatten.
Ich reiste mit meiner Mutter (skeptisch, ängstlich), meiner verwitweten Tante Annie, die mit dem Bruder meiner Mutter verheiratet gewesen war (ruhig), und meinem fünfzehnjährigen Sohn (neugierig). In Wien bestiegen wir ein kleineres Flugzeug für die 650-Kilometer-Reise nach Osten, hinweg über die unsichtbare Linie, die einst den Eisernen Vorhang markiert hatte. Nördlich von Budapest ging das Flugzeug bei wolkenlosem Himmel über dem ukrainischen Kurort Truskawez weiter nach unten, so dass wir die Karpaten und in der Ferne Rumänien sehen konnten. Die Landschaft um Lwiw – das »blutgetränkte Land«, wie es ein Historiker in seinem Buch über die Schrecken der Hitler- und Stalinzeit nannte – war flach, bewaldet und wurde landwirtschaftlich genutzt, die verstreuten Felder waren gesprenkelt mit Dörfern und Gehöften, menschliche Behausungen in Rot, Braun und Weiß. Vielleicht flogen wir gerade direkt über die Kleinstadt Schowkwa, als Lwiw in Sicht kam, der ferne städtische Ballungsraum einer ehemaligen sowjetischen Metropole, und dann das Stadtzentrum, die Türme und Kuppeln, die nacheinander »aus dem gewellten Grün[2] hervorsprangen«, die Türme von Gebäuden, die Wittlin so am Herzen lagen und die ich nun kennenlernen würde: St. Georg, St. Elisabeth, das Rathaus, die Kathedrale St. Bernhard und der Kornjakt-Palast. Ich erblickte, ohne sie zu kennen, die Kuppeln der Dominikanerkirche und des Stadttheaters, den Hügel der Lubliner Union und den kahlen, sandigen Piaskowa-Hügel, den während der deutschen Okkupation »das Blut Tausender von Märtyrern« getränkt hatte. Mit allen diesen Orten würde ich vertraut werden.
Das Flugzeug rollte bis vor ein flaches Gebäude und hielt dort. Es wäre in einem Tim und Struppi-Band nicht fehl am Platz gewesen, ganz so, als befänden wir uns im Jahr 1923, als sich der Flughafen des sinnträchtigen Namens Sknyliw erfreute. Ich entdeckte eine bemerkenswerte Parallele: Der kaiserliche Bahnhof der Stadt wurde 1904 eröffnet, Leons Geburtsjahr; der Sknyliw-Flughafen ging 1923 in Betrieb, im Jahr seiner Abreise; und nun, 2010, im Jahr der Rückkehr seiner Nachkommen, war ein neues Terminal im Entstehen.
Der alte Flughafen hatte sich in den vergangenen neunzig Jahren kaum verändert, mit seiner Marmorhalle, den großen Holztüren und den übereifrigen jungen Beamten, die grün gekleidet waren wie im Zauberer von Oz und ohne Weisungsbefugnis Befehle bellten. Wir Passagiere standen in einer langen Schlange, die sich hinzog bis zu den hölzernen Kabinen, in denen grimmig blickende Grenzbeamte saßen, jeder von ihnen unter einer riesigen, schlechtsitzenden grünen Mütze.
»Grund der Einreise?«, fragte der Beamte.
»Lecture«, antwortete ich.
Er starrte mich verständnislos an. Dann wiederholte er das Wort, nicht einmal, sondern dreimal.
»Lecture? Lecture? Lecture?«
»University, university, university«, erwiderte ich. Das zeitigte ein Grinsen, einen Stempel und eine Einreiseerlaubnis. Wir gingen durch den Zoll, vorbei an rauchenden dunkelhaarigen Männern in glänzenden schwarzen Ledermänteln.
Mit einem Taxi fuhren wir zum alten Stadtzentrum, kamen an verfallenen Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert im Wiener Stil vorbei, an der großen ukrainisch-katholischen St.-Georgs-Kathedrale und am alten galizischen Parlament und gelangten in die Hauptdurchgangsstraße, die auf das Opernhaus und ein eindrucksvolles Denkmal des Dichters Adam Mickiewicz zulief. Unser Hotel befand sich nah am mittelalterlichen Zentrum auf der Teatralna-Straße, die von den Polen Ulica Rutowskiego und von den Deutschen Lange Gasse genannt wurde. Um mir die verschiedenen Namen einzuprägen und eine historische Orientierung zu bekommen, gewöhnte ich mir an, mit drei Karten herumzulaufen: einer modernen ukrainischen (2010), einer alten polnischen (1930) und einer noch älteren österreichischen (1911).
An unserem ersten Abend suchten wir nach Leons Haus. Ich hatte die Adresse von seiner Geburtsurkunde beziehungsweise einer englischen Übersetzung davon, die 1938 von einem Bolesław Czuruk aus Lwów angefertigt worden war. Professor Czuruk hatte, wie viele in der Stadt, ein kompliziertes Leben: Vor dem Zweiten Weltkrieg lehrte er slawische Literatur an der Universität, dann diente er der polnischen Republik als Übersetzer und half während der deutschen Besatzung Hunderten von Juden, an falsche Papiere zu kommen. Zum Lohn dafür[3] steckten ihn die Sowjets nach dem Krieg für eine Zeitlang ins Gefängnis. Laut seiner Übersetzung war Leon in der Szeptyckich-Straße 12 geboren und von der Hebamme Mathilde Agid auf die Welt gebracht worden.
Heute heißt die Szeptyckich-Straße Scheptyz’kyj-Straße. Um dorthin zu gelangen, umrundeten wir den Rynok-Platz, bewunderten Kaufmannshäuser aus dem 15. Jahrhundert, kamen am Rathaus und der Jesuitenkirche vorbei (die während der Sowjetära als Archiv und Buchlager genutzt worden war), dann auf einen namenlosen Platz vor St. Georg, wo der Nazi-Gouverneur Galiziens, Dr. Otto von Wächter[4], Mitglieder der »Galizischen Division« der Waffen SS rekrutiert hatte.
Von hier aus war es nur ein kurzer Weg bis zur Scheptyz’kyj-Straße, die zu Ehren von[5] Andrej Scheptyzkyj benannt ist, dem berühmten Erzbischof von Lemberg und Metropoliten der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, der im November 1942 einen Hirtenbrief mit dem Titel »Du sollst nicht töten« verfasste. Nr. 12 war ein zweistöckiges Gebäude aus dem späten 19. Jahrhundert, mit fünf großen Fenstern im ersten Stock. Auf die Wand des Gebäudes nebenan war ein großer Davidstern gesprayt.
Im städtischen Archiv[6] von Lwiw erhielt ich später eine Kopie der Baupläne und -genehmigungen. Ich erfuhr, dass das Gebäude 1878 errichtet worden war, dass es in sechs Wohnungen unterteilt war, dass es vier Gemeinschaftstoiletten gab und dass sich eine Gaststätte im Erdgeschoss befand (vielleicht die von Leons Vater Pinkas Buchholz geführte, obwohl ein städtisches Adressbuch von 1913 ihn als Eigentümer eines Restaurants ein paar Häuser weiter, in Nr. 18, aufführte).
Wir gingen in das Haus. Im ersten Stock öffnete ein älterer Mann auf unser Klopfen die Tür – Jewgen Tymchyschn, der 1943, während der deutschen Herrschaft, hier geboren worden war, wie er uns erzählte. Die Juden seien fort gewesen, fügte er hinzu, die Wohnung habe leergestanden.
Scheptyz’kyj-Straße, Lwiw, April 2015
Er bat uns herein, und seine freundliche, doch schüchterne Frau führte uns stolz durch das eine geräumige Zimmer, das das Zuhause des Paares war. Wir tranken schwarzen Tee, bewunderten die Bilder an den Wänden und sprachen über die Herausforderungen der modernen Ukraine. Hinter der winzigen Küche befand sich auf der Rückseite des Hauses ein kleiner Balkon, wo Jewgen und ich standen. Er trug eine alte Militärmütze. Jewgen und ich lächelten, die Sonne schien, und die St.-Georgs-Kathedrale ragte hoch über uns auf, nicht anders als im Mai 1904.
4
Leon wurde in diesem Haus geboren. Die Wurzeln der Familie führten ins nahe Schowkwa, das 1870, als seine Mutter Malke dort zur Welt kam, Zółkiew hieß. Unser Reiseführer Alex Dunai fuhr uns durch eine neblige, friedliche ländliche Gegend mit niedrigen braunen Hügeln und verstreuten Wäldern, Städten und Dörfern, die vor langer Zeit für ihren Käse, ihre Wurst oder ihr Brot berühmt waren. Leon musste vor einem Jahrhundert dieselbe Straße genommen haben, wenn er seine Verwandten besuchte, wobei er Pferd und Wagen benutzte oder vielleicht den Zug vom neuen Bahnhof aus. Ich machte einen alten Eisenbahnfahrplan von Cook ausfindig, der die Strecke von Lemberg nach Zółkiew enthielt. Sie endete in einem Ort namens Bełzec, in dem später das erste dauerhafte Vernichtungslager errichtet wurde, in dem man Gas für massenhafte Tötungen einsetzte.
Aus der Zeit von Leons Kindheit habe ich nur ein einziges Familienfoto gefunden, ein Studioporträt vor einem gemalten Hintergrund. Leon musste damals ungefähr neun Jahre alt gewesen sein und war vor seinem Bruder und seinen beiden Schwestern platziert, zwischen seinen Eltern.
Familie Buchholz, Lemberg, ca. 1913 (von links: Pinkas, Gusta, Emil, Laura und Malke, vorne Leon)
Alle blicken ernst, besonders Pinkas, der Gastwirt, mit seinem schwarzen Bart und der Kleidung eines frommen Juden, der fragend in die Kamera starrt. Malke wirkt angespannt und förmlich, eine vollbusige und gutfrisierte Dame in einem spitzenbesetzten Kleid und mit schwerer Kette. Ein offenes Buch liegt in ihrem Schoß, eine Anspielung auf die Welt der Ideen. Emil war das älteste Kind, 1893 geboren, mit militärischem Kragen und Uniform, kurz davor, in den Krieg und in seinen Tod zu ziehen, was er damals noch nicht wusste. Neben ihm steht die vier Jahre jüngere Gusta, elegant und etwas größer als ihr Bruder. Vor ihm hält sich Laura, seine jüngere, 1899 geborene Schwester, an einer Stuhllehne fest. Mein Großvater sitzt ganz vorn, ein kleiner Junge im Matrosenanzug, mit weitgeöffneten Augen und abstehenden Ohren. Nur er lächelte, als die Kamera klickte, als habe er nicht gewusst, wie die anderen sich verhielten.
In einem Warschauer Archiv entdeckte ich die Geburtsurkunden der vier Kinder. Alle wurden in demselben Lemberger Haus geboren, jedes von ihnen mit Hilfe der Hebamme Mathilde Agid. Pinkas hatte Emils Geburtsurkunde unterschrieben, die besagte, dass der Vater 1862 in Cieszanów geboren worden war, einer Kleinstadt nordwestlich von Lemberg. Das Warschauer Archiv[1] förderte außerdem eine Heiratsurkunde von Pinkas und Malke zutage. Die zivile Eheschließung hatte im Jahre 1900 in Lemberg stattgefunden, nur Leon war ehelich geboren.
Das Archivmaterial wies auf Zółkiew als Familienmittelpunkt hin. Malke und ihre Eltern wurden dort geboren, sie als erstes von fünf Kindern und einziges Mädchen. So erfuhr ich von Leons vier Onkeln – Josel (1872 geboren), Leibus (1875), Nathan (1877) und Ahron (1879) –, alle verheiratet und mit Kindern, was bedeutete, dass Leon eine große Verwandtschaft in Zółkiew gehabt hatte. Malkes Onkel Meijer hatte auch viele Kinder, was Leon eine Menge Cousinen und Cousins zweiten und dritten Grades verschaffte. Vorsichtig geschätzt zählte Leons Familie in Zółkiew, die Flaschners, mehr als siebzig Mitglieder – ein Prozent der dortigen Bevölkerung. Leon erwähnte in all den Jahren, die ich ihn kannte, mir gegenüber keinen dieser Menschen. Er erweckte immer den Eindruck eines Mannes, der allein dastand.
Unter den Habsburgern blühte Zółkiew. Noch zu Malkes Zeiten war es ein bedeutendes Zentrum des Handels, der Kultur und der Gelehrsamkeit. Gegründet fünf Jahrhunderte früher[2] durch Stanisław Żółkiewski, einen berühmten polnischen Heerführer, wurde es von einem Schloss aus dem 16. Jahrhundert mit einem schönen italienischen Garten dominiert, die beide noch in heruntergekommenem Zustand existierten. Die zahlreichen Gotteshäuser der Stadt spiegelten deren vielfältige Einwohnerschaft wieder: das Dominikanerkloster, mehrere römisch-katholische sowie eine griechisch-katholische Kirche und direkt im Zentrum eine Synagoge aus dem 17. Jahrhundert, die letzte Erinnerung daran, dass Zółkiew einstmals der einzige Ort in Polen war, an dem jüdische Bücher gedruckt wurden. 1674 wurde das große Schloss zur Residenz des polnischen Königs Jan III. Sobieski, der die Türken 1683 in der Schlacht von Wien schlug und damit die unmittelbare Bedrohung des Heiligen Römischen Reichs durch die Osmanen beendete.
Als Leon die Familie seiner Mutter besuchte, hatte Zółkiew ungefähr 6000 Einwohner, eine Mischung von Polen, Juden und Ukrainern. Alex Dunai gab mir die Kopie eines hervorragenden von Hand gezeichneten Stadtplans aus dem Jahr 1854. Die Palette von Grün-, Creme- und Rottönen sowie das Schwarz der Namen und Zahlen erinnerten an ein Gemälde von Egon Schiele: Die Frau des Künstlers. Die Exaktheit im Detail war beeindruckend: Jeder Garten und Baum waren bezeichnet, jedes Gebäude nummeriert, angefangen mit dem königlichen Schloss im Zentrum (Nr. 1) bis zu den weniger wichtigen Gebäuden in den Außenbezirken (Nr. 810).
Zółkiew, Lembergerstraße, 1890
Joseph Roth beschrieb den Grundriss[3] einer solchen Stadt. Typischerweise lag sie »mitten im Flachland, von keinem Berg, von keinem Wald, keinem Fluss begrenzt«, und fing einfach mit »kleinen Hütten« an, dann kamen ein paar Häuser, die sich gewöhnlich um zwei Hauptstraßen gruppierten, die eine lief »von Süden nach Norden, die andere von Osten nach Westen«. Wo sich die beiden Straßen kreuzten, lag der Marktplatz, während sich der Bahnhof stets »am äußersten Ende der Nord-Süd-Straße« befand. Das beschreibt Zółkiew perfekt. Aus einem Katasterplan von 1879 erfuhr ich, dass Malkes Familie das Haus Nr. 40 in der Parzelle 762 von Zółkiew bewohnte, ein Holzbau, in dem sie höchstwahrscheinlich auch geboren wurde. Es stand an der westlichen Stadtgrenze[4] in der Ost-West-Straße.
Zu Leons Zeit war dies die Lembergerstraße. Wir kamen von Osten her in die Stadt und fuhren an einer großen Holzkirche vorüber, die auf der 1854 mit großer Sorgfalt hergestellten Karte als die »Heilige Dreyfaltigkeit« bezeichnet wurde. Nach dem Dominikanerkloster zu unserer Rechten erreichten wir den Ringplatz, den Hauptplatz. Das Schloss war nun zu sehen, nah an der St.-Laurentius-Kathedrale, der Grabstätte von Stanisław Żółkiewski und einigen weniger bedeutenden Sobieskis. Ein Stück weiter lag das Basiliuskloster, das einen Platz krönte, der einmal prächtig gewesen sein musste. An einem kalten Herbstmorgen wirkten der Platz und die Stadt schwermütig und grau: Ein kultureller Mikrokosmos war zu einem Ort voller Schlaglöcher und umherlaufender Hühner geworden.
5
Im Januar 1913 verließ Leons ältere Schwester Gusta Lemberg, um in Wien Max Gruber, einen Branntweinverschleißer (Spirituosenhändler), zu heiraten. Pinkas war bei der Zeremonie zugegen und unterschrieb die Heiratsurkunde. Die Zeiten waren unruhig: Auf dem Balkan hatte Serbien sich mit Bulgarien und Montenegro verbündet und führte, unterstützt von Russland, Krieg gegen das Osmanische Reich. Im Mai 1913[1] wurde in London ein Friedensvertrag unterschrieben, der neue Grenzen vorsah. Doch nur einen Monat später[2] wandte sich Bulgarien gegen Serbien und Griechenland, seine früheren Verbündeten, und löste den zweiten Balkankrieg aus, der bis August 1913 dauerte. Das war ein Vorbote der noch viel schwerwiegenderen Umwälzungen, die bald über die Region hereinbrechen sollten. Denn Bulgarien unterlag den Serben, die neue Territorien in Mazedonien erwarben, was wiederum von der übermächtigen Österreichisch-Ungarischen Monarchie als Bedrohung angesehen wurde.
In Wien entwarf man den Plan eines Präventivkrieges gegen Serbien, um Russland und die Slawen im Zaum zu halten. Am 28. Juni 1914 ermordete Gavrilo Princip den Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajewo. Innerhalb eines Monats hatte Wien Serbien angegriffen und einen Flächenbrand ausgelöst: Die Deutschen marschierten in Belgien, Frankreich und Luxemburg ein, während Russland an der Seite Serbiens in den Krieg eingetreten war, gegen Wien und die österreichisch-ungarische Armee. Ende Juli überschritten russische Truppen die galizische Grenze. Im September 1914[3] berichtete die New York Times, dass Lemberg und Zółkiew nach einer »gigantischen Schlacht« mit über anderthalb Millionen Teilnehmern von den Russen besetzt worden waren. Die Zeitung schrieb von der »tausendfachen, kosmischen Zerstörung und Vernichtung von Menschenleben, dem abscheulichsten Inferno, das die Menschheit je erlebt hat«. Eins der Opfer war Leons Bruder Emil, der noch vor seinem einundzwanzigsten Geburtstag in der Schlacht fiel. »Was galt da ein einzelner Mord[4] noch viel«, fragte Stefan Zweig, »innerhalb der tausendfältigen und kosmischen« Schuld, »dieser fulminantesten Massenzerstörung und Massenvernichtung menschlichen Lebens, die bisher die Geschichte gekannt?«
Pinkas Buchholz versank in Verzweiflung und starb nur wenige Wochen später an gebrochenem Herzen, überwältigt von Schuld, weil er seinen Sohn Emil ein Jahr zuvor daran gehindert hatte, nach Amerika auszuwandern. Trotz meiner Bemühungen fand ich keine weiteren Informationen über den Tod von Pinkas und Emil, auch keine Gräber, nur die Bestätigung in einem Wiener Archiv, dass Pinkas am 16. Dezember 1914 in Lemberg gestorben war. Ich konnte nicht herausfinden, wo Emil gefallen war. Das Kriegsarchiv in Wien[5] erklärte knapp, dass »keine persönlichen Unterlagen verfügbar« seien. Das war eine Laune der Geschichte: Als die Österreichisch-Ungarische Monarchie zerfiel, bestimmte der Vertrag von Saint-Germain 1919[6], dass alle galizischen Akten in den verschiedenen Nachfolgestaaten verbleiben sollten. Die meisten gingen verloren.
Innerhalb von drei Monaten hatte Leon Vater und Bruder verloren. Mit zehn Jahren war er das einzige verbliebene männliche Mitglied der Familie. Er ging mit seiner Mutter und der Schwester Laura nach Wien, als der Krieg die Familie nach Westen trieb.
6
In Wien zogen sie zu Gusta und ihrem Mann Max Gruber. Im September 1914 kam Leon in die örtliche Volksschule in der Gerhardusgasse in Wiens 20. Bezirk. Seine Zeugnisse vermerkten seine mosaische (jüdische) Herkunft und bescheidene schulische Leistungen. In diesem Monat bekamen Gusta und Max ihr erstes Kind, Leons Nichte Therese, genannt Daisy. Leon wohnte bei den Grubers in der Klosterneuburger Straße, nahe der Schule, in einer Wohnung im ersten Stock eines großen Gebäudes, das Max und Gusta später mit Hilfe einer Hypothek erwarben.
Leons Familie war eine von zehntausenden, die in einer großen Wanderungsbewegung von »Ostjuden« aus Galizien nach Wien übersiedelten. Es war der Krieg, der viele jüdische Flüchtlinge dazu trieb, in Wien eine neue Heimat zu suchen. Joseph Roth schrieb[1] über den Nordbahnhof, wo »sie alle angekommen sind«, über seine hohen Hallen, erfüllt vom »Aroma der Heimat«. Die neuen Einwohner von Wien zogen in die jüdischen Bezirke Leopoldstadt und Brigittenau.
1916 kam Leon mit zwölf Jahren in die nahe gelegene Franz-Joseph-Realschule. Sein ganzes Leben lang bewahrte er die am 19. Dezember ausgestellte Schülerausweiskarte auf. Mit verblasster Tinte waren die Worte »Franz Joseph« durchgestrichen, um den Tod des Kaisers vor ein paar Wochen anzudeuten. Das Foto zeigt einen dünnen Jungen in einem dunklen, zugeknöpften Kittel. Mit seinen abstehenden Ohren und verschränkten Armen macht er einen herausfordernden Eindruck.
Die Realschule, deren Schwerpunkte Mathematik und Physik waren, befand sich in der Karajangasse 14, nicht weit vom Haus der Familie. Heute befindet sich hier das Brigittenauer Gymnasium, und als ich es mit meiner Tochter besuchte, bemerkte sie die kleine Plakette an der Wand beim Eingang. Darauf stand, dass das Souterrain 1938 als Gestapo-Gefängnis genutzt wurde und dort Bruno Kreisky inhaftiert gewesen war[2], der 1970 österreichischer Bundeskanzler wurde. Die jetzige Schuldirektorin Margaret Witek fand die Klassenbücher von 1917 und 1919. Diese zeigten, dass Leon in den naturwissenschaftlichen Fächern besser als in den künstlerischen gewesen war, dass er Deutsch »befriedigend« beherrschte und dass sein Französisch »gut« war.
Malke kehrte nach dem Ersten Weltkrieg zurück nach Lwów und wohnte in der Szeptyckich-Straße in einem Haus, in dem Pinkas einst ein Restaurant betrieben hatte. Leon ließ sie in Wien in der Obhut von Gusta, die bald zwei weitere Mädchen zur Welt brachte, 1920 Herta und 1923 Edith. Leon lebte etliche Jahre bei ihnen, doch er sprach nie von seinen beiden kleinen Nichten, wenigstens nicht mir gegenüber. Inzwischen heiratete Laura, die andere Schwester, Bernard Rosenblum, einen Schausteller. Daraufhin kehrte Malke von Lwów nach Wien zurück.
Max Gruber vor seiner Spirituosenhandlung in der Klosterneuburger Straße in Wien, ca. 1937
Meine Wissenslücken über Leons Familie, ihr Leben in Lemberg, Zółkiew und Wien wurden allmählich kleiner. Aus Familienurkunden und staatlichen Archiven kannte ich nun Namen, Geburtsdaten, Orte und sogar Berufe. Als diese Einzelheiten nach und nach auftauchten, erfuhr ich, dass die Familie größer war, als ich gewusst hatte.





























