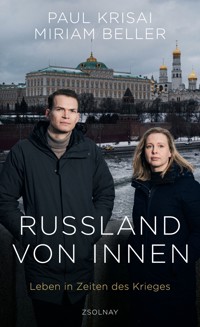
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die ORF-Korrespondent:innen Paul Krisai und Miriam Beller über das Leben in Russland während des Angriffskrieges
Seit dem Morgen des 24. Februar 2022 ist nichts mehr wie zuvor: An diesem Tag erklärt Wladimir Putin der Ukraine den Krieg und verbietet kurz darauf per Gesetz jegliche Kritik an der "militärischen Spezialoperation". Paul Krisai und Miriam Beller setzen trotz der Zensurmaßnahmen ihre Berichterstattung aus Moskau fort. Sie interviewen inhaftierte Oppositionspolitiker per Gefängnispost, sprechen mit gestrandeten ukrainischen Flüchtlingen, reisen Tausende Kilometer durch Russland, Georgien, Belarus und Kasachstan, um zu verstehen, wie grundlegend der Krieg das Land und seine Nachbarschaft verändert. Wie wirken sich die Sanktionen des Westens aus? Was machen Unterdrückung und Überwachung mit einer Gesellschaft? Und wie berichtet man unter Zensur? Krisai und Beller erzählen vom Leben in einem Aggressorstaat, der zur Bedrohung Europas geworden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Die ORF-Korrespondent:innen Paul Krisai und Miriam Beller über das Leben in Russland während des AngriffskriegesSeit dem Morgen des 24. Februar 2022 ist nichts mehr wie zuvor: An diesem Tag erklärt Wladimir Putin der Ukraine den Krieg und verbietet kurz darauf per Gesetz jegliche Kritik an der »militärischen Spezialoperation«. Paul Krisai und Miriam Beller setzen trotz der Zensurmaßnahmen ihre Berichterstattung aus Moskau fort. Sie interviewen inhaftierte Oppositionspolitiker per Gefängnispost, sprechen mit gestrandeten ukrainischen Flüchtlingen, reisen Tausende Kilometer durch Russland, Georgien, Belarus und Kasachstan, um zu verstehen, wie grundlegend der Krieg das Land und seine Nachbarschaft verändert. Wie wirken sich die Sanktionen des Westens aus? Was machen Unterdrückung und Überwachung mit einer Gesellschaft? Und wie berichtet man unter Zensur? Krisai und Beller erzählen vom Leben in einem Aggressorstaat, der zur Bedrohung Europas geworden ist.
Paul Krisai/Miriam Beller
Russland von innen
Leben in Zeiten des Krieges
Paul Zsolnay Verlag
Vorwort
Es gibt Tage, die die Welt verändern. Tage, an denen so Unfassbares geschieht, dass wir uns für immer erinnern werden, wo wir waren, was wir machten und wie wir uns fühlten, als uns die Nachricht ereilte. Der 24. Februar 2022 ist so ein Tag.
Während in den Morgenstunden jenes Februartages Wladimir Putins martialische Fernsehansprache über die Bildschirme flimmerte, wurden Städte in der gesamten Ukraine bereits von Explosionen erschüttert. Russlands großflächige Invasion des Nachbarlandes sandte Schockwellen durch Europa: Monatelang hatte die Welt gerätselt, was Putin will. Rund 150.000 Soldaten hatte er laut Schätzungen westlicher Geheimdienste seit Herbst 2021 an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Dass dieser riesige Truppenaufmarsch mehr sein könnte als militärisches Säbelrasseln, konnten und wollten sich die wenigsten vorstellen — auch wir nicht.
Seit wir für den ORF aus Russland berichten — seit 2019 bzw. 2021 —, befindet sich dieses Land in einer stetigen Abwärtsspirale: politische Repression nach innen, militärische Aggression nach außen. Der Überfall auf das Nachbarland Georgien im Jahr 2008 und die militärische Intervention in Syrien ab 2015 sind nur zwei Beispiele für Russlands Selbstverständnis als Weltmacht, die sich im Recht sieht, ihren Einfluss mit Waffengewalt auszuweiten. Und auch innerhalb der eigenen Staatsgrenzen schreckte Putin von Anfang an nicht vor militärischer Gewalt zurück, begann doch seine Präsidentschaft im Jahr 2000 mit dem zweiten Krieg gegen die abtrünnige russische Teilrepublik Tschetschenien.
Im Februar 2014 rücken erstmals russische Truppen auf ukrainischen Boden vor und besetzen die Halbinsel Krim. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim tritt Russland in der Ostukraine einen bewaffneten Konflikt los: Moskau unterstützt die Separatisten im Kampf gegen die ukrainische Armee mit Waffen und eigenen Truppen. In den darauffolgenden acht Jahren kommen durch die Kämpfe (bis Dezember 2021) laut UN-Hochkommissariat für Menschenrechte mindestens 14.200 Menschen ums Leben. Darüber, und über die Ursprünge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, wurde bereits vielfach geschrieben. Dieses Buch beginnt am 24. Februar 2022, im Moment des großflächigen russischen Angriffs gegen die Ukraine, den Wladimir Putin nach wie vor als »Spezialoperation« verharmlost. Es will nicht die große politische Analyse Russlands in der Welt sein und auch keine weitere Putin-Biografie — auch davon gibt es bereits reichlich. Dieses Buch ist, wie der Titel schon sagt, ein Blick ins Innere eines Landes in Zeiten des Krieges: Wie entwickelt sich eine Gesellschaft in einem immer repressiveren System? Wie wird der Krieg sichtbar in einem Staat, in dem er nicht einmal so heißen darf? Und wie berichtet man unter Zensurbedingungen?
Niemals hätten wir uns gedacht, eines Tages Kriegsberichterstatter zu sein. Wir sind es im eigentlichen Sinne auch nicht. Wir waren nicht in den Schützengräben im Donbas unterwegs — das tun unsere mutigen Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, oft unter Einsatz ihres Lebens. Wir haben dafür ganz Russland und etliche seiner Nachbarländer bereist — von Rostow am Don über Sankt Petersburg bis Ulan-Ude, von Belarus über Georgien bis Kasachstan. All das, um zu verstehen, wie sich der Krieg auf eine einst von Moskau dominierte Weltregion auswirkt. Wir sind nie unter Beschuss geraten, wir mussten nie vor russischen Bomben in Luftschutzkeller flüchten. Die Gefahren sind in unserem Fall unsichtbar — Überwachung, Zensur und Justizwillkür.
In diesem Buch stellen wir Menschen vor, die wir im Rahmen unserer Berichterstattung für den ORF kennengelernt und die uns besonders beeindruckt haben, wie der inhaftierte Oppositionelle, mit dem wir nur noch per Gefängnispost kommunizieren konnten, oder die traumatisierten ukrainischen Geflüchteten in Sankt Petersburg, die im Aggressorstaat gestrandet sind. Es sind Schicksale von Unterdrückten, Verfolgten und Vertriebenen, die exemplarisch sind für das Russland unter Wladimir Putin. Diese Menschen sind die moralische Stimmgabel in einem Land, das zunehmend an den Rand des Totalitarismus gerät. Wir haben es uns zur journalistischen Aufgabe gemacht, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen. Wir widmen uns auch der Frage, was die passiven und aktiven Unterstützerinnen und Unterstützer von Wladimir Putin antreibt und wie der mächtige Apparat der Staatspropaganda funktioniert. In manchen Fällen verwenden wir zum Schutz unserer Gesprächspartner bewusst nur den Vornamen, manchmal haben wir sie vollständig anonymisiert.
Den Sprachkundigen wird auffallen, dass wir für ukrainische Ortsnamen jeweils die ukrainische Schreibweise verwenden (zum Beispiel Kyjiw, Donbas), es sei denn, es handelt sich um wörtliche Zitate russischer Regimevertreter, diese bleiben in der russischen Transkription (Kiew, Donbass).
Seit dem 24. Februar 2022 leben und arbeiten wir in Russland in einer permanenten Ausnahmesituation. Die Normalität, die vielerorts an der Oberfläche herrscht, ist äußerst fragil. Jeden Moment kann sich buchstäblich alles verändern. Das hat sich am 24. Juni 2023 gezeigt. Nachdem die Söldnertruppe Wagner ihren bewaffneten Aufstand gegen die russische Militärführung erst kurz vor Moskau abbricht, ist klar: Die Ruhe ist trügerisch. Im Hintergrund rumort es gewaltig. Ein Buch wie dieses kann und will daher nur eine Momentaufnahme sein. Es ist unser Einblick in jene Blackbox, zu der Russland inzwischen geworden ist. Es ist auch ein Blick hinter die Kulissen unserer journalistischen Arbeit für den ORF, gleichzeitig geht es weit über das hinaus, was im schnelllebigen Nachrichtenalltag normalerweise Platz hat. Hier erzählen wir die Geschichten, die uns bewegt haben.
Das ist »Russland von innen«.
Paul Krisai und Miriam Beller
Moskau, Juli 2023
Der Krieg beginnt, und nichts ist wie zuvor
Paul Krisai
Der Krieg beginnt an einem Donnerstag. Kurz nach sechs Uhr morgens Moskauer Zeit reißt mich das Klingeln meines Telefons aus dem Schlaf. Am Display leuchtet die Nummer der Redaktion in Wien. Ein Anruf der Kollegen um diese Uhrzeit ist meistens ein schlechtes Zeichen. »Es hat angefangen«, sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung, und der Kollege zählt hastig auf: Putin ist mit einer Kriegserklärung aufgetreten, es gibt Explosionen in Mariupol, Charkiw, Kyjiw und anderen Städten in der gesamten Ukraine, die Lage ist unübersichtlich.
Was der Kollege erzählt, klingt nach dem, was seit Wochen viele befürchtet und die wenigsten geglaubt haben: Russland hat offenbar einen großflächigen Angriff auf die Ukraine begonnen. Das Ausmaß ist mir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht klar. Mit der Redaktion vereinbare ich den Ablauf der nächsten paar Stunden: Schaltung in der ersten Radionachrichtensendung um sechs Uhr Wiener Zeit, dann im Radio-Morgenjournal um sieben Uhr und direkt danach in der Frühausgabe der Zeit im Bild-Fernsehnachrichten. Während ich mich auf den Weg ins Büro mache, vibriert mein Handy im Stakkato der Eilmeldungen: Russische Fallschirmspringer in Odessa gelandet, Ukraine hat Kriegszustand ausgerufen und Generalmobilmachung angeordnet, Berichte über erste Todesopfer. Was ich da ungläubig lese, sieht nicht nach einem Einmarsch russischer Truppen in den Donbas aus, mit dem seit Tagen zu rechnen war, sondern nach einem vollständigen Angriff auf das gesamte Nachbarland.
Zum Nachdenken bleibt keine Zeit. Ich rufe meine Kollegin Miriam an. Sie ist in diesem Moment zufällig viel näher am Kampfgeschehen als ich — erst am Vorabend ist sie mit ihrem Kameramann in Rostow am Don in Südwestrussland gelandet, nur hundert Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Dort wollte sie einen Beitrag über die mutmaßliche Zwangsevakuierung der ukrainischen Bevölkerung filmen. Die russischen Behörden haben den ORF und andere internationale Medien zu einem Pressetermin in ein Flüchtlingszentrum eingeladen — ausgerechnet für den Nachmittag des 24. Februar. Zu diesem Dreh wird es nicht mehr kommen.
»Miriam, der Krieg hat angefangen«, sage ich atemlos in den Hörer. An ihrer Stimme erkenne ich, dass sie seit ihrem Nachtflug nur wenig geschlafen hat. Ohne viel zu erklären, bitte ich sie, sich mit ihrem Kameramann eine sichere Position für Liveschaltungen zu suchen, vorzugsweise in einem geschützten Innenraum. »Oh mein Gott«, schreibt Miriam wenige Minuten später per WhatsApp, nachdem sie die ersten Nachrichtenmeldungen gelesen hat, »das ist ja die ganze Ukraine! Haben uns ein Livestudio im Hotelzimmer eingerichtet.«
Mein Adrenalinspiegel steigt, als ich den Lift in unserem grauen Bürogebäude zwei Kilometer südlich des Moskauer Kremls betrete. Vom Spiegel an der Wand starrt mir ein kreidebleiches Gesicht entgegen. Ich zücke mein Handy und nehme ein kurzes Video auf, um den Moment für später zu dokumentieren: »Guten Morgen«, sage ich mit kratziger Stimme, »es ist sieben Uhr am 24. Februar 2023 —« Ähm, 2023? Kurzes Kopfschütteln. Warum ich mich ausgerechnet im Jahr irre, wundert mich in diesem Moment selbst. Es ist wohl Ausdruck des allgemeinen Chaos an diesem Donnerstagmorgen. Oder gar ein Vorbote für die Zeitenwende, die bevorsteht? Ich setze neu an: »Es ist der 24. Februar 2022. Putin hat in der Nacht angekündigt, eine Militäroperation gegen die Ukraine zu starten.« Pause. Tiefes Durchatmen. »Es gibt Krieg. Wir werden jetzt stündlich in Liveschaltungen versuchen, die unübersichtlichen Ereignisse irgendwie einzuordnen.« Mein Gesichtsausdruck im Video wirkt, als hätte man mich gerade aufgeweckt, auf ein Zehn-Meter-Brett gestellt und mir befohlen, mit verbundenen Augen ins Wasser zu springen. In weniger als einer Stunde muss ich live meinen ersten Lagebericht abgeben.
Ich schalte hastig Computer, Radio und Fernseher ein und sehe Putins frühmorgendliche TV-Ansprache, die im staatlichen Nachrichtensender Rossija 24 in Endlosschleife wiederholt wird: Zwischen zwei Russlandfahnen sitzt mit eisiger Miene der Präsident an einem Schreibtisch, die linke Hand eigenartig an die Tischplatte geklemmt, die rechte hebt er beim Gestikulieren ab und zu leicht an. Putin spricht unruhig, mit künstlichen Pausen, immer wieder verdunkelt sich sein Blick. »Ich habe die Entscheidung getroffen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen. Ziel ist es, die Menschen zu schützen, die acht Jahre lang unter den Misshandlungen und dem Völkermord durch das Kiewer Regime gelitten haben.« Diese von Putin oft wiederholten Anschuldigungen eines angeblichen Völkermords seitens der ukrainischen Truppen im Donbas werden von unabhängigen Quellen nicht gestützt. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte sieht in seinem Bericht vom September 2021 keine Anzeichen für einen Genozid.1 Zum selben Befund kommt die OSZE-Beobachtermission, die seit 2014 — wohlgemerkt mit russischer Zustimmung — die Lage beiderseits der Frontlinie in der Ostukraine beobachtet. Putin schließt die Kriegserklärung mit einer Drohung an alle Staaten, die die Ukraine unterstützen: Wer versuche, Russland zu stoppen, müsse mit einer sofortigen Reaktion rechnen und mit Konsequenzen, wie es sie »noch nie zuvor in der Geschichte« gab. Die Botschaft ist klar: eine unverhohlene Drohung mit dem russischen Atomwaffenarsenal an alle, die sich in den Krieg militärisch einmischen. Es wird nicht die letzte Drohung dieser Art sein.
Die nächsten Stunden fühlen sich an wie ein Wirbelsturm, der uns einsaugt, hin und her beutelt, auf den Kopf stellt, mit Nachrichten und Meldungen bewirft und am Abend wieder ausspuckt. Schaltgespräch folgt auf Schaltgespräch, ich verlasse zum Teil das Livestudio zwischen den Einstiegen gar nicht und arbeite, verkabelt und eingeleuchtet, auf der Liveposition weiter. Es geht darum, zu funktionieren. Das Adrenalin dürfte eine wichtige Rolle dabei spielen, dass die Konzentrationsfähigkeit auch nach fünfzehn Stunden unverändert hoch bleibt. Wenn ich in diesen Stunden eines spüre, dann ist es eine klare Mission: zu erzählen, was wir wissen und was wir nicht wissen. Auch im ORF-Zentrum in Wien herrscht an diesem Tag Ausnahmezustand, mit stundenlangen Sondersendungen zum Krieg, die zu einem großen Teil von den Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Ukraine, in Russland und dem Rest der Welt gefüllt werden.
Während ich von Moskau aus die Meldungslage sortiere, schaltet sich Miriam regelmäßig aus dem rund tausend Kilometer entfernten Rostow am Don zu und schildert ihre Beobachtungen: Kampfjets donnern über ihren Kopf hinweg, als sie mit ihrem Kameramann einen Stadtrundgang macht. Entlang des Grenzstreifens zur Ukraine, zweieinhalb Stunden von Rostow entfernt, gibt es bereits Meldungen über Einschläge auf russischem Boden. Die russischen Behörden sperren den Luftraum in allen an die Ukraine angrenzenden Regionen — auch der Regionalflughafen von Rostow am Don ist vorübergehend geschlossen. Am Vortag mit der Abendmaschine gelandet, werden Miriam und ihr Kameramann die Rückreise später per Auto antreten müssen. Denn auch alle Zugverbindungen sind ausgebucht. Offenbar versuchen viele Menschen, die Grenzregion zu verlassen.
Ein dramatischer Tag geht zu Ende
Am Abend des ersten Kriegstages gehen in Moskau und mehr als fünfzig anderen Städten Russlands tausende Menschen gegen den Krieg auf die Straße. »Njet wojne« — Nein zum Krieg — wird zum spontanen Protestslogan, der sich auch in den sozialen Medien rasend schnell verbreitet. Mein Instagram-Feed ist voll mit Ukraine-Flaggen und Anti-Kriegs-Botschaften, die meine russischen Freunde und Bekannten in den ersten Stunden posten. Dieser Protest — on- und offline — ist in diesem Moment ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass sich in der russischen Bevölkerung Widerstand gegen Putins Aggression regen könnte. Doch die Antwort der Staatsmacht lässt nicht lange auf sich warten. Überall, wo sich friedliche Proteste formieren, schreitet die Polizei sofort mit aller Härte ein. Es gibt bereits am ersten Tag rund 1500 Festnahmen, davon etwa tausend allein in der Hauptstadt. Auch wenn die Proteste für einige Wochen anhalten werden, erreichen sie von Anfang an keine Größe, die für die Sicherheitskräfte zum Problem werden könnte.
Auch die Medien werden gemaßregelt: Die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor gibt noch am ersten Kriegstag die Anweisung aus, dass russische Medien das militärische Geschehen fortan als »Spezialoperation« bezeichnen sollen, anstatt Invasion, Einmarsch oder Krieg zu schreiben. Ansonsten drohe die Blockierung oder gar der Entzug der Medienlizenz. Es ist ein Vorgeschmack auf die drakonischen Zensurgesetze, die nur Tage später auch uns ausländische Journalistinnen und Journalisten treffen werden.
Doch davon ahne ich noch nichts, als ich in der Liveschaltung der Hauptnachrichtensendung des ORF, der Zeit im Bild 1, Wladimir Putin zum Kriegspräsidenten erkläre. Als solcher wird er wohl in die Geschichte eingehen, als ein Mann, der besessen ist von einem Selbstbild als Retter der russischen Nation. Als ein Mann, der eine demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine stürzen will, um die Ukraine zurück in seinen Einflussbereich zu zwingen. Als ein Mann, dem offenbar jedes Mittel recht und kein Preis zu hoch ist, wenn es darum geht, seine geopolitischen Interessen durchzusetzen.
Die ganze Welt muss erfahren, was für ein Wahnsinn sich hier abspielt, ist der Gedanke, der mich durch diese letzte Liveschaltung des Tages trägt. Das Ausmaß der Ereignisse zu begreifen gelingt in diesem Moment nicht einmal ansatzweise. Den ganzen Tag habe ich zwischen Radio- und TV-Studio verbracht, Telefonate geführt, Meldungen gelesen und Texte geschrieben. Als ich am späten Abend nach Hause komme, bin ich zu aufgewühlt, um zu Bett zu gehen. Stundenlang scrolle ich mich durch die Nachrichten-Feeds auf meinem Handy, sehe mir noch einmal die Bilder von Raketeneinschlägen und Panzerkolonnen an. Jedes Video wirkt so surreal wie ein Horrorfilm und gleichzeitig so vertraut, als wäre es nicht in der Ukraine, sondern um die Ecke in Moskau aufgenommen worden: Die sowjetischen, fünfstöckigen Plattenbauten aus der Chruschtschow-Ära sind die gleichen, die auch in jeder russischen Stadt stehen — nur sind sie auf diesen Bildern von Raketensalven durchlöchert. Ein Ukrainer, der auf einem Video mit bloßen Händen einen russischen Panzer aufhält, spricht in derselben Sprache wie die Soldaten in ihren Z-Uniformen — Russisch. »Was habt ihr hier verloren? Ihr seid in der Ukraine, nicht in Russland! Fahrt nach Hause!« Dass Russland ein Nachbarland überfällt, mit dem es historisch, sprachlich und kulturell so eng verbunden ist, ist schlichtweg unbegreiflich. Anders als bei Putins vergangenen militärischen Eskapaden, etwa ab dem Jahr 2015 in Syrien auf der Seite von Diktator Baschar al-Assad, kann der russischen Bevölkerung in diesem Fall nicht weisgemacht werden, es handle sich um einen hochpräzisen Militäreinsatz in einem weit entfernten Land zur Bekämpfung einer islamistischen Terrormiliz. Im Gegenteil: Millionen Russinnen und Russen haben familiäre Verbindungen in die Ukraine — ihre Eltern, Geschwister, Kinder, Verwandten leben dort, oft auch Freunde und Bekannte. Wird sich die Mehrheit der russischen Bevölkerung tatsächlich davon überzeugen lassen, dass in der Ukraine angebliche Neonazis bekämpft werden müssen? Werden sich die Menschen in Russland tatsächlich hinter Putins unklar formuliertem Ziel einer »Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine« vereinen?
Vor dem 24. Februar: Die Zeichen stehen auf Sturm
Schon vor Kriegsausbruch rumort es in der russischen Gesellschaft. Kriegsgerüchte machen die Runde, ernten aber zumeist ungläubiges Kopfschütteln. Meinem Eindruck nach ist zu diesem Zeitpunkt den meisten Menschen rational nicht erklärlich, wozu ein großflächiger Krieg gegen die Ukraine dienen sollte. Zu diesem Schluss komme ich nach zahlreichen Interviews mit Russlandkennern, Politologinnen, Militärexperten, Ökonominnen, aber auch im Gespräch mit Menschen in verschiedenen Regionen in den Wochen vor Kriegsausbruch — etwa in der Stadt Kursk nahe der ukrainischen Grenze. »Wenn hier einmal Raketen oder Bomben fliegen, wäre das eine schlimme Sache«, sagt mir dort ein junger Familienvater ins Mikrofon. Die Anspannung unter den Menschen ist besonders in der Grenzregion spürbar. Denn nur wenige Kilometer außerhalb von Kursk stehen die Militärbasen, in denen Teile des riesigen Truppenkontingents untergebracht sind, das Putin in den vorangegangenen Monaten entlang der ukrainischen Grenze stationiert hat. Passanten in Kursk schildern, dass sie immer wieder Kolonnen von Militärgerät vorbeifahren sehen, am Himmel seien oft Kampfjets zu hören. Doch am meisten bewegt mich in Kursk das sichtbare Gedenken an die Opfer des Großen Vaterländischen Krieges, wie der Zweite Weltkrieg in Russland genannt wird: Beim Vormarsch der deutschen Wehrmacht wurde Kursk fast vollständig zerstört — und die weitläufigen Felder vor der Stadt waren im Jahr 1943 Schauplatz der größten und tödlichsten Panzerschlacht der Geschichte. An fast jeder Ecke steht ein Mahnmal. Beim wichtigsten seiner Art, dem Ewigen Feuer am Stadtrand, treffen wir während unserer Dreharbeiten eine Schülerin und ihre Lehrerin. Die beiden legen eine rote Rose vor der Gedenkflamme nieder. Ausrangierte sowjetische Panzer säumen das verschneite Denkmal. Nachdem wir mit ihr ins Gespräch kommen, rezitiert die Gymnasiastin vor der Kamera aus dem Stegreif ein Kriegsgedicht über einen vermissten Soldaten. Sie hoffe auf Frieden, sagt die Siebzehnjährige zur Verabschiedung. Ihr Vorname Nadeschda bedeutet übersetzt genau das: Hoffnung.
Es mag eine naive Hoffnung auf einen Truppenabzug und eine Entspannung der Lage sein, an die auch ich mich unbewusst klammere, als ich am 11. Februar in Kursk in den Zug zurück nach Moskau steige — selbst wenn die Faktenlage recht klar erscheint: Mehr als die Hälfte der kampfbereiten russischen Truppen sind zu diesem Zeitpunkt schon an der ukrainischen Grenze zusammengezogen, schätzt damals der unabhängige Militärblogger Ruslan Lewijew. Auch wenn Putin noch nicht entschieden hat, einzumarschieren, so kann er das jederzeit tun. Selbst wenn Putin keinen Einmarsch beabsichtigt, so kann es allein durch ein Missverständnis zu einer militärischen Eskalation kommen. Kurzum: Die Lage ist hochexplosiv. Es sind noch dreizehn Tage bis Kriegsausbruch.
Und das ist nicht die einzige Demonstration des Säbelrasselns, die ich miterlebe. Wenige Tage danach, am 19. Februar, donnern mit ohrenbetäubendem Lärm fünf Kampfhubschrauber über meinen Kopf hinweg. Artilleriefeuer ist in der Ferne zu hören. Ein Panzer rollt auf mich zu und gibt mehrere Schüsse ab. Der Geruch von Platzpatronen liegt in der Luft. Ich befinde mich auf dem 230. Truppenübungsplatz der Republik Belarus, auf einer Art Zuschauertribüne, die das gesamte Übungsgelände überblickt. Zwei Autostunden südwestlich der belarussischen Hauptstadt Minsk sind wir zu einer gemeinsamen russisch-belarussischen Militärübung eingeladen. »Alliierte Entschlossenheit« lautet der Titel des Manövers. Es ist eine weitere Machtdemonstration Russlands, die möglichst von der ganzen Welt gesehen werden soll: Außer dem ORF sind rund hundert ausländische Medienvertreter und -vertreterinnen anwesend, geschätzt 30.000 Soldaten aus Russland und Belarus sollen an dem Manöver teilnehmen, auch wenn keine der teilnehmenden Seiten diese Zahl bestätigt.
Das Szenario der Übung, erklärt man uns, sei ein hypothetischer Angriff auf Belarus von Norden, Westen und Süden, also auch aus der Ukraine. Auch wenn die belarussischen Militärs betonen, dass es sich um eine rein defensive Übung handle, ist leicht zu erraten, wer hier der unausgesprochene Feind ist. Mit Lasersimulatoren und Platzpatronen wird eine Stunde lang Feuerwechsel simuliert, Militärgerät hin und her verschoben, Fallschirmjäger werden aus einer Transportmaschine abgeworfen. Vor diesem martialischen Hintergrund stehen indische, arabische und US-amerikanische Fernsehkorrespondenten auf der Tribüne aufgereiht und versuchen, förmlich ins Mikrofon schreiend, den Umgebungslärm zu übertönen. Die Kriegsspiele werden zum Medienspektakel. Mein Kameramann und ich nehmen lediglich einige Bilder von den Übungen auf und schicken sie an die Redaktion in Wien. Die eigentliche Nachricht des Tages ist eine andere: Als wir den Truppenübungsplatz bereits verlassen haben, verkündet das belarussische Verteidigungsministerium, dass die russischen Truppen bis auf Weiteres in Belarus stationiert bleiben. Der Kreml hat zuvor tagelang das Gegenteil beteuert. Noch fünf Tage bis Kriegsausbruch.
Die Ereignisse nehmen Fahrt auf. Dass Russland am 21. Februar 2022 die selbsternannten »Volksrepubliken« Donezk und Luhansk als eigene, unabhängige Staaten anerkennt, lässt Schlimmes befürchten. Die neu gebildeten »Staaten« mit ihren von Moskau installierten Marionettenregierungen könnten nun Russland angesichts einer angeblich drohenden Militäroffensive Kyjiws offiziell um militärische Hilfe bitten. Genau das passiert kurz darauf auch. Die Separatistenführer der »Volksrepubliken« wenden sich in voraufgezeichneten Videobotschaften mit einem Hilferuf an den Kreml. Putins Drehbuch wird immer offensichtlicher, ein Einmarsch russischer Truppen in der Ostukraine scheint bevorzustehen, auch wenn der russische Präsident betont, dass es dabei nur darum gehe, für »Frieden zu sorgen«. Dass eigentlich ein großflächiger Angriff bevorsteht, ist auch zu diesem Zeitpunkt alles andere als klar.
23. Februar, ein Tag vor Kriegsbeginn. Es ist ein Morgen wie jeder andere: Ich wache zum Klang der Morgenshow von Echo Moskwy auf, einem der letzten kritischen Radiosender, und radle vor der Arbeit zur nächstgelegenen Bäckerei. Es ist ein grauer Tag, leichte Plustemperaturen, ab und zu zwängt sich ein Sonnenstrahl durch die Wolkendecke. Ich quere auf meinem Fahrrad den sechsspurigen Gartenring und bin in einer rastlosen Stimmung. Für den Abend werde ich eine Fernsehreportage drehen, zur Stimmung in Russland am traditionellen Militärfeiertag, dem Tag des Vaterlandsverteidigers. Um schon jetzt Material zu sammeln, halte ich auf dem Weg zur Bäckerei immer wieder an, um mit der Handykamera Passanten zu befragen, was sie über den Truppenaufmarsch entlang der ukrainischen Grenze denken. Von jenen, die überhaupt vor der Kamera antworten wollen, bekomme ich zwei Extreme zu hören: »Es wird Zeit, im Donbas für Ordnung zu sorgen, dort werden unsere Leute seit acht Jahren massakriert«, wiederholt ein Mann die Linie der Staatspropaganda. »Unsere Leute«, damit meint er offenbar die rund 700.000 Bewohnerinnen und Bewohner des Donbas, die Russland in den vorangegangenen Jahren aktiv eingebürgert hat — indem es an alle, die wollten, unbürokratisch Reisepässe verteilt hat. Die These, dass Russland diese »neugewonnenen« Bürgerinnen und Bürger beschützen muss, wenn nötig mit militärischer Gewalt, wird von der Staatspropaganda schon seit der illegalen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 aktiv unterstützt. Doch nicht bei allen scheint dieses Narrativ zu verfangen. »Ich habe Angst vor einem neuen Krieg«, sagt eine ältere Dame vor einem Supermarkt und bricht in Tränen aus: »Meine Schwester und ihre Familie leben in der Ukraine.« Die übrigen Befragten sind ebenfalls gegen militärische Gewalt: »Wir brauchen keinen Krieg, wir haben auch so genug Probleme«, bringt es ein Passant auf den Punkt. Kann diese Gesellschaft tatsächlich einen Krieg gegen das Nachbarland befürworten? Ich will es nicht so recht glauben.
Die Normalität des Alltags in Moskau erscheint mir beinahe absurd vor dem Hintergrund dessen, was zur selben Zeit in der Ukraine passiert: Dort werden seit Monaten Luftschutzkeller vorbereitet, Menschen versuchen, ihre Ersparnisse abzuheben, im Osten des Landes intensivieren sich die Gefechte. Beinahe surreal friedlich wirkt es an diesem Tag, dieses opulente, pulsierende, hochmoderne, vielerorts wunderschöne und mancherorts abgrundtief hässliche Moskau. Metropole, Moloch, Machtzentrum.
In diesem Machtzentrum, dem Moskauer Kreml, tritt am selben Tag Wladimir Putin auf. Seine Rede zum Militärfeiertag transportiert eine widersprüchliche Botschaft: »Unser Land ist immer offen für direkten und ehrlichen Dialog, für die Suche nach diplomatischen Lösungen für die komplexesten Probleme, aber ich wiederhole: Die Interessen Russlands und die Sicherheit unserer Bürger sind für uns nicht verhandelbar.« Angebliche Offenheit für Dialog und diplomatische Lösungen, aber gleichzeitig militärische Drohgebärden: Monatelang spielt Putin dieses doppelte Spiel. Bis tief in den Februar hinein empfängt er fast jede Woche einen westlichen Staats- oder Regierungschef im Kreml. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz, Ungarns Premier Viktor Orbán — sie alle nehmen an Putins überdimensioniertem, sechs Meter langem Verhandlungstisch Platz. Nach Hause fahren sie alle mit mehr oder weniger dem gleichen Ergebnis — kein Zentimeter Verhandlungsfortschritt. (Mit einer Ausnahme: Viktor Orbán sichert sich bei Putin einen Freundschaftsrabatt auf russische Gaslieferungen nach Ungarn — was berechtigte Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner diplomatischen Mission laut werden lässt.) Dass die westliche Reise- und Telefondiplomatie an diesem 23. Februar bereits gescheitert ist, weiß zu diesem Zeitpunkt wohl nur Wladimir Putin. Der 69-jährige Präsident dürfte seine Entscheidung bereits getroffen haben. Nur noch wenige Stunden trennen uns vom Kriegsausbruch.
Die ersten Tage des Krieges
Und dann geht es Schlag auf Schlag. Während am 24. Februar 2022 die russische Armee in einer Boden-, See- und Luftoffensive die Ukraine von Norden, Osten und Süden angreift, verhängen die USA und die Europäische Union, zum Teil akkordiert, sofort die bis dahin weitreichendsten Wirtschafts-sanktionen. Die Sanktionen treffen in verschiedenen Abstufungen die Banken, die Rüstungs-, Hightech- und Pharmabranche. Der für Russland sehr wichtige Energiebereich bleibt vorerst unangetastet — zu groß ist die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas in vielen europäischen Staaten, darunter auch Österreich und Deutschland. Fast so etwas wie Einigkeit gibt es dafür bei der politischen Verurteilung Russlands: Die meisten Staaten der Welt, abgesehen von einigen wenigen Verbündeten Russlands — Belarus, Iran, Kuba, Nicaragua, Venezuela, Syrien und Nordkorea —, verurteilen Russlands militärische Aggression auf das Schärfste. Eine entsprechende Resolution wird in einer Dringlichkeitssitzung der UNO-Generalversammlung am 2. März mit überwältigender Mehrheit angenommen. Von den 35 Staaten, die sich durch Stimmenthaltung in Schweigen hüllen, ist China mit Abstand der mächtigste Player. Doch auch wenn Peking auf direkte Kritik verzichtet, befürwortet es den Krieg zumindest nicht: In einer Erklärung zeigt sich der chinesische UNO-Botschafter »zutiefst besorgt über die letzten Entwicklungen in der Ukraine« — aus der Diplomatensprache übersetzt bedeutet das ernsthafte Unzufriedenheit. Dass Putin und Chinas Präsident Xi Jinping einander nur drei Wochen zuvor die »grenzenlose Freundschaft« schworen, wirkt nun beinahe wie eine Episode aus längst vergangenen Zeiten.
In Moskau befürchten viele angesichts des Wertverfalls der Landeswährung, des Rubels, einen Kollaps des Bankensystems. Die Moskauer Börse erlebt einen historischen Crash und stellt erstmals in der jüngeren Geschichte Russlands vorsorglich den Handel mit ausländischen Wertpapieren ein. Auf den Moskauer Flughäfen herrscht zum Teil Chaos, eine große Ausreisebewegung ist im Gange. Wer gegen das Regime ist und es sich finanziell leisten kann, reist aus. Darunter sind vor allem Gutausgebildete, Besserverdienende und auffällig viele IT-Spezialisten und -spezialistinnen. Russland erlebt einen Braindrain.
Bei vielen, die im Land bleiben, schlägt die Fassungslosigkeit in Wut um. In den ersten Kriegstagen bekommen wir auf den Straßen von Moskau bemerkenswert offene Worte zu hören: »Putin hat unser Land zerstört«, schimpft eine Frau in unser Mikrofon, »die Leute denken, weil bei uns nicht geschossen wird, ist alles wie immer. Das stimmt nicht. Wir sind im Kriegszustand.«
Miriam, die inzwischen wohlbehalten von ihrem Einsatz in Rostow am Don zurückgekehrt ist, bekommt von einer Frau vor einer Moskauer Bank noch deutlichere Worte zu hören: »Wie soll man dieses Land denn sonst bestrafen? Wir haben einen Affen mit einer Atombombe als Präsidenten! Jetzt werden wir mit Sanktionen erdrosselt. Wie soll man den Menschen denn sonst klarmachen, dass es einen Regimewechsel braucht?« Es wird das letzte Mal sein, dass Normalbürgerinnen uns gegenüber so offen und ungeniert ihre Wut auf Putin äußern.
Spürbar ist aber auch zu Kriegsbeginn schon der Einfluss der staatlichen Propaganda, die von vielen unhinterfragt übernommen wird: »Der Westen hat alles getan, um diesen Krieg loszutreten. Die USA, die EU und die NATO





























