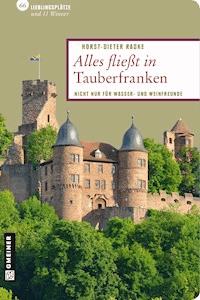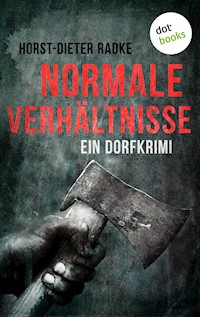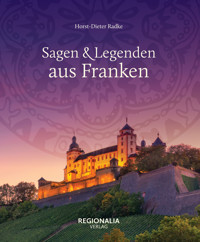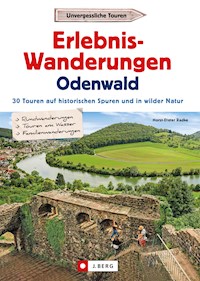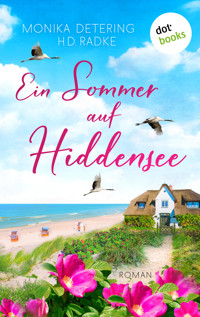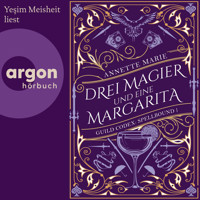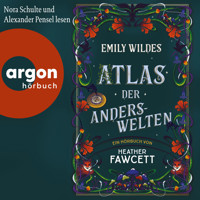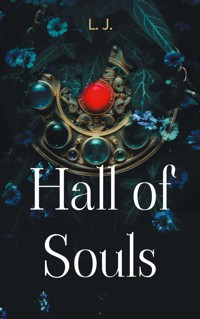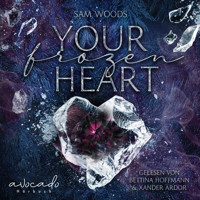7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eifelbildverlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sagen und Legenden
- Sprache: Deutsch
Mit Sagen Geschichte erleben Baden, heute ein Teil von Baden-Württemberg, hat eine lange Geschichte. Ausgehend von kleinen Territorien über die Markgrafschaft bis hin zum Großherzogtum dehnte es sich im Laufe der Geschichte im Südwesten Deutschlands diesseits und jenseits des Rheins immer weiter aus. Was kann spannender sein, als diese Entwicklung mit Sagen und Legenden nachzuerleben? Folgen Sie dem Autor, ausgehend vom Bodensee und den Herren von Bodmann, ins Breisgau und den Schwarzwald. Erleben Sie die Entstehung von Freiburg und die Zerstörung der Burg von Falkenstein. Erfahren Sie, was es mit den vierhundert Pforzheimern und dem Hornberger Schießen auf sich hat. Lernen Sie den Türkenlouis und die Helden vom Kappeler Tal kennen. Aber auch von Gespenstern und Werwölfen wimmelt es in den alten Sagen, weshalb der beschauliche Abschluss mit Legenden, etwa um die Entstehung der Wallfahrtskirche in Walldürn, angelegt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
SAGEN & LEGENDEN AUS BADEN
HORST-DIETER RADKE
INHALT
Einleitung
I. Aus alter Zeit
1. Von der Insel Reichenau
2. Karl der Dicke am Bodensee
3. Die Herren von Bodman
4. Aus der Frühzeit von Überlingen
5. Das Femegericht in Baden
6. Die Sage vom Wolfsbrunnen
II. Der Ursprung von Baden (10.–12. Jahrhundert)
7. Von alten Breisgaufürsten und den Köhlern von Zähringen
8. Vom Ursprung der Herzoge von Zähringen
9. Die Gründung der Stadt Freiburg
10. Die Ritter von Angeloch
11. Kuno von Falkenstein
12. Die Zerstörung der Burg Falkenstein
III. Die Zeit der Markgrafen
13. Kellers Bild und Schloss
14. Die vierhundert Pforzheimer
15. Ludwig der Strenge
16. Friedrichs I. Rettung aus Weiber- und Pfaffenlist
17. Eine derbe Warnung
18. Das Hornberger Schießen
IV. Baden im Alten Reich (1648–1806)
19. Türenne’s Fall
20. Der Großwesir und der Türkenlouis
21. Die Helden vom Kappeler Tal
22. Die Sage vom Baldreit
V. Napoleon und das Großherzogtum Baden (1806–1918)
23. Die verlorene Tochter
24. Der rätselhafte Findling von Nürnberg
25. Der Dichter und die Burg
26. Das Bergschloss
VI. Von Schätzen, bösen Grafen und Gespenstern
27. Der böse Graf von Neufürstenberg und der Esel im Wappen der Stadt Vöhrenbach
28. Der Hexenturm in Bühl
29. Die Entstehung der heißen Quellen von
30. Der Turmberg bei Durlach
31. Die Burg zu Boxberg
32. Schatzgräberei am Hochrhein
33. Der Werwolf von Thummlingen
34. Der Burggeist auf Rodeck
VII. Legenden und geistliche Erzählungen
35. Der heilige Fridolin und der tote Zeuge
36. Die heilige Lioba zu Bischofsheim
37. Die Sieben Schwestern von Vöhrenbach
38. Die Jungfrau Maria als Schützerin von Konstanz
39. Die Entstehung der Wallfahrtskirche
Glossar
Quellen
Sekundärliteratur
Ortsliste
EINLEITUNG
Die Markgrafen von Baden waren es, die den Namen für ein bestimmtes Territorium im Südwesten Deutschlands ins Spiel brachten. Die Gegend am mittleren Neckar zwischen Backnang und Besigheim war der Ausgangspunkt für den Herrschaftsbereich der Badener, später erweitert hin zum Oberrhein und im Süden in den Nord-Schwarzwald. Das mit dem Haus Baden verwandte Fürstengeschlecht der Zähringer, sesshaft bei Freiburg im Breisgau, vergrößerte das Badener Gebiet, nachdem die Linie der Zähringer mit Berthold V. ausgestorben war. Die Markgrafen von Baden erbten einen Teil des Zähringer Gebiets. Napoleon war dafür verantwortlich, dass Anfang des 19. Jahrhunderts das moderne Land Baden entstand. Es kamen erhebliche Gebiete hinzu – viele kleine rechtsrheinisch gelegene Fürstentümer bis hinunter zum Bodensee. Das neue Großherzogtum bekam eine für damalige Verhältnisse fortschrittliche und liberale Verfassung. Nach dem Beitritt zum deutschen Zollverein im Jahr 1835 erlebte das Land einen wirtschaftlichen Aufschwung. 1848 allerdings kam es zu einem republikanischen Umsturzversuch, der mit Hilfe des preußischen und württembergischen Militärs niedergeschlagen wurde.
Trotz Besatzung blieb Baden ein Verfassungsstaat und weitgehend selbstständig. Liberal blieb man trotz allem. 1862 wurden etwa die Juden vollständig gleichgestellt. Baden war damit Vorreiter unter den deutschen Staaten. 1871 trat Baden dem Deutschen Reich bei, ja war durch Großherzog Friedrich I. an dessen Gründung sogar maßgeblich beteiligt. Sein Nachfolger, Großherzog Friedrich II., trat nach dem Ersten Weltkrieg 1918 ab. Baden wurde Republik. 1933 ersetzten die Nationalsozialisten die Regierung durch einen Gesinnungsgenossen als Reichsstatthalter für Baden. 1952 schließlich wurde Baden mit Württemberg zu einem neuen Bundesland zusammengeschlossen. Ganz einfach war das nicht und auch danach gab es noch Querelen, sodass es 1970 noch einmal zu einer Volksabstimmung kam. Fast 82 % der Bevölkerung von Baden stimmte da jedoch für den Verbleib im Bundesland Baden-Württemberg.
Dass es über diese historische Entwicklung zu vielen großen und zahlreichen kleinen regionalen Sagen kam, ist nachvollziehbar. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, aus der Vielzahl der Sagen eine repräsentative Auswahl zu treffen. Beginnend im späten 18. Jahrhundert, insbesondere aber im 19., waren die Sagensammler sehr aktiv. Ich habe mich schließlich entschlossen, eine zeitliche Gliederung zu wählen, die die historische Entwicklung in groben Zügen nachzeichnen kann. Damit ein vollständiger Überblick entsteht, durfte aber auch die Zeit vor den Zähringern und Markgrafen nicht ausgelassen werden. Und weil den regionalen Sagen durchaus auch einige Bedeutung zukommt, habe ich eine Auswahl in einem eigenen Kapitel zusammengestellt. Typische Legenden für Baden sind in einem letzten Kapitel diesem Buch mitgegeben. Trotzdem ist dies nur eine kleine Auswahl. Woher ich die Sagen habe, ist am Ende des Buches unter »Quellen« aufgelistet. Wenn Sie sich für weitere Sagen des badischen Landes interessieren, werden Sie dort fündig.
Neben dem reinen Aufzeichnen von mündlich und schriftlich überlieferten Sagen waren vor allem im 19. Jahrhundert dichterische Umsetzungen sehr beliebt, besonders solche in metrischen Formen. Es gab ganze Sagensammlungen, die ausschließlich in Versen verfasst waren. Ich habe weitgehend auf die zugrunde liegenden Aufzeichnungen zurückgegriffen, solche lyrischen Varianten aber nicht gänzlich ausgeklammert.
Aufgrund der vielen Varianten habe ich einige Sagen zusammengefasst, sie insgesamt sprachlich so bearbeitet, dass sie einerseits den Duktus der »alten Zeit« nicht verlieren, den heutigen Lesegewohnheiten aber entgegenkommen, unter anderem in der Rechtschreibung. Einiges ist auch nacherzählt, insbesondere dort, wo sonst der Umfang für dieses Buch nicht ausgereicht hätte. Wichtig war mir, wie bei meinen anderen Sagen-und-Legenden-Büchern, den einzelnen Sagen Hintergrundinformationen beizugeben, die sie so für heutige Leser verständlich machen. Bestimmte Begriffe, die heute nicht mehr allgemein geläufig sind, habe ich im Text gelassen und der Lesbarkeit halber darauf verzichtet, sie sofort an den jeweiligen Stellen zu erläutern, stattdessen ist ein Glossar angehängt, in dem mancher dieser Begriffe näher erklärt wird.
Ich hoffe, Sie haben Freude am Lesen der badischen Sagen und Legenden.
Horst-Dieter Radke,
Lauda-Königshofen, Mai 2022
AUS ALTER ZEIT
Grenzen in Mitteleuropa des 1. Jahrtausends vor und nach unserer Zeitrechnung waren so flexibel wie Gummibänder. Die Kelten siedelten in der Zeit vom 8. bis zum 1. Jahrhundert vor Chr. von Spanien bis zum Balkan, also auch in dem Bereich, der später Baden bilden sollte. Sie brachten die Bearbeitung von Eisen mit. Bis zum 3. Jahrhundert nach Chr. machten sich die Römer in diesem Bereich breit und gründeten Siedlungen, die später auch Grundlage für die Städte wurden, etwa Aquae an der Stelle, wo später Baden-Baden entstand. Dann fielen die Alamannen ein, die später ins Frankenreich integriert wurden. Die Merowinger schufen das Frankenreich, das gegen Ende ihrer Herrschaft in Austrasien und Neustrien zerfiel, bis es die Hausmeier der Merowinger übernahmen, das Reich der Karolinger gründeten und das Frankenreich zu einer erheblichen Ausdehnung brachten, bis es von Neuem zu zerfallen schien. Die Liudolfinger schufen eine neue Kaiserdynastie, die nach der ersten Kaiserkrönung Ottonen genannt wurden. Von »Baden« konnte noch keine Rede sein, aber in dem Gebiet des künftigen Landes fand doch genügend Entwicklung statt, sodass Sagen und Legenden sich bilden konnten. Eine Auswahl der zahlreichen Überlieferungen wird in diesem Kapitel vorgestellt.
VON DER INSEL REICHENAU
Die liebliche Insel Reichenau war ehemals noch ein von schädlichem Gewürme bewohntes, wildes Eiland, das in dem Gebiet eines Austrasischen Landvogtes namens Sintleoz oder Sintlas lag, welcher gegenüber, auf einer wahrscheinlich nach ihm benannten Burg, später Sandeck genannt, oberhalb Bernang am Untersee, sesshaft war. Sie hieß schlechthin die Aue, auch die Sintlas-Au. Dorthin schickte der Austrasische Hausmeier Karl Martell den helvetischen Bischof Pirminius aus Winterthur, um eine christliche Pflanzstätte zu gründen.
Im Jahre 724 kam jener in das Gebiet des Sintlas, der ihn bat, ein Haus der Andacht in der Gegend zu gründen. Der Heilige wählte dazu die nahe Insel, die der See von allen Seiten umfloss; weil sie aber voll gräulicher Würmer war, riet ihm Sintlas ab. Pirminius Entschluss blieb jedoch fest. Von einem Schiffer begleitet, fuhr er auf die Insel hinüber, die damals nur finstere Wälder, dorniges Buschwerk und Sümpfe enthielt, worin eine Unzahl Kröten, Schlangen, giftige Insekten und anderes Getier hausten.
Als der Heilige die Insel betrat, da entstand wunderbarerweise an der Stelle, wo sein Bischofsstab die Erde berührte, eine Quelle. Die hässlichen Tiere aber flohen und schwammen über den See. Drei Tage und drei Nächte soll ihre Flucht gedauert haben. Als nun die Insel für immer von den Tieren befreit war, reinigte Pirminius mit vierzig seiner Genossen das Eiland von dem wild verschlungenen Gesträuch, und bald war die Insel zu einer Wohnstätte für Menschen vorbereitet.
In kurzer Zeit erhob sich durch den Fleiß des heiligen Pirminius und seiner Brüder ein Kloster, das bald die Zierde der ganzen Seegegend werden sollte. Leider musste Pirminius schon nach drei Jahren infolge der Streitigkeiten der Alemannen mit den Franken die Insel verlassen. Bevor er abreiste, setzte er seinen Schüler Heddo oder Etto als Vorsteher seines Stifts auf der Sintlas-Au ein. Dieser führte die Ordensregeln des heiligen Benedikt ein.
Ungewöhnlicher Segen begleitete die Stiftung. Könige und Kaiser wetteiferten in ihren Schenkungen an das Kloster. So kam es, dass die Reichenau in den ersten Jahrhunderten nach ihrer Stiftung das begütertste Kloster weit und breit war und mit allem Recht ihren Namen führte. In der Sage hieß es: Wenn der Abt von Reichenau nach Rom reiste, konnte er jede Nacht auf eigenem Grund und Boden zubringen. Das mag durch den Umstand entstanden sein, dass das Kloster bedeutende Besitzungen am Comer See in Italien hatte.
Sehr oft weilte vornehmer Besuch auf der Insel. Für gutes Essen und ausreichend Trinken, ja sogar für herrlichen Schlaf war bestens gesorgt. Wenn der Abt von Reichenau Tafel hielt, da kredenzte der Ritter vom nahen Salenstein als Schenk der Au seinem geistlichen Lehensherrn den köstlichen Trank aus den Rebhügeln, welche das Kloster umgaben, und der edle Ritter von Krähen stellte als Truchsess den Braten auf.
Um den hohen Gästen ungestörten Schlaf zu ermöglichen, musste der Lehensmann des so genannten Froschlehens, sooft das Kloster es verlangte, nachts den quakenden Fröschen am Seeufer mit langen Stangen auf die Köpfe schlagen, damit sie Ruhe gaben. Seinem Auftrag zufolge musste der Lehensmann Lehenseid leisten. Dieses Lehen selbst bestand bis in das 19. Jahrhundert hinein. Dem Froschlehenbesitzer wurde das Gut Rosenstauden mit Umgebung zugesprochen. Es liegt auf der nördlichen Seite der Insel, unweit des Klosters an der Hauptstraße. Nach Aufhebung des Klosters wurde das Lehen in eine jährliche Abgabe von 6 Gulden umgewandelt und zuletzt im Jahre 1830 vollends abgelöst.
Weithin drang der Ruhm des Klosters, das für Jahrhunderte neben St. Gallen eine der ersten Bildungsstätten des südlichen Deutschlands wurde. Aus der Reichenauer Schule gingen 14 Erzbischöfe und 60 Bischöfe hervor. Hier wurde der alemannische Adel in den Wissenschaften unterrichtet; zu Zeiten sollen im Kloster, wohl Mönche und Schüler zusammengerechnet, über 600 Menschen gewesen sein. Die berühmtesten Gelehrten ihrer Zeit lehrten in der Schule mitten im See: Abt Walafried Strabo, zugleich ein gefeierter Dichter der karolingischen Epoche, und besonders Hermann der Lahme, 1013 –1054, von dem ein herrlicher Antiphon, das Salve Regina, herrühren soll.
Nach dem Willen des Klostergründers Pirminius war die Insel heiliges Eiland. Die Rechtsprechung lag beim Kloster und es wurden durchaus auch Todesurteile gefällt, vollstreckt werden durften sie auf der Insel jedoch nicht. Auch Waffen durften auf der Insel nicht getragen werden. Deshalb stand der Galgen der Abtei auf dem Festland gegenüber, ungefähr dort, wo heute Allensbach liegt, das ehemals Alohospach hieß. Dabei galt Folgendes: Ließ der Abt während der Überfahrt des Verurteilten zum Festland eine Glocke läuten, so wurde der Delinquent begnadigt und am Ufer freigelassen. Deshalb bekam der Teil des Sees zwischen Allensbach und der Reichenau den Namen »Gnadensee«.
Nach Joseph Waiberl: Sagen des Bodensees …, und August Schnezler, Badisches Sagenbuch I.
Quellen, die auf den alemannischen Adligen Sintlas oder Sintlaz verweisen, stammen aus dem 15. Jahrhundert. Er soll ein Abgesandter des fränkischen Hausmeiers Karl Martell, der Alemannien in das Frankenreich eingegliedert hatte, gewesen sein. Pirminius (*um 670 † 753), der vermutlich ein irischer Mönch war, gründete 724 das Kloster Mittelzell auf der Insel Reichenau. Jener Sintlas vom Südufer des Sees, in der Burg Sandeck residierend, soll ihn dabei unterstützt haben, aber auch der Allemannherzog Lantfried, der sich 730 mit Karl Martell anlegte und dabei ums Leben kam. Lantfrieds Bruder hatte Pirminius bereits 727 von Reichenau aus Hass gegen den »Karoli« vertrieben. Er gründete jedoch in anderen Orten im Schwarzwald und den Vogesen neue Klöster. Die letzte Klostergründung war das Kloster Hornbach in der Südwestpfalz im Jahre 741, wo er um 753 starb und begraben wurde. Der Hinweis, dass er die Insel »von Gewürm« befreit habe, deutet vermutlich darauf hin, dass er sie urbar gemacht hatte, so wie das im Umfeld von Klöstern üblich war. Vielleicht wurde Brandrodung betrieben, was die Flucht der Tiere durch den See erklären würde. Schloss Sandegg, die angebliche Burg des Sintlas, stand seit Mitte des 13. Jahrhunderts im Besitz des Klosters Reichenau. Eberhard von Steckborn hatte es 1265 dem Deutschen Orden vermacht, der es 1272 mit dem Reichenauer Abt Albrecht von Ramstein gegen die Abtei auf der Insel Mainau tauschten. Aus Geldmangel verkaufte die Abtei die Burg schließlich im Jahr 1350. Dass die Burg schon im 8. Jahrhundert existiert haben kann, ist nicht anzunehmen, dass ein Vorgängerbau vorhanden war, aber durchaus.
Bedeutende Äbte sorgten bis ins 12. Jahrhundert dafür, dass dem Reichenauer Kloster eine hohe Bedeutung zukam. Ab dem 13. Jahrhundert setzte der Niedergang ein, bis im Spätmittelalter, zum Beginn des 15. Jahrhunderts nur noch der Abt und zwei adlige Konventsherren dort residierten. Noch einmal kam dann Leben ins Kloster, das Münster in Mittelzell bekam einen spätgotischen Chor und der Chronist Gallus Oehem schrieb die Geschichte des Klosters auf. Abt Markus von Knöringen legte jedoch 1540 die Klosterleitung nieder und trat sie an den Bischof von Konstanz ab. Zwölf Mönche wurden nun in das Konstanzer Priorat eingesetzt. 1757 löste man es auf.
Die Deutung der Namensfindung des Gnadensees ist wohl als Legende anzusehen. Viel eher ist anzunehmen, dass es sich um eine Verkürzung aus »Gnadenfrausee« handelt, da das Kloster in Mittelzell ein Marienkloster war.
Der Name der Insel ist von dem alemannischen Riichenau abgeleitet und nicht von dem Begriff »reich«.
KARL DER DICKE AM BODENSEE
Einer der größten Wohltäter der Reichenau war Kaiser Karl der Dicke. Er beehrte die Insel oft mit seinem Besuch und wurde mit den Klosterherren derart vertraut, dass er mit ihnen spielte und oft auch scherzte. Im Jahre 881 schenkte er dem Gotteshaus den Flecken samt Kloster Zurzach im heutigen Kanton Aargau, und zwei Jahre später die Orte Ionen und Kembraten im Zürichgau; ja, zuletzt ließ er alles, was dem Kloster im Laufe der Zeit entzogen und wieder zur kaiserlichen Kammer gebracht worden war, zurückstellen.
Auf dem Schloss Bodmann lebte Kaiser Karl der Dicke, nachdem er im Jahr 881 sehr krank aus Italien nach Deutschland zurückgekehrt war. Die Mönche haben an diesem königlichen Märtyrer gerühmt, dass er sie besonders geachtet, fleißig ihre Gebete verrichtet und ihre Psalmen gesungen, dass er reichliches Almosen gespendet und stets auf die Gnade des Herrn gebaut habe. Auch waren sie seine einzigen Freunde in schlechten Zeiten. Nach seinem Tod brachte man deshalb seine Leiche auf die Insel Reichenau, wo er im Münster, neben dem Altar der heiligen Maria, feierlich beigesetzt wurde.
Allen Anzeichen nach, sagt eine alte Chronik, hat die Pfalz, die König Konrad I. abbrechen ließ, nicht weit vom Bodensee und der Kirche gestanden und in der Ebene gelegen. Hier soll sich der Kaiser einen Weinberg angelegt haben, wofür er die Reben aus Burgund bezogen habe. Seit vielen Jahrhunderten heißt dieser Weinberg deshalb Königweingarten.
Doch der arme Kaiser hatte viele traurige Tage zu erleben. Er wurde krank und musste sich in Bodman einer Operation am Kopf unterziehen. Ein ungewöhnlich großer Zahn, der lange in Gold gefasst, aufbewahrt wurde, soll die Ursache von heftigen Kopfschmerzen gewesen sein. Die Operation hatte aber leider keinen Erfolg. Der arme Kaiser wurde zuletzt geistesschwach und unfähig, das Reich in den stürmischen Zeiten der Normanneneinfälle zu regieren. Zu alledem kam häusliches Unglück über ihn. Seine Gemahlin Richardis war des verbotenen Umgangs mit dem Kanzler Luitward beschuldigt, den der Kaiser vom einfachen Hufschmiedssohn so hoch erhoben hatte. Wohl reinigte sich die Kaiserin durch ein Gottesurteil, doch trotzdem wurde sie geschieden und ging ins Kloster Andlau im Elsass. Luitward aber spann verräterische Pläne gegen seinen Herrn, so wird erzählt, und brachte es in Verbindung mit vielen weltlichen und geistlichen Größen des Reichs dahin, dass der Kaiser auf dem Reichstag zu Tribur abgesetzt wurde. Kaum noch erlangte Karl als Erbe die Macht seines großen Ahnen. Zu seinem Lebensunterhalt bekam er von den Fürsten einige Höfe in Schwaben, darunter Neidingen. So wandelbar ist alle irdische Größe, wenn sie nicht auf dem Geist beruht!
Der verlassene Kaiser zog sich in die Einsamkeit zurück. Mariahof, im Dorfe Reidingen, wählte Karl zu seinem Wohnsitz und führte ein schlichtes Leben. Wollte er sich einmal recht unterhalten, so ging er auf die Entenjagd bei Pfohren. Bei einer solchen, erzählt eine Sage, erstickte der Kaiser im Sumpf. Eine alte Urkunde erwähnt dagegen ein altes Gerücht, dass der Kaiser von seinen Feinden erdrosselt worden sei. Wir wissen aber heute, dass Karl am 13. Januar 888 in Neidingen eines natürlichen Todes starb.
Weil der Verstorbene ein besonderer Wohltäter der Reichenau gewesen war und sich schon zu Lebzeiten Ort und Stelle für sein Grab gewählt hatte, wurde der Leichnam des verstorbenen Fürsten von den treuen Mönchen auf ihre Insel gebracht. Auf dem Weg schien sich der Himmel zu öffnen und ein Lichtstrahl fiel auf die Bahre. Eine sagenhafte Überlieferung berichtet, dass ein Flämmchen den Weg über das Wasser vorausgezogen sei.
Karl der Dicke wurde neben dem Altar der allerseligsten Jungfrau Maria zur Erde bestattet. Zu seinem Andenken stiftete Bruder Luitwards einen Jahrestag. Das Grab des Kaisers liegt jetzt am Eingang der Sakristei. Im Jahre 1728 ließ der Bischof Schenk von Staufenberg die Gebeine des Kaisers an dem Orte, wo sie jetzt liegen, beisetzen. Im Jahre 1842 scheint eine Öffnung des Grabes stattgefunden zu haben; danach war dasselbe auf dem Boden und auf den Seitenwänden mit blassroten, durch Kitt verbundenen Backsteinen oder Ziegeln ausgelegt. Unter einem Gemälde über der Sakristeitür, das Karl den Dicken in Lebensgröße darstellt, liest man die Worte, welche vielleicht auf sein früheres Denkmal gesetzt waren:
»Karl der Dicke, König von Schwaben, Urenkel Karls des Großen, drang mit Macht in Italien ein, überwand es und nahm das Römische Reich, wo er zum Kaiser gekrönt ward, in Besitz. Nach dem Tode seines Bruders erhielt er als Erbe ganz Deutschland und Frankreich. Schließlich war er, der an Geist, Verstand und Körper schwach war, durch die Tücke des Schicksals aus einem Reiche verstoßen, und von all den Seinen verachtet, an diesem unscheinbaren Orte begraben. Er starb den 13. Januar im Jahre 888.«
Nach Joseph Waiberl: Sagen des Bodensees …, und August Schnezler, Badisches Sagenbuch I.