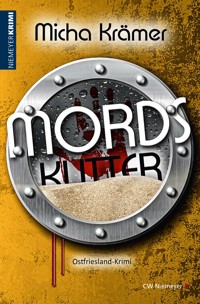7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Inselpolizist Onno Federsen ist ratlos. Auf dem ansonsten so beschaulichen Eiland Langeoog treibt ein Fallensteller sein Unwesen. Zweimal hat die Falle schon zugeschnappt. Wer wird das nächste Opfer sein? Und was hat es mit dem menschlichen Schädel auf sich, den Urlauber am Flinthörn gefunden haben und der aus dem Polizeigewahrsam verschwindet? Die Verwirrung ist komplett, als angeblich auch noch der vor zwölf Jahren ertrunkene Mann von Annemarie Hansen gesehen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Micha KrämerSand in der Kimme
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2018 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8338-5
Micha Krämer
Sand inder Kimme
Micha Krämer wurde 1970 in Kausen, einem kleinen 700 Seelen Dorf im nördlichen Westerwald, geboren. Dort lebt er noch heute mit seiner Frau, zwei mittlerweile erwachsenen Söhnen und seinem Hund. Der regionale Erfolg der beiden Jugendbücher, die er 2009 eigentlich nur für seine eigenen Kinder schrieb, war überwältigend und kam für ihn selbst total überraschend. Einmal Blut geleckt, musste nun ein richtiges Buch her. Im Juni 2010 erschien „KELTENRING“, sein erster Roman für Erwachsene, und zum Ende desselben Jahres folgte sein erster Kriminalroman „Tod im Lokschuppen“, der die Geschichte der jungen Kommissarin Nina Moretti erzählt. Was als eine einmalige Geschichte für das Betzdorfer Krimifestival begann, hat es weit über die Region hinaus zum Kultstatus gebracht. Inzwischen findet man die im Westerwald angesiedelten Kriminalromane in fast jeder Buchhandlung im deutschsprachigen Raum.Neben seiner Familie, dem Beruf und dem Schreiben gehört die Musik zu einer seiner großen Leidenschaften.
Prolog
Insel Langeoog
Herbst 1964
Was man nicht alles des lieben Geldes wegen tat. Er sah aus dem Fenster in die klare Herbstnacht. Wind heulte über das Dach des in die Jahre gekommenen Friesenhauses und schüttelte die letzten verwelkten Blätter von den Zweigen des alten Birnbaums. Der Baum zierte diesen Garten schon so lange er überhaupt denken konnte. Hier war er aufgewachsen. Hatte als Kind mit den Jungs aus dem Dorf Verstecken gespielt und war bis in die Krone des Birnbaums geklettert, von wo man einen wunderbaren Ausblick hinaus auf das Wattenmeer hatte. Die Birnen, von denen sie auch in diesem Jahr wieder körbeweise gepflückt, eingekocht oder anderweitig verarbeitet hatten, waren klein, aber zuckersüß. Er seufzte und rückte die Bettdecke von Vater Hein zurecht. Wie sollte es ihnen wohl ohne den alten Mann ergehen? Alle sprachen sie vom Wirtschaftswunder. Nur hier, an ihrer wunderschönen Insel, schien der Geldregen, der über dem Land herunterging, komplett vorbeizuziehen. Von den paar Pensionsgästen, die im Sommer auf die Insel kamen, würde auch in Zukunft kaum jemand leben können. Die Deutschen, die das Geld hatten, um in den Urlaub zu fahren, fuhren eben lieber in das sonnige Italien als an die Nordsee. Das war so und würde sich auch niemals ändern. Davon war er fest überzeugt. Improvisationstalent war in diesen Zeiten also so gefragt wie nie zuvor. Solange er denken konnte, waren all seine Vorfahren zur See gefahren, und auch er liebte die Nordsee über alles. Dennoch hatte er ein anderes Handwerk gelernt, eines, was ihm heute Nacht etwas nützen würde. Maurer war doch ein angesehener Beruf. Gerade jetzt, zwanzig Jahre nach dem verlorenen Krieg, gab es immer noch eine Menge wiederaufzubauen. Dumm nur, dass viele auf der Insel es sich nicht leisten konnten, ihn zu beschäftigen. Dieses Fleckchen Erde zu verlieren, es verlassen zu müssen, würde ihm das Herz brechen. Es musste also etwas passieren. Er zog die Vorhänge zu, löschte das Licht, tätschelte noch einmal die kalte Hand des alten Mannes und verließ dann das Zimmer. Er arbeitete bis zum Morgengrauen. Mischte eine Karre Mörtel nach der anderen und setzte Stein auf Stein. So wie er es gelernt hatte. Vater Hein wäre stolz auf ihn. Ganz bestimmt.
Kapitel 1
Juli 2017Strand Insel Langeoog
Martin von Schlechtinger liebte die Wintermonate auf seiner Insel. Dann, wenn die Winterstürme über das alte Friesenhaus fegten und sich das Leben ein wenig verlangsamte, war seine Jahreszeit. Klar mochte er auch den Sommer. Früher, als er noch in Köln-Kalk lebte, hatte er ihn regelrecht herbeigesehnt. Weil … Winter am Rhein, das war ja überhaupt nicht schön, weil dann irgendwie alles so graubraun war. Dazu der ewige Nieselregen. Fürchterlich! Doch die Zeiten und Menschen änderten sich. Sogar ein Martin von Schlechtinger. Seit beinahe drei Jahren lebte und arbeitete er nun auf Langeoog. Er verließ die Insel nur selten, und das war auch in Ordnung so. Er brauchte die weite Welt nicht, um zufrieden zu sein. Die Winter hier auf seiner Insel waren, zumindest empfand er dies so, bei Weitem nicht so trostlos wie die in seiner alten Heimat. Doch Farben und Klima waren auch eher zweitrangig. Im Leben ging es doch um viel mehr als nur um das Wetter und ob die Bäume grün waren. Hier auf Langeoog zum Beispiel brach jedes Jahr mit dem Frühling nicht nur die warme Jahreszeit, sondern auch die Saison an. Regelrechte Scharen, Tausende von Touristen, brachten dann wieder Unruhe auf das kleine ostfriesische Eiland. Klar waren die Touristen auch wichtig für die Insel. Ohne diese und das Geld, das sie daließen, wären die Einheimischen ganz schön aufgeschmissen. Das war Martin schon klar. Langeoog lebte schließlich vom Tourismus. Dennoch musste Martin im Sommer beinahe täglich und sehr wehmütig an die gemütlichen Wintermonate denken, dann wenn die Urlauber nicht da waren. Aber es half nichts. Wenn er etwas im Leben gelernt hatte, dann war es das, dass man immer das Beste aus der jeweiligen Situation machen musste. Und die beste Zeit im Sommer war eindeutig der Sonnenaufgang.
Jeden Morgen schälten er und Annemarie sich deshalb bereits vor dem ersten Hahnenschrei aus den Federn und genossen die Zeit, in der die Urlauber noch in ihren Betten schlummerten. Dann wenn der Strand noch leer war und keine johlenden Kinder durch die Dünen streiften. Zu seinem Glück war Martin, genau wie Annemarie, ein Frühaufsteher. Während seine bessere Hälfte konsequent jeden Morgen eine Stunde am Strand entlangjoggte, radelte er mit dem Fahrrad über die Insel und genoss die frische Brise, die über das Meer aus fernen Ländern herbeiwehte. Einfach nur herrlich. Heute war er, wie so oft, früh morgens an den Strand geradelt. Natürlich nicht direkt am Dorf, da wo die ganzen Strandkörbe standen. Nein, er war zuerst bis zur Inselmitte an die Melkhörndüne gestrampelt und erst dort nach links zum Strand abgebogen. Er hatte sein Rad abgestellt, sich entkleidet und sich in die kalten Fluten gestürzt. Eine sehr erfrischende Angelegenheit. Er schwamm dann immer einige Meter hinaus aufs Meer und ließ sich von den Wellen zurück an den Strand tragen.
Auch heute saß er nach seinem Bad, wie Gott ihn geschaffen hatte, im feinen Sand und genoss die Ruhe. Mit geschlossenen Augen lauschte er der Brandung und dem Gekreische der Möwen. Neben ihm lag fein säuberlich der Stapel mit seiner Kleidung, und in der Hand ruhte seine Meerschaumpfeife. Er schätzte, dass es nicht später als sechs Uhr in der Früh war. Genau wusste er es nicht, da er weder eine Uhr noch ein Handy dabeihatte. Wozu auch. Seine innere Uhr funktionierte doch noch tadellos. Nach ihr waren es noch gut und gerne zwei Stunden Zeit, sich für die Arbeit fertigzumachen. Er zündete deshalb in aller Seelenruhe die Pfeife an, sog den Rauch ein und beobachtete die Wellen, die an den Strand rollten. So ein Sandstrand war schon etwas Schönes. Obwohl er natürlich auch Nachteile barg. Dann zum Beispiel, wenn der Sand sich in jede Ritze der nassen Haut setzte und dort wie Paniermehl auf einem Schnitzel klebte. Besonders unangenehm war es, wenn man, wie Martin, nachher noch auf dem Sattel des Fahrrades sitzen und bis zum Dorf radeln musste. Sand in der Kimme, wie man den Landstrich unterhalb des Rückens in Köln zu nennen pflegte, war eine äußerst unangenehme Sache. Da half nur eins. Gleich, vor der Abfahrt, noch einmal gut im Meer durchspülen, sorgfältig abtrocknen und dann bloß nicht noch mal in den Sand setzen, bevor man seinen Schlüpfer angezogen hatte.Heute war es relativ windstill. Wobei der Wind hier am Strand immer ein bisschen wehte, auch wenn man ihn im von den Dünen geschützten Inneren der Insel kaum noch wahrnahm. Martin blies den aromatisch nach Vanille schmeckenden Rauch in den klaren Morgenhimmel und lauschte wieder dem Gezeter einiger Möwen. Er stutzte: War da nicht noch ein anderes Geräusch? Etwas, das klang wie ein klägliches Jaulen? Er konzentrierte sich auf die Misstöne, die hier definitiv nichts zu suchen hatten. War das vielleicht ein Seehundbaby, ein Heuler, der von seiner Mutter getrennt worden war und jetzt um Hilfe rief? Also jetzt nicht so wie ein Mensch, sondern in der Sprache der Seehunde eben.
Martin klopfte seine Pfeife aus und griff sich seine Latzhose. Nachdem er sie angezogen hatte, ging er langsam in die Richtung, aus der das Klagen kam. Den Sand, der jetzt in seiner Hose scheuerte, würde er später noch unbedingt entfernen müssen, bevor er sich da was wund scheuerte. So etwas ging rapzap und war nicht zu unterschätzen. Jetzt interessierte ihn erst einmal nur, welches Geschöpf sich da gerade so zu quälen schien. Nein, ein Heuler war das nicht, die klangen anders. Vielleicht eine ausgewachsene Robbe, die sich in einem alten Fischernetz verheddert hatte? Ja, das könnte schon eher sein. Da stellte sich allerdings die Frage, wie das Tier und das Netz zwischen die Dünen geraten waren, die ja schon einige Meter von der Wasserlinie entfernt waren. Auf allen vieren kraxelte er durch den losen Sand eine sehr steile Düne empor und staunte nicht schlecht, als er in das Tal dahinter blicken konnte.
„Ja, wat bist du denn für einer?“, fragte er den pechschwarzen Hund mit dem Zottelfell, den Schlappohren und der schneeweißen Zeichnung auf der Schnauze bis hoch zu den Augen.
Natürlich konnte er nicht verstehen, was das Hundchen ihm antwortete. Doch egal was es war: Es klang äußerst jämmerlich. Vorsichtig rutschte Martin die Düne herunter, bis kurz vor das struppige Etwas. Durch das Wimmern des Tieres hörte er das Klappern von Metall. Als er die Ursache des metallischen Klirrens herausfand, fühlte er plötzlich eine unermessliche Wut in sich aufsteigen. Die rechte Vorderpfote des armen Tieres steckte in einem rostigen Eisending, das an einer Kette hing, die wiederum an einem Pflock im Sand befestigt war.
„Ja, wo gibt dat denn sujet“, schimpfte er und näherte sich vorsichtig dem armen Hund, der tatsächlich in einer Tierfalle steckte. Martin kannte diese Art von Fallen nur aus dem Fernsehen. Mit solchen Dingern fingen die Trapper im Wilden Westen Bären und anderes Getier. Wer zum Teufel stellte so ein Mistding bloß hier zwischen den Dünen auf Langeoog auf? Hier gab es doch weder Bären noch Wölfe. Er musste handeln.
„Jetzt pass mo uff, liebes Hundchen. Mir zwei, mir machen jetzt ene Geschäft. Der liebe Onkel Maddin, der befreit dich jetzt aus dem Dingens da, und dafür tust du den nit beissen tun. Verstanden?“, schlug er dem Vierbeiner vor. Martin konnte nicht sagen warum, aber er hatte tatsächlich das Gefühl, das Hundchen würde ihn verstehen. Er ging in die Hocke und krabbelte dann auf allen vieren, ganz vorsichtig, weiter auf das Tier zu. Als Kind hatte Martin sich immer einen Hund gewünscht, doch seine Eltern waren strikt dagegen gewesen. Einmal hatte er einen Dackel, den er am Rheinufer gefunden hatte, mit nach Hause gebracht und ihn in seinem Zimmer versteckt. Als sein Vater es rausbekam, hatte er dem kleinen Martin wie so oft die Hosenbeine stramm gezogen. Aber so etwas von heftig. Er hatte zwei Tage nicht sitzen können, so weh hatte sein Hinterteil getan, nachdem der hölzerne große Kochlöffel darübergetanzt war. Dagegen war das bisschen Kratzen an seinem Popo, von dem feinen Sand in seiner Latzhose, heute beinahe eine wahre Wohltat. Die fuffzig Mark Finderlohn, die der Besitzer des Dackels damals springen ließ, hatte sein alter Herr aber dann doch gerne eingesteckt und sofort in der nächsten Kneipe versoffen. Alles in allem ein Kindheitserlebnis, das sich in Martins Hirn förmlich eingebrannt hatte. Vorsichtig streckte Martin dem Hund seine Hand hin. Das Tier knurrte kurz, schnüffelte dann aber interessiert und begann schließlich wieder zu winseln. Der erste Schritt war also schon mal getan. Vorsichtig näherte er sich dem Kopf des Tieres und strich nun über das lange flauschige Fell. Erst jetzt sah er, dass nicht nur ein Teil des Kopfes zwischen den Augen weiß war, sondern auch alle vier Pfoten. Er überlegte, was das wohl für eine Rasse war. Er hatte keine Ahnung. Es war jetzt im Moment auch vollkommen egal.
„Ja, der Onkel Maddin … der tut dir nix. Der will dir nur helfen“, beruhigte er das Hundchen und besah sich die blutende Wunde oberhalb der Hundepfote. Das sah ja gar nicht gut aus.
„Lumpi, du musst jetzt ganz tapfer sein“, erklärte er dem Tier, das er soeben auf den Namen getauft hatte, den er vor vierzig Jahren schon einmal dem Funddackel gegeben hatte. Dann fasste er mit beiden Händen die rostige Bärenfalle und drückte sie mit aller Kraft auseinander. Das Hundchen fiepte und machte einen Satz nach hinten.
„Siehste, Lumpi, dat war doch gar nit so schlimm“, meinte er zu dem Hund, der nun sogar mit dem Schwanz wedelte. Martin betrachtete noch einmal die Wunde am Vorderlauf des Hundes. Also, gut sah das nicht aus. Nein, ganz und gar nicht. Es wäre wohl das Beste, wenn er den Hund zu einem Tierarzt brächte. Dumm war nur, dass es auf der Insel keinen Veterinär gab. Die nächste Praxis befand sich auf dem Festland in Esens.
„Lumpi, et hilft nix, mir müssen einen finden, der sich dein Füßchen mo angucken tut“, entschied er und versuchte sich dem Hund zu nähern. Doch der schien von dem Gedanken nicht allzu begeistert zu sein, drehte sich um und hinkte schwerfällig durch den Sand davon. Als der Vierbeiner die Kuppe der nächsten Düne erreicht hatte, legte er sich dort hin und beobachtete Martin misstrauisch.
„Na gut, wer net will, der hat schon“, entschied Martin und widmete seine Aufmerksamkeit der Bärenfalle. Dass die tatsächlich für einen Bären ausgelegt war, glaubte er nicht. Nein, so ein Bär hatte sicherlich eine wesentlich größere Pfote als so ein Hund. Selbst für den Fuß eines erwachsenen Menschen schien ihm das Ding noch zu klein. Wobei, nein, für einen Menschen könnte es gerade noch so reichen. Doch ausprobieren würde er es nicht wollen.
An der Falle hing eine Kette, die wiederum mit einem Karabiner an einem Eisen befestigt war, das ziemlich fest im Sand steckte. Auch die Kette würde so ein richtiger Grizzlybär bestimmt zerreißen wie einen Wollfaden. Aber mal egal, das Ding musste hier weg. Martin zog also, so fest er konnte, an dem Eisen, das in den Boden eingeschlagen war. Doch leider ohne Erfolg. Dieser blöde Bodenanker bewegte sich keinen Millimeter. Er beschloss deshalb, morgen früh noch einmal herzukommen, um das Ding auszugraben. Nicht auszudenken, wenn sich an dem Eisen jemand verletzen würde. Er löste fürs Erste lediglich den Karabiner von der Kette und trug die Falle dann zu seinem Fahrrad. Suchend sah er sich nach dem Hund um. Er entdeckte ihn an der Stelle, wo der Weg die lange Dünenkette durchbrach.
„Lumpi, mein letztes Angebot: Komm mit, und ich bring dich zum Onkel Doktor“, bot er dem Schlappohr an und glaubte dann zu sehen, wie der Hund den Kopf schüttelte, als würde er Martin verstehen. Ja, vermutlich verstand das schlaue Tier ihn sogar ziemlich genau. Nur, ob es tatsächlich auch schlau war, mit einer solchen Verletzung weiter hier im Sand herumzurennen, da war Martin sich nicht so sicher. Da, wo die Wunde und das Blut waren, sah die Pfote nämlich schon aus wie ein Wiener Schnitzel. Kein schöner Anblick … also, die Wunde jetzt und nicht das Schnitzel.
*
Onno Federsen liebte seinen Job als Inselpolizist. Seit beinahe drei Jahren lebte er nun das ganze Jahr auf Langeoog. Zuvor war er lediglich während der Saison auf der Insel gewesen. Im Winterhalbjahr musste er dann im Raum Wittmund Streife fahren. Das war weniger schön gewesen. Den endgültigen Wechsel zur Inselpolizei hatte er deshalb noch keinen Tag bereut.
Da er bisher noch keine Wohnung gefunden hatte, wohnte er noch immer zur Untermiete bei Tine Humbold, einer ehemaligen Lehrerin aus Dortmund. Tine war, genau wie Onno, keine Einheimische. Sie hatte spontan, nach dem Tod ihres Mannes vor einigen Jahren, ihre Zelte an der Ruhr abgebrochen und war auf die Insel gezogen.
Onno wurde jedoch in letzter Zeit irgendwie das Gefühl nicht los, dass Tine mehr von ihm wollte als die monatliche Miete. Seit drei Wochen fing sie ihn regelmäßig jeden Morgen, wenn er aus seinem kleinen Apartment hinunterstieg, am Fuße der Treppe ab, um ihm einen schönen Tag zu wünschen und ihm dabei eine Papiertüte mit geschmierten Broten und etwas Obst zu überreichen. Ein Service, der so im Mietpreis nicht enthalten war, den er aber dennoch, der Bequemlichkeit wegen, dankend annahm. Wenn er dann am Abend nach Hause kam, erwartete sie ihn bereits an der Haustür, um ihn mit in ihre gute Stube zu schleppen, wo sie dann jedes Mal auftischte, als sei ein Feiertag. Tine konnte hervorragend kochen. Es war Onno auch nicht wirklich lästig, dass sie ihn so dermaßen umgarnte, nein, das nicht. Im Grunde mochte er Tine ja auch. Doch die Frage war, wo das noch hinführen könnte. Onno und die Frauen, das passte irgendwie nicht. Seine letzte feste Freundin Gisela, von der er sich bereits vor sieben Jahren getrennt hatte, hatte es zuvor ziemlich treffend auf den Punkt gebracht. Onno war nicht beziehungstauglich. Er selbst würde es ein wenig anders formulieren. Er sah sich mehr als den Typ „einsamer Wolf“. So ein Wolf zog auch lieber frei wie der Wind durch die Steppe, anstatt sich an die Leine legen zu lassen. Onno genoss seine Freiheit. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Wenn er abends schon mal einen über den Durst trank – dann war das eben so. Auch wenn er gelegentlich mal mit einer einsamen Touristin flirtete, war es so, wie es war.
Heute Morgen war es nicht wie sonst. Tine wartete erst gar nicht, bis er nach unten kam, sondern hämmerte bereits an die Tür seines Zimmers, als er sich gerade ankleidete.
„Onno, du hast Besuch“, hörte er ihre Stimme trällern. Onno stutzte. Wer sollte ihn morgens um zehn nach sieben besuchen wollen?
„Einen kleinen Moment, Tine, ich bin in einer Minute fertig“, beschied er ihr und wollte schon nach seinem Jackett greifen, das zusammen mit dem Gürtel, an dem die Pistole, die Handschellen und der ganze andere Krempel befestigt waren, über dem einzigen Stuhl hing. Das meiste von dem Zeugs an dem Gürtel waren Dinge, die man als Inselpolizist eigentlich gar nicht brauchte, die aber nun einmal zur Ausrüstung eines Polizisten gehörten. Zum Beispiel die Pistole. Onno konnte sich nicht erinnern, wann er die zuletzt aus dem Holster gezogen hatte. Trotzdem schleppte er das Ding immer mit sich herum. Geladen war sie aus Gewichtsgründen nicht. Oder die Handschellen. Er hatte keine Ahnung, ob die überhaupt noch funktionierten. Den Schlüssel dazu hatte er schon länger nicht mehr gesehen. Doch Vorschrift war nun mal Vorschrift, und er musste diesen Kram eben mit sich herumschleppen.
Doch auf die Uniformjacke würde er zumindest heute verzichten können. Die im Fernsehen hatten gestern in der Wettervorhersage etwas von hochsommerlichen Temperaturen erzählt. Da reichte es, lediglich im kurzärmligen Hemd auf die Wache zu radeln. Er schnappte sich also nur den Gürtel, band ihn sich um und war gespannt, wer so früh am Morgen schon etwas von ihm wollte.
Als er die Treppe hinunterstieg, vernahm er bereits Stimmen aus Tine Humbolds guter Stube. Er musste lächeln, als er den Kölner Dialekt erkannte.
„Moin, Maddin“, begrüßte er das Kölner Urgestein, als er die hübsch eingerichtete Friesenstube betrat. Martin saß am Tisch und trank Kaffee. Wie immer trug er seine blaue Arbeitslatzhose. Darunter ein T-Shirt mit dem Logo des 1. FC Köln und an den Füßen die bunten Nike-Turnschuhe. Rechts einen mit blauem und links einen mit rot- gelbem Logo. Onno war überrascht, Martin hier so früh anzutreffen. Was der wohl von ihm wollte?
„Moin moin, Onno“, erwiderte das Kölner Unikat friesisch echt und prostete ihm mit einem Kaffeepott zu. Tine besaß nur solch große Tassen. Die meisten davon waren mit den gängigen Nordseemotiven bedruckt, wie Leuchttürmen, Seehunden und so einem Zeugs. Eben solche Becher, wie man sie in den diversen Souvenir- und Kitschläden überall entlang der Küste und auch auf den Inseln fand. Auf dem Pott in Martins Hand prangten allerdings eine Sonne und der Slogan ATOMKRAFT NEIN DANKE. Vermutlich ein Relikt aus Tines früherem Leben.
„Magst du auch einen Kaffee oder lieber einen Tee?“, erkundigte Tine sich, die wie jeden Morgen bereits adrett gekleidet und ordentlich frisiert war. Sie trug eine beige Hose, dazu passende braune Schuhe mit halbhohen Absätzen und eine helle Bluse. Gerade so, als müsse sie gleich zur Schule. Onno hatte Tine noch nie im Nachthemd oder in bequemer Hauskleidung gesehen. Nein, so wie sie ihm da jeden Morgen am Fuße der Treppe auflauerte, erinnerte sie ihn ständig an seine Deutschlehrerin Frau Lieselotte Schnäbelchen. Eine fürchterliche Person, zumindest hatte Onno sie so in Erinnerung. Vermutlich lag es tatsächlich nur an Onnos düsteren Erinnerungen an seinen alten Schuldrachen, dass er sich so gar nicht auf die Flirtversuche seiner Vermieterin einlassen konnte. Weil, direkt hässlich war Tine Humbold eigentlich nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Sie hatte die richtigen Rundungen an genau den Stellen, wo sie sein sollten, und auch ihr Gesicht würde Onno durchaus als hübsch bezeichnen. Sogar menschlich gefiel sie ihm. Neulich hatte er sich einmal die Mühe gemacht und seine alten Schulfotos herausgesucht. Auf einem der Klassenfotos war auch Lieselotte Schnäbelchen zu sehen gewesen. Das Ergebnis seiner Recherche war ernüchternd. Die alte Schnäbelchen und Tine ähnelten sich optisch noch nicht einmal im Ansatz. Die waren zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Dennoch erinnerte Tine ihn an die alte Lehrerin. Eine sehr seltsame Sache, die sich vermutlich darin begründete, dass Onno von Tines beruflicher Vergangenheit wusste.
Onno lehnte dankend sowohl den Kaffee als auch den Tee ab. Wobei er schon gerne einen ordentlichen Tee getrunken hätte. Doch das müsste warten, bis er in seinem Büro war. Pünktlich um halb acht musste er schließlich erst einmal die Dienststelle aufsperren. Da hatte er jetzt keine Zeit mehr für ein Kaffeekränzchen und schon gar nicht für einen ordentlichen Friesentee. So ein traditioneller Tee brauchte schließlich seine Zeit. Den musste man in Ruhe genießen. Was halfen die dicksten Kluntje darin, wenn der Zucker keine Zeit bekam sich aufzulösen? Nein, er wollte jetzt endlich wissen, weshalb Martin von Schlechtinger schon so früh hier war.
Onnos Blick fiel auf ein rostiges Eisending, das neben Martins Kaffeetasse auf dem Tisch lag und nach dem der Kölner nun griff.
„Ich hatte gedacht, ich bring dir dat noch kurz vorbei, bevor ich uf die Maloche muss, Onno“, meinte der und hielt ihm das Ding hin.
Onno betrachtete es mit zusammengekniffenen Augen.
„Und was soll ich damit anstellen, wenn die Nachfrage erlaubt ist?“, äußerte er sich skeptisch.
Das Metallding erinnerte ihn an ein altes Fangeisen, wie man sie gelegentlich in diesen Dokumentationen im Fernsehen aus Alaska und dem Wilden Westen sah. Aber was zum Teufel sollte er damit hier auf Langeoog fangen? Für Gauner und Verbrecher war so ein Fangeisen eher ungeeignet. Außerdem gab es hier auf der Insel überhaupt keine großen Verbrechen. Onnos Tagesgeschäft bestand in der Hauptsache aus der Aufnahme von Fahrradunfällen mit und ohne Personenschäden.
„Stell dir vor, Onno, Martin hat diese grässliche Falle draußen in den Dünen gefunden. Irgendwer hat sie da aufgestellt, ein Hund ist hineingetreten und hat sich ganz schlimm an der Pfote verletzt“, mischte sich Tine ein.
„Ein Hund … verletzt … wo?“, fragte Onno erstaunt, nahm nun doch das Fangeisen von Martin entgegen und betrachtete es genauer. Deutlich waren noch Spuren von Blut und einige Haare daran zu erkennen. Das war ja mal ein Ding! So etwas war ihm noch gar nicht untergekommen. Schon gar nicht hier auf seiner Insel. Onno spürte, wie sich sein Puls beschleunigte. Dies war ein Fall von Tierquälerei, dem er auf der Stelle nachgehen musste. Da würden die ramponierten Radfahrer heute einmal warten müssen.
„Kannst du mir zeigen, wo du das genau gefunden hast?“, fragte er Martin.
„Dat war draußen in Höhe der Melkhörndüne. Vom Strand aus gesehen rechts vom Weg, hinter der ersten Dünenreihe“, versuchte Martin zu erklären.
Nun ja, für einen Handwerker wie den Kölner war die Beschreibung schon in Ordnung. Doch so ein Kriminalist, wie Onno einer war, brauchte es schon ein wenig genauer.
„Maddin, ich würde sagen, wir fahren da jetzt mal hin und schauen uns die Stelle an. Vielleicht gibt es noch verwertbare Spuren, die wir sichern können“, schlug er daher vor.
Martin blickte auf die Küchenuhr an der Wand.
„Nee, ming Fründ, dat geht jetzt aber nit mehr. Dat is ja gleich schon halb acht. Um acht fängt die Arbeit an. Wir haben Saison. Dat tät der Frau Annemarie gar nit passen, wenn ich da zu spät kommen tät. Und außerdem muss ich noch schnell heim, mich frisch machen, wegen dem Sand in der Ki… Hose“, wiegelte Martin ab.
Onno verzog das Gesicht. So, wie Martin sich das vorstellte, ging das aber nicht. Diese Fallen waren in Deutschland verboten, da war er sich ganz sicher. Wenn jemand so ein Ding in den Dünen vergrub, dann war das eine Straftat. Da gab es nichts zu diskutieren. Onno würde aktiv werden müssen. Ob er wollte oder nicht. Das Wichtigste bei ordentlichen Ermittlungen war die sofortige Sicherung der Beweise am Tatort. Da Martin ein wichtiger … wenn nicht gar der einzige ... Zeuge war, musste der jetzt also mit. Andererseits kannte Onno aber auch Annemarie Hansen. Die würde seinem Freund Martin ganz schön Dampf machen, wenn der zu spät zur Arbeit kam. Da war es egal, ob die beiden ein Paar waren oder nicht. Dienst war Dienst und Schnaps war Schnaps. Wer wusste das besser als Onno. Er würde also erst einmal mit Annemarie reden und ihr erklären müssen, dass er Martin für wichtige Ermittlungen brauchte.
„Sag mal, Maddin. Wo ist denn das andere Beweismittel?“, fragte er jetzt erst einmal.
„Wat für ein anderes Beweisdingens meinst du?“ Martin runzelte die Stirn.
„Na, der Hund. Der, von dem das Blut und die Haare stammen“, wurde Onno konkret.
„Ach, du meinst den Lumpi? Na, den hab ich befreit und laufen lassen“, erzählte Martin und klang dabei auch noch sehr stolz auf seine Tat.
„Ja, sag mal … du kannst doch nicht einfach das Beweismaterial laufen lassen“, schimpfte er den Kölner.
„Wieso? Der Lumpi kann doch gehen, wohin der will. Dat is doch ein freies Land. Der wollte auch nit mit bei den Tierdoktor. Ich hab den extra ein paarmal gefragt. Aber der hat den Kopp geschüttelt, und fort war der. Aber wie meine Mama schon immer jesaht hät: ,Wer nit will, der hät schon‘“, entgegnete Martin.
Onno schüttelte fassungslos den Kopf. Dieser Fall fing ja schon gut an. Er zog einen Bleistift und das winzige Notizbuch aus seiner Gürteltasche und begann zu notieren.
Zuerst den Namen des Hundes.
Lumpi. Also ein Rüde. Das war schon mal klar. Hündinnen hießen ja nicht Lumpi, sondern Lumpine … oder so ähnlich.
„Gut, Martin. Der Hund heißt also Lumpi. Weißt du denn, wem er gehört?“
Das Kölner Urgestein schüttelte den Kopf.
„Nee, keine Ahnung. Der war ja allein“, antwortete er.
„Und woher weißt du dann, wie er heißt? Er wird dir das ja wohl nicht gesagt haben“, fand Onno es jetzt schon merkwürdig.
„Na weil … weil der eben aussah, wie einer, der so heißt, aussieht. Dat is doch aber jetzt auch egal“, fand Martin.
Onno stöhnte. Nein, das war nicht egal.
„Okay, Martin. Dann beschreib ihn mal. Wie sah er denn aus?“
Martin überlegte und rutschte dabei unruhig auf dem Stuhl hin und her, als hätte er Hummeln in der Hose.
„Der war schwarz. Komplett schwarz. Bis auf die Nase und die Pfoten. Die waren weiß“, wusste er.
„So einer mit etwas längerem Fell?“, hakte Onno nach. Ihm schwante gerade etwas.
„Genau. Der war so ein bisschen zusselig.“
„Zusselwas?“, verstand Onno jetzt überhaupt nicht, was Martin meinte.
„Ja, su sät man in Kölle, wenn der su ... su …na, du weißt schon wie is …“
„Strubbelig“, half Tine aus, und Martin nickte zustimmend.
„Na super. Das war bestimmt Ronja vom Alsterberg“, stöhnte Onno.
„Wer? Ronja von wem … Wer is dat dann?“, verstand Martin wieder einmal nicht die Tragweite seiner Tat.
„Ronja vom Alsterberg, mein bester Maddin, ist der Hund der Familie von Bubenheim. Der ist vor vier Wochen ausgebüchst und wird seitdem per Steckbrief gesucht. Für die Ergreifung haben die Eigentümer eine Belohnung von zweihundert Euro ausgesetzt“, belehrte Onno den Freund.
Martins Augen weiteten sich.
„Wat? Zweihundert Euro? Dat is aber schon ne Menge Jeld. Wat hat der dann angestellt, dat der gesucht wird?“, stieß er aus.
„Ja nichts. Er ist den Leuten halt weggelaufen, als die hier auf Langeoog ihre Ferien verbracht haben. Das stand doch sogar im Inselkurier“, erklärte Onno und schüttelte dann wegen Martins Unwissenheit fassungslos den Kopf.
Kapitel 2
Juli 2017
Haus von Annemarie Hansen/Insel Langeoog
Annemarie Hansen sah besorgt auf die Uhr. Es war jetzt zwanzig vor acht. Wo Martin bloß so lange blieb? Sie beide verließen seit zwei Jahren jeden Morgen gemeinsam das Haus, um ihrem Morgensport nachzugehen. Sie selbst joggte dann immer eine Stunde am Strand, während Martin sich auf seinen Drahtesel schwang, um eine Runde zu drehen. Anschließend, wenn sie beide wieder zu Hause waren, machten sie sich frisch, frühstückten ausgiebig und gingen dann zur Arbeit. So war es immer … außer heute. Sie schob die Gardinen beiseite und spähte nach draußen. Was, wenn ihm etwas zugestoßen war? Martin war ein Mann Anfang fünfzig, leicht übergewichtig und ernährte sich auch nicht wirklich gesund. Er war also ein prädestinierter Kandidat für einen Herzinfarkt. Zudem wusste sie, dass er in den Sommermonaten morgens nicht nur mit dem Rad unterwegs war, sondern, wenn die Tide es erlaubte, auch gerne einmal im Meer baden ging. Sie hatte im Gezeitenkalender nachgesehen, heute um sechs Uhr achtzehn war Hochwasser gewesen. Perfekte Bedingungen für ein morgendliches Bad in der Nordsee. Aber was, wenn er in dem kalten Nordseewasser einen Infarkt erlitten hatte und ertrunken war?
„Nein, Annemarie, es ist alles in Ordnung. Martin hat sich lediglich irgendwo festgequasselt und wird bestimmt gleich nach Hause kommen“, redete sie sich selbst zum wiederholten Male gut zu. In solchen Momenten schwemmten in ihr immer die Erinnerungen an die Sturmnacht im Oktober 2004 an die Oberfläche. Sie und Heiner waren am Abend bei einem Konzert auf dem Festland gewesen. Bei der Rückfahrt war es dann passiert. Heiner war über Bord gegangen. Von einem Moment auf den anderen war er aus ihrem Leben verschwunden. Gerade noch hatte er an der Reling gestanden, dann war ein schwerer Brecher über das Schiff geschlagen und Heiner war verschwunden. Zumindest glaubte sie, dass es so gewesen war. Annemarie konnte sich an den genauen Ablauf des Unglücks und die Stunden danach nicht mehr richtig erinnern. Sie waren aus ihrem Hirn beinahe ausgelöscht. Kein totaler Filmriss. Nein, so würde sie es nicht beschreiben. Der Film war lediglich beschädigt und stark verschwommen. Ihr Arzt hatte gemeint, dies sei normal. Eine Schutzfunktion des Gehirns, um solche Ereignisse besser zu verarbeiten. Bei Annemarie war es so extrem, dass sie noch nicht einmal mehr wusste, wie sie es geschafft hatte, die ANNE II zurück in den Hafen zu manövrieren. Auch an den Notruf, den sie selbst bei der Küstenwache abgesetzt hatte, konnte sie sich nicht mehr erinnern. Onkel Piet, der Käpt’n, hatte sie morgens bewusstlos im Steuerhaus des alten Krabbenkutters gefunden. Daran konnte sie sich wieder erinnern. Zumindest so ein bisschen. Und an die Welle, die ihr Leben verändert hatte. Die war nachts öfter in ihren Träumen präsent. Doch Annemarie hatte in den letzten Jahren auch das Gefühl, dass es besser, seltener wurde.
Was sie genau wusste, war, dass sie es nicht noch einmal überstehen würde, ihren Partner an die See zu verlieren. Dass sie sich überhaupt noch einmal verlieben könnte, hatte sie bis zu dem Tag, an dem Martin ihr über den Weg lief, selbst nicht geglaubt.
Ungeduldig sah sie auf die Uhr. Gleich Viertel vor acht. Sie musste los. Verflixt, wo blieb der denn bloß? Wenn Martin nach Hause kam, dann würde sie ihm die Meinung geigen, dass ihm Hören und Sehen verging. Als ob sie nicht schon genug zu tun hätten. Sie sah auf den Küchentisch, wo neben seinem unbenutzten Frühstücksgedeck sein Mobiltelefon lag. Sie konnte ihn ja noch nicht einmal anrufen. Sie spürte, wie die Sorge ihr beinahe die Luft zum Atmen nahm. Vielleicht sollte sie Krischan anrufen und ihn bitten, raus zur Melkhörndüne zu fahren, um nach Martin zu suchen. Dort war Martins Lieblingsbadeplatz.
Draußen vor dem Haus vernahm sie das vertraute Quietschen von Fahrradbremsen und spürte, wie ihr augenblicklich ein riesengroßer Stein von der Seele purzelte. Sie kannte dieses Quietschen wie kein anderes. Das alte schäbige Rad von Martin würde sie aus Tausenden anderen heraushören. Damit könnte sie glatt bei ‚WETTEN DASS‘ auftreten, wenn es die Sendung noch geben würde. Sie stürzte ans Fenster, schob die Gardinen beiseite und sah hinaus. Dem Himmel sei Dank, er war es tatsächlich. Aber nanu? Martin war nicht alleine. Bei ihm war Onno Federsen, der Inselpolizist. Annemarie spürte sogleich wieder, wie die Unruhe zurückkehrte. Was wollte die Polizei denn schon so früh morgens hier bei ihr? Was könnte passiert sein? War etwa was mit Krischan, ihrem Ziehsohn, oder mit Lotta, seiner Verlobten? Lotta war schwanger, und in sechs Wochen sollte das Baby kommen. Annemarie rannte in den Flur und riss die Haustüre auf.
„Ist etwas passiert?“, fragte sie die beiden Männer, die sie erstaunt anblickten, als sei sie ein Geist. Onno nickte, während Martin beruhigend abwinkte und den Kopf schüttelte.
„Nix Schlimmes, Annemariechen. Halb so wild. Et is alles jot. Et is nur wegen dem Lumpi und der Falle in den Dünen“, plapperte Martin wirres Zeug.
„Der Martin ist Zeuge einer Straftat geworden. Wir wollten nur eben Bescheid geben, dass wir noch einmal zum Tatort müssen, wegen der Sicherung der Spuren und Beweise“, mischte sich Onno ein. Annemarie sah von dem einen zum anderen.
„Sag mal … habt ihr etwa am frühen Morjen schon einen über den Durst getrunken oder warum schnackt ihr hier wirres Zeugs?“, schimpfte sie jetzt einfach mal, da es ihr tatsächlich so vorkam.
„Nee, nee, kein Tröpfchen. Ich schwör“, antwortete Martin hastig und blickte Hilfe suchend zu Onno.
Der machte sich derweil an den dicken Gepäcktaschen seines Rades zu schaffen. Annemarie beobachtete, wie er einen durchsichtigen Mülleimerbeutel mit einem kantigen Gegenstand darin hervorholte.
„Wir haben einen schweren Fall von versuchter Wilderei und Tierquälerei hier auf der Insel“, erklärte Onno und hielt die Tüte in die Höhe.
Annemarie trat näher und besah sich das seltsame Ding.
„Dat is eine Bärenfalle. Die hat einer in den Dünen verbuddelt, und der Lumpi ist da reingetreten“, quasselte Martin.
„Eine Bärenfalle? In den Dünen? Hier auf Langeoog?“, fragte Annemarie ungläubig. Das war nun wirklich ein starkes Stück.
„Ja, sag ich doch“, ereiferte sich Martin. „Dat Pfötchen vom Lumpi … dat hätte ab sein können.“
„Wer zum Kuckuck ist denn dieser Lumpi?“, wollte Annemarie jetzt erst einmal wissen, da ihr der Name so gar nicht geläufig war.
„Martin meint Ronja vom Alsterberg, den Hund der Familie von Bubenheim“, erklärte Onno, und Annemarie begann langsam zu begreifen.
„Ach, ist das nicht dieser schwarz-weiße Border Collie? Der, der vor einigen Wochen dieser Familie aus Hamburg entlaufen ist?“, glaubte sie zu wissen. Sie hatte von dem Vorfall bereits gehört und war dem Hund sogar schon einige Male bei ihrem morgendlichen Dauerlauf begegnet. Ein sehr scheues Tier, das den Kontakt zu Menschen zu meiden schien. Sie war ihm noch nie näher als einhundert Meter gekommen, und das war, wenn sie es recht überlegte, auch gut so. Hunde waren noch nie Annemaries Fall gewesen. Noch dazu so ein großer wie dieser schwarze Border Collie. Als sie ihn zum ersten Mal ganz alleine morgens am Strand gesehen hatte, war sie schon ziemlich erschrocken gewesen. Sie hatte sich umgedreht und war zurück in Richtung Dorf gelaufen. Natürlich nicht, ohne sich zigmal umzudrehen. Zum Glück war der Köter ihr aber nicht gefolgt.
„Und dieser Hund ist jetzt also endlich eingefangen worden“, schlussfolgerte sie erleichtert, obwohl es ihr natürlich schon irgendwie leidtat, dass das Tier dabei verletzt worden war, wie Martin sagte.
„Ja, genau. Das ist er. Er ist in die Falle getreten. Allerdings hat Martin ihn befreit und wieder laufen lassen“, antwortete Onno zähneknirschend und sah dann sehr vorwurfsvoll zu Martin.
„Du hast ihn wieder laufen lassen?“, schimpfte Annemarie und war jetzt doch ein wenig schockiert von dem, was ihr Liebster getan hatte.
„Ja … nee … wat hätte ich denn tun sollen. Der arme Kerl wollt ja net mitkommen. Ich hab den ja extra jefragt … Wejen dem Pfötchen … und …“
„Du hast ihn gefragt, ob er mitkommen will, und dann wieder laufen lassen“, stieß Annemarie fassungslos aus. Sie schüttelte den Kopf. Manchmal zweifelte sie wirklich an Martins Verstand. Doch es war jetzt eh egal. Das Vieh war wieder weg, und sie mussten zur Arbeit. Um acht musste sie in ihrem Büro sein. Gleich mit der Fähre würden neue Urlauber kommen. Die mussten samt ihrem Gepäck vom Inselbahnhof abgeholt werden. Da hatte sie keine Zeit, sich auch noch Gedanken um entlaufene Hunde zu machen. Sollte Onno doch einen Hundefänger mit dem Fall beauftragen.
„Martin und ich … wir fahren dann mal eben schnell noch zur Spurensicherung an den Strand“, meinte der Polizist jetzt auch noch, während er die Bärenfalle wieder in eine der Taschen an seinem Gepäckträger stopfte.
„Nix da. Für so einen Unfug ist jetzt keine Zeit. Mit der Acht-Uhr-Fähre kommen neue Gäste. Außerdem muss Martin noch die Heizungsanlage im alten Hempel-Haus einbauen. Da sind wir eh schon hinter Plan. Wir haben Arbeit genug, auch ohne so ein Gedöns“, entschied sie.