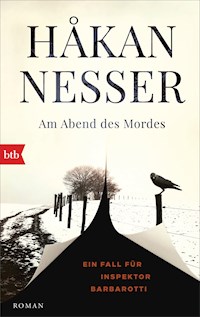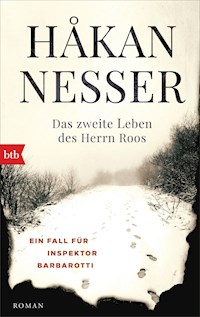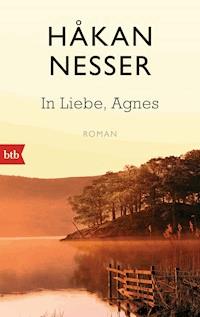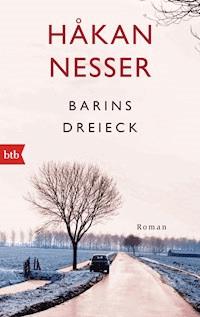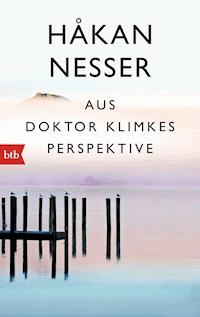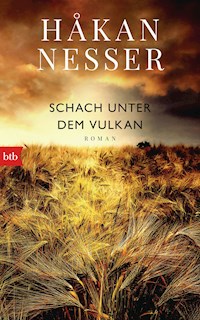
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gunnar Barbarotti
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Leser des erfolgreichen Autors Franz J. Lunde sind sich sicher: Wer einen Mord so schildert, muss ihn selbst begangen haben. Lunde, der an einem Manuskript mit dem Titel »Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers« arbeitet, fühlt sich von seinem Publikum bedroht. Nach einer Lesung in Kymlinge ist er plötzlich spurlos verschwunden. Kurze Zeit später wird die bekannte Lyrikerin Maria Green vermisst. Auch sie hinterlässt ein rätselhaftes Schriftfragment. Die Polizei tappt im Dunklen, bis ein halbes Jahr später der Autor und Literaturkritiker Jack Walde unauffindbar ist. Was verband diese drei Schriftsteller? Was ist ihnen zugestoßen? Kommissar Barbarotti fördert trotz erschwerter Bedingungen Erstaunliches zu Tage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Ähnliche
Zum Buch
Die Leser des erfolgreichen Autors Franz J. Lunde sind sich sicher: Wer einen Mord so schildert, muss ihn selbst begangen haben. Lunde, der an einem Manuskript mit dem Titel »Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers« arbeitet, fühlt sich von seinem Publikum bedroht. Nach einer Lesung in Kymlinge ist er plötzlich spurlos verschwunden. Kurze Zeit später wird die bekannte Lyrikerin Maria Green vermisst. Auch sie hinterlässt ein rätselhaftes Schriftfragment. Die Polizei tappt im Dunklen, bis ein halbes Jahr später der Autor und Literaturkritiker Jack Walde unauffindbar ist. Was verband diese drei Schriftsteller? Was ist ihnen zugestoßen? Kommissar Barbarotti fördert trotz erschwerter Bedingungen Erstaunliches zu Tage.
Zum Autor
HÅKAN NESSER, geboren 1950, ist einer der beliebtesten Schriftsteller Schwedens. Für seine Kriminalromane erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, sie sind in über zwanzig Sprachen übersetzt und mehrmals erfolgreich verfilmt worden. Håkan Nesser lebt abwechselnd in Stockholm und auf Gotland.
HÅKAN NESSER
Schach unter dem Vulkan
Roman
Aus dem Schwedischen von Paul Berf
Einleitende Bemerkung
Die Stadt Kymlinge existiert nicht auf der Landkarte. Desgleichen sind alle wichtigeren Personen, die meisten Ereignisse sowie Wetterbeobachtungen in der vorliegenden Erzählung frei erfunden. Möglicherweise sind die Kommissare Gunnar Barbarotti und Eva Backman etwas weniger fiktiv, weil sie auch früher schon dabei waren.
Menschen, die Bücher schreiben, denkt er, wollen keine eigene Geschichte haben. Warum denn auch? Im Vergleich mit dem Geschriebenen wäre sie doch stets nur schal und ausdruckslos erschienen.
Olga TokarczukAus Die Jakobsbücher
I. Oktober – November 2019
1
Die Wirklichkeit
Um Viertel nach zehn an einem Abend Ende Oktober liegt der recht erfolgreiche Schriftsteller Franz J. Lunde bekleidet und rücklings auf einem Hotelbett in einer mittelschwedischen Stadt.
Das heißt, nicht in einem Mantel, einem Jackett und mit Schal; diese Kleidungsstücke hängen an Haken an der Tür. Die Schuhe liegen abgestreift auf dem Fußboden. Seit zehn Minuten betrachtet er einen unregelmäßigen Stockfleck an der Decke – der vage an die zu der Inselgruppe der Kapverden gehörende Insel Santiago erinnert, die er Ende der Neunzigerjahre besucht hat –, während er intensiv nachdenkt. Intensiv und nicht ohne Sorge, das hat seine Gründe.
Dann atmet er so tief durch, dass es beinahe einem Seufzer gleichkommt, streckt einen Arm aus, ohne den Kopf vom Kissen zu heben, und zieht Stift und Notizbuch aus der dünnen Aktentasche, die an das Bett gelehnt steht. Das Notizbuch ist noch unbenutzt und erinnert an zahlreiche andere Notizbücher auf der Welt. Es ist schwarz und hat einen festen Einband. Im A4-Format. Er setzt eine Hornbrille auf und beginnt zu schreiben.
Das einzige wirksame Mittel gegen die Angst, zumindest in seinem Fall.
Die Dichtung: Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers
John Leander Franzén war nicht nur Schriftsteller. Er war außerdem Narzisst, auf der Schwelle zum Psychopathen.
Ersteres, die Schriftstellerei, war der Bücher lesenden Öffentlichkeit wohlbekannt, Letzteres war ein einigermaßen gut gehütetes Geheimnis. Wie man so sagte. Das Geheime war zumindest eine Hoffnung, die er selbst hegte, auch wenn sich aus gutem Grund annehmen ließ, dass seine frühere Ehefrau genau wie ein, zwei frühere Freunde der bitteren Wahrheit wohl auf die Spur gekommen waren. Wie man auch sagte. Psychopath war im Übrigen ein Modewort, das so häufig missbraucht wurde, dass es auf dem besten Weg war, noch den letzten Rest an Bedeutung zu verlieren.
Aber egal. Inzwischen, seit er zur Gemeinschaft der über Fünfzigjährigen gehörte, hatte JLF – wie er oft angesprochen und genannt wurde, im kleinen Kreis, aber auch in größeren Kreisen – sowohl seine Frau als auch die meisten Freunde hinter sich gelassen. Er lebte in angenehmer Abgeschiedenheit in einer mittelgroßen, mit Bücherregalen bestückten Wohnung in einem Haus aus der Jahrhundertwende in Södermalm in Stockholm, der Stadt und dem Stadtteil, wo er einst aufgewachsen und wohin er zurückgekehrt war, als sein literarisches Werk eine solche Dignität erreicht hatte, dass er sich von seiner Stelle als Lehrer am Gymnasium in Norrköping verabschieden konnte, an dem er knapp zwei Jahrzehnte gearbeitet hatte. Natürlich war ein Narzisst/Psychopath besser für die einsame Rolle des Schriftstellers als für den Platz am Lehrerpult geeignet, das dürfte wohl jedem klar sein.
An diesem speziellen Abend dachte er allerdings weder über seinen Beruf noch über seinen Charakter nach. Es war Viertel nach zehn, er lag rücklings auf einem Hotelbett in einer mittelschwedischen Stadt, während er einen Stockfleck an der Decke betrachtete – der vage an eine Insel im Atlantik erinnerte, die er möglicherweise vor etlichen Jahren besucht hatte – und sich zu erinnern versuchte, wie diese Frau ausgesehen hatte. Sie, die ihm kurz vor Ende der Veranstaltung diese Frage gestellt und ihn dazu gebracht hatte, die Fassung zu verlieren.
Klein und dunkelhaarig? Das glaubte er, war sich aber nicht sicher. Um die fünfzig? Vielleicht, aber sie hätte ebenso gut vierzig oder sechzig sein können. Ihre Stimme war eher im Altbereich angesiedelt, hätte fast die eines Mannes sein können und klang auf falsche Weise angenehm. Sie passte schlecht zu dem, was sie tatsächlich sagte, sehr schlecht.
JLF verlor eigentlich nie die Fassung, zumindest nicht bei seinen Auftritten als Schriftsteller. Er konnte auf mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung zurückblicken und war vor sicherlich mehr als hundert verschiedenen Versammlungen aufgetreten. Große wie kleine – Tage des Buchs, literarische Salons und simple Lesungen in Bibliotheken an Orten, von denen er vorher nicht gewusst hatte, in welcher Landschaft oder Himmelsrichtung sie zu finden waren. Wie an diesem Abend: der Freundeskreis der städtischen Bibliothek in Ravmossen.
Wer zum Teufel hatte jemals von Ravmossen gehört? Ein so kleines Kaff, dass man ihn zu einer nahe gelegenen Stadt gefahren hatte, um ihn in einem anständigen Hotelzimmer unterbringen zu können. Anständig, aber auch nicht mehr. Er wandte den Blick von dem Fleck an der Decke ab, richtete sich halb auf, nahm einen gehörigen Schluck von dem mittelmäßigen spanischen Rotwein, den die Veranstalter ihm zum Dank überreicht hatten, und begann sich auszuziehen.
Blieb jedoch in dieser schrägen Haltung sitzen. Versuchte, sich mit einem leicht feuchten Strumpf in jeder Hand die genaue Formulierung ins Gedächtnis zu rufen.
»Herr Franzén, ich habe gerade ein Buch von Ihnen gelesen, in dem Sie einen perfekten Mord beschreiben. Und wissen Sie was, ich hatte fast das Gefühl, dass Sie ihn begangen haben. Trifft diese Annahme zu?«
Die Wirklichkeit
Franz J. Lunde legt seinen Stift auf den Nachttisch und liest sich sorgsam die zwei Seiten durch, die er geschrieben hat. Herausreißen und in den Papierkorb werfen oder weitermachen? Das ist hier die Frage.
Fünf Jahre zuvor, oder vielleicht auch nur drei, hätte er ohne größeres Zögern den Papierkorb gewählt, aber im Moment ist die Situation eine andere. Seit mehr als zwei Jahren hat er keine tragfähige Idee mehr gehabt und seinem Verlag bis Weihnachten ein Manuskript versprochen. Sechzig, siebzig Seiten, keinesfalls mehr als hundert, es geht um ein kleineres Werk, das im April in Druck gehen soll, wenn der Verlag eine Art Jubiläum feiert. Eine Novelle folglich, eine ungewöhnlich lange Novelle oder ein ungewöhnlich kurzer Roman.
So ist es abgesprochen worden. Er hat völlig freie Hand; seine Lektorin Rachel Werner hat ihm ihr berühmtes sphinxartiges Lächeln geschenkt und ihm versichert, das wäre ja noch schöner, einem Schriftsteller vom Kaliber Lundes lege man nicht so ohne Weiteres Ketten an. Ketten und Rahmen seien für Anfänger und Dilettanten, nicht für etablierte und gefeierte Autoren mit großem Publikum und Übersetzungen da und dort.
Die Hälfte des Vorschusses ist bereits ausbezahlt worden, den Rest erhält er bei Abgabe eines satzreifen Manuskripts. Erst vor einer Woche hat Franz J. mit Rachel in der Opernbar zu Mittag gegessen und ihr bei der Gelegenheit versichert, er sei auf einem guten Weg. Kein Problem, nicht das geringste.
Dass er im Moment mehr oder weniger abgebrannt ist, bildet zwar ein Problem, aber von anderer Art. Nichts, worüber man sich mit seiner Lektorin unterhält, ganz sicher nicht. Jedenfalls nicht mit einer Lektorin wie Rachel Werner.
Er schließt die Augen und beschwört ihr Gesicht vor seinem inneren Auge herauf. Versucht auch heraufzubeschwören, wie sie ohne einen Fetzen am Leib aussehen müsste, was ihm jedoch nicht recht gelingen will. Stattdessen liest er sich die beiden Seiten noch einmal durch. Vielleicht doch nicht so dumm?
Aber die Sorge nagt an ihm, will sich nicht legen. Er steht auf und holt die zweite Weinflasche aus der Minibar, schraubt sie auf und schenkt sich ein Glas ein. Wenn er die untere Grenze anpeilt, sechzig Seiten, fehlen ihm nur noch achtundfünfzig. Bis Heiligabend sind es noch ungefähr zwei Monate. Eine Seite am Tag, wie schwer kann das sein? Wenn er beim Schreiben der Geschichte in Schwung kommt, kann es sogar sein, dass er siebzig oder achtzig zusammenbekommt. So läuft es doch immer, jedes Mal ist es diese anfängliche Trägheit, die überwunden werden muss, nicht? Man kennt doch seine Pappenheimer, sowohl Böll als auch Borges ging es mit Sicherheit genauso.
Er trinkt einen Schluck und greift erneut zum Stift. Was die nächsten Seiten betrifft, ist es im Übrigen nicht sonderlich schwer; er braucht sich nur an das zu halten, was vor … er sieht auf seine Armbanduhr … vor gerade einmal zwei Stunden tatsächlich passiert ist.
Sogar Ravmossen ist ja die reine Wahrheit.
Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers
»Verzeihung? Könnten Sie das bitte wiederholen?«
Das konnte sie.
»In dem Buch, das ich gelesen habe und das Sie geschrieben haben, wird ein perfekter Mord verübt … jedenfalls wird er so genannt. Ich hatte das Gefühl, dass Sie das tatsächlich erlebt haben. Stimmt das?«
Ein etwas anderer Wortlaut als beim ersten Mal, aber das spielte natürlich keine Rolle. Die Botschaft war glasklar. JLF erinnerte sich, dass er sich umständlich geräuspert und versucht hatte, die Frau zu mustern, bevor er antwortete. Das Räuspern lief gut, das Mustern weniger gut, weil sie offenbar ganz hinten im Raum saß und er seine Brille nicht anhatte. Damit zollte er nicht etwa seiner Eitelkeit Tribut, er mochte es nur einfach nicht, seine Leser allzu deutlich zu sehen. Es hatte sich mit den Jahren so ergeben.
»Hrrm. Natürlich nicht. Was deuten Sie da eigentlich an?«
»Ich deute gar nichts an. Es ist eine ganz einfache Frage, nicht? Haben Sie tatsächlich …?«
Dann hatte der Moderator eingegriffen. Ein Herr um die siebzig mit schütterem Haar. Axelryd oder so ähnlich. Ein alter gelblicher Anzug aus Cord, außer einer einleitenden einminütigen Präsentation hatte er nicht viel beigetragen. Wie üblich hatte JLF die Zügel in der Hand gehalten und den Abend allein bestritten. Annähernd eine Stunde lang, auch das wie üblich und wie abgesprochen.
»Liebe Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr heute gekommen seid … und ganz besonders danken wir natürlich unserem verehrten Gast, John Leander Franzén, der uns einen interessanten Einblick in die seltsame … Welt des Schreibens gewährt hat. Ich denke, wir bedanken uns mit einem tosenden Applaus!«
Von tosend konnte man eher nicht sprechen, dachte JLF und betrachtete seine Strümpfe. Aber das wäre auch gar nicht möglich gewesen; der Raum war eng und die Luft schlecht gewesen, zwar war er bis auf den letzten Platz gefüllt, aber mehr als siebzig Zuhörer dürften kaum Platz gefunden haben. Die meisten waren Frauen jenseits der Wechseljahre gewesen, wie immer. Sicherlich aus dem Bildungsbürgertum, aber viel zu anämisch, um etwas zustande zu bekommen, was tosend genannt werden konnte.
Zweiundzwanzig verkaufte und signierte Bücher. Vielleicht war die Fragestellerin eine derjenigen gewesen, die ihr Buch signieren lassen wollten, aber das stand in den Sternen. Und zweiundzwanzig war eine gute Quote, wenn man bedachte, dass es nichts Neues aus seiner Feder gab. Die Buchhändlerin, eine große, dunkelhaarige Frau mit einem leichten Akzent, vermutlich einem slawischen, war zufrieden gewesen. Hatte ein Selfie gemacht und ihn umarmt. Ein wenig inniger, als die Situation es erforderte, fand er.
Ja, bestimmt ein slawischer.
Er leerte das Weinglas und machte sich bettbereit. Warf Unterhose und Socken in den Papierkorb. Schlüpfte unter die Decke, löschte das Licht, stellte fest, dass er Sodbrennen vom Wein hatte und die Frage ihm einfach keine Ruhe lassen wollte.
Auf der Autofahrt von Ravmossen zurück zum Hotel war die Sache nämlich noch einmal zur Sprache gekommen.
»Eine komische Frage hat sie da am Ende gestellt. Die eine Dame da.«
Der Mann, der ihn fuhr, war klein und krumm. Er hatte etwas Mausartiges und hätte an Humphrey Bogart erinnern können, wenn er nicht mit småländischem Dialekt gesprochen hätte. Anfangs hatte JLF geglaubt, er würde sich verstellen, dass sein breiter Dialekt ein Witz sein sollte, aber so war es nicht.
»Kennen Sie sie?«
»Nee. Die kommt nicht aus Ravmossen.«
Er hatte sich damit begnügt zu nicken. Bereute, dass er sich nicht auf die Rückbank gesetzt und darum gebeten hatte, dass man ihn in Ruhe ließ. Aber es war, wie es war, von Psychopathen wurde erwartet, dass sie nett waren, wenn sich ihnen die Gelegenheit dazu bot. Eine unausgesprochene Anforderung vielleicht, aber trotzdem. Meine Persona, dachte er und fragte sich, warum ihm ausgerechnet dieses Wort in den Sinn kam.
»Irgendwie impertinent.«
»Was?«
Das war ein unerwartetes Wort, und der Fahrer sah sich veranlasst, seine Bedeutung zu erklären.
»Frech, könnte man sagen.«
»Sicher, die Bedeutung ist mir bekannt …«
»Als ob Sie …«
Er hatte den Satz nicht beendet, und JLF hatte es vorgezogen zu schweigen. Hatte sein Handy herausgeholt und eine Weile das Lesen wichtiger Mails simuliert. Er hatte während des ganzen Abends nur eine einzige erhalten. Sie kam von einem Gebirgshotel, das ihn aufforderte, Weihnachten dort zu feiern. Umgeben von Weihnachtswichteln und Trollen, glitzerndem Schnee, dem Teufel und seiner Großmutter. Aber er achtete darauf, das Smartphone so zu halten, dass Humphrey Bogart keinen Blick auf das Display werfen konnte. Nach fünf Minuten stiller Fahrt begann es zu regnen. Die Scheibenwischer des Autos ließen einiges zu wünschen übrig, und JLF überlegte, ob es nun enden würde. Ob dies seine allerletzte Autofahrt und seine letzten Minuten im Leben sein würden. Es war ein Gedanke, der gelegentlich auftauchte, und eines Tages würde er sicher vollkommen adäquat sein.
Diesmal jedoch nicht. Sie erreichten wie vorgesehen das Hotel.
»Danke für einen interessanten Abend«, sagte Humphrey und hielt die Tür auf. »Um die Rechnung brauchen Sie sich nicht zu kümmern, die ist bezahlt. Aber die Minibar müssen Sie selbst bezahlen.«
Geiziges Småland, dachte John Leander Franzén und eilte unter das Vordach. Obwohl, befand er sich dafür nicht zu weit nördlich? Auf der Höhe von Askersund oder so.
Er seufzte. Drehte sich halb im Bett und begriff, dass der Schlaf auf sich warten lassen würde.
Eine Rockerkarre fuhr mit einem alten Chuck-Berry-Song in voller Lautstärke unten auf der Straße vorbei, und im Nachbarzimmer zog jemand in der Toilette ab.
Die Wirklichkeit
Franz J. Lunde platziert den Stift auf dem Nachttisch und liest sich das Ergebnis durch. Die Rockerkarre kehrt zurück, jetzt aber aus der anderen Richtung. You never can tell, fällt ihm plötzlich ein. So heißt der Song. Er wartet, bis die Musik endgültig verklingt, dann versucht er, seine Gedanken zu schärfen. Bleibt er bei dem Geschriebenen zu nahe an der Wirklichkeit? Zu nahe an sich selbst? Mit Autobiografien konnte er noch nie viel anfangen, mit diesen schweren Klötzen, die in Tümpeln und Meeren aus egozentrischen Plattitüden umhertreiben. Namedropping und verfälschte Erinnerungen. Gleichwohl kann man den Stoff für große Romane eben nur aus der eigenen Vorratskammer holen. Und selbst wenn er in diesem speziellen Fall nicht mehr als sechzig, siebzig Seiten anstrebt, muss die Geschichte natürlich seinen Ansprüchen genügen. Unabhängig von seiner Anwesenheit oder Abwesenheit im Text. Klar wie Kloßbrühe.
Er liest sich das Ganze noch einmal durch und beschließt, dass es das tut. Es genügt seinen Ansprüchen. Angesichts des sensiblen Inhalts muss er von nun an jedoch Vorsicht walten lassen. Das eine oder andere maskieren, so gut es geht, auf dem schmalen Grat zwischen Wahrheit und Humbug balancieren, aber als er die klägliche Nachttischlampe ausschaltet und das Kissen umdreht, kann er letztlich festhalten, dass er tatsächlich fünf Seiten zu Papier gebracht hat. Ungefähr ein Zwölftel, denkt er. Es kommt ins Rollen. Zufrieden mit der Welt im Großen und mit sich selbst schläft er ein, und beginnt praktisch sofort, von einer Frau ohne Gesicht zu träumen. Weit hinten in einer verschwommenen Menschenmenge.
2
Die Wirklichkeit
Der Zug hat eine halbe Stunde Verspätung, und als er endlich zu seinem Sitzplatz in der ersten Klasse kommt, denkt er darüber nach, den Besuch bei seiner Mutter abzublasen. Wenn es auf der Strecke nach Stockholm zu weiteren Verspätungen kommt, was meistens der Fall ist, wird er kaum rechtzeitig bei ihr sein können. Die Besuchszeit geht von fünfzehn bis siebzehn Uhr nachmittags, außer am Wochenende, an dem sie etwas großzügiger ist, und sie nur für ein paar Minuten zu treffen hat wenig Sinn. In der kurzen Zeit wird sie vermutlich nicht einmal begreifen, wer er ist, und falls ihr dieses Kunststück trotz allem gelingen sollte, wird sie mit Sicherheit wütend und unruhig sein, weil er sie so schnell wieder verlassen muss.
Aber sein Schuldballast würde durch den Besuch kleiner, was der wahre Grund dafür ist, dass er sie überhaupt besucht. Ihm ist bewusst, dass dies primitiv ist, aber das schwächt die Wirkung nicht ab.
Wenigstens einmal in der Woche, manchmal auch eine Stippvisite am Sonntag; vier Jahre ist es jetzt her, dass ihre Umnachtung begann, drei, seit sie in dem Pflegeheim draußen in Nacka gelandet ist. Ihr endgültiger Wohnsitz ist nicht billig, er ist ein guter Sohn, der seine Mutter achtet und ehrt. Immer noch, obwohl sie es nicht verdient hat und er während der verwirrten Gespräche mit ihr nie auch nur das Geringste zurückbekommt.
Mit seiner Schwester ist es anders. Linnea, fünf Jahre jünger als ihr Bruder, einst wunderschön und von hundert Freiern umschwärmt. Sie entschied sich für einen Typen aus Luleå, wurde schwanger, noch bevor sie einundzwanzig war, und zog in den Norden. Sie hatte eine Fehlgeburt, wechselte zu einem neuen Typen aus demselben Ort und bekam im Laufe der Zeit vier Kinder. Sie besucht ihre Mutter nie. Schiebt es darauf, dass sie zu weit weg lebt, eine Reise nach Stockholm würde sie mindestens zwei Tage kosten, und wenn man Teenagerkinder, Arbeit und Hunde habe, sei dafür einfach keine Zeit.
Ausgelaugt, pflegt sie zu sagen. Es laugt mich total aus, sie nur zu treffen. Du bist immer schon ihr Liebling gewesen, für mich hat sie sich nie interessiert. Glaube nicht, dass sie sich erinnert, jemals eine Tochter gehabt zu haben. Verdammt.
Der Zug hält mitten auf der Strecke in einem Fichtenwald, und den Fahrgästen wird mitgeteilt, dass man auf ein Signal warte. Franz J. Lunde greift zu seinem schwarzen Notizbuch und seinen Stiften. Anscheinend wird er reichlich Zeit haben weiterzuschreiben, und er denkt, dass er sich zumindest in einem Punkt von dem fiktiven John Leander Franzén unterscheidet. Er ist weder ein Narzisst noch ein Psychopath; ein Mensch mit dieser Ausstattung besucht nicht mehrmals im Monat seine hoffnungslose Mutter. Ein solcher Mensch liebt seine Schwester nicht, obwohl sie es gar nicht verdient hat.
So steht es um diese Dinge.
Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers
John Leander Franzén seufzte erleichtert auf, als er am folgenden Nachmittag seine Wohnung in der Nähe des Mosebacke torg betrat. Meine Burg, dachte er. Mein Schutzwall gegen eine Welt voller Idioten und ahnungsloser Kretins. Sieben Jahre seines Lebens hatte er mit einem solchen Menschen zusammengelebt, er wusste also, wovon er sprach. Sieben verlorene Jahre, aber jetzt war sie fort.
Vieles war fort. Er hatte den Müll aus seinem Leben eliminiert, aber der reine Kern existierte noch, und er war die Quintessenz. Je weniger Unsinn und unnötige Diskussionen, desto deutlicher wurde das wirklich Wichtige. Das war nichts, was Otto Normalbürger begreifen konnte, und JLF hatte den Versuch, es ihn zu lehren, vor langer Zeit aufgegeben. Es bestand keine Veranlassung dazu.
Aber wenn trotz allem der eine oder andere existierte, der die Fähigkeit besaß – möglicherweise die Fähigkeit besaß, musste man wohl ergänzen – zu verstehen, dann wäre es die Mühe wert. Zu der Erkenntnis zu gelangen, dass man Herr über sein eigenes Leben sein konnte, dass die Sklavenmentalität nicht der einzige Weg war … ja, in dem Fall konnten diese Glücklichen die Nahrung, die sie benötigten, in seinen Büchern finden. Wenn sie sich nur zu einer gewissen Anstrengung durchrangen.
Er stellte sich lange unter die heiße Dusche, onanierte und rief Börje an.
»Wollen wir uns in einer Stunde unten beim Griechen treffen?«
Börje erklärte, dies sei ein vortrefflicher Vorschlag.
»Du verstehst, was das bedeutet?«
Sie hatten Bifteki gegessen und eine Flasche Wein von Boutari geleert. JLF hatte eine weitere Flasche bestellt. Börje Fager nickte beiläufig und blinzelte durch seine verschmierten Brillengläser. Erkannte, dass sie verschmiert waren, setzte die Brille ab und rieb sie mithilfe seiner Krawatte sauber. Karierte Krawatte, kariertes Hemd. Allerdings in unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Karogrößen. Vielleicht hatte er seine Brille nicht an, als er sich für den Abend umzog, dachte JLF. Oder er hatte zu Hause keine Spiegel mehr.
Aber immer eine Krawatte. Börje Fager hielt große Stücke auf Stil und Tradition. Oder Geist und Geschmack, wie er selbst gern hervorhob. Sie kannten sich seit der Schulzeit und JLF dachte oft, dass sein Freund so treu war wie eine Warze. Vielleicht hatte er genau diesen Vergleich auch einmal bei irgendeiner betrunkenen Gelegenheit im Laufe ihrer langen Bekanntschaft ausgesprochen, aber Börje war niemand, der einem so etwas übelnahm. Er hatte seinen Platz unter den größeren und kräftigeren Fittichen seines Kameraden gefunden, und so war es geblieben. Franzén und Fager, in dieser Rangordnung. Wer dumm geboren ist, bleibt auch dumm.
»Was sie da angedeutet hat«, verdeutlichte JLF.
»Ja, natürlich«, antwortete Börje und sah zu, dass die Brille wieder an ihren Platz kam. »Nicht gut. Aber …«
»Aber?«
»Aber vielleicht war es auch nur ein spontaner Einfall. Ich meine, es ist ja ein verdammt guter Roman, und weil du so gut schreibst, glaubt man, dass es wahr ist.«
JLF konnte sich nicht verkneifen, das Kompliment zu genießen, obwohl es von Börje kam. Er schwieg eine Weile und dachte nach.
»Genau das ist die Stärke deiner Bücher«, fuhr Börje fort. »Eine von vielen Stärken. Uns Leser mit ins Boot zu holen … sozusagen.«
Er versteht es nicht, dachte JLF. Unglaublich, er kapiert nicht das Geringste.
Oder er spielt Theater. Schließlich ist er in höchstem Maße beteiligt gewesen, ist es wirklich vorstellbar, dass er niemals verstanden hat, welche Rolle er gespielt hat?
Sieben Jahre waren seither vergangen. Fünf seit dem Erscheinen des Buchs. Eine Krankenschwester verschwindet. Er erinnerte sich, dass er mit dem Gedanken gespielt hatte, auf dem Vorsatzblatt »Nach einer wahren Begebenheit« zu ergänzen, aber er war rechtzeitig zur Vernunft gekommen und hatte es gelassen. Es hätte bedeutet, das Schicksal herauszufordern, das Glück mochte zwar dem Mutigen beistehen, aber alles hatte seine Grenzen.
Die Kritiken waren gut gewesen. Er hatte zwei Preise dafür verliehen bekommen, einen schwedischen, einen internationalen. Letzterer war ein polnischer gewesen, und man hätte ihm den Preis sicher nicht verliehen, wenn er nicht bereit gewesen wäre, zu diesem Literaturfestival zu fahren und ihn dort persönlich entgegenzunehmen. In Breslau oder Posen, er wusste nicht mehr, in welcher der beiden Städte.
Und niemand hatte den Zusammenhang gesehen. Niemand hatte die Handlung in Die Krankenschwester, wie er den Roman nannte, mit dem in Verbindung gebracht, was zwei Jahre zuvor mit seiner Frau passiert war.
Erst jetzt. Erst als diese Frau ihre … was hatte er noch gesagt, dieser mausartige Chauffeur? … am Vorabend ihre impertinente Frage gestellt hatte.
»Worüber zerbrichst du dir den Kopf?«, erkundigte sich Börje Fager. »Hast du was mit einem neuen Frauenzimmer am Laufen?«
»Nein, verdammt nochmal!«, platzte JLF so laut heraus, dass er selbst überrascht war und die Gäste am Nachbartisch sich einmütig umdrehten. »Im Gegenteil … ja, genau … im Gegenteil.«
»Jetzt komme ich nicht ganz mit«, gestand Börje Fager.
Nicht am Laufen, dachte JLF. Möglicherweise am Hals.
Doch das war eine allzu elegante Distinktion, um sie an den karierten Börje zu verschwenden, deshalb blieb er stumm und trank stattdessen einen Schluck von dem griechischen Roten.
Die Wirklichkeit
Der Zug erreicht Västerås und hält. Franz J. Lunde seufzt, sieht auf die Uhr und verstaut die Schreibutensilien in der Aktentasche. Halb zwei. Wenn wir in den nächsten zehn Minuten nicht weiterfahren, sage ich den Besuch bei Muttchen ab, denkt er. Ich werde eines Tages noch in einem stehenden Zug sterben.
Eine kräftig gebaute Dame schlendert vorbei und fragt, ob der Platz neben ihm frei sei. Er antwortet, seine Frau sei nur kurz weggegangen, um sich frisch zu machen, und werde jeden Moment zurückkommen. Die Dame murmelt danke und schlendert weiter.
Er versucht sich vorzustellen, dass Marie-Louise sich tatsächlich in der Toilette am anderen Ende des Wagens befindet, sich die Nase pudernd oder was man sich vorstellen mag, und dass sie bald zurückkommen und sich neben ihm niederlassen wird. Er kann ihre blonde Erscheinung fast visualisieren, ihren hoch erhobenen Kopf und ihre blasierten blauen Augen. Vor allem, wenn sie auf ihn gerichtet waren, dann waren sie besonders blasiert. Jedenfalls in den letzten Jahren (vierzehn von fünfzehn), irgendwann im Anbeginn der Zeit musste es logischerweise eine Glut in ihnen gegeben haben, als sie sich in einem Hotel auf Kreta begegneten und er vom Blitz getroffen wurde.
War das wirklich so, fragt er sich und betrachtet durch das schmutzige Zugfenster einen kleinen gräulichen, in Västerås beheimateten Vogel. Der Blitzeinschlag der Liebe? War ich wirklich verrückt vor Liebe?
Ja, wahrscheinlich, stellt er finster fest, während er den Blick von dem Vogel abwendet und stattdessen einem rauchenden Paar mit gebeugten Rücken hinterhersieht, die sich in bunten Trainingsanzügen und Crocs den Bahnsteig hinabschleppen. Wäre ich bei klarem Verstand gewesen, wäre doch nie etwas passiert.
Und trotz allem kam ja etwas dabei heraus, das Bestand hatte.
Viktoria. Seine Tochter, das Wunderkind. Mittlerweile siebenundzwanzig Jahre alt und ausgeflogen bis in die italienische Schweiz, wo sie in einem kleinen Alpendorf mit einer dunkelhäutigen Gefährtin zusammenlebt. Es ist, wie es ist, o tempora, o mores.
Der Sinn meines Lebens, denkt er gelegentlich: die schöne und gute Viktoria.
Und über die Toten kein böses Wort. Nicht einmal über eine plötzlich verstorbene Ehefrau. Der blasierte Blick ist für alle Zeit erloschen, es gibt keinen Grund, in einem stehenden Zug in Schwedens zweithässlichster Stadt (laut dem, was er irgendwo gelesen hat) zu sitzen und zu versuchen, aus dem Herbarium der Erinnerung Marie-Louise Rinckenström heraufzubeschwören. Sie hat nie seinen Namen angenommen, es nicht einmal in Erwägung gezogen. Es war eine äußerst missglückte Ehe gewesen. Let bygones be bygones.
Oder ist sie vielleicht nur verschwunden? Es ist ihm immer schwergefallen, sich in dem Punkt zu entscheiden.
Er seufzt noch einmal, schließt die Augen und versucht, stattdessen John Leander Franzén zum Leben zu erwecken. Es dauert einen Moment, aber dann gelingt es ihm.
Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers
John Leander Franzén betrachtete sein Gesicht im Badezimmerspiegel. Wenn ich nicht wüsste, dass ich zweiundfünfzig bin, würde ich mich eher auf fünfundfünfzig schätzen, dachte er. Oder sechzig?
Die Haut enthüllte die Jahre. Obwohl sie sonnengebräunt war (eine Woche auf Fuerteventura Ende September), wirkte sie grau. Die Haare, die all die Jahre dicht und braun gewesen waren, sahen leblos und strapaziert aus. Auch sie größtenteils grau. An ihren besten Stellen mausfarben.
Die Augen wässrig und glotzend. Die Lippen aufgesprungen, die Nase schien gewachsen zu sein.
Er trat einen Meter zurück und stellte fest, dass er so besser aussah. Dämpfte mithilfe des Dimmers die Beleuchtung ein wenig. Noch besser.
Ich bin am schönsten, wenn es dämmert, dachte er. Am Abend an einer Bar. In einem Schlafzimmer, erhellt von einer einzigen Kerze. Solche Umgebungen werden einem gerecht. Tageslicht ist ein verdammt überschätztes Phänomen.
Er seufzte und musste sauer aufstoßen. Das Glas Genever hätte ich mir sparen sollen, dachte er. Aber Börje hatte darauf bestanden. Ein Glas klarer Schnaps zum Abschluss einer Mahlzeit war dazu gedacht, der Verdauung auf die Sprünge zu helfen, aber bei JFL hatte das noch nie funktioniert.
Aber aufgeben gilt nicht, Übung macht den Meister.
Er verließ das Bad und setzte sich im Arbeitszimmer an den Schreibtisch. Aus England. Nachgedunkelte Eiche mit Intarsien, erworben beim Auktionshaus Bukowski und über zweihundert Jahre alt. Er griff nach seinem Kalender und blätterte darin. Es war, wie er vermutet hatte, bis Weihnachten waren fünf weitere Auftritte geplant. Obwohl er in den letzten zwei Jahren nichts veröffentlicht hatte. Man wird geschätzt und sehnlichst erwartet, dachte er. Kann sowohl schreiben als auch reden, das ist nicht allen vergönnt.
Er gähnte so ausgiebig, dass die Kiefer knackten, ließ über die Musikanlage (eingebaute Boxen in jedem Zimmer, auch in der Küche) Bachs Cellosuiten laufen und legte sich ins Bett.
Geschätzt und sehnlichst erwartet. Er ließ sich den Gedanken sicherheitshalber noch einmal durch den Kopf gehen, ehe er einen fahren ließ und einschlief.
3
Die Wirklichkeit
Franz J. Lunde betrachtet seine Mutter.
Sie sitzt in ihrem Schaukelstuhl im Heim und sieht ihre Hände an. Es ist nicht erkennbar, ob sie überhaupt wahrgenommen hat, dass er ins Zimmer gekommen ist. Eine knappe Stunde bleibt noch von der Besuchszeit. Der Zug ist auf dem letzten Teilstück bis Stockholm auf Touren gekommen, er hat vom Hauptbahnhof ein Taxi genommen, und jetzt sitzt er hier. Darauf wartend, dass seine Mutter aufblickt, schaut er sich in dem vertrauten Zimmer um. Es ist so gedacht, dass die Klienten es ein wenig nach ihren eigenen Vorstellungen einrichten, das eine oder andere aus ihrem alten Leben mitnehmen dürfen, einen Tisch, zwei Stühle, ein Gemälde, einen Flickenteppich … damit die Fäden zu dem, was gewesen ist, nicht zu brutal abgeschnitten werden. Für diese Fürsorglichkeit hat sie sich allerdings nie interessiert. Das Einzige, was sie bei ihrem Umzug ins Heim mitgenommen hat, ist der Schaukelstuhl, in dem sie sitzt, was jedoch auf Franz’ Initiative hin geschehen ist, sowie der Wandbehang über ihrem Bett. Er reagiert jedes Mal leicht gereizt, wenn er dessen Botschaft liest, so auch jetzt.
Sei demütig in deinem Leben
Nimm nicht alles als gegeben
Verschnörkelte blassrote Buchstaben vor einem blassgelben Hintergrund. Verwaschen, möglicherweise hat seine Urgroßmutter das gehäkelt. Oder gestickt oder wie zum Teufel das heißt. Dann jedenfalls Ende des neunzehnten Jahrhunderts, aber es ist genauso gut möglich, dass sie den Wandbehang gekauft hat, als der Nachlass eines verstorbenen Bauern versteigert wurde. Seine Mutter hat immer gern alles verfälscht. Das Dasein in ein besseres Licht gerückt und geschönt, und wer wollte ihr das verübeln?
Demütig ist sie jedenfalls nie gewesen, erst recht nicht, seit sie den Kontakt zu ihrer Umwelt verloren hat. Franz seufzt und fragt sich, warum in aller Welt er dort sitzt. Es ist eine wiederkehrende Frage, und die beste Antwort, die ihm darauf regelmäßig einfällt, ist das Katholische. Indem er seine Mutter besucht, geht er zur Beichte. Die Sünden, für die er Vergebung sucht, sind mehr oder weniger offensichtlich, haben aber nichts mit seiner Mutter zu tun. Das ist bei richtigen Katholiken bestimmt auch nicht anders. Die primitiven Gleichungen sind das Spielfeld der Religionen. Wie gesagt, in dieser verwässerten Umgebung auf neue Gedanken zu kommen, ist unmöglich.
»Du musst nicht denken, dass ich nichts begreife.«
»Hä …?«
Er zuckt zusammen und erkennt, dass die Augen seiner Mutter auf ihn gerichtet sind.
»Ich verstehe nur zu gut.«
Er fragt sich, ob ihr bewusst ist, wer er ist, oder ob sie ihn mit jemandem verwechselt. Zum Beispiel mit ihrem verstorbenen Ehemann, seinem Vater Lars-Lennart. Oder ihrem älteren Bruder, seinem Onkel Ernst, der noch lebt und zu dem sie seit jeher ein kompliziertes Verhältnis hat. Der mindestens acht Kinder hat und seit mehr als einem halben Jahrhundert in Salt Lake City lebt. Einem hartnäckig sich haltenden Gerücht zufolge als Mormone. Vielleicht auch mit mehr als einer Frau, das besagt jedenfalls ein anderes Gerücht, das kursiert, solange Franz denken kann.
Sie hat ihn auch vorher schon mehrmals als Ernst identifiziert, und im Grunde ist es ihm egal. Seine Mutter ist auf die meisten Menschen wütend. Einmal hat sie ihn für Viktoria gehalten, ihr Enkelkind, zu dem sie nie eine engere Verbindung aufgebaut hat, seine eigene geliebte Tochter, aber daraufhin ist ihm der Kragen geplatzt. Er hat sie gebeten, die Schnauze zu halten, und den Raum verlassen.
»Was verstehst du, Mama?«
»Nenn mich nicht Mama. Kinder haben Mamas, erwachsene Männer haben Mütter.«
»Sicher, liebe Mutter.«
»Liebe Mutter, so begann mein Brief … wie hießen die noch?«
»Wer?«
»Die das Lied gesungen haben, das so anfängt, natürlich.«
»Vielleicht die Göingemädchen?«
»Ja, sag ich doch.«
»Hm, du hast gesagt, dass es etwas gibt, was du verstehst …«
»Stell dir vor, das habe ich.«
»Und was hast du verstanden?«
Jetzt lehnt sie sich vor und schärft ihren Blick noch mehr. Penetriert ihn regelrecht.
»Ich verstehe, warum sie dich verlassen hat.«
»Marie-Louise?«
»Ja, Marie-Louise. Hast du mehr als eine Ehefrau gehabt, die dich verlassen hat?«
Ungewöhnlich klar im Kopf, denkt er. Sie weiß, wer ich bin und wie meine Frau hieß.
»Mama, Marie-Louise ist tot. Sie ist gestorben, sie hat mich nicht verlassen.«
Oder sie ist nur verschwunden. Aber diesen Vorbehalt lässt er unausgesprochen.
»Das weiß ich doch. Erst hat sie dich verlassen, dann ist sie gestorben. Nenn mich nicht Mama. Kinder haben Mamas.«
»Natürlich, Mutter.«
Sie legt den Kopf schief.
»Ist doch klar, dass sie dich verlassen hat. Sie hat es wohl nicht mehr ausgehalten.«
Er zieht es vor zu schweigen.
»Du bist schon immer ein fauler Apfel gewesen. Deine Schwester ist ganz anders. Sie kommt mich jedenfalls besuchen.«
»Aber …«
»Sie kommt fast täglich, und du bist niemals hier.«
Was zum Teufel, denkt er. Warum soll ich hier herumsitzen und mir diesen Mist anhören? Was geht nur in ihrem verwirrten Schädel vor? Es ist lange her, dass Marie-Louise, die schlechte Ehe und ihr eventueller Tod auf der Tagesordnung gestanden haben, aber dass seine Mutter jetzt auf seine Kosten gut über die frühere Frau ihres Sohnes spricht, ist wirklich eine unangenehme Überraschung. Und dass seine Schwester gelobt wird, obwohl sie nie einen Finger rührt. Schließlich gibt es Grenzen dafür, was man sich gefallen lassen muss. Eine höchst berechtigte Wut schießt in ihm hoch, und er steht auf.
»Liebe Mutter, du musst entschuldigen, aber ich habe noch eine wichtige Besprechung.«
»Du hast niemals Zeit …«
»Grüß Linnea ganz herzlich von mir, wenn sie hier auftaucht. Ich habe sie lange nicht gesehen, aber es freut mich, dass sie sich um dich kümmert und dich so oft besucht.«
Vergeudete Ironie. Seine Mutter sieht aus, als wolle sie ihn anspucken.
»Geh einfach, denk nicht an mich.«
»Adieu, liebe Mutter.«
Er macht auf dem Absatz kehrt und verlässt das Zimmer. Die Göingemädchen können mir gestohlen bleiben, denkt er. Ziemlich viele andere auch.
Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers
John Leander Franzén verbrachte drei Tage in seinem Arbeitszimmer mit einer Teilaussicht auf Kastellholmen und Gröna Lund, ohne eine einzige Zeile zu schreiben. Am Vormittag des vierten Tages riss er sich zusammen und komponierte folgenden schönen Satz.
Wer in der Nacht sein Heim verlässt und schnurgerade gen Osten wandert, stößt früher oder später auf einen anderen Menschen.
Er las ihn laut und nahm ihn mit dem winzigen Diktiergerät auf, das er einmal auf einer Reise in Italien gekauft hatte. Hörte sich das Ergebnis an, fand die Phrasierung nicht wirklich gut, probierte es erneut, lauschte abermals, war aber erst beim fünften Versuch zufrieden. Er lud die kurze Tondatei auf seinen Computer, wo er bereits um die hundert Aphorismen von der gleichen gediegenen Qualität aufgenommen hatte, und beschloss auszugehen, um zu Mittag zu essen.
Er stellte sich ein Gros vor. Einhundertvierundvierzig prägnante Sätze, die nicht nur sein eigenes literarisches Werk, sondern auch ein halbes Jahrtausend ästhetischen Humanismus zusammenfassen sollten. Ihm gefiel außerdem der Gedanke, dass dieses dünne Buch, hübsch eingebunden in Graublau, sowohl in Schweden als auch auf dem Kontinent Pflichtlektüre für Gymnasiasten sein würde und seine eigene Lesung des Ganzen einen Meilenstein des gesprochenen Worts markieren und portionsweise in besonders wichtigen Augenblicken der Geschichte im Radio gesendet würde. Kurz vor Mitternacht an Silvester. Hochzeiten im Königshaus. Kriegsausbrüche und Ähnliches.
Er ging im schneidenden Wind über den Verkehrsknotenpunkt Slussen, der seit unzähligen Jahren umgebaut wurde, in die Gassen von Gamla stan, der Stockholmer Altstadt. Die Österlånggatan hinab bis zum Restaurant Tradition. Reibekuchen, dachte er grimmig. Oder vielleicht auch eine Graupenschweinswurst mit Béchamelkartoffeln und Dill. Ein großes Bier. Ehrenwerte Hausmannskost für richtige Schriftsteller männlichen Geschlechts.
Die Wirklichkeit
Ein hochmütiger, verfluchter Angeber, denkt Franz J. Lunde und schlägt das Schreibbuch zu. Ein Sexist und Narzisst. Aber das ist hervorragend, das wird eine Art Untergangsroman; er wird bekommen, was er verdient hat, und es sind schon dreizehn Seiten.
Obwohl Graupenschweinswurst jetzt nicht verkehrt wäre.
Er hat zwei Stunden im Under kastanjen am Platz Brända tomten gesessen und geschrieben, einem seiner Lieblingslokale. Hat vier oder fünf Tassen Kaffee getrunken und leicht distanziert, aber nicht bösartig vier oder fünf Bekannten zugenickt. Autoren der einen oder anderen Art. Alle haben begriffen, dass er arbeitet, und Kontaktversuche unterlassen. Man respektiert seine Privatsphäre, alles andere wäre ja auch noch schöner.
Aber für das Restaurant Tradition fehlt ihm jetzt die Zeit. Er begnügt sich mit einem Brot in seiner einfachen Zweizimmerwohnung in der Prästgatan, gefolgt von einem Spaziergang zum Hauptbahnhof. Auf dem Programm steht ein abendlicher Auftritt in der Stadtbibliothek von Västerås. Alles hat seine Zeit.
4
Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers
Und dann war sie wieder da.
Als er ihre Frage und ihre Stimme hörte, geschah etwas mit John Leander Franzéns Wahrnehmung. Vermutlich ein Kurzschluss in einer Reihe von Synapsen im Gehirn, und für einen Moment glaubte er, dass er das Bewusstsein verlieren würde. Mitten vor den Augen der mindestens siebzigköpfigen Zuhörerschar in der Stadtbibliothek von Västerås auf den Boden plumpsen würde.
Aber es ging noch einmal gut. Er hielt sich mit beiden Händen an dem schmucklosen Rednerpult fest, und einige Sekunden später begann die Umgebung sich zu stabilisieren. Er bekam ein Glas Wasser zu fassen und trank ein paar große Schlucke. Tastete nach der Brille in seiner Brusttasche, erinnerte sich dann aber, dass sie in der Aktentasche lag.
»Herr Franzén, in einem Ihrer Bücher wird ein perfekter Mord beschrieben, und als ich über ihn gelesen habe, drängte sich mir der Eindruck auf, dass Sie das tatsächlich selbst erlebt und ihn begangen haben. Es würde mich interessieren, Ihren Kommentar zu hören.«
Genau das hatte sie gesagt. Also ein etwas anderer Wortlaut als in Ravmossen, aber definitiv die gleiche Bedeutung und mit Sicherheit dieselbe Frau. Weit hinten im Publikum, sie war nicht aufgestanden, als sie ihre Frage stellte, und der Veranstalter war nicht rechtzeitig mit dem Handmikrofon bei ihr gewesen. Aber das war auch gar nicht nötig gewesen, ihre Stimme war klar und deutlich, genau wie beim letzten Mal. Ein schöner und distinkter Alt. War sie vielleicht Schauspielerin?
Es herrschte wahrscheinlich einige Sekunden Stille, aber das war eine fragliche Beobachtung, da er nur mit knapper Not einer Ohnmacht entgangen war. Und der Veranstalter kam nicht auf die Idee, sich einzuschalten. Stattdessen musste er sich selbst aus der Klemme helfen.
»Entschuldigen Sie, ich war plötzlich unterzuckert. Nein, ich werde das nicht kommentieren … ich kann dazu nur sagen, dass es sich natürlich um ein Missverständnis handelt. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.«
Blumenstrauß und Heimatbuch. Dreizehn Bücher schnell signiert, danach danke und tschüss. Als er aus der Bibliothek gekommen und fünfzig Meter durch den dünnen, diagonalen Regen gegangen war, entdeckte er, dass er gar nicht den Weg zum Bahnhof eingeschlagen hatte, sondern in eine völlig falsche Richtung unterwegs war. Er blieb stehen, spürte plötzlich, dass er sich übergeben musste, und konnte zum Glück hinter ein Gebüsch huschen und das meiste ausspucken, was er an diesem Tag gegessen hatte. Zum Beispiel eine gut durchgekaute Graupenschweinswurst. Und Béchamelkartoffeln, genauso gut zerkaut.
Eine halbe Stunde später saß er im Zug, sehnte sich nach einem großen Glas Single Malt Whisky und fragte sich, was sich verdammt nochmal zusammenbraute.
Die Wirklichkeit
Das fragt sich Franz J. Lunde auch. Im Prinzip sitzt er ja im selben Zug, er hat sich zwar nicht übergeben, aber ansonsten stimmen sein Erlebnis des Abends und sein Zustand mit dem seines Alter Egos überein.
Er liest sich durch, was er gerade geschrieben hat. Kann ich auf die Art weitermachen, fragt er sich. Wohin wird das am Ende führen?
Er hat das Gefühl, auf einmal jede mögliche Distanz zu seinem fiktiven Charakter, dem Psychopathen und Narzissten Franzén, verloren zu haben. Wird nicht jeder halbwegs begabte Leser begreifen, dass diese Geschichte von ihm selbst handelt? Dass dieses bescheuerte Buch nichts anderes ist als eine schlecht maskierte Autobiografie? Um eine Leere kreisend, die in Wahrheit ein schwarzes Loch ist.
Oder vielleicht doch nicht. In diesem Moment, während der Zug vor dem Halt in Bålsta allmählich abbremst, kann er das nicht entscheiden. Aber das ist auch nicht wichtig, wirklich wichtig ist diese verdammte Frau, die zweimal im Laufe einer Woche die Frechheit besessen hat, ihm ihre impertinente Frage zu stellen. Die ihn mehr oder weniger beschuldigt hat, einen Mord begangen zu haben.
Verflucht, denkt Franz J. Lunde. Und verflucht, dass es ihm auch diesmal nicht gelungen ist, einen Blick auf sie zu werfen. Dass er nicht darauf geachtet hat, seine Brille in der Brusttasche zur Hand zu haben. Diese Marotte, dass er es vorzieht, seine Leser nicht zu deutlich zu sehen, muss er in Zukunft einfach aufgeben.
In Zukunft? Ja, er hat eindeutig das Gefühl, dass er sie nicht loswerden wird.
Wer ist sie? Wer zum Teufel ist sie?
Und warum taucht sie ausgerechnet jetzt auf, ausgerechnet in diesem dunklen und regnerischen Herbst? Es sind doch zweieinhalb Jahre vergangen, seit das Buch erschienen ist, und noch mehr Zeit seit … nein, diese Gedanken bringen nichts. Es ist gekommen, wie es gekommen ist, und er erkennt eine Sackgasse, wenn er sie sieht.
Es ist ein wenig unklar, was er mit diesen letzten Worten meint, aber wenn er nur nach Hause kommt und ein paar Zentiliter Laphroaig intus hat, wird er schon wieder einen klaren Kopf bekommen. Es tut sich etwas, und er braucht einen Plan.
Einfach ausgedrückt.
Vielleicht sollte er auch versuchen, sich zu erinnern, was tatsächlich passiert war. Im Großen und Ganzen und im Detail; die Abfolge der Ereignisse und die Konsequenzen. Das Gespräch im Café, das Ziehen der Lose und die Entscheidung. Sich das alles in Erinnerung rufen und zu etwas anderem umschreiben.
Verlogene Worte für den ganzen alten Kram finden, das Einzige, wozu er taugt.
Oder auch nicht.
Es in Frieden lassen?
Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers
Zurückgekehrt in sein Heim und seine Burg im Stadtteil Södermalm schenkte John Leander Franzén sich acht Zentiliter Whisky mit einem Schuss Wasser ein und sank in den Gebärmuttersessel. Das Möbelstück umschloss einen auf diese Weise – er hatte die Bezeichnung von einem französischen Schriftsteller gestohlen; kleine Schriftsteller leihen, große Schriftsteller stehlen –, und er ging in Gedanken ein Jahrzehnt in die Vergangenheit zurück. Dafür gab es anscheinend gute Gründe.
Die Buchmesse in Göteborg. Die Nacht von Samstag auf Sonntag, eine halbwegs abgeschiedene Ecke in der Bar im Erdgeschoss des Hotel Gothia. Nur er selbst und der alte Dichter waren noch übrig; eine kleinere Gruppe betrunkener zweitklassiger Autoren beiderlei Geschlechts hatte sich kurz zuvor zurückgezogen. Es war vermutlich eher zwei Uhr als etwas anderes. Jeder von ihnen mit einem letzten Bier auf dem Tisch.
Der Dichter ungepflegt und verbittert. Abgerissen, besoffen und hemmungslos, eine Warze auf der Wange, es fiel einem schwer, sie nicht anzustarren. Aber noch durchaus fähig, einem Gedanken zu folgen. Also der Dichter, nicht die Warze.
JLF ungefähr im gleichen Zustand. Allerdings mit reinen Wangen und nicht verbittert; schließlich war er erfolgreich, darauf konnte man Gift nehmen. Er schrieb Romane, Bücher, die gelesen wurden.
Um diesen Gedankengang ging es, zumindest dem Dichter.
»Ich habe sechzehn Gedichtsammlungen geschrieben«, murrte er übellaunig. »Von keiner sind mehr als fünfhundert Stück verkauft worden. Von den letzten knapp zweihundert. Und jetzt, bei diesem verdammten Verlagsessen, habe ich … hicks, entschuldige … neben so einer neuen Krimiqueen gesessen, die von ihrem ersten Buch sechzigtausend Exemplare verhökert hat! Im Hardcover, was sagst du dazu?«
»Prost!«, hatte JLF geantwortet. »Die Kultur geht in diesem Jammertal zum Teufel.«
»Die Leute sind Idioten«, hielt der Dichter inspiriert fest und rülpste. »Vor allem die Leute, die Bücher lesen.«
»Außer ein paar hundert, die Lyrik lesen?«, wollte JLF wissen.
»Du triffst den Nagel auf den Kopf«, erwiderte der verkannte Dichter. »Allerdings sind das größtenteils Dichter, die die Bücher anderer Dichter kaufen. Die meisten von denen sind auch Idioten.«
»Tatsächlich?«, sagte JFL. »Ja, das ist wirklich zum Kotzen, wenn man es recht bedenkt.«
»Deshalb werde ich jetzt einen Krimi schreiben.«
»Was?«
»Einen Kriminalroman … bevor ich den Löffel abgebe. Nur um diesen Idioten zu zeigen, dass … dass …«
An dieser Stelle hatte er dann doch den Faden verloren, erinnerte sich JLF. Seltsam, dass er sich so viele Jahre später an ein so unwichtiges Detail erinnern konnte, aber trotz seines Rauschs und der späten Stunde hatte das Gespräch sich in seine Gehirnrinde eingebrannt. Oder wo auch immer altes Gelaber landete.
»Hast du denn eine gute Idee?«, hatte er nach einer Pause und einem Schluck Bier gefragt. Nicht, weil er sich sonderlich für die Jeremiaden oder Pläne des Dichters interessierte, sondern weil ihm nichts Besseres einfiel.
»Darauf kannst du wetten. Das perfekte Verbrechen, mehr oder weniger.«
Verflucht nochmal, hatte JLF gedacht. Du eingebildeter alter Dichterarsch. Gesagt hatte er allerdings nur:
»Aha? Wie interessant.«
Der Dichter hatte sich umständlich geräuspert, sich in dem glatten Sessel etwas aufgerichtet und ihn sorgsam betrachtet. Irgendwie forschend und mit einer plötzlichen nüchternen Schärfe im Blick. Unklar, wie eine solche Metamorphose möglich war, aber so war es. So war es gewesen. Ein entscheidender Augenblick, das hatte JLF schon in der kurzen Zeit gedacht, die er andauerte.
Dann hatte der Dichter erzählt.
Vom perfekten Verbrechen. Das in seinem Debüt als Autor von Kriminalromanen begangen werden sollte.
Und es war nicht so übel, wie man hätte befürchten können.
Die Wirklichkeit
Franz J. Lunde liest sich die letzten Seiten dreimal durch.
Wohl abgewogen, denkt er. Statt des geplanten Whiskys hat er schwarzen Tee getrunken, das mag eine Rolle gespielt haben. Der abgerissene Dichter ist halb fiktiv; genauso wie Göteborg, das Hotel Gothia und die Buchmesse. Der ungefähre Zeitpunkt ist uninteressant, und dass ein Schnüffler in dem Gewühl aus Schriftstellern, Journalisten, Krethi und Plethi während des alkoholgeschwängerten Kulturgewimmels den richtigen finden konnte, muss wohl als undurchführbar bezeichnet werden. Niemand kann dafür bürgen, mit wem man gesprochen hat oder wen man mit anderen sprechen gesehen hat – oder was möglicherweise gesagt worden war –, schon gar nicht Jahre später. Die Ausgestaltung ist so wasserdicht wie eine versiegelte Kiste auf dem Meeresgrund.
Nur Sekunden nach dieser beruhigenden Feststellung stellen sich jedoch Zweifel ein. Ist es wirklich klug, diese Geschichte in den Druck zu geben? Plötzlich fällt ihm ein holländischer Schriftsteller ein, der irgendwann in den Neunzigerjahren einen Roman über den Mord an einer Ehefrau schrieb und Jahre später dafür verurteilt wurde, dass er seine Frau umgebracht hatte. Genau wie im Buch; er verkaufte sein Haus, und als der neue Besitzer im Garten grub, fand er die Leiche. Man sollte stets bedenken, dass die Wirklichkeit für seriöse Schriftsteller ein Minenfeld sein kann, und dass man in seinem Eifer, gründlich zu recherchieren, manchmal auf der falschen Seite einer wichtigen Grenzlinie landen kann.
Aber meine Güte. Es kommt auch darauf an, Zweifel und Anfechtungen in den Wind schlagen zu können. Er wird den Text eben nach und nach bearbeiten und die erforderlichen Justierungen durchführen müssen. Oder gezwungen sein, den ganzen Mist zu verbrennen. Im Moment kommt es darauf an, die Geschichte als solche weiterzuspinnen. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt das Nachdenken.
Er stellt fest, dass es fast Mitternacht ist, aber er hat am nächsten Tag keine Verpflichtungen. Seine nächste Lesung ist erst in drei Tagen, er kann also ruhig noch eine oder zwei Stunden weitermachen. Die tatsächliche, offensichtlich quicklebendige Frau aus Ravmossen und Västerås pocht in seinem Schädel auf Aufmerksamkeit, aber er verdrängt sie, so gut es geht. Verfluchter Mensch, denkt er, was treibst du da eigentlich? Jetzt mache ich Literatur aus dir, aber sieh verdammt nochmal zu, dass du mir in Zukunft vom Leib bleibst! Du hast deine Rolle ausgespielt.
Dream on, you old fucker. Er dreht zwei Runden durch die Wohnung, blickt durch die Fenster zu einem dunklen und verschlossenen Himmel sowie zu diversen Dachfirsten und Kirchtürmen in anderthalb Himmelsrichtungen hinaus. Denkt ein paar Augenblicke an die Stille Gottes nach Bach, macht sich eine Tasse Tee mit einem Schuss Rum und zählt die Seiten.
Siebzehn. Sie sind zwar handgeschrieben, aber im Druck sollten es dennoch fünfzehn sein.
Ausgezeichnet, denkt Franz Josef Lunde. Schon ein Viertel, wenn er sich mit der unteren Grenze zufriedengibt. Es läuft wie am Schnürchen, vielleicht eine Schnur, die reißt, aber es gibt nichts Gutes, das nicht auch etwas Schlechtes mit sich bringt. Er trinkt einen großen Schluck des stimulierenden Tees und geht wieder ans Werk.
Letzte Tage und Tod eines Schriftstellers
»Ich gehe von unseren modernen Zeiten aus«, hatte der Dichter gesagt. »Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber wie man die Frage des Alibis betrachtet, hat sich in den letzten Jahren radikal verändert.«
»Die Frage des Alibis?« JLF rieb sich die Schläfen und versuchte, sich zu konzentrieren.
»Ja, die Frage des Alibis. Heutzutage stellt sich nicht mehr die Frage, wo du und dein Leib sich zu einem bestimmten Zeitpunkt befunden haben, sondern wo sich dein Mobiltelefon und deine Kreditkarte herumgetrieben haben.«
»Hm, ja?«, brachte JLF heraus.
Der Dichter warf ihm unter buschigen Augenbrauen einen scharfen Blick zu, als wollte er ergründen, ob er Perlen an eine Sau verschwendete. Aber offensichtlich war er viel zu beeindruckt von seiner eigenen eleganten Konstruktion, um sich aufhalten zu lassen; vorsichtig fingerte er an der Warze herum, trank einen Schluck Bier und sprach weiter.
»Sagen wir, dass du die Absicht hast, eine missliebige Person in Östersund zu ermorden. Das kann praktisch jeder sein, eine frühere Ehefrau, irgendein Miststück, dem du Geld schuldest, ein anderes Miststück, an dem du dich aus irgendeinem Grund rächen musst. Nemesis wohnt in deinem Reptiliengehirn in der guten Stube, aber das Problem ist, dass du ein Bekannter des betreffenden Individuums bist, und wenn die Polizei dann die weibliche oder männliche Person findet, die um die Ecke gebracht worden ist, wird man dich so sicher wie das Amen in der Kirche vernehmen. Fast alle, die ermordet werden, haben eine Beziehung zu ihrem Henker, kommst du mit?«
»Ich komme mit«, versicherte JLF. »Red weiter. Prost, übrigens.«
»Prost. Was du brauchst, um dich am einfachsten aus den Fängen der Polizei zu winden, ist ein sogenanntes Alibi. Dass du zum Zeitpunkt der grausigen Tat schlichtweg nicht vor Ort gewesen bist und sie deshalb auch nicht begangen haben kannst. Klar?«
»Glasklar.«
»Gut. Je weiter entfernt vom Ort des Verbrechens du dich aufhältst, desto besser. Wenn deine Frau beispielsweise in Östersund ermordet wird … wir bleiben dem Beispiel zuliebe bei diesem Ort … und zwar an einem Donnerstagabend im November, kommt es dir natürlich sehr gelegen, wenn du dich an diesem Abend nachweislich in Malmö aufgehalten hast. Do I make myself quite clear, wie es im Koran heißt?«
Das hatte er tatsächlich so gesagt, der alte Ziegenbock. Do I make myself quite clear …?JLF erinnerte sich daran genauso deutlich wie an ein Glas Essig in der falschen Röhre.
»Ja, ja«, hatte er ein wenig ungeduldig erwidert. »Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und habe einen IQ von fast siebzig.«
»Hervorragend, sogar ganz ausgezeichnet«, machte der Dichter weiter. »Jetzt nehmen wir einmal an, dass du eine missliebige frühere Gattin in Östersund ermorden willst, und aus diesem Grund ziehst du meine Wenigkeit als deinen Assistenten hinzu.«
Würde mir niemals einfallen, einen Dichter hinzuzuziehen, dachte JLF. Nicht einmal, um ein Plumpsklo zu streichen. Aber wohl wissend, wie empfindlich manche Zehen sein konnten, blieb er stumm.
»Um deinen Mord im nordschwedischen Jämtland begehen zu können, kaufst du ein Flugticket nach Malmö im Süden. Dein Assistent, will sagen meine Wenigkeit, kauft gleichzeitig ein Ticket nach Östersund. Wir haben kontrolliert, dass im Abstand von nur wenigen Minuten Flüge zu den jeweiligen Reisezielen starten. Vom Flughafen Bromma. Wir checken ein, gehen zu unserem jeweiligen Gate und tauschen auf dem Weg zu den Flugzeugen die Boardingkarten aus. Außerdem die Handys und Kreditkarten. Wir können die Sachen auch schon vor der Sicherheitskontrolle tauschen, das spielt keine Rolle. Kannst du mir noch folgen?«
»Natürlich. Übrigens, Prost.«
»Öh … Prost. Nach unserem kleinen Tausch der Identitäten … o ja, hier geht es um einen Tausch der Identitäten … fliegst du nach Östersund und erwürgst in aller Ruhe deine alte Frau. Oder du erschlägst sie mit einem Kerzenständer, wenn dir das lieber ist. Du steigst in meinem Namen in einem Hotel ab, im Voraus gebucht natürlich, benutzt meine Kreditkarte für die Minibar und die Rechnung und so weiter und so fort, und achtest darauf, mein Handy ein paarmal zu benutzen, und … tja, zwei Tage später fährst du mit dem Zug nach Stockholm zurück. In der Zwischenzeit …«
»In der Zwischenzeit bist du in meinem Namen in Malmö gewesen«, ergänzte JLF, um zu zeigen, dass er noch immer auf der Höhe des Geschehens war. »Du hast meine Kreditkarte für das eine oder andere benutzt und mit dem Handy ein paar SMS verschickt, und … äh, mir ganz einfach ein Alibi verschafft. Ja, hol mich der Teufel, ich glaube, du liegst nicht ganz falsch.«
»Nicht ganz falsch?«, hatte der Dichter geseufzt. »Das verbitte ich mir. Das ist die exzellenteste Krimihandlung seit Agatha Christies Alibi, wenn du mir die klaust, bringe ich dich um.«
»Danke«, sagte JLF. »Ich fühle mich geehrt. Zweifellos.«