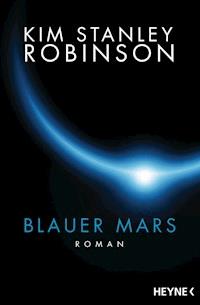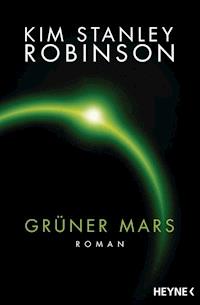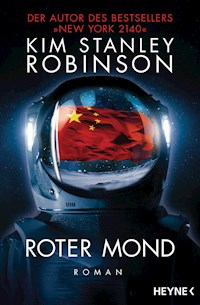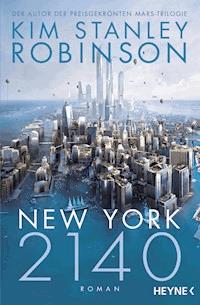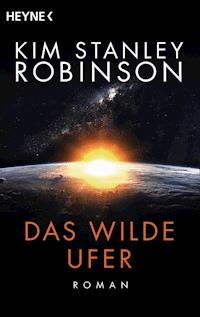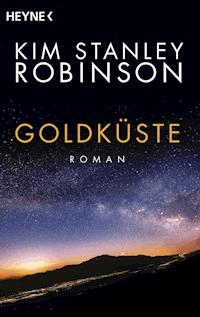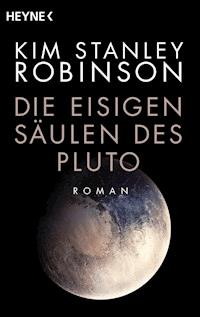18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Das größte Abenteuer der Menschheit
Europa vor circa 30.000 Jahren: Der junge Eistaucher wird von dem Schamanen seines Stammes nackt und ohne Hilfsmittel in die Wildnis geschickt. Eistaucher ist auserwählt, einst Dorns Nachfolge anzutreten, und dazu muss er nicht nur lernen, in der Natur zu überleben, sondern auch, die Natur und alles, was Teil von ihr ist, zu verstehen. Auf sich allein gestellt, begegnet Eistaucher den wilden Tieren der Eiszeit – und einer anderen Menschenart, die Jagd auf ihn macht. Das Abenteuer seines Lebens beginnt . . .
Eistaucher heißt der Waisenjunge, den der Schamane Dorn aus dem Lager schickt, um zwei Wochen allein und ohne Hilfsmittel in der Wildnis zu überleben. Eistaucher ist auserkoren, einmal Dorns Nachfolge anzutreten, und zu diesem Zweck muss er nicht nur das Überleben in der Natur lernen, sondern auch seine Fähigkeit schulen, mit der Welt und all ihren Geschöpfen »eins zu werden«. Eistaucher trägt von seinem Ausflug zwar einige Verletzungen davon, doch seine Visionen waren so stark, dass er sich nicht mehr vorstellen kann, weiterhin bei seinem Stamm zu leben. Aber welche Freiheit kann es für einen Schamanenschüler in einer Welt geben, in der Bären, Löwen und Luchse lauern und eine andere Menschenart – die rätselhaften »Alten« – Jagd auf ihn macht? Eistaucher bricht auf in eine ungewisse Zukunft – die zugleich die Zukunft der Menschheit ist . . . Ein atemberaubendes Panorama des steinzeitlichen Europas und eine faszinierende Nacherzählung der Menschwerdung – mit Schamane hat Kim Stanley Robinson einen historischen Roman geschrieben, den es so noch nie gab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 842
Ähnliche
DAS BUCH
Europa vor 30 000 Jahren: Der Waisenjunge Eistaucher wird von Dorn, dem Schamanen seines Stammes, aus dem Lager schickt, um zwei Wochen allein und ohne Hilfsmittel in der Wildnis zu überleben. Eistaucher ist auserkoren, einmal Dorns Nachfolge anzutreten, und zu diesem Zweck muss er nicht nur das Überleben in der Natur lernen, sondern auch seine Fähigkeit schulen, mit der Welt und all ihren Geschöpfen »eins zu werden«. Eistaucher trägt von seinem Ausflug zwar einige Verletzungen davon, doch seine Visionen waren so stark, dass er sich nicht mehr vorstellen kann, weiterhin bei seinem Stamm zu leben. Aber welche Freiheit kann es für einen Schamanenschüler in einer Welt geben, in der Bären, Löwen und Luchse lauern und eine andere Menschart – die rätselhaften »Alten« – Jagd auf ihn macht? Eistaucher bricht auf in eine ungewisse Zukunft – die zugleich die Zukunft der Menschheit ist …
Ein atemberaubendes Panorama des eiszeitlichen Europas und eine faszinierende Nacherzählung der Menschwerdung – mit Schamane hat Kim Stanley Robinson einen historischen Roman geschrieben, den es so noch nie gab.
»Kim Stanley Robinsons Sprachgewalt ist herausragend!« Booklist
»Kim Stanley Robinson hat die Gabe, alles, was er beschreibt, auch wirklich zum Leben zu erwecken.« Chicago Sun-Times
DER AUTOR
Kim Stanley Robinson wurde 1952 in Illinois geboren. Nach einem Studium der Literatur machte er sich als freier Schriftsteller selbstständig. Zahlreiche seiner Romane – darunter die Mars-Trilogie und der zuletzt erschienene 2312 – wurden mehrfach preisgekrönt und zu Bestsellern. Robinson lebt mit seiner Familie in Kalifornien.
KIM STANLEY
ROBINSON
SCHAMANE
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Jakob Schmidt
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel Shaman
bei Orbit, an Imprint of Hachette Book Group Inc., New York
Copyright © 2013 by Kim Stanley Robinson
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Birgit Herden
Umschlaggestaltung: Eisele Grafikdesign, München
Umschlagabbildung: MICHAŁKARCZ/Parallel Worlds
Satz: Leingärtner, Nabburg
ePub-ISBN: 978-3-641-14294-0
Im Gedenken an Ralph Vicinanza
Erster Teil
EISTAUCHERS WANDERUNG
Wir hatten einen schlimmen Schamanen.
Das sagte Dorn immer, wenn er selbst etwas Schlimmes tat. Beim geringsten Widerspruch, egal, worum es ging, hob er seine langen grauen Zöpfe an, um einem die fleischigen roten Knubbel um seine Ohrlöcher herum zu zeigen. Dorns Schamane hatte seinen Jungen Knochennadeln durch die Ohren gestochen und sie dann seitlich herausgerissen, damit sie bloß keine seiner Lektionen vergaßen. Dorn hingegen schlug Eistaucher bei solchen Gelegenheiten aufs Ohr und zeigte dann an seine eigene Schläfe, wobei er den Kopf schief legte, wie um zu sagen: Und du denkst, du hättest es schwer?
Im Moment hielt er Eistaucher am Arm gepackt und zerrte ihn über den Kammweg zum Pfeifhasenfels, von dem aus man das Ober- und das Untertal überblicken konnte. Es war spät am Nachmittag, und die schweren Wolken schoben sich wie ein graues Weltendach über die Landschaft. Darunter bewegte sich eine kleine Gruppe Männer im Gänsemarsch über den Grat, Dorn vorneweg. Sie hatten eine Schamanenangelegenheit zu erledigen. Es war an der Zeit für Eistauchers Wanderung.
—Warum heute?, wandte Eistaucher ein. —Ein Unwetter zieht auf, das siehst du doch.
—Wir hatten einen schlimmen Schamanen.
Und da waren sie also. Einer nach dem anderen umarmten die Männer Eistaucher, grinsten ihn mitleidig an und schüttelten die Köpfe. Ihre Blicke ließen ahnen, dass er eine scheußliche Nacht vor sich hatte. Dorn wartete, bis sie fertig waren, und stimmte dann krächzend das Abschiedslied an:
Auf diese Art beginnt es seit je
Nun wirst du als Mann neu geboren
Gib dich Mutter Erde hin
Sie wird dein Bitten erhören
—Wenn du höflich genug bittest, fügte Dorn hinzu und gab Eistaucher einen Klaps auf die Schulter. Dann wurde viel gelacht, und die Männer bedachten ihn mit teils hämischen, teils ermutigenden Blicken, während sie ihm Kleider, Gürtel und Schuhe abnahmen und alles an Dorn weiterreichten, der Eistaucher so böse anstarrte, als wollte er ihn gleich schlagen. Und als Eistaucher ganz nackt und all seiner Besitztümer beraubt war, versetzte Dorn ihm tatsächlich einen Schlag, wenn auch nur locker, mit dem Handrücken vor die Brust. —Geh. Mach dich davon. Wir sehen uns bei Vollmond. Bei klarem Himmel hätte man im Westen die erste schmale Sichel des Neumonds sehen können. Eine dreizehntägige Wanderschaft also, die er mit nichts begann, so wie jeder Schamane bei seiner ersten Wanderschaft. Doch diesmal zog ein Unwetter auf. Außerdem war erst der vierte Monat, und es lag noch Schnee.
Eistaucher wahrte eine ausdruckslose Miene und blickte zum westlichen Horizont. Es wäre würdelos gewesen, um einen Monat Aufschub zu betteln, und ohnehin sinnlos. Also starrte er an Dorn vorbei und überlegte, wie er hinunter ins Untertal gelangen sollte, wo der von Baumgrüppchen gesäumte Bach floss. Der übliche Abstieg vom Pfeifhasenfelsen war sehr steinig, weshalb er ihn barfuß besser nicht nehmen sollte. Die erste von vielen Entscheidungen, bei denen er sich nicht vertun durfte.
—Freund Rabe hinter dem Himmel, sagte er in einem lauten Singsang. —Führe mich nun, aber führe mich ohne Tücke!
—Wenn du Rabe dazu bewegen willst, dir zu helfen, dann viel Glück, sagte Dorn. Aber da Eistaucher im Gegensatz zu Dorn aus der Rabensippe stammte, beachtete er den Einwurf nicht und blickte auf der Suche nach einem Pfad ins Tal. Dorn versetzte ihm einen weiteren Klaps und führte die anderen Männer zurück über den Kammweg. Eistaucher stand allein da. Er spürte den schneidenden Wind auf der Haut. Zeit, seine Wanderschaft zu beginnen.
Aber es war nicht ersichtlich, welchen Weg er nach unten wählen sollte. Für eine Weile schien es, als würde er einfach an Ort und Stelle erfrieren und niemals die Reise seines Lebens antreten.
Also regte ich mich in ihm und gab ihm ein wenig Kraft.
Ich bin der dritte Atem.
Er begann, über die Felsen hinabzusteigen. Einmal drehte er sich noch um, um Dorn die Zähne zu zeigen, aber der war mit den anderen bereits an der Flanke des Höhenzugs hinabgestiegen und außer Sicht. Eistaucher lief weiter abwärts und schleuderte jeden Gedanken an Dorn weit von sich. Die zersplitterten Steine unter seinen Füßen waren hier und da mit Schnee bedeckt, der sich in Senken und neben Erhebungen sammelte, ein Muster, das seine Schritte lenkte. Lauf geschmeidig wie eine Katze, von Fels zu Fels hinab, immer bereit, kleine Sprünge mit den Händen abzufangen. Seine Zehen waren eiskalt, und er überließ sie ihrem frostigen Schicksal und konzentrierte sich darauf, seine Hände warm zu halten. Dort unten zwischen den Bäumen würde er sie brauchen. Es begann zu schneien, erste, feine, kalt piksende Flöckchen. Auf dem Hang gab es große Schneeflächen, auf denen er besser laufen konnte als auf den Steinen.
Er zog den Brustkorb zusammen und presste alle Wärme nach außen in seine Gliedmaßen, schnaufte, bis etwas Hitze in ihm aufflackerte und der Nadelschnee auf seiner Haut schmolz. Manchmal konnte man nur durch noch größere Eile warm werden.
Er kletterte abwärts und dann über die Felsbrocken in der Rinne, die der Bach unten im Tal eingegraben hatte. Auf der anderen Seite konnte er über den dünnen Waldboden wieder hochlaufen. Der Untergrund war unangenehm schwammig, durchweicht von Regen und geschmolzenem Schnee. Hier ging er den Schneeflecken aus dem Weg. Der erste Tag des vierten Monats: Es würde nicht leicht werden, ein Feuer zu machen. Doch wenn es ihm gelang, hatte er eine um vieles angenehmere Nacht vor sich.
Das obere Ende des Untertals verengte sich zu einer steilen, gekrümmten Schlucht. Um die Quelle des Bachs stand eine kleine Gruppe von Fichten und Erlen. Dort würde er Schutz vor dem Wind finden und Zweige, aus denen er sich Kleider machen konnte, und unter den Bäumen dort lag mit Sicherheit nicht mehr viel Schnee. Eilig lief er zu dem Wäldchen, achtete dabei allerdings darauf, sich nicht die fühllosen Zehen anzustoßen.
Zwischen den Bäumen an der Quelle angekommen, zog er grüne Fichtenzweige herab und brach mehrere davon ab. Er fluchte laut darüber, wie nass sie waren, doch selbst feuchte Nadeln würden ein wenig seiner Körperwärme bewahren. Er verflocht zwei Fichtenzweige miteinander und steckte den Kopf durch eine Lücke in der Mitte, sodass eine Art Überwurf entstand.
Dann brach er ein totes Stück Wurzelholz von einer Krüppelkiefer ab, um es als Untergrund für sein Feuerzeug zu verwenden. Bei der Quelle fand er einen guten Hackstein, mit dem er einen gerade gewachsenen abgestorbenen Erlenzweig zum Feuerstock abschlug. Er hatte gerade noch genug Gefühl in den Händen, um den Stein zu halten. Ansonsten war ihm nicht besonders kalt, mit Ausnahme seiner Füße, die sich tot stellten. Die schwarze Matte aus Fichtennadeln, die den Boden unter den Bäumen bedeckte, war größtenteils schneefrei. Er kauerte sich unter einen der höchsten Bäume, bohrte die Zehen zwischen die Nadeln und wackelte so ausgiebig wie möglich mit ihnen. Als er ein leichtes Brennen verspürte, zog er sie wieder heraus und machte sich auf die Suche nach trockenem Mulm. Selbst bei den besten Feuerzeugen brauchte man etwas Mulm als Brennstoff.
Er langte ins Innere toter Fichtenstämme und tastete nach Mulm oder Zunderholz. Schließlich fand er ein wenig von Letzterem, das nur leicht feucht war. Dann brach er eine Handvoll toter Zweige ab, die im Schutz größerer Äste hingen. Von außen waren sie feucht, aber innen trocken; sie würden brennen. Auch ein paar größere tote Äste konnte er abbrechen. In dem Wäldchen gab es genug totes Holz, um ein Feuer zu versorgen, wenn es erst einmal brannte. Die Frage war, ob er genug Mulm oder Zunder fand. Weder Fichten noch Erlen ergaben beim Verrotten guten Zunder, also brauchte er Glück. Vielleicht würde er etwas ameisenzerfressenes Holz finden. Er ging auf die Knie und begann, unter den größten umgestürzten Bäumen zu suchen, wobei er sich von den Schneeflecken fernhielt. Auf der Suche nach etwas Brauchbarem drehte er größere Äste um und durchwühlte die Erde. Schnell war er bis zu den Ellenbogen mit Dreck verklebt, aber auch das würde ihn warm halten.
Und vielleicht würde es genau darauf ankommen, weil er nämlich weder trockenen Zunder noch Mulm fand. Er wrang das Wasser aus einem stark verrotteten Holzklumpen, aber der braune Schmier, der in seinen Händen zurückblieb, erinnerte eher an totes Moos oder Wollkraut und war noch immer feucht. Dieses Zeug ließ sich mit der rauen Spitze des Feuerstocks unmöglich in Brand setzen.
—Bitte, sagte er flehend zu dem Wäldchen. Er bat es um Verzeihung, dass er bei seinem Eintreffen auf die Bäume geflucht hatte. —Gib mir etwas Zunder, bitte, Göttin.
Nichts. Es wurde zu kalt, um weiter auf dem nassen Boden zu knien und zwischen herabgefallenen Ästen herumzuwühlen. Um etwas Wärme zu erzeugen, stand er auf und tanzte. Dadurch gelang es ihm, seine Hände aufzuwärmen; es war wichtig, dass sie nicht ebenso taub wurden wie seine Füße. Ach, mit einem Feuer wäre die Nacht so viel angenehmer! Hier musste sich doch etwas finden lassen, das sich unter der Hitze seines Feuerstocks entzünden würde!
Nichts. An seinem Gürtel waren viele kleine Gänselederbeutel befestigt, in denen er Feuersteine, trockenes Moos, einen Feuerstock und ein kleines Brett verwahrte. Wäre er angezogen gewesen und hätte all das bei sich gehabt, dann hätte er diese Nacht und die kommenden zwei Wochen in bester Verfassung überstehen können. Eben deshalb hatte man ihn nackt losgeschickt: Bei der Wanderschaft ging es darum, zu beweisen, dass man ohne jedes Hilfsmittel mit Ausnahme der eigenen Hände losziehen konnte und trotzdem nicht nur überlebte, sondern sogar gut zurechtkam. Er musste Eindruck machen, wenn er bei Vollmond wieder ins Lager einzog.
Aber zuerst einmal musste er die Nacht überleben. Er verausgabte sich beim Tanzen, warf die Arme herum, beschrieb große Kreise mit den Händen. Er sang ein warmes Lied und wackelte mit Fingern und Zehen. Nachdem er das eine Weile getan hatte, spürte er ein Brennen am ganzen Körper, mit Ausnahme der Füße. Aber er wurde auch müde. Er achtete darauf, ein Gleichgewicht zwischen der Kälte und seinen Anstrengungen zu finden, ging in engen Kreisen und suchte dabei weiter den Waldboden nach Stellen ab, an denen sich Zunder oder Mulm gesammelt haben konnte. Nichts!
In jedem Hain findet sich etwas Holz, das brennt.
Das war eine der Redensarten, die Heide oft verwendete, obwohl es dabei nur selten um Feuer ging. Eistaucher sprach die Worte laut aus, mit Nachdruck, beschwörend: —In jedem Hain findet sich etwas Holz, das brennt! Aber heute Nacht überzeugten sie ihn nicht. Sie machten ihn nur wütend.
Grabe!
Er machte sich an der Unterseite eines Stamms zu schaffen, der vor langer Zeit beim Umstürzen auf einem anderen zerbrochen war. Es handelte sich fast nur noch um zwei über Kreuz liegende Erdanhäufungen. An sich hätte er dort durchaus fündig werden können, wenn nicht alles völlig durchnässt gewesen wäre. Und kalt.
Als er das erkannte, schlug er mit den Fäusten auf die weichen, feuchten Stämme. Ihm blieb nichts anderes übrig, als wieder im Kreis zu gehen.
Später förderte er beim Graben in einem anderen Stück Holz einen Astknoten zutage, der noch hart war und aus dem zwei Sporne in beinahe dem richtigen Winkel für eine Speerschleuder wuchsen. Er ersetzte sein ursprüngliches Feuerbrett durch den flachen Astknoten, der besser geeignet war. Sein Erlen-Feuerstock machte nach wie vor einen guten Eindruck. Alles war bereit, er musste nur noch etwas finden, das trocken genug war, um Feuer zu fangen.
Wenn nur dieses heftige Unwetter aufgehört hätte. Eine Weile war der Schneeregen in kalten Böen niedergeprasselt. In dem beißenden Wind fühlte es sich an, als würde man von eisigem Sand getroffen. Ihm war nichts anderes übrig geblieben, als sich einen Unterschlupf zu suchen, und so war er unter eine Fichte gekrochen, deren ausladende Äste bis auf den Boden reichten, hatte sich fest an den Stamm geschmiegt und nur ein paar Tropfen und das leichte Kitzeln des Windes auf der Haut gespürt. Die Fichtennadeln kratzten, und der Boden war kalt, aber Eistaucher bewegte die Schultern, sang ein wärmendes Lied und schwor Rache an Dorn. Der sollte ihm noch mal mit schlimmen Schamanen kommen!
Aber alle Jungen mussten auf die eine oder andere Art Männer werden, ihre Fähigkeiten und ihr Durchhaltevermögen auf einer solchen Wanderschaft unter Beweis stellen. Die Wanderungen von Jägern waren kein bisschen weniger unangenehm. Und es hieß, dass die Schamanen anderer Rudel auf sogar noch härteren Prüfungen bestanden.
Eistaucher verbannte alle Gedanken an Dorn. Er prüfte alle Äste am Fuß der Fichte. Wenn er einen toten Ast fand, der vertrocknet, aber innen noch leicht harzig war, dann konnte er vielleicht einen Teil von seinem Innern mit einer Steinspitze zu Fasern zermahlen, die dünn genug waren, um unter dem sich drehenden Stock Feuer zu fangen. Es war einen Versuch wert, und seine Anstrengungen würden ihn warm halten.
Doch er musste feststellen, dass es unten an diesem Baum keinen Ast gab, den er abbrechen konnte.
Als der Regen nachließ, kroch er wieder nach draußen und tastete auf der Suche nach einem passenden Zweig die anderen Fichten ab. Seine Hände waren so kalt, dass er die Äste kaum greifen konnte, um sie zu begutachten.
Nach einer Weile hatte er ein paar geeignet erscheinende Äste abgebrochen. Wenn es ihm gelang, einem von ihnen eine Flamme zu entlocken, dann konnte er das Feuer mit den anderen nähren.
Er fand einen geeigneten Herdstein und einen besseren Hackstein. Dann wählte er seinen besten toten, trockenen Fichtenzweig aus, platzierte ihn auf seinem Herdstein und schlug mit seinem Hackstein darauf. Der Ast war fest. Offenbar würde es eine Weile dauern, seinen Plan in die Tat umzusetzen, aber es war ein vielversprechender Anfang. Krach, krach, krach. Weil er so wenig Gefühl in den Händen hatte, musste er vorsichtiger sein als sonst, wenn er sich nicht auf die Finger schlagen wollte. Vor zwei Jahren hatte er sich einmal eine Fingerspitze zerquetscht, und bis heute war sie dicker als die anderen und leicht taub, mit Einkerbungen im Nagelbett. Er nannte diesen Finger Dickerchen. Entsprechend vorsichtig hieb er also mit seiner Hacke seitlich auf den abgebrochenen Ast ein. Ein- oder zweimal traf er versehentlich den Herd, und die ein oder zwei Funken, die dabei aufstoben, erinnerten ihn schmerzlich an seine Feuersteine. Aber ein paar vereinzelte Funken würden in einer solchen Nacht nicht genügen. Der feuchte, in den Bäumen rauschende Wind lachte ihn aus.
Schließlich hatte er ein Ende des Astes zu wunderbar trockenen Splittern zerquetscht. Im Schneidersitz saß er da, den Oberkörper über den Ast gebeugt, und kam zu dem Schluss, dass das zersplitterte Astende vielleicht wirklich brennen würde. Schwer atmend und warm mit Ausnahme seiner Füße, kroch er unter die beste Fichte in seinem Hain und breitete sein neues Feuerzeug um sich herum aus. Er hielt den Feuerstock fast senkrecht zwischen den Handflächen in die Splittermasse. Alles war bereit: Er drehte den Feuerstock hin und her.
Hin und her, zwischen den Händen hin und her, wobei er die Spitze des Stocks behutsam auf den Ast drückte. Hin und her, hin und her. Seine Hände glitten durch den Druck, den er ausübte, am Stock entlang abwärts, und wenn sie bei der Spitze ankamen, musste er ihn mit einer Hand greifen, die andere wieder ans obere Ende legen, die zweite hochbewegen, den Stock zwischen den Handflächen fassen und weiterreiben, so schnell es ging. Derweil hatte der Regen wieder eingesetzt, und selbst dicht am Stamm seiner Fichte fielen nun Tropfen durch die Äste. Langsam verließ ihn die Hoffnung, doch noch wollte er sich das nicht eingestehen. Denn dann würde ihm rasch sehr viel kälter werden.
Nach langer Zeit, vielleicht nach einer Faust oder mehr, musste er aufgeben, zumindest mit diesem Ast. Der Splitterbrei war etwas zu dicht und nach einer Weile auch leicht feucht geworden. Die Stelle unter dem Feuerstock hatte er so weit erhitzt, dass man sich die Fingerspitze daran verbrennen konnte, und die Splitter darum herum waren sogar etwas angekohlt, aber sie wollten einfach nicht Feuer fangen.
Eistaucher saß da. Es würde ihn einiges an Überwindung kosten, Dorn davon zu erzählen, vorausgesetzt, er überlebte. Der alte Zauberer würde ihm sicher einen Schlag auf die Ohren verpassen. Man musste jederzeit und überall ein Feuer entfachen können. Je schlechter die Bedingungen waren, desto wichtiger war das. Wie die meisten Schamanen beim Großen Tanz war Dorn außergewöhnlich gut im Feuermachen und hatte viel Zeit damit verbracht, Eistaucher und den anderen Kindern seine Kniffe beizubringen. Er hatte ihnen Feuerstöcke auf die Unterarme gedrückt und sie gedreht, um ihnen zu zeigen, wie heiß sie wurden. Irgendwann war Eistaucher dazu in der Lage gewesen, immer Feuer zu machen, egal, wie schwierig der Alte es ihm machte. Aber es hatte immer etwas trockenen Mulm gegeben.
Jetzt kroch er schluchzend vor Enttäuschung unter der Fichte hervor, stand auf und tanzte, bis die Kälte von einer dünnen Schweißschicht abgehalten wurde. Als der Regen etwas nachließ, dampfte er. Schon jetzt war er hungrig, aber dagegen war nichts zu machen. Am besten kaute er auf einem Steinchen herum und dachte an etwas anderes. Kaute auf einem Steinchen herum und tanzte im Regen. Ob er nun fror oder nicht, dies war seine Wanderschaft. Wenn es endlich hell wurde, würde er schließlich einen besseren Unterschlupf, trockenen Mulm und eine Balme oder einen kleineren Überhang finden. Dann konnte er sich für seine Rückkehr bei Vollmond ausstaffieren. Er würde bekleidet ins Lager einziehen, mit vollem Bauch und einen Speer in der Hand! In ein Löwenfell gehüllt! Mit einer Kette aus Bärenzähnenum den Hals! Im Kopf sah er es alles vor sich. Er schrie seine Geschichte in die Nacht hinaus.
Nach einer Weile saß er wieder unter der besten Fichte, den Kopf auf den Knien, die Arme um die Beine geschlungen. Später ging er hinaus und schleppte sich durch das Wäldchen, auf der Suche nach einem besseren Unterschlupf. Einen nach dem anderen probierte er aus. Die guten fügte er einer stetig wachsenden Runde von Rastplätzen hinzu, jeder mit seinen eigenen Stärken und Schwächen. Über weite Strecken sang er, und dann und wann fluchte er auf Dorn. Möge dir der Pimmel abfallen, mögest du von einem Löwen gefressen werden … und von Zeit zu Zeit schrie er laut. —Es ist kalt! Dorn brüllte seine Gedanken manchmal auf diese Art hinaus, wobei er alte Worte aus der Schamanensprache ausstieß, Worte, die wie die Dinge selbst klangen: Esch var kelt! Esch var k-k-k-KEEEELT!
Er stieß sich den großen Zeh an und spürte es nur im Knochen; das Fleisch war taub. Wieder fluchte er. Mögen die Raben auf dich scheißen, mögen deine Kinder sterben … Dann legte er sich unter einer großen Fichte auf den Boden, sodass nur seine Kniescheiben und Zehen und seine Handflächen und seine Stirn den Boden berührten. Immer wieder drückte er sich mit den Armen hoch und hielt seinen Körper dabei starr. Wenn er nur mit der Erde hätte ficken können, um sich warm zu halten, doch sie war zu kalt, sein armer Pimmel wollte nicht zum Horn werden, der war ebenso taub wie seine Zehen, und er würde wie verrückt wehtun, wenn er sich wieder erwärmte, er würde kribbeln und brennen, bis Eistaucher die Tränen kämen. Vielleicht, wenn er an das Mädchen aus dem Löwenrudel dachte, das ebenfalls zur Rabensippe gehörte und ihm deshalb verboten war, zumindest im Prinzip, schöne Augen hatten sie einander trotzdem gemacht, und der Gedanke daran, in sie einzudringen, würde ihn wärmen. Oder Salbei aus seinem eigenen Rudel.
Mit diesen Gedanken konnte er etwas Zeit einfangen: damit, all das hinter seinen Lidern zu beobachten, zuzusehen, wie sie die Schenkel vor ihm spreizte. Dort in ihrer Kolbi konnte er diesen kalten Regen vergessen. In ihrer Kolbi, ihrer Baginare, ihrem Fuchs. Er wollte ein kleines Feuer hinter seinem Bauchnabel entfachen und seinen Visel spritzen lassen. Aber es war zu kalt. Er konnte nur das geschundene Fleisch etwas kneten und leicht zum Brennen bringen, es wärmen, damit es nicht vor Kälte abstarb. Das wäre wirklich schlimm.
Nach einer Weile ließ der Regen nach. Der graue, wolkendunkle Himmel wirkte etwas heller. Kein Mond, keine Sterne, an denen sich erkennen ließ, ob die Morgendämmerung nahte. Aber er hatte das Gefühl, dass sie nicht mehr fern sein konnte. Bald musste es so weit sein. Es war eine lange, lange Nacht gewesen.
Schwankend erhob er sich. Das Grau am Himmel war eindeutig heller geworden. Er sang ein warmes Lied, ein Lied für die Sonne. Er rief nach der Sonne, dem großen Gott der Wärme und des Frohsinns. Er war müde, und ihm war kalt. Aber die Kältewürde ihn nicht umbringen. Er würde bis zur Morgendämmerung durchhalten, das spürte er. Das war seine Wanderung, so wurde ein Schamane geboren. Er heulte, bis er eine raue Kehle hatte.
Schließlich kam die Morgendämmerung, feucht, grau, trübe, kalt. Unter dem Gewitterhimmel blieben alle Farben gedämpft, aber immerhin konnte Eistaucher nun sehen. Von Westen her schoben sich weitere, tief hängende Wolken heran und kappten die Höhenzüge. Ihre Unterseiten hingen durch wie fette schwarze Brüste. Stromabwärts von ihm gingen breite Regenschleier im Untertal nieder. Sie sahen aus wie Ginstergesträuch, das zwischen Wolken und Wald in der Luft hing. Durch die großen Schneeflecken überall war der Boden heller als der Himmel.
Und dann wurde innerhalb weniger Lidschläge alles sehr viel heller, und ein weißer Fleck glomm in den Wolken über den östlichen Höhenzügen auf. Die Sonne, der wunderbare Gott der Wärme, war endlich über den Berg gekrochen. So bewölkt es auch sein mochte, jetzt würde es sicher bald angenehmer werden. Nur bei den schlimmsten Gewitterstürmen war der Tag kälter als die vorangegangene Nacht. Und derzeit sah der Himmel in Windrichtung gar nicht so übel aus: Zwischen den Wolken, die über den grauen Hügeln wogten, war helles Weiß zu sehen. Es war allerdings nach wie vor windig, und Regen ging in kleinen Schauern nieder.
Doch ob der Tag nun wärmer als die Nacht würde oder nicht, er musste in Bewegung bleiben, wenn er nicht frieren wollte. Erholen konnte er sich erst, wenn er ein Feuer in Gang gebracht hatte. Also sammelte er die Ausrüstung für sein missglücktes Feuer ein, nahm sie in die linke Hand, ergriff mit der rechten einen guten Wurfstein und folgte dem Bachlauf. Er brauchte ein größeres Wäldchen, mit einer guten Mischung aus Fichten und Kiefern, Zedern und Erlen. Die Hänge und Höhenzüge und auch das dahinterliegende Hochland bestanden vor allem aus kahlem, von Grasbüscheln übersätem Felsgestein, auf dem noch alter Schnee lag. Aber an den Wasserläufen wuchsen meistens Bäume, ausgefranste grüne Bänder in den Talsohlen. Ein kurzes Stück stromabwärts, wo ein Rinnsal über den Osthang in den Bach des Untertals mündete, befand sich an einer flachen Stelle ein größeres Wäldchen, das sich zu beiden Seiten an den Talwänden emporzog, in der Mitte eine kleine, ovale Wiese.
Vorbei am überfluteten Teil der Wiese ging er in den dichtesten Teil des Wäldchens. Dort schlüpfte er zwischen die Stämme, dankbar für ihren Schutz. Es war windiger geworden und regnete heftiger, als er es beim Verlassen seines Nachtlagers gedacht hatte. Doch in diesem größeren Wäldchen war seine Lage sehr viel besser. Er war hier gut geschützt, und jetzt, wo es Tag war, konnte er bei der Arbeit sehen. Sein Blick fiel auf eine umgestürzte Zeder in der Mitte des Wäldchens, deren innere Rinde er herausziehen konnte, um sich Kleidung daraus zu fertigen. Und mehrere schneeberingte Ameisenhaufen vor einer weiteren, verrotteten Zeder verrieten ihm, wo er Zunder finden konnte. Am Ende des Stamms befand sich ein kleines Loch. Er schlug mit seinem Stein dagegen, um es zu weiten, griff hinein und drehte die Finger tastend nach oben. An der Unterseite des noch festen Außenholzes befand sich ein Bereich mit zundrigem Mulm, der ziemlich trocken war —O Mutter!, rief er. —Danke!
Er zog eine große Handvoll heraus und trug sie hastig auf die windabgewandte Seite einer knorrigen alten Fichte. —In jedem Wäldchen, DASGROSSGENUGWAR, findet sich etwas Holz, das brennt, schrie er seine Richtigstellung von Heides Redensart laut heraus. Das würde er ihr klar und deutlich sagen. Sie würde ihn auslachen, das wusste er, aber er würde es ihr trotzdem sagen. Irrtümer konnten verhängnisvoll sein, insbesondere, wenn man etwas zu einer Redensart machte.
Er ließ den trockenen Mulm gut geschützt in einer Vertiefung am Fuß einer gesplitterten alten Kiefer zurück, sammelte hastig trockene Zweige und brach noch einige weitere ab. Die verstaute er zusammen mit dem Mulm, bevor er zehn bis zwanzig kleinere lebende Äste abbrach und sie über und rund um die gesplitterte Kiefer anordnete, die er sich ausgesucht hatte, um so seinen Windschutz zu verbessern. Krüppelkiefern wie diese besonders alte hatten mehrere Stämme und einen dichten Nadelwuchs; der Baum hier war an sich schon ein wunderbar geschützter Platz, und mit seinen Astwänden kam praktisch kein Wind und Regen zur Feuerstelle durch.
Anschließend legte er sich sein Feuerholz bereit und hockte sich mit dem Rücken zum Stamm vorgebeugt hin, sodass sein Körper ebenfalls zum Windschutz beitrug. Er spreizte die Knie ab und klemmte sich sein Feuerbrett zwischen die fühllosen Füße.
Dann hackte er seinen Feuerstock zurecht, um ihn etwas ordentlicher und spitzer zu machen, und setzte ihn in die Vertiefung seines Bretts, sehr dicht bei seinem frischen Mulm. Als alles seine Richtigkeit hatte, begann er, um sein Leben zu reiben, hin und her, vor und zurück. Er spürte, wie seine Hände an dem Stock herabrutschten, und er spürte, wie der Stock sich im Drehen gegen das Brett presste, und er versuchte, die Kombination von Geschwindigkeit und Druck aufrechtzuerhalten, die am meisten Hitze erzeugen würde. Es war ein ganz eigenes Gefühl, und die Art, wie die Hände jedes Mal vom unteren Ende des Stocks ans obere zurückkehrten, hatte etwas von einem kleinen, schnellen Tanzschritt. Als er einen guten Rhythmus gefunden und mehrmals umgegriffen hatte, schob er mit den Zehen einen Teil des Mulms dichter an die sich langsam schwärzende Mulde, eine kleine Vertiefung in dem Astknoten, die ihn überhaupt erst veranlasst hatte, dieses Holzstück auszuwählen; es war genau das, was man sonst mit einer Klinge in eine ebene Oberfläche geschnitzt hätte.
Er sah, wie der Mulm sich schwarz verfärbte, hielt den Atem an; und dann begannen einige der angekohlten Stellen, erst gelb und dann weiß zu glühen. Er blies behutsam auf die weißen Spitzen, verrenkte sich fast, um mit dem Gesicht dichter heranzukommen, und blies genau in der richtigen Art und Weise, um das Weiß weg von der Vertiefung und hin zu dem größeren Büschel Mulm zu treiben. Er krümmte den Rücken wie die Gewundene Au und blies so behutsam wie nur möglich, um die weiße Hitze wachsen zu lassen, nährte sie mit einem bisschen Atem, ohne sie dabei auszupusten, gab ihr genau das, was sie brauchte, entleerte sich für sie, puff puff puff, puffff, das konnte er, damit kannte er sich aus, puff puff puff, puff puff puff, pufffff
Und dann fuhren Flammen aus dem Mulm. FEUER! Selbst diese winzige Flamme schlug ihm ihre Wärme ins Gesicht, und er atmete gierig ein und blies dann noch hingebungsvoller ins Feuer, nach wie vor behutsam, aber mit einem zunehmenden Gefühl der Dringlichkeit, wie wenn man einer Flöte den Zweiklang eines Wolfsschreis entlocken wollte. Dabei erhob er sich auch auf Knie und Ellenbogen und setzte sein Gesicht als dichten Windschutz für diese wunderschöne kleine Flamme ein, blies in genau der richtigen Weise in sie hinein, um sie wachsen zu lassen, liebkoste sie, o ja, wie sehr er sich wünschte, dass sie sich wohlfühlte, dass sie glücklich war und wuchs! Er gab ihr seinen Atem, seinen Geist, seine Liebe, er wollte, dass sie aufloderte, dass sie wie die zähe Milch aus einem Visel emporschoss, dass sie ihm das Gesicht verbrannte: Und sie tat es!
Als er sah, dass die kleine Flamme sich hielt, begann er, die kleinsten und trockensten Zweige so darüberzuschichten, dass möglichst viele von ihnen Feuer fingen, ohne dabei die Glut darunter zu ersticken. Man musste genau das richtige Maß wahren, aber damit kannte Eistaucher sich aus; er war gut darin, weil Dorn ihn dazu gezwungen hatte, es zwanzigzwanzigzwanzigzwanzigmal zu üben. O ja, Feuer, Feuer, FEUER! Die meisten Leute waren ziemlich gut im Feuermachen, aber Eistaucher hielt sich für einen der Besten, weshalb ihm sein Versagen in der vergangenen Nacht auch so zusetzte. Es würde ihm schrecklich peinlich sein, die Geschichte jener ersten Nacht zu erzählen. Er würde betonen müssen, wie ungeheuer wild das Unwetter gewesen war, allerdings hatte sein Rudel die Nacht nur ein Tal weiter verbracht und würde ihm nicht glauben, wenn er allzu sehr übertrieb. Letztlich würde er zugeben müssen, dass er in jener Nacht einfach nicht in Bestform gewesen war.
Aber jetzt war es Morgen, und er hatte ein Feuer in Gang gebracht, und die ersten Zweige entzündeten sich und ließen die Flammen wachsen, sodass er mehr Holz aufschichten konnte, darunter auch einige dickere Zweige. Schon bald brannten zehn bis zwanzig Zweige in einem kräftigen Gelb über der ersten Glut. Jetzt konnte er gefahrlos eine ordentliche Handvoll trockener Zweige auf seinem kleinen Feuer platzieren, die praktisch sofort aufloderten. —Ha! Ha!, sagte er und legte ein paar größere Stücke dazu. Erst fingerdicke Stöcke, dann Äste vom Durchmesser seines Handgelenks. Glücklich sah er zu, wie die wachsenden Flammen über das Holz leckten und es verkohlten. Wenn man ein Feuer hat, ist man mit der Welt im Reinen.
Jetzt stieg auch Rauch auf, und das Zischen und Knacken des Holzes verriet, wie heiß die Flammen inzwischen waren. Die Hitze knallte ihm auf die nackte Brust, auf den Bauch und den Pimmel, der schrecklich brannte, als er sich erwärmte; ein qualvolles, wohlbekanntes Kribbeln. Er umfasste ihn mit einer Hand, um den Schmerz festzuhalten, und stellte fest, dass es ein guter Schmerz war, so gut, dass man ihn leicht als eine raue Art von Wohlbehagen empfinden könnte; ah, das nur zu vertraute Brennen tauben Fleisches, das wieder zum Leben erwacht, dieses Jucken tief unter der Haut, das schmerzhafte Kitzeln der Lebendigkeit! Jetzt konnte er sich sogar die Füße wärmen! Sie würden beim Auftauen wie wahnsinnig brennen. Ach, das Feuer, das prachtvolle Feuer, so gütig und warm, so wunderschön!
—Welch ein Segen, welch ein Freund! Welch ein Segen, welch ein Freund! Das war eines von Heides kleinen Feuerliedern.
Jetzt sah es wirklich gut für ihn aus. Die vorangegangene Nacht schien nun nur noch eine anfängliche Schwierigkeit, ein düsteres Vorspiel. Jetzt, wo sein Feuer brannte, spielte das Unwetter, das noch immer über seinem Kopf toste, keine auch nur ansatzweise so große Rolle mehr. Er konnte sein Feuer die ganzen zwei Wochen lang am Leben erhalten, wenn ihm das als das Beste erschien, oder er konnte es ein Stück weit mitnehmen, wenn er sich an anderer Stelle niederlassen wollte. Er konnte seine Anstrengungen darauf konzentrieren, Nahrung, Unterschlupf und Kleidung zu finden, und ganz egal, wie erfolgreich er dabei war, das Wichtigste hatte er nun und würde es nicht wieder verlieren. Und dabei war er erst seit einem Tag auf Wanderschaft!
Er setzte sich auf die windzugewandte Seite seines Feuers und streckte die Beine darum, hielt die Arme darüber. Inmitten des Rauchs fing er mit den Händen die Hitze ein. Ah, wie das kribbelte, als das Leben zurückkehrte: —HA-UU! Das war ein ganz anderes Aufheulen als in der vorangegangenen Nacht. Wie die Wölfe und wie seine Namensvettern, die Eistaucher, kannte er eine ganze Bandbreite von Heullauten. Dies war das glückliche Heulen, das triumphierende Heulen: —HA-UUUU!
Als er sich bis in die Zehen aufgewärmt hatte und mehrere dicke Äste auf einem breiten Bett grauer, rot glühender Scheite lagen, schritt er die Grenze seines kleinen Wäldchens ab und ging dann in enger werdenden Kreisen von außen nach innen, um es zu inspizieren. Da war die gesplitterte Zeder am Rande der kleinen Wiese, und am seichten Bachufer fand er ein Stück Feuerstein mit einem spitzen Ende und einer breiten, rauen Kante, der einem großen, groben Stichel ähnelte. Der würde eine brauchbare Hacke abgeben. Mit seinem Fund kehrte er zu der gesplitterten Zeder zurück und begann, auf den Spalt im Stamm einzuhacken, um die Borke zu lösen. In so großen Stücken wie möglich schälte er die innere Rinde ab. Einige der Streifen waren länger, als er groß war.
Als er so viel Rinde wie möglich aus dem Baum herausgeschält hatte, kehrte er damit zu seinem Unterschlupf zurück, legte ein paar mehr Äste aufs Feuer und setzte sich dann in der wundervollen Wärme hin, um die Rinde in Streifen zu reißen. Es war langsame Arbeit, die peinliche Sorgfalt verlangte, aber sie war auch sehr befriedigend, weil mit der Zeit ein großer Haufen Rindenstreifen zusammenkam.
Zu Mittag hatte er wahrscheinlich mehr, als er brauchen würde. Nachdem er sich einmal mehr um das Feuer gekümmert hatte, breitete er die Streifen auf einem schneefreien Stück Boden neben seinem Unterschlupf aus. Er hatte vier oder fünf Dutzend. Sechs davon legte er in einer Reihe nebeneinander und verwob dann sechs weitere mit ihnen. Mit diesem einfachen, aber haltbaren Drüber-Drunter-Muster war er ganz zufrieden. Die längeren Streifen benutzte er für die Längsrichtung, während er die kürzeren quer einflocht und dabei jede Reihe etwas versetzte, damit der entstehende Schlauch nicht eine von oben nach unten durchgehende Naht aufwies. Schließlich griff er unter das Gewebe und zog es in der Mitte hoch, wob weitere Reihen um die Rückseite und verband dabei die Längsstücke, die am weitesten auseinanderlagen; damit hatte er einen Schlauch. Einen Beinling.
Das Ganze wiederholte er für den zweiten Beinling. Dann drehte er ein Band aus drei Streifen, das ihm als Gürtel und Aufhängung für die Beinlinge dienen sollte. Dazu fertigte er noch Schlaufen an und schließlich ein einfaches Hodenband, um seinen kalten Pimmel zu schützen. Er stieg in die Beinlinge, band sie an seinem Gürtel fest und spürte sofort, wie sie seine Körperwärme auffingen. —Ha!
Dann kam ein Wams; danach eine Mütze; und zuletzt machte er sich aus den Resten einen ausgefransten, kurzen Umhang. Bei Regen würde diese Kleidung nass werden und leicht reißen, aber bis dahin würde sie ihn in seinem Unterschlupf halbwegs warm halten, und wenn der Regen aufhörte, stellte sie auch einen gewissen Schutz dar. Für richtige Kleidung brauchte er natürlich Tierpelze, aber an die würde er nicht so leicht herankommen. Fürs Erste musste er mit seinem Rindenanzug vorliebnehmen, der immer noch sehr viel besser war als überhaupt keine Kleidung, so hoffte er zumindest.
Jetzt, wo ihm warm war, verspürte er das Zwacken des Hungers. Auf der Wiese hatte er einige Beerensträucher gesehen, also legte er noch drei Äste aufs Feuer und machte sich in seinen Rindenkleidern daran, sie wiederzufinden.
Es war zwar immer noch windig, hatte aber zu regnen aufgehört, und die Wolken rissen auf. Der Rand der Lichtung war gesäumt von Entenaugenbeeren-Sträuchern, in die er vorsichtig hineingriff, um einige der toten Beeren des letzten Jahres vom Boden zu sammeln. Sie waren schwarz und platt gedrückt, aber besser als nichts.
Dann ging er dorthin, wo der Bach von der Wiese fortfloss. Wie oft an solchen Stellen erspähte er Forellen, versteckt unter dem letzten Stück Uferböschung vor der Rinne zwischen den Bäumen. Sein Unterschlupf lag nicht weit hinter ihm; zwischen den Bäumen hindurch konnte er sein Feuer fröhlich flackern sehen.
Er ging stromabwärts, bis er eine geeignete seichte Stelle fand. Dort schleppte er Steine vom Ufer in den Bach, bis er einen kleinen Damm hatte. Der Bach strömte ungehindert durch die Lücken in diesem Damm, sodass das Wasser dahinter kein bisschen anstieg; aber selbst kleine Fische konnten nicht hindurch. Dann eilte er stromaufwärts zur Wiese zurück.
Dort zog er seine neuen Kleider aus, stieg in den Bach und ging stromabwärts. Kurz vor der letzten Biegung riss er einen großen Stein aus dem Ufer und warf ihn fest mitten ins Wasser, wobei er auf und ab sprang und laut schrie. Keine Fische flitzten stromaufwärts an ihm vorbei, also watete er, immer noch schreiend, stromabwärts. Es waren auch keine Fische unter der Uferböschung, also vermutete er, dass sie stromabwärts geflohen waren.
Mit einem Stein in der einen und einem Stock in der anderen Hand watete er zu seinem Damm. Auf dem Weg schlug er mit dem Stein auf Steine im Wasser und schrie laut.
Dann konnte er seinen Damm sehen. Vor ihm im Wasser, zwischen ihm und dem Damm, befanden sich drei Forellen. Er ließ seinen Stein ins Wasser fallen, langte ans Ufer und zog so schnell er konnte Steine ins Wasser, um einen weiteren Damm zu errichten. Während er ihn fertigstellte, musste er einen der Fische abfangen, der stromaufwärts fliehen wollte, aber selbst dieser hatte zu viel Angst, um direkt an ihm vorbeizuflitzen, und die anderen beiden versuchten es nicht einmal. Sobald der zweite Damm ein gutes Stück höher war als der Wasserstand, hatte er sie in einem kleinen Fischteich gefangen. —Ah!, rief er. —Ich danke dir!
Er watete stromaufwärts, um kurz nach seinem Lager zu sehen. Sein Feuer brannte noch immer gut. Er stieg aus dem Bach und ging wieder stromabwärts zu seinem Fischteich. Dort lauerte er einem Fisch auf – es schien der zu sein, der vorhin den Fluchtversuch unternommen hatte. Vorsichtig ging er zu einer Stelle, von der aus er beide Hände ganz langsam dicht neben dem Fisch ins Wasser strecken konnte. Der Fisch versuchte sich unsichtbar zu machen, indem er ganz regungslos wurde. Mit einer einzigen großen Schaufelbewegung schleuderte er Wasser und Fisch ans Ufer, wo der Fisch eine Weile zappelte und schließlich starb. Eistaucher unterdrückte seinen Schrei, um die anderen nicht zu verschrecken, und wandte sich mit langsamen Bewegungen dem nächsten zu, der ebenfalls dicht am Ufer schwamm. Sehr behutsam steckte er erneut die Hände ins Wasser, schaufelte es aufs Neue an Land, und der zweite Fisch flog durch die Luft und verendete zappelnd.
Der letzte schoss wild umher und wich mehreren seiner Schaufelversuche aus, aber dann erwischte Eistaucher ihn, sodass auch er letztendlich am Ufer hin- und herspringend starb. Damit hatte er drei gute Forellen, jede deutlich länger als eine Handspanne.
Er sang das Dankeslied der Fischer, stieg aus dem Bach, zog seine Kleider wieder an und trug die Fische ans Feuer.
Aus alten Erlenstöcken, deren Enden er abdrehte, bekam er schließlich eine Spitze hin, mit der er die Fische schneiden und ausnehmen konnte. Dann steckte er sie auf lange Kiefernzweige und hielt sie über das Feuer, bis sie durch waren und an den Rändern brutzelten. Sie schmeckten großartig, ungewürzt, aber nach Forelle. Für spätere Mahlzeiten würde er Rosmarin und Minzblätter sammeln. Beim Essen kam ihm in den Sinn, dass er den oberen Damm seines Fischbeckens hätte öffnen sollen, bevor er zu seinem Unterschlupf zurückgekehrt war.
Aber das konnte er auch noch morgen erledigen. Jetzt, wo er mit vollem Bauch und Kleidung am Leib am Feuer saß, wurde er plötzlich schläfrig.
Er drehte noch eine weitere kurze Runde durch sein Wäldchen und sammelte dabei mehr Fichtenzweige, um darauf zu schlafen und sich mit ihnen zuzudecken. Er machte sich sein Bett direkt am Feuer, und als er die Zweige mit den weichen Nadeln zu seiner Zufriedenheit hergerichtet hatte, kehrte er zum Bachufer zurück, um Moosstücke zu sammeln, die er nach seiner Rückkehr nahe ans Feuer legte. Während sie trockneten, sammelte er noch mehr Feuerholz für die Nacht und verteilte dann das getrocknete Moos auf seinem Bett aus Zweigen. Auf dieses gepolsterte Lager legte er sich nieder und zog die Fichtenäste mit ihrem dichten Nadelkleid über sich, ohne seine Rindenkleidung auszuziehen. Er würde das Feuer hell brennen lassen. Es würde eine sehr angenehme Nacht werden. Noch herrschte Zwielicht, aber er blieb trotzdem neben seinem Stapel aus Feuerholz liegen, sah den Flammen zu und war glücklich. Es war erst sein zweiter Abend, und schon war er satt, hatte etwas zum Anziehen und lag in einem Bett am Feuer! Da hatte er was zu erzählen.
So lag er da, behaglich im Warmen. Der Mond war in seiner zweiten Nacht, und seine Sichel war ein hübsches Stück dicker als der schmale Neumond. Die Zeit von Neumond bis Vollmond verging schnell, hieß es. Schon bald sank die Mondsichel hinter den Horizont, und die Nacht wurde absolut dunkel. Nur die Sterne durchstachen die Schwärze über den wenigen verbliebenen Wolken. Die von unten angeleuchteten Bäume verschwammen im flackernden Feuerschein miteinander. Es war der zweite Tag des vierten Monats, und außerhalb der Wärmeblase, die sein Feuer umgab, hing nasse Kälte in der Luft. Der Schlaf trug Eistaucher fort.
Etwa um Mitternacht weckte ihn ein Wolfsheulen von einem fernen Höhenzug, und er warf einige weitere Äste auf die glühenden Scheite, die unter der schwebenden weißen Asche rot pulsierten. Funken stoben auf; er sah zu, wie sich ein Ast schwarz verfärbte und dann Feuer fing, das plötzliche, gelbe Hineinplatzen der Flammen in die Welt, der hypnotische, durchscheinende Tanz; dann schlief er wieder ein.
Später träumte er davon, dass er eine Furche unter einem Bergkamm emporlief und dabei einen Blick auf drei Steinböcke erhaschte, die gerade den Grat erklommen. Er hatte die Tiere direkt vor sich; alle drei blickten ihn geradeheraus und entspannt an, während ihre schönen, gekrümmten Hörner in den Himmel stachen. Felstänzer; die Lieblingstiere seiner Mutter. Mit einem Mal stand sie neben ihm, und sein Vater auch. Sie sahen die Felstänzer zu der Zeit, in der die Rentiere durch die Steppe zogen und das tiefe Donnern ihrer Hufe wie ein fernes Gewitter klang. Seine Mutter gehörte zur Rabensippe und sein Vater zu den Adlern, aber sie beide liebten unverkennbar den Steinbock; das war es, was Eistaucher von diesem Erlebnis im Gedächtnis blieb. Ihm war bewusst, wie sonderbar die Anwesenheit seiner Eltern war, und dieses Wissen weckte ihn.
Die Sterne waren über den Himmel gezogen, und die Morgendämmerung war nicht mehr fern. Er wollte wieder in den Traum eintauchen, doch es gelang ihm nicht. Dann versuchte er, so viel wie möglich davon zu behalten, ehe ihm die Erinnerung endgültig durch die Finger rann. Alles war ihm sogleich wieder präsent; er ging den Traum von seinem leisesten bis zu seinem eindrucksvollsten Moment durch; und dann vom Anfang bis zum Ende. Manche Träume wollen, dass man sich an sie erinnert, aber andere versuchen, einem zu entkommen, sodass man sie jagen muss. Dieser gehörte zur letzteren Sorte.
Seine Mutter und sein Vater hatten ihn also besucht. Das war seit einer ganzen Weile nicht mehr vorgekommen. Er versuchte, sich ihr Bild zu vergegenwärtigen oder zu begreifen, woher er im Traum so genau gewusst hatte, wer sie waren, obwohl sie nur neben ihm gestanden und, soweit er sich erinnern konnte, nichts gesagt hatten. Manchmal erinnerte er sich an Gespräche, die er im Traum geführt hatte, und manchmal nicht. Diesmal hatte er ihre Gefühle gekannt, ohne dass sie etwas hatten sagen müssen. Sie waren voll Wohlwollen und Sorge um ihn gewesen, und voller Liebe für die Felstänzer. Als Eistaucher daran dachte, dass sie nicht in der Welt der Lebenden weilten, wimmerte er leise. Wie war es wohl, nur in der Geisterwelt zu existieren, wie lebte man dort, und warum konnte man nicht zurückkommen? Warum waren sie gestorben, warum starb überhaupt etwas? Die Rätselhaftigkeit all dessen überwältigte ihn, und mit einem Mal kam er sich vor wie etwas Winziges, das von etwas Gewaltigem durchbohrt wurde. Ohne das Feuer hätte er sich völlig verloren gefühlt. Mit dem Feuer konnte er diese Dinge betrachten, es sich gestatten, dem Schmerz und dem Gewaltigen in seinem Innern nachzuspüren.
Kurz nach der Morgendämmerung zog sich der Himmel wieder zu, aber diesmal war die Wolkendecke dünn und brachte keinen Regen. Der Wind war böig und riss Ascheflocken aus dem Glutbett mit sich. Eistauchers Unterschlupf war nach wie vor recht gut geschützt, und obwohl ihm an der vom Feuer abgewandten Seite kalt wurde, konnte er sich einfach drehen und spüren, wie die strahlende Hitze ihm die kalte Haut versengte. Dies war der zweite Tag seiner Wanderschaft; doch jetzt fühlte er sich trotz all seiner Annehmlichkeiten traurig und einsam. Er seufzte. Dies war seine Initiation als Schamane. Er trat in eine neue Welt, in eine andere Existenz über; es ging nicht nur darum, Zeit allein zu verbringen. Das hatten ihm seine Eltern mit ihrem Besuch sagen wollen: Er musste sich etwas stellen, etwas lernen, etwas erreichen. Sich in etwas anderes verwandeln: einen Zauberer, einen Mann in der Welt. Natürlich waren seine Eltern tot.
Er ging zum Bach hinab, um zu trinken, suchte mehr Feuerholz und trug ein großes Stück von einem alten Stamm mit sich zurück, das dem Feuer erst als Dach dienen und dann zum Teil der Glut werden würde.
Dann war es an der Zeit, mehr zu essen aufzutreiben. Er schritt die Wiese auf der Suche nach Spuren, Kötteln oder anderen Anzeichen von Tieren ab und in der Hoffnung, einen guten Platz für eine Schlinge zu finden. Schlingen machte man am besten aus Hautriemen. Borkenschnüre waren nur selten fest genug. Als er an der Stelle vorbeikam, an der der Bach von der Wiese floss, entfernte er den oberen Damm, musste aber feststellen, dass es in der oberen Biegung keine Fische gab, die er flussabwärts jagen konnte, also suchte er weiter die Wiese ab, wobei er die Flecken alten Schnees ausließ. Am Ufer waren Wasserstellen mit vielen Tierspuren, aber die meisten davon waren unbewachsen, sodass sich eine Schlinge kaum verstecken ließ. Er brauchte einen schmalen Durchgang zwischen zwei Büschen, durch den ein am Wasser aufgeschrecktes Tier vielleicht blindlings fliehen würde. Schließlich fand er eine passende Stelle. Doch er hatte nach wie vor kein geeignetes Material für seine Schlinge. Mit seinem Hackstein schnitt er ein paar Ruten von einer Erle, biegsam, fest und lang, spaltete sie an den Enden und flocht drei davon ineinander. Wenn er diese Stolperfalle dicht über dem Boden festband, würde sich vielleicht ein junges Reh oder eine Ziege darin verfangen. Etwas Besseres bekam er an diesem Morgen nicht hin, also brachte er seine Schlinge sorgfältig zwischen den beiden Büschen an. Wenn auch nur ein kleines Tier hineintappte, während er zusah, würde ihm das Zeit geben, zuzupacken. Allerdings musste er auf der Lauer liegen, um im richtigen Moment da zu sein, sonst würde seine mögliche Beute sich freistrampeln. Bei Sonnenuntergang würde er also zurückkehren in der Hoffnung, ein trinkendes Reh aufscheuchen zu können.
Als er die Schlinge so gut wie möglich ausgelegt hatte, ging er zurück ans Feuer und suchte nach guten Wurfsteinen. Selbst ein Schneehase oder Schneehuhn wäre ihm sehr willkommen gewesen. Als er zwei gute Steine gefunden hatte, suchte er den Boden auf der dem Sonnenaufgang zugewandten Talseite nach mehr Beeren vom Vorjahr ab. Er sah einen Mistelzweig in einem Baum mit kahlen Ästen und dachte darüber nach, hinaufzuklettern und die weißen Beeren zu kauen. Dabei entstand ein zähes weißes Zeug, das man zwischen Zweige spannen konnte, um kleine Vögel zu fangen, die daran festklebten. Aber es waren noch keine kleinen Vögel unterwegs. Er kam zu einem Brombeergestrüpp und schluckte zu den alten, toten Beeren noch ein paar weiße Pilze herunter, von denen er wusste, dass sie ungefährlich waren. Dann eilte er zurück, um nach seinem Feuer zu sehen.
Dem Feuer ging es gut. Eistaucher legte einen weiteren Scheit auf und machte sich auf den Weg in die andere Richtung. Stromabwärts wurde das Untertal tiefer, aber nicht breiter, und auf seiner östlichen Seite gab es eine Lücke, dort, wo die Obere Klamm ins Untertal einmündete. Die Obere Klamm war eine höher gelegene Schlucht, die sich nach Nordosten erstreckte. Jenseits dieser Bresche, wo der Osthang wieder anstieg, thronte ein hoher Felsen namens Elchgeweih über einer niedrigen, breiten Felswand. Unterhalb der Felswand fiel ein bewaldeter Hang zum Bach des Untertals hin steil ab. Der Grund war noch großteils schneebedeckt.
Eistaucher machte sich auf den Weg dorthin, wo der Unterbach und die Obere Klamm aufeinandertrafen. Dort befand sich eine kleine, überfrorene Ebene oberhalb eines Erlenbruchs, auf der sich vielleicht etwas Interessantes finden ließ. Mit Sicherheit würde es dort Spuren geben.
Ein Knacken aus dem Wald oben am Hang ließ ihn erstarren, und er stand ganz und gar regungslos, als eine junge Ricke zwischen den Bäumen hervorbrach, verfolgt von zwei Braunbären. Das Reh hatte sich den linken Hinterlauf gebrochen und sprang auf drei Beinen, deutlich verlangsamt, den Hang hinab. Der vordere Bär rannte hingegen mit erschreckender Geschwindigkeit, holte die Ricke ein, schleuderte sie zu Boden und ging ihr wie ein Wolf an die Kehle. Eistaucher hatte schon gesehen, wie Bären ihrer Beute ins Genick bissen, wie eine Katze es tat. Aber Bären waren zu allem Möglichen imstande. In dieser Hinsicht waren sie beinahe wie Menschen, was nur folgerichtig war, da sie ja in den alten Zeiten Menschen gewesen waren. Und sie sahen immer noch aus wie Menschen: Große, gefährliche, in Pelze gehüllte Gestalten.
Eistaucher verharrte regungslos und sah zu, wie der vordere Bär ein paar Bissen aus der Kehle des Rehs riss und das Blut aufleckte. Ihm lief beim Zusehen das Wasser im Mund zusammen. Das Reh zuckte noch; Bären hatten in dieser Hinsicht keinen Sinn für Anstand.
Der zweite Bär griff den ersten von hinten an. Zwei junge Männchen, erkannte Eistaucher, die nun gegeneinander kämpften, einander dabei aber vor allem wild anknurrten und nacheinander schlugen, ohne Schaden anzurichten. Es sah aus, als setzten sie einen zuvor begonnenen Streit fort. Sie waren blind für ihre Umgebung, weshalb Eistaucher seine beiden Steine nach ihnen warf und beide traf. Der aus dem Nichts kommende Schmerz erschreckte sie, und sie flohen gemeinsam zwischen die Bäume, ohne sich auch nur umzublicken. Nach den Geräuschen zu urteilen stritten sie sich auch dort weiter.
Eistaucher rannte so schnell er konnte zu dem Reh und versuchte dabei angestrengt, in alle Richtungen zugleich zu blicken. Sicherlich blieb ihm nur wenig Zeit, bevor die Bären zurückkehrten oder ein anderes Tier vorbeikam. Keiner der herumliegenden Steine war scharfkantig genug, um das Reh damit zu häuten, und der erste Bär hatte gerade erst zu fressen begonnen. Eisläufer zog das Tier auf den Bauch, spreizte ihm die Hinterläufe und begann, leise Danksagungen ausstoßend, mit einem seiner Wurfsteine auf das hintere Hüftgelenk einzuhacken. Schnell hatte er den Hüftknochen gebrochen, löste dann das Bein von der Wirbelsäule, durchschnitt Haut und Sehnen und zertrümmerte das Gelenk in der Hoffnung, zumindest eine Keule mitnehmen zu können, wenn er fliehen musste. Zweifellos trug der die Schlucht emporwehende Wind den Geruch von Blut weit davon.
Er hackte noch immer auf das Hüftgelenk des Rehs ein, das noch nicht völlig durchtrennt war, als eine Bewegung oben am Hang seine Aufmerksamkeit erregte. Schlimmer hätte es nicht kommen können: Aus dem Wald näherten sich drei Löwinnen in lockerem, federndem Gang.
Eistaucher stürzte weg von der kleinen Lichtung, rannte vorgebeugt zwischen den Bäumen hindurch und die andere Seite der Schlucht hoch, sprang über einen Haufen Felsbrocken, warf sich dahinter flach auf den Boden und versuchte, zu Atem zu kommen, ohne dabei laut zu keuchen.
Die Löwinnen hatten bei dem Tier angehalten und beschnüffelten es, während sie sich umsahen. Sie wussten, dass das Reh gerade erst getötet worden war. Eistaucher zog zwei weitere Steine unter sich hervor. Wenn er es zu seinem Feuer zurückschaffte, konnte er sich die Löwinnen wahrscheinlich vom Leib halten, auch wenn es, falls sie ihn wirklich wollten, schwer werden würde, sobald sie erkannten, dass er allein war. Löwen waren sehr gut darin, ihre Chancen in jeder denkbaren Jagdsituation einzuschätzen, und sie würden wissen, dass sie ihn töten konnten, wenn es ihnen nichts ausmachte, zuvor ein paar Steine abzubekommen. Manche Löwinnen rannten mitten in einen Steinhagel hinein, wenn ihnen danach war. Hoffentlich würde das Reh ihre Aufmerksamkeit weiter beanspruchen und ihren gröbsten Hunger stillen.
Eine Weile kroch er auf den beiden Steinen in seinen Händen und auf seinen Zehen herum, wie eine Eidechse. Als er weit genug außer Sicht der Löwinnen war, stand er auf und rannte so schnell und leise wie möglich zu seinem Feuer zurück.
Es war heruntergebrannt, aber noch immer heiß genug, um jedes Holz in Brand zu setzen. Er warf Äste verschiedenster Größen darauf, um es auflodern zu lassen und auch um Fackeln zu seiner Verteidigung zu haben.
Als das erledigt war, eilte er zurück zu dem toten Reh, aber auf einem Umweg, der ihn weiter oben am Hang herauskommen ließ. Ein unbewachsenes, schneebedecktes Stück Hang bot ihm freie Sicht auf die kleine Ebene mit den Löwen darauf.
Das Reh war inzwischen zu einem großen Teil aufgefressen, aber auch die Reste wären noch ein Festmahl für Eistaucher, und Haut und Knochen würden ihm ebenfalls von großem Nutzen sein. Am besten musste er sich wie ein Rabe verhalten und auf die Löwen hinabscheißen, bis sie den Rest liegen ließen, ohne dass er dabei vom Himmel geholt wurde. Also schlich er sich hangabwärts näher heran, alle Sinne nach außen gekehrt, mit einem Kribbeln auf der Haut und sich aller Vorgänge im Tal gewärtig. Alles zeichnete sich so scharf ab, als hätte er sich in einen Falken verwandelt. Felsbrocken schienen von innen heraus zu leuchten, und Bäume bebten und raschelten im leichten Wind, der nach wie vor die Schlucht heraufwehte.
Die Löwinnen, von denen jede so groß war wie ein kleiner Bär, lungerten bei den Überresten des Rehs herum und säuberten sich die blutigen Schnauzen mit den Pfoten wie ganz gewöhnliche Katzen. Vollgefressene Löwen konnte man mit einem Steinhagel von ihrer Beute vertreiben, aber normalerweise hatte man dafür mehrere Männer mit Speeren. Für ihn allein lagen die Dinge anders. Die Löwinnen mochten zu dem Schluss gelangen, dass ein so vermessener Dummkopf einen guten Nachtisch abgab, auch wenn sie sich nicht die Mühe gemacht hätten, jemanden zu jagen, der sie in Frieden ließ. Es kam also darauf an, ihre Laune richtig einzuschätzen – und den Umfang ihrer Bäuche, die breit auf dem Boden lagen wie blassbraune Wasserschläuche. Eistaucher hielt hinter einem umgestürzten Baum inne und beobachtete die drei Löwinnen eine Weile. Sie waren groß und schön und strahlten jenen magischen Glanz aus, der Löwen immer zu eigen war – gewaltige Katzen, die sich der Form nach nicht von den kleineren Tieren unterschieden, die sich in Lagernähe herumtrieben, abgesehen davon, dass diese Riesen, die so viel wogen wie zwei oder drei ausgewachsene Männer, wie Wölfe in Rudeln jagten. Es war eine Ehrfurcht gebietende Kombination, die jedem anderen Geschöpf Schreckliches verhieß. Wunderschöne Götter, die auf Erden wandelten, Götter der Jagd, die vor nichts Angst hatten.
Ein Stein in der richtigen Größe, der kräftig genug geworfen den Kopf traf, konnte ein schlimmer Treffer sein, besonders, wenn er aus einer erhöhten Position kam. Aber höchstwahrscheinlich würde er die Tiere irgendwo an Bauch oder Rücken treffen, wenn überhaupt. Würden sie sich beleidigt trollen oder losstürmen, um den Plagegeist zu töten? In diesem Punkt durfte er sich nicht vertun.
Eine ganze Weile wartete er und sah zu, wie die Löwinnen sich putzten. Zweifellos gehörten sie zu den schönsten Tieren überhaupt, zu den neun heiligen Geschöpfen. Wie könnte es anders sein? Welches lebende Wesen konnte gottgleicher sein als die Löwen mit ihrer gemächlichen Eleganz und ihrer mörderischen Kraft, ihrer katzengleichen Wolfshaftigkeit? Die Art, wie sie sich umsahen, mit den schwarzen Tränenstreifen, die wie Festbemalung von ihren Augen herabflossen. Unweigerlich verzagte man unter ihrem Blick. Nein, sie waren unvergleichlich. Sie konnten alles töten, was sie wollten.
Eine von ihnen erhob sich nach einer Weile und schlenderte zum Trinken an den Bach hinunter. Die anderen beiden folgten ihr. Damit waren sie ein gutes Stück weit entfernt. Eistaucher kam zu dem Schluss, dass der Abstand groß genug war, und so flitzte er den Hang hinab und hackte die traurigen Überreste der Keule frei, die er ursprünglich hatte nehmen wollen. Mit einem festen, zweihändigen Schlag trennte er auch den zerkauten Kopf ab, ehe er beides ergriff und die Schlucht hoch und bis zurück zu seinem Feuer rannte, so schnell, dass ihm der Schweiß ausbrach und er den größten Teil des Wegs über keuchend nach Luft schnappte. Als er sein Lager erreichte, pochte ihm das Herz bis zum Hals.
Er schichtete sein Feuer neu auf, und den Rest des Tages und einen guten Teil der Abenddämmerung über war er damit beschäftigt, mit seinem Hackstein Haut und Sehnen von der Rehkeule zu lösen. Während der Arbeit grillte und aß er die Fleischfetzen. Als das Bein ganz zerlegt war, wandte er sich dem Kopf zu und tat sich an den Resten von Zunge und Hirn gütlich, ebenso an den Fettpolstern hinter den Augen und an dem Fleisch des Unterkiefers. Mit Haut und Knochen des Beins ging er zum Bach hinab und wusch beides im Licht des schüsselförmigen Monds. Es war die dritte Nacht des Monats. Anschließend ließ er die Tierteile am Feuer trocknen, in der Hoffnung, dass sie zu uninteressant sein würden, um nächtliche Aasfresser anzulocken, die groß genug wären, um ihm gefährlich zu werden.
Erneut legte er genug Holz auf das Feuer, damit es bis Mitternacht brennen würde, und schlüpfte dann unter seine Decke aus Ästen, die Rehteile direkt neben sich und das Stück Haut vom Bein als Kissen. Er spürte das weiche Haar an seiner Wange. So lag er in seinem Kiefernbett und stellte fest, dass er satt und müde war. So fühlte sich ein guter Tag an; aber gleichzeitig war er auch unruhig bei der Vorstellung, einzuschlafen, ohne dass jemand über ihn wachte. Diese Löwinnen waren irgendwo da draußen, und sie jagten nachts. Wenn sie das Feuer sahen oder rochen, würden sie wissen, was es zu bedeuten hatte. Aber er war zu müde, um die ganze Nacht lang wach zu bleiben. Schlaf flackerte im Feuer und umspülte ihn. Er konnte nicht widerstehen, konnte nur noch seinem Inneren Auge einen letzten Befehl geben, dass es offen und wachsam bleiben sollte. Mit einem Stein in der Hand schlief er ein.
In jener Nacht jagten ihn die Löwinnen in seinen Träumen, und mehrmals erwachte er stöhnend vor Schreck. Als schließlich der Morgen graute, hatte er das Gefühl, überhaupt nicht geschlafen zu haben. Seine Augen fühlten sich trocken an, und er war hungriger denn je.
Ein über Nacht aufgekommener Wind trieb von Westen neue Wolken heran, die für einen Moment vom Sonnenaufgang rosa eingefärbt wurden. Vielleicht würde es wieder regnen. Der dritte Tag seiner Wanderschaft, das zweite Unwetter. Aber diesmal konnte er am Feuer bleiben und sich Kleidung und Ausrüstung aus den Fetzen des Rehfells machen.
Also wieder hinaus in die Kälte. Zwischen den Steinen am Bachufer fand er einen kantigen Feuersteinbrocken, aus dem er sich Klingen, Spitzen und Hacken anfertigen konnte. Um ihn zu behauen, wählte er einen großen länglichen Hornstein aus. Diese beiden Brocken brachte er zurück zu seinem Feuer und ging dann über die Wiese zum Ende des Baches. Unter der Uferböschung an der Biegung waren wieder Forellen, also zog er seine