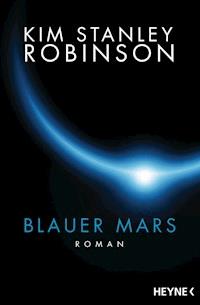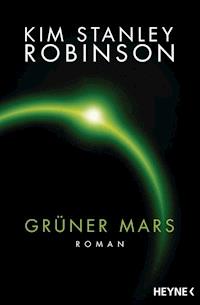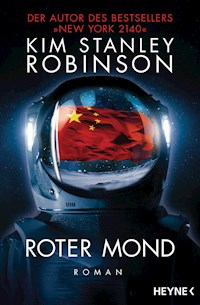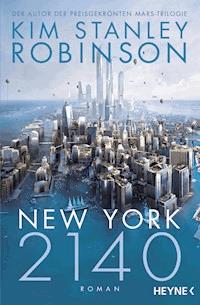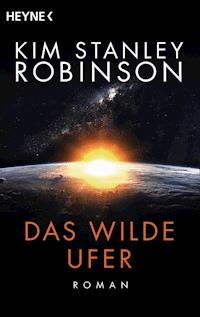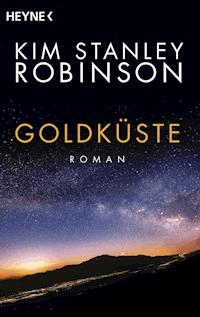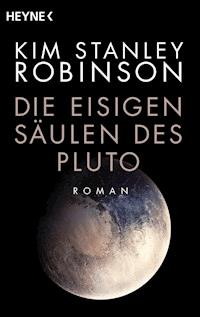5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Nicht von dieser Welt
Johannes Wright, der Meister-Musiker des Jahres 3229, geht mit seinem Orchester auf seine erste große Reise durch das Sonnensystem. Er will den Menschen, die in den letzten Jahrtausenden Planeten, Monde und Asteroiden besiedelt haben, seine Musik bringen. Sie ist nicht nur die beste, sondern, wie er manchmal feststellen muss, auch die einzige Möglichkeit wahrer Kommunikation. Und so starten Wright und seine Freunde auf Pluto und arbeiten sich in Richtung Sonne vor, jenem schicksalhaften Ereignis entgegen, das sie – und mit ihnen jeden einzelnen Menschen – verändern wird: der absoluten Erkenntnis des Universums.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Ähnliche
KIM STANLEY ROBINSON
SPHÄRENKLÄNGE
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Johannes Wright, der Meister-Musiker des Jahres 3229, geht mit seinem Orchester auf seine erste große Reise durch das Sonnensystem. Er will den Menschen, die in den letzten Jahrtausenden Planeten, Monde und Asteroiden besiedelt haben, seine Musik bringen. Sie ist nicht nur die beste, sondern, wie er manchmal feststellen muss, auch die einzige Möglichkeit wahrer Kommunikation. Und so starten Wright und seine Freunde auf Pluto und arbeiten sich in Richtung Sonne vor, jenem schicksalhaften Ereignis entgegen, das sie – und mit ihnen jeden einzelnen Menschen – verändern wird: der absoluten Erkenntnis des Universums.
Der Autor
Kim Stanley Robinson wurde 1952 in Illinois geboren, studierte Literatur an der University of California in San Diego und promovierte über die Romane von Philip K. Dick. Mitte der Siebzigerjahre veröffentlichte er seine ersten Science-Fiction-Kurzgeschichten, 1984 seinen ersten Roman. 1992 erschien Roter Mars, der Auftakt der Mars-Trilogie, die ihn weltberühmte machte und für die er mit dem Hugo, dem Nebula und dem Locus Award ausgezeichnet wurde. Kim Stanley Robinson lebt mit seiner Familie in Kalifornien.
Von Kim Stanley Robinson sind im Heyne-Verlag folgende Romane lieferbar:
2312, Schamane, Roter Mars, Grüner Mars, Blauer Mars, Aurora, Das wilde Ufer, Goldküste, Pazifische Grenze, Die eisigen Säulen des Pluto, Sphärenklänge.
www.diezukunft.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der Originalausgabe
THE MEMORY OF WHITENESS
Aus dem Amerikanischen von Bernd Müller
© Copyright 1985 by Kim Stanley Robinson
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-20875-2V002
Präludium
DER SEHER ERWACHT
Nun treibt all meine Kraft durch die Straßen von Lowell, und ich haste über die Plätze von Gasse zu Gasse, wie eine Ratte, die man durch ein Labyrinth jagt. Es ist finstere Nacht, und die Plätze sind unheimliche, leere Felder. In der Dunkelheit ist die Halbkugel rund um die Stadt nicht zu erkennen, und jenseits der plötzlich endenden Gassen erstreckt sich die Tartarusebene Plutos wie ein schwarzes Meer. Ich werfe blasse Schatten, meine Oberarme reiben sich feucht am Körper, ich spüre das Allegro meines Herzschlages. Ein innerer Chor verlangt nach der Droge Nepanathol.
Ich werde ihm nüchtern gegenübertreten, verspreche ich mir zum wiederholten Mal. Meine Hand zittert, ich stecke sie in die Tasche. Die schmalen Gassen sind mir jetzt wohlbekannt, ich nähere mich dem Institut; meine Schritte werden langsamer, als verdichte sich die Luft. Mein nächster Kristall ist längst überfällig. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen, werde nur noch vorangetrieben von … meiner Bestimmung.
Daheim. Jenseits des dunklen, baumbewachsenen Platzes erhebt sich ein großes, kantiges Gebäude mit hoher Eingangstür; über der Tür steht in eingemeißelten Lettern HOLYWELKIN-INSTITUT FÜR MUSIK. Ich überquere den Platz, öffne die Tür, trete leise ein, schleiche durchs Foyer. Holywelkins Hologramm-Standbild sieht auf mich herab, eine kleine Gestalt, im düsteren Licht beinahe transparent. Ich mache vorsichtig einen Bogen darum, bin mir seiner Gegenwart zwischen mir und dem Deckengewölbe bewusst. Hüter des Heiligen Brunnens, Meister unserer Welt, wäre es möglich, dass du all dies gewollt hast? Korridore weisen mir den Weg, dann gelange ich an eine weitere Tür, die Tür: sanctum sanctorum. In der Vorhalle erklingt ein volltönender Glockenschlag, und ich erschrecke. Mitternacht: die rechte Zeit, ein Gelübde zu brechen. Ich klopfe an, erkenne meinen Fehler; ich besitze das Privileg, eintreten zu dürfen, ohne anzuklopfen; aber nein, das habe ich verloren, von alledem habe ich mich losgesagt. Von drinnen ertönt ein undeutlicher Ruf. Oh … Es ist an der Zeit, ihm gegenüberzutreten. Tief durchatmen.
Ich schiebe die Tür auf, und ein Keil weißen Lichts durchschneidet die Dunkelheit des Korridors. Blinzelnd trete ich ein.
Der Meister liegt unter dem Orchester auf dem Rücken, klopft vorsichtig an einer Beule herum, die sich der Schalltrichter der Tuba auf der letzten Großen Tournee eingehandelt hat.
Der Meister blickt auf, die grauen Augenbrauen aufgerichtet wie der Federkamm eines Vogels. »Johannes«, sagt er milde. »Warum hast du geklopft?«
»Meister«, sage ich unsicher, aber immer noch entschlossen: »Ich kann meine Lehre bei Ihnen nicht fortsetzen.«
Zusehen, wie es zu ihm durchdringt, oh, oh … Der Autokrat schiebt sich unterm Orchester hervor, steht auf, langsam, ganz langsam. Er ist so alt. »Was hat das zu bedeuten, Johannes?«
Ich schlucke. Ich habe eine Lüge parat. Ich habe sie mir tagelang zurechtgelegt; das Ganze ist absurd, unmöglich. Plötzlich fühle ich mich genötigt, ihm die Wahrheit zu sagen. »Ich bin vom Nepanathol abhängig.«
Vor meinen Augen läuft sein Gesicht tiefrot an, seine blauen Augen quellen vor. »Du bist was?«, sagt er, dann brüllt er beinahe: »Ich höre wohl nicht recht?«
»Die Droge«, erkläre ich ihm. »Ich bin süchtig.«
War der Schock zu viel für ihn? Oh, alter Mann, alter Mann, den ich liebe … Er zittert, sagt: »Warum?«
Es ist so kompliziert – zu kompliziert, um es erklären zu können. »Meister«, sage ich, »es tut mir leid.«
Mit einem krampfhaften Zucken wirft er die Hämmer von sich, die er in der Hand gehalten hat, und ich weiche zurück; sie treffen geräuschlos auf die Schaumstoffbeschichtung der Wand, schlagen erst aneinander, als sie zu Boden fallen. »Es tut dir leid«, zischt er, und ich spüre seine Verachtung. »Es tut dir leid! Bei Gott, das darf doch wohl nicht alles sein! Drei Jahrhunderte und acht Meister des Orchesters, du sollst der neunte werden, und nun willst du wegen einer Droge die Erbfolge abbrechen? Hier steht die großartigste musikalische Leistung der Geschichte« – er deutet auf das Orchester, aber ich weigere mich hinzusehen – »und du ziehst ihr das Nepanathol vor? Wie konntest du nur? Ich bin ein alter Mann, in wenigen Jahren werde ich sterben, es bleibt keine Zeit, einen weiteren Musiker wie dich auszubilden. Und du wirst vor mir tot sein.« Damit hat er aller Wahrscheinlichkeit nach recht. »Ich werde der letzte Meister gewesen sein«, ruft er aus, »und das Orchester ist zum Schweigen verurteilt!«
Bei diesem Gedanken dreht er sich um die eigene Achse und lässt sich mit gekreuzten Beinen auf dem Boden nieder, weinend. Nie zuvor habe ich den Meister weinen sehen, hätte es auch nie zu sehen erwartet. Er ist kein gefühlsbetonter Mann.
»Was habe ich falsch gemacht?«, stöhnt er. »Das Orchester wird mit mir zu Ende gehen, und Ekern und die anderen werden behaupten, es sei meine Schuld. Ich sei ein schlechter Meister gewesen.«
Ekern, der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Instituts, war von Anfang an dagegen, dass der Meister mich als Lehrling auswählte, hat mich von Anfang an gehasst – dies wird sein Urteil bestätigen. »Sie sind der Beste von allen«, widerspreche ich.
All seine Aggression wendet sich gegen mich. »Warum dann? Warum? Johannes, wie konntest du so etwas nur tun?«
Ich wäre der neunte Meister von Holywelkins Orchester geworden. Ich war der Thronanwärter, der Kronprinz. Warum also? »Ich … konnte nicht anders.«
Er weint.
Da höre ich, wie aus großer Entfernung, meine eigene Stimme: »Meister«, sage ich, »ich werde mit der Droge aufhören.«
Bei diesen Worten schließe ich die Augen. Einem alten Mann zuliebe werde ich den bitteren Entzug von Nepanathol durchstehen. Ich schüttele den Kopf, überrascht von mir selbst. Was bewegt uns zum Handeln, wo liegen die Triebkräfte des Handelns?
Er sieht zu mir auf, und in seinem Blick liegt – was ist es? List? Manipuliert er mich? Nein. Es ist nur Verachtung. »Das schaffst du nicht«, murmelt er ärgerlich. »Es würde dich umbringen.«
»Nein«, sage ich, obwohl ich keineswegs sicher bin. »Dazu nehme ich es noch nicht lange genug. Wenige Stunden – etwa acht –, dann ist es vorbei.« Es wird nicht lange dauern; das ist mein einziger Trost. Ein innerer Chor protestiert lauthals: Was machst du da! Schmerzen … Krämpfe, Gedächtnisverwirrung, Erinnerungsverlust, Übelkeit, Halluzinationen, dazu die hohe Wahrscheinlichkeit sensorischer Schäden, insbesondere Gehör, Geschmacksempfindung und Sehvermögen: Ich will nicht erblinden.
»Bestimmt?«, sagt der alte Mann. »Wann wirst du es tun?«
»Jetzt«, sage ich und ignoriere den Chor. »Ich werde hierbleiben, denke ich«, zeige auf das Orchester, das anzusehen ich mich immer noch weigere.
»Ich werde ebenfalls hier …«
»Nein. Nicht hier. Im Aufnahmeraum, oder in einem der Übungsräume. Besser wäre es noch, Sie würden sich in Ihre eigenen Räume zurückziehen und morgen wiederkommen.«
Wir sehen einander an, der alte Richard und der junge Johannes, und schließlich nickt er. Er geht zur Tür, öffnet sie, wirft einen Blick zurück. »Sieh dich vor, Johannes.«
Ich müsste lachen, wäre ich nicht so verzweifelt. Die Tür fällt zu, und ich bleibe allein mit Holywelkins Orchester zurück.
♪
Ich erinnere mich, wie ich es das erste Mal sah, im Konzertsaal des Instituts anlässlich einer Sonderaufführung für junge Leute. Meine Mutter und ich waren mit dem Zug von der anderen Seite Plutos angereist, um das Konzert zu hören, eingeladen, weil meine Lehrer am Konservatorium von Vancouver mich empfohlen hatten. Der Meister – er war es, Richard Yablonski, schon damals ein alter Mann – spielte Stücke, die den jungen Geist erfreuen sollten: Mussorgskis Bilder einer Ausstellung, De Bruiks Nachtsee und ihre Biologische Sinfonie, Shimatus Concerto für Didgeridoo. Das letzte Stück war eine Offenbarung für mich. Der Meister setzte jede Phrase zögernd an, dehnte die Pausen, und die düsteren Heul- und Huptöne des Soloinstrumentes klangen, als werde die Musik zum allerersten Mal gespielt, improvisiert. Sie erfüllte den Raum jenseits des Saals, jenseits der Musik selbst, als schaffe der phantastische Turm aus blauen Kreisen und Strahlen eine ganz eigene Struktur transzendenter Schwingungen.
Nach Ende des Konzerts kamen ein paar Kinder nach vorn, die bereits für die Lehre in Betracht gezogen wurden, um mit dem Meister zu sprechen. Benommen ging ich den Mittelgang hinunter, die Hand meiner Mutter schob mich bestimmt voran, und ich konnte mich kaum vom Anblick des verschnörkelten Gebildes aus Holz, Metall und Glas losreißen, um mich dem Sterblichen zuzuwenden, der es bediente.
Yablonski sprach ruhig zu uns von der Freude, als Einzelner ein ganzes Orchester zu spielen. Während er redete, beobachtete er unsere Gesichter. »Was hat euch besser gefallen«, fragte er, »die Bilder einer Ausstellung in der Fassung für Klavier oder in der für Orchester?«
»Orchester!«, ertönten zwanzig Stimmen zugleich.
»Klavier«, sagte ich in die entstandene Pause.
»Warum?«, fragte er höflich, wobei er mich zum ersten Mal direkt ansah. Ich zuckte nervös die Achseln; ich konnte nicht klar denken, wusste es einfach nicht; ich spürte die Finger meiner Mutter im Rücken, suchte nach einer Erklärung …
»Weil das Stück für Klavier geschrieben ist«, sagte ich.
Ganz einfach. »Gefällt dir Ravels Orchesterfassung denn nicht?«, fragte er nun interessiert.
»Ravel hat den rauen russischen Klaviersatz zu einem üppigen französischen Stück geglättet. Er hat ihn verändert.« Damals war ich dogmatisch, ein frühreifes Kind, das schon vor dem Wechsel ans Konservatorium jeden Tag fünf Stunden am Klavier und drei über den Büchern verbrachte – und eine auf der Straße, eine viel zu kurze Stunde, jeden Tag von sechs bis sieben Uhr, um die angestaute Energie eines ganzen Tages abzubauen.
»Hast du die Partituren verglichen?«, fragte der Meister, und der Blick seiner blauen Augen bohrte sich in meine.
»Ja, Meister. Die Noten sind beinahe die gleichen, aber die Strukturen stimmen nicht. Die Klangfarben stimmen nicht. Und Klangfarbe ist …« Ich wollte sagen alles, aber stattdessen sagte ich: »… wichtig.«
Yablonski nickte, schien darüber nachzudenken. »Ich glaube, du hast recht.«
Dann endete das Gespräch, und wir waren auf dem Weg nach Hause. Es sollten Jahre vergehen, ehe ich den Meister und sein Orchester wiedersah, aber ich wusste, dass etwas geschehen war. Mir war schlecht. »Das hast du gut gemacht«, sagte meine Mutter. Ich war neun Jahre alt.
♪
Und hier bin ich nun, zehn Jahre später, und wieder ist mir übel. Schwer zu sagen, was in meinem Körper vorgeht; es ist längst Zeit für meinen nächsten Nepanatholkristall. Meine Abhängigkeit sendet ihre Warnsignale aus, kleine Stiche an der Rückseite der Oberarme. Wenigstens wird es nicht lange dauern.
Endlich wende ich mich dem Orchester zu. »Man stelle sich alle Instrumente des modernen Orchesters vor, durcheinandergewirbelt von einem kleinen Tornado«, schrieb einer der frühen Kritiker, »dann hat man Holywelkins Erfindung vor sich.« Heutzutage aber gibt es kaum noch Kritiker. Alter führt zu Ansehen, und das Orchester ist jetzt dreihundert Jahre alt. Eine Institution.
Und es ist imposant: Elf Meter hoch aufragende Instrumente, elf Meter gewundenes Metall und gebogenes Holz, aufgehängt in einer komplizierten Armatur gläserner Stäbe, die nur deshalb sichtbar sind, weil sich blaue und rote Lichter in ihnen spiegeln. Die Wolke aus Violen, die durchbrochene Treppe aus Posaunen, die bauchige Quecksilberpauke; die komischen Ballonflöten, das elegante Lyrikon, die gewundene Godzilla … sämtliche Tonerzeuger der Welt hängen da wie Früchte an einem riesigen gläsernen Baum. Wahrhaftig ein wunderschönes Kunstwerk. Aber Holywelkin, der Architekt unseres Zeitalters, war nicht nur Bildhauer, sondern auch Mathematiker, nicht nur Erfinder, sondern auch Musiker, und die Synthese seiner geistigen Fähigkeiten hat meiner Meinung nach in diesem besonderen Fall etwas Verhängnisvolles hervorgebracht. Etwas Unmusikalisches. Etwas Gefährliches.
Ich gehe zum Klaviereingang und schiebe mich auf die Bank. Die Anschlaghebel aus Glas verdecken die Tasten, sodass es unmöglich ist, das Klavier von dieser Bank aus zu spielen; und das ist ein Sinnbild des Ganzen. Ich mache mich daran, die gläserne Treppe hinter den Celli zur Kontrollkabine zu erklimmen. Selbst die Stufen sind mit winzigen Bildern eingelegt, die Waldhörner, Leiern, Krummhörner darstellen … Es ist, als sehe ich die Einzelheiten des Orchesters zum ersten Mal. Die Bedienungszelle ist in der Mitte des Ganzen aufgehängt, von außen kaum zu erkennen: Sie verblüfft mich. Ich setze mich auf den Drehhocker und sehe mich um. Computerkonsolen, Tastaturen, Pedalreihen, Akkordknöpfe, Registerzüge, Klangklappen, Schlagwerktasten, Tonbandmaschinen, Verstärkerarmaturen, Klaviaturen: gelb für Streicher, blau für Holzbläser, rot für Blechbläser, braun für Schlaginstrumente, grün für Synthesizer … Ich betätige mit dem Zeh das Pedal für Paukenwirbel, drücke die Tasten für Tempo und Tondauer, und plötzlich erfüllt der Ton der B-gestimmten Pauke dröhnend den Raum, die Schlegel in ihren gläsernen Halterungen verschwimmen wirbelnd vor meinen Augen. Ich sehne mich danach, die Schlegel in der Hand zu halten und selbst zum Rhythmus zu werden, die Schwingungen im runden Fell der Trommel zu sehen und sie in der Magengrube zu spüren, denn das ist Musik, dieses Gefühl; aber um den Trommelwirbel in Holywelkins Orchester zu spielen, bringe ich lediglich einen Schalter in eine bestimmte Stellung, drücke einen weiteren mit dem Zeh. Ich nehme den Fuß vom Pedal, und sofort tritt Stille ein. »Nein, Holywelkin, nein! Verstehst du nicht, was du da angerichtet hast? Verstehst du nicht, dass du der Musik die menschliche Komponente geraubt hast, die es ihr ermöglicht, unser Gemüt anzurühren? Dieses verdammte Orchestrion …« Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich schüttele meine Faust in die Runde. Ich klettere über die gläsernen Arme des Werks zur Quecksilberpauke, lege die Arme darum und wiege sie hin und her; drinnen schwappt die Flüssigkeit über die Tonabnehmer, und die unheimlichen Schwingungen silbriger Töne zerren an mir … aber ich kann sie nicht kontrollieren. Erste Schmerzen durchzucken wie aufflammende Streichhölzer meine Arme und Beine, meinen Hals. Geschlagen klettere ich zurück in die Bedienungszelle. Trete an eine gelbe Klaviatur, betätige Registerzüge: Die linke Hand spielt, und sechzig Geigen erwachen zum Leben, mit sattem, pulsierendem Ton – ein weiterer Pluspunkt für Holywelkin. Ich füge einen eiligen großen Zeh auf der gelben Pedalreihe hinzu, von unten her setzen die Bässe ein, und ich spiele De Bruiks Die Winde Utopias. Nach einer geschickten Manipulation der Bandmaschine kann der rechte Fuß zu den Blechbläsern wandern, die rechte Hand bleibt frei für die ausschweifenden, leidvollen Oboenstöße, die der Bedeutung jener endlosen Weiten hohnsprechen, ah, De Bruik!
Ein solches Stück verlangt intensive Konzentration, zu der ich im Augenblick nicht fähig bin; man muss dabei die Aufmerksamkeit auf vier bis fünf Punkte zugleich richten, was echte geistige Anstrengung erfordert. Und doch: Vier oder fünf musikalische Stränge sind eben nicht einhundertundfünfzig Stränge; diese Maschine ist kein Orchester, und Orchestermusik leidet in ihr, wird verwässert, registriert, neu geordnet …
Aufhören. Nur noch die Kontrabässe, lugubrioso. Ich lasse mich gehen und beobachte meine Füße, wie sie über die gelben Pedale hüpfen und die tiefen, gestrichenen Töne erzeugen, die aus der Spirale großer dunkler Klangkörper unter mir aufsteigen als urgewaltige Schwingungen, meine unsichtbare rechte Hand manipuliert den Bass-Synthesizer, um die Töne immer tiefer werden zu lassen, bis unter zwanzig Hertz, sie verwandeln sich in ein nicht mehr hörbares Beben in der Magengrube – die Muskeln beider Füße verkrampfen sich, und mir dreht sich der Magen um. Ich kann mich nicht an das De-Bruik-Stück erinnern, die Dirigentenpartitur, die sich vor meinem inneren Auge ausbreitete, ist verschwunden, die Bässe sägen automatisch vor sich hin. Auf Gesicht und Armen bricht mir der Schweiß aus, und das Orchester dreht sich langsam, dreht sich, wie es das bei Konzerten zu tun pflegt …
Ich warte darauf, dass Mikel und Joanne kommen, damit wir zum Konzert aufbrechen können. Ich sitze am schäbigen alten Klavier, das ich gleich nach Mutters Beerdigung aus ihrem Haus hierher gebracht habe, spiele Ravels Pavane pour une Infante défunte und fühle mich einsam. Tränen rinnen, und ich lache erbittert über meine Fähigkeit, mir selbst etwas vorzuspielen, wie immer unsicher, ob meine Empfindungen echt sind, oder ob ich sie nur für ein imaginäres Publikum in einem Theater um meinen Kopf herum produziere; ich ignoriere die Indizien, die mich blinzeln lassen, und denke stattdessen: Ich kann sie bewusst auslösen, wenn mir nur elend genug ist!
Mikel und Joanne treffen ein, ihr Lachen klingt wie der Ton der Äolsharfe. Sie sind beide Sänger am Konservatorium, das ich verlassen habe, wahre Künstler, Freunde, die darüber traurig sind, dass ich nicht mehr mit ihnen zusammen studiere. Ich bemühe mich um Fassung, begrüße sie, wir sitzen im Kreis zusammen, lachen, unterhalten uns über Thomsons Gazelle, das Ballonflötenquintett, zu dessen Konzert wir gehen wollen. Das Gespräch verstummt, Mikel und Joanne werfen sich Blicke zu.
»Johannes«, sagt Mikel bedächtig, »Joanne und ich werden für das Konzert Kristalle nehmen.« Er streckt mir die Hand entgegen. In der Handfläche erkenne ich einen kleinen, durchsichtigen Kristall, der am ehesten einem Diamanten ähnelt. Er wirft ihn hoch in die Luft, fängt ihn mit dem Mund auf, schluckt, grinst. »Möchtest du dich uns anschließen?« Joanne bekommt einen von ihm und schluckt ihn mit der gleichen, ebenso lässigen wie herausfordernden Kopfbewegung. Sie bietet mir einen an, den sie zwischen zwei Fingern hält. Ich sehe sie an, denke an das, was ich darüber gehört habe. Nepanathol. Ich will nicht erblinden.
»Seid ihr süchtig?«, frage ich.
Sie schütteln die Köpfe. »Wir beschränken uns auf ganz besondere Anlässe«, erklärt Joanne. Sie lachen. Fröhliche Menschen.
»Oh«, sage ich, und wieder regt sich der Druck meines bisherigen Lebens, die Lektionen meiner Mutter, die Jahre am Konservatorium, das Erringen der Lehrstelle, ihr Tod, das Orchester, und hinter alledem die Schemen Ekerns und des Meisters. »Oh«, sage ich, »gib her.« Mir ist alles egal – die Droge erscheint mir gar als Lösung und – ich kann nicht anders. Ich lege mir den Kristall auf die Zunge. Er schmeckt nach nichts. Ich schlucke …
♪
Halluzinationen. Einen Augenblick war ich völlig abwesend. Ich setze mich wieder auf den Schemel und bereue, mich so rasch bewegt zu haben. Übelkeit überkommt mich. Das Heranziehen der Tastaturen ist recht anstrengend. Ich versuche den St. Louis Blues; es ist unmöglich, alle sieben Instrumente gleichzeitig zu spielen, also nehme ich bestimmte Passagen auf, lasse sie als Endlosschleife abspielen, bediene das Orchester mit den Tontechnikerfähigkeiten, die zu seiner Beherrschung so wichtig sind, indem ich wie bei einer Fuge eine Stimme nach der anderen aufbaue und mich dann auf die Melodielinie konzentriere. Die Posaune ist ein wahrer Witz: Unfähig, die Töne vorherzusehen, wie menschliche Musiker das können, bewegen die gläsernen Arme des Orchesters den Posaunenzug mit unglaublich rascher, mechanischer, unmenschlicher Präzision. Das Posaunensolo des St. Louis Blues geht über in das Klarinettensolo aus Rampart Street Parade (passen die beiden Stücke nicht gut zusammen?), und ich höre resigniert auf. Ich hasse es, schlecht zu spielen. Und das ist schließlich der wesentliche Punkt des Ganzen, das eigentliche Problem.
♪
Um dem Einhalt zu gebieten, sagen die Stimmen meines inneren Chors, musst du nichts weiter tun als nach Hause zu gehen und einen Kristall zu schlucken. Gedankenlos lasse ich mich vom Hocker gleiten; meine Knie knicken ein wie die Klinge eines Taschenmessers, und ich krache gegen ein Tastenfeld, falle in der Kammer zu Boden. In den gläsernen Fußboden sind Nachbildungen von Bass- und Violinschlüssel eingelegt, sie verschwimmen vorwurfsvoll unter mir. Nach einiger Zeit richte ich mich auf, übergebe mich in den Trinkwasserspender der Kammer. Dann falle ich wieder zu Boden. Mir ist so übel wie vor dem Erbrechen, was ich erschreckend finde. »Tu doch was!« Was soll ich tun? Dieser Schlangenbaum hält mich in Bann … Ich ziehe die Klaviatur der Celesta direkt vor meinem Gesicht heraus, die unterste dieser Gruppe. Weit oben hängt der reich verzierte weiße Kasten, der das Instrument darstellt, im Schatten der daneben aufragenden Godzilla. Die Celesta: ein Klavier, dessen Hämmer statt Saiten Stahlplatten anschlagen. Ich fahre mit dem Finger einige Oktaven entlang, und eine Serie kurzer Glockentöne hallt durch die Kammer. (Dieser Raum ist hallfrei.)
Ich versuche mich an einer Zweiteiligen Invention Shimatus, einem Meisterstück an Eleganz, das eigentlich dem Klavier gehört. Meine Hände beginnen in verschiedenen Tempi zu spielen, und ich kann sie nicht hindern: erschreckend! Ich höre auf, und um das Einhalten des Taktes zu erleichtern, strecke ich die zitternde rechte Hand aus, setze das Metronom in Gang, ein antiker Mechanismus, an dem Holywelkin Gefallen fand. Er ist konstruiert wie ein umgekehrtes Pendel, das beim ersten Anblick dadurch verblüfft, dass es der Schwerkraft zu trotzen scheint.
Wieder setze ich zu der Invention an, aber das Tempo ist mir zu schnell, und die Noten verschmelzen zu einer verworrenen Masse, wie Kirchenglocken, die man aufgenommen und mit viel höherer Geschwindigkeit wieder abgespielt hat. Das goldene Gewicht am Pendelarm reflektiert einen Teil meines Gesichts (meine Augen), wenn es den tiefsten Punkt seines Ausschlags nach links erreicht. Und mein Herz, mein Herz schlägt im Takt mit dem durchdringenden, holzverstärkten, rhythmischen Ticken des Metronoms.
Das Metronom schlägt immer schneller. Unmöglich, denn das Gewicht hat seine Stellung nicht verändert; aber wahr. Anfangs schlug es ein Andante: tick … tack, jetzt dagegen ein flottes Marschtempo: tick, tack; und mein Herzschlag hat sich mitbeschleunigt. Bei jedem Impuls explodieren kleine Lichtflecken, schweben wie winzige Lampions vor meinen Augen. Ich spüre, wie mit jedem Pulsschlag in meinem Hals und meinen Fingern das Blut pocht, das Ticken ist jetzt ein Allegretto: ticktacktick, und erschrocken hebe ich einen furchtbar schweren Finger und stecke ihn in den silbrig blitzenden Lichtbogen mit dem goldenen Band in der Mitte.
Das Metronom hält an.
Ich atme auf. Mein Herzschlag beruhigt sich. Eine echte Halluzination, denke ich bei mir, ist etwas sehr Beunruhigendes. Nach einiger Zeit schiebe ich die Celesta-Klaviatur wieder in ihre Nische zurück und versuche aufzustehen. Meine Beine explodieren. Ich klammere mich an den Hocker. Krämpfe, denke ich in einem objektiven Winkel meines Gehirns und beobachte meine zuckenden Glieder. Ich knete mit einer Hand die hervortretenden Muskelstränge und verändere dauernd die Haltung, um eine weniger schmerzhafte Position zu finden; mir fällt ein, dass dies wohl sein muss, was der Ausdruck »sich vor Schmerzen winden« beschreibt. Der objektive Winkel meines Gehirns ist verstummt, und er war alles, was mir blieb …
Ich komme zu mir, und die Krämpfe sind vorbei. Doch es ist klar, dass sie jederzeit wieder auftreten können. Ich denke: Solange ich mich nicht bewege, ist alles gut. Wenn ich nur dem Ende näher wäre. Wie lange war ich weggetreten? Die Zeit dehnt sich mit jedem Atemholen und zieht sich mit dem Ausatmen wieder zusammen. Wie lange lebe ich schon? Ich glaube nicht mehr an das Verstreichen der Zeit, das Metronom ist zerbrochen, es gibt nur diesen Augenblick, den Augenblick und nichts als den Augenblick.
Ich kann im eingebeulten Schalltrichter der Tuba mein Spiegelbild sehen. Ein trauriger Anblick, blass und aufgelöst. Ich kann jede Einzelheit meiner Gesichtszüge unterscheiden. Deutlich sehe ich die Äderchen in meinen Augen. Das Spiegelbild flackert, führt mir immer wieder eine neue Version meines Gesichts vor. Einige haben eine hohe Stirn und ein fliehendes Kinn; andere riesige Hakennasen; wieder andere sind hohlwangig, mit spitz zulaufenden Köpfen.
Ich strecke den Arm aus, um nach dem Hocker zu greifen; meine Hand fasst ins Leere, und ich sehe erneut hin; mindestens fünfzehn Zentimeter daneben. Ich muss mich auf den Hocker ziehen. Die Arme heben sich, die Füße versuchen Halt zu finden, alles sehr träge. Ich bewege mich unendlich langsam, wie ein Kind, das nachts aus dem Haus schlüpft, um durch die Straßen zu streifen. Kopf auf die Sitzfläche, Knie an die Fußstütze, ich halte inne, um mich an die Höhe zu gewöhnen, beobachte die zersplitterten Lichter, die vor meinen Augen explodieren.
Jetzt habe ich mich aufgerichtet und sitze auf dem Hocker. Ich erinnere mich an ein Hologramm, in dem ein Mann bei Ebbe bis zum Hals im Sand des Strandes vergraben wird. Urtümliche Foltern unserer primitiven Vorfahren auf der alten Erde. Ein Kopf über dem feucht glitzernden Sand, den Blick seewärts gerichtet: Dieses Bild ist auf der Innenseite meiner Augenlider eingeätzt.
Tu doch was. Ich ziehe die Waldhorn- und Oboentastaturen heraus, spiele das erhabene, ätherische Duett aus De Bruiks Gartengebet. »Dies sind die Instrumente mit Erkältung«, hat der Meister einmal in einem heiteren Augenblick zu mir gesagt. »Das Horn hat's auf der Brust, die Oboe in der Nase.« Timbre, das Herz der Musik. Das Gebet ist zu langsam, die Instrumente können das Glissando nicht wiedergeben, Fehler schleichen sich ein, ich wechsle die Tonleitern, C, F, B, Es, As, Des d, h-e-a-d; h-e-a-d. Ein Guter Hut Darf Flattern, Ein Guter Hut Dreht Flott; dann die Moll-Tonarten, harmonisch und melodisch …
»Die sechste Stufe vermindert«, ruft sie aus der Küche, »harmonisch, nicht melodisch. Spiel mir die harmonische.«
Noch einmal.
»Harmonisch!«
Noch einmal.
Sie kommt herein, greift sich meine rechte Hand, schlägt die Töne an. »Dritte Stufe vermindert, sechste runter, siehst du, wie's dann gespenstisch klingt? Jetzt du.« Ich spiele die Tonleiter, ich erkenne den Unterschied, es ist, als ginge über mir ein Licht an, eine neue Welt eröffnet sich mir, plötzlich steht mir ein Gefühlsbereich offen, der bisher nicht existierte, und ich habe das Gefühl, über dem Klavierhocker zu schweben, von den Tönen emporgetragen. »Okay, das übst du jetzt zwanzigmal, dann versuchen wir's mit dem melodischen Moll.«
♪
Ich höre auf, Molltonleitern zu spielen, mein Herz klopft. Ich sammle um mich die sonderbaren Klaviaturen, die selten benutzt werden: Glockenspiel, Kontrafagott, Zugklarinette, Didgeridoo, Glasharfe, und das Quintett langweilt mich schon, ehe ich alle in Griffweite habe. Ich übergebe mich wieder in den Wasserspender. Quälende Flammenstiche in der Muskulatur; das Atmen tut weh; und die Zeit wabert wie eine Seeanemone in einer Flut von Schmerzen. Bestimmt sitze ich schon sehr lange im Orchester. Ein Gang durch den Raum wäre jetzt nett, aber ich fürchte, damit wäre ich überfordert. Ich nähere mich dem Ende, so oder so. Die Flut schwillt an. De Quincey und Cocteau, Burroughs und Nguyen, Kirpal und Tucci, ihr habt mich angelogen: der Entzug an sich, die damit verbundene Erfahrung, birgt keinerlei Romantik, überhaupt keine. Es macht keinen Spaß. Es tut weh.
♪
Es klopft an der Tür. Sie geht auf, langsam wie das Pendel des Metronoms, wenn das Gewicht am höchsten Punkt ist. Ein untersetzter Mann stolziert herein. Er hat eine kleine Basstrommel vor den Bauch geschnallt, und oben auf der Trommel ist eine verbeulte Trompete angeschweißt, deren Mundstück vor seinem Gesicht hin und her pendelt. Neben dem Trompetenmundstück hängt eine Mundharmonika in einem Drahtgestell, das er um den Hals gelegt hat. In der Rechten hält er einen Trommelschlegel, in der Linken eine urtümliche Knarre (Canasta?) und zwischen den Knien sind abgenutzte Zimbeln befestigt, die schief herabhängen. Er sieht so abgerissen aus, wie ich mich fühle. Er marschiert bis zu einem Punkt direkt unter mir, schlägt dabei sanft die Trommel, dann hält er an und klappt mit Wucht die Knie zusammen. Als das Klirren verklingt, sieht er grinsend auf. Sein Gesicht ist rötlich angelaufen, und ich kann durch ihn hindurchsehen.
»Wer sind Sie?«, frage ich.
»Arthur Holywelkin«, erwidert er, »zu Ihren Diensten.« Plötzlich erkenne ich die Ähnlichkeit zwischen dieser heruntergekommenen Gestalt unter mir und der imposanten Statue hoch droben im Foyer. »Und Sie?«, sagt er zu mir.
»Johannes Wright.«
»Ah! Ein Musiker.«
»Nein«, erkläre ich. »Ich bediene bloß Ihre Maschine.«
Er wirkt verwirrt. »Sicherlich bedarf es doch eines Musikers, um meine Maschine zu bedienen.«
»Nur eines Mechanikers.« Unser Gespräch findet inmitten einer Totenstille statt, einer makellosen Geräuschlosigkeit. »Haben Sie tatsächlich dieses Ding hier gebaut?«
»Das habe ich.«
»Dann ist alles Ihre Schuld. Sie sind die Ursache all meiner Schwierigkeiten«, sage ich zu ihm hinunter, »Sie und Ihre dumme, ordinäre Monstrosität! Als Sie diesen Witz zusammengebastelt haben«, frage ich und trete dabei gegen eine gläserne Säule, »haben Sie es da ernst gemeint?«
»Völlig ernst.« Er nickt gravitätisch. »Junger Mann«, sagt er und betont bestimmte Worte durch Trommelschläge, »Sie haben das Ganze Völlig Missverstanden. Meine Erfindung Ist Kein Orchester.«
»Aber sie ist ein Orchester«, sage ich. »Sie ist eine Orchesterimitation, ein Orchestrion, eine Orchestrina, wie immer man das Ding auch nennt, jedenfalls wird es seiner Aufgabe nicht gerecht! Sie haben nichts weiter getan, als eine erhabene Gemeinschaftsleistung, eine menschliche Handlung, in eine minderwertige, egozentrische Soloeskapade …«
»Nein, nein, nein, nein, nein«, ruft er aus und unterstreicht jedes Nein mit einem Trommelschlag. »Diese Erfindung ist doch nur insofern das Imitat eines Orchesters, wie eine Ein-Mann-Band eine Band imitiert, oder?« Er zwinkert anzüglich. »Mit anderen Worten: überhaupt nicht. Es ist ein Fehler, hier Vergleiche anstellen zu wollen.« Er setzt sich in Bewegung und umrundet einmal das Orchester, wobei er auf der Trompete »Dixie« spielt und dazu die Basstrommel schlägt; sämtliche Pausen füllt er mit Zimbelklirren. Es klingt scheußlich. Da ist er wieder. »Wunderbar, oder? Herzlichen Dank.«
»Sie haben bewiesen, was ich meine«, sage ich boshaft. »Dieses Instrument ist ein Witz. Nichts als Effekthascherei. Ich bin Künstler« – mit schneidender Stimme – »und ich kann es nicht ausstehen.«
Langsam verschwindet das Grinsen aus seinem Gesicht. Er wächst sichtbar, rückt die Basstrommel zurecht, sodass er sich ins Orchester lehnen und mich finster anstarren kann. »Meine Erfindung ist nicht besser oder schlechter als irgendein anderes Instrument. Nicht weiter von menschlichem Handeln entfernt als jeder andere Schritt weg von der Stimme.« Er hat das Gesicht jetzt weit ins Orchester hineingestreckt, zwischen den Bandmaschinen und dem Hals eines Cellos hervor glotzt es mich an. Ganz leise flüstert er: »Wenn Sie je lernen wollen, mein Instrument richtig zu spielen, müssen Sie das Bild ändern, das Sie von sich haben …«
»Man kann nicht ändern, was man ist.«
»Natürlich kann man das. Was könnte leichter sein?«
Die Stille zieht sich hin. Rote und blaue Lichter spiegeln sich im Glas.
»Hören Sie«, flüstert er im Befehlston. »Das Orchester trägt den falschen Namen. Ich habe es nicht gebaut, damit darauf sinfonische Musik der Vergangenheit gespielt wird; insofern haben die Meister Sie falsch unterrichtet. Das Instrument hat seinen eigenen Sinn, und den müssen Sie entdecken. Sie müssen sich umsehen, zu einer neuen Denkweise finden. Sie müssen die Musik dafür selbst schreiben. So habe ich es gemacht. Man hat mich nie als Komponisten angesehen; aber das war ein Fehler. Meine ganze Arbeit bestand aus Musik.«
»Sie waren Mathematiker.«
»Genau. Deshalb habe ich dieses Instrument gebaut. Und Sie müssen es erlernen, um mich zu verstehen. Um seinen Sinn zu verstehen.« Er hebt die Hand, um meinen Widerspruch zu bremsen. »Sie kennen es noch nicht besonders gut.« Sein freudloses Lächeln ist zum Fürchten. »Ich habe neunzehn Jahre gebraucht, um es zu bauen, doch das Zusammensetzen allein würde höchstens zwei oder drei Jahre dauern. Hat Sie das nie gewundert? Es steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick erkennt.« Seine Stimme nimmt jetzt einen gewaltigen, tiefen, unheilverkündenden Ton an, und sein rotes Gesicht ist so groß wie die Kontrollkabine; er scheint sich bücken zu müssen, um mich anstarren zu können, und über die aufgetürmten Klaviaturen hinweg droht mir ein riesenhafter Zeigefinger: »Es steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick erkennt. Sie müssen es vollständig erfassen lernen. Und dann dafür komponieren. Und es dann spielen; mit allem, was in Ihnen steckt. Und dann …« Er weicht zurück, schrumpft auf seine ursprüngliche Größe. Er dreht sich um, geht zur Tür, klapper, klapper, klapper. Ein dumpfer Trommelschlag, ein Finger, ausgestreckt wie eine Waffe. Er geht hinaus. Die Tür schließt sich.
♪
Da bin ich nun, ein junger Mann, mitten in der halluzinatorischen Phase des Entzugs, gefangen in diesem Ungetüm von einem Apparat wie eine Fliege im Netz einer Spinne, die mitten in der halluzinatorischen Phase des Entzugs steckt … Haben Sie je Aufnahmen der kümmerlichen, wirren Gespinste gesehen, die unter Drogen stehende Spinnen im Labor weben? So würde Holywelkins Orchester zweidimensional betrachtet aussehen, egal von welcher Seite. Gläserne Arme, an denen polierte Instrumente aus Blech und Holz hängen wie Weihnachtsschmuck oder seltsame Früchte. Eine Glashand, ein Baum, der als Gewirr satter Braun- und Silbertöne und Lichtbrechungen emporwächst. Die Welt-Esche Yggdrasil im Reich der Klänge. Musik wächst nicht auf Bäumen, müssen Sie wissen. Die Zimbelränder sind von Regenbögen eingefasst.
Ich habe mit Sicherheit unter Wahnvorstellungen gelitten. Im Nachhinein ist es leicht, sich zu sagen, dass eine Unterhaltung mit einem Mann, der seit dreihundert Jahren tot ist, eine Wahnvorstellung sein muss, aber während sie stattfindet, ganz real stattfindet, ist es schwer, den eigenen Sinnen zu misstrauen. Schließlich nehmen wir die Welt nur durch unsere Sinne wahr; und falls dem nicht so sein sollte, falls wir die Welt auch noch auf andere Weise wahrnehmen können, wäre das kaum nachzuweisen. Die Sinne … mein Gehirn erleidet Schaden; mir ist, als spürte ich, wie die einzelnen Zellen anschwellen und aufplatzen. Ich bin krank, sehr krank. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als dazusitzen und abzuwarten. Bald muss das Ende doch erreicht sein.
Ich warte. Zeit vergeht. Plop plop plop … wie aufgeblähte Reiskörner. Bitte nicht – nicht! – nicht mein Gehirn. Irgendetwas muss geschehen. Da kann ich genauso gut auf dem Ding spielen. Mich ans Lernen machen: mit dem Lernen beginnen.
Du hast mich nicht überzeugt, Holywelkin! Kein bisschen!
♪
Mein Schicksal.
♪
Ich ordne die Klaviaturen in Konzertposition an, meine Hände schieben sie hin und her wie Schleppkähne die großen Schiffe. Gelassen beobachte ich meine zitternden Hände. Der nüchterne Winkel meines Gehirns hat die Kontrolle übernommen, und meine Übelkeit habe ich überwunden. Ich sehe die Dinge mit einer Klarheit, wie sie einen überkommt, wenn man extrem hungrig ist oder so müde, dass man nicht mehr schlafen kann. Alles wirkt ganz klar, ganz deutlich. Ich habe gehört, dass Ertrinkende einen letzten Moment großer Ruhe und Klarheit erleben, ehe sie das Bewusstsein verlieren. Vielleicht ist die Flut schon so weit angestiegen. Ich weiß es nicht. Oh, wie satt ich das alles habe! Warum kann es nicht vorbei sein? Bachs »Jesu, meine Freude«, die Oberstimme im Bariton. Wie wunderbar der 9/8-Takt dahinrollt. Die einzelnen Passagen fließen mir sauber und klar umrissen zu. Es fällt mir schwer, die Balance zu halten: Alles wirkt überbelichtet. Ich schwanke. Ich schließe die Augen. Eine Shimatu-Fantasie. Vor dem schwarzen Feld der Innenseite meiner Augenlider läuft eine phantastische Show wechselnder Lichter ab, farbenfrohe Würmchen flackern auf, kriechen durch mein Gesichtsfeld und verschwinden wieder. Hinter den Lichtern erkenne ich kaum wahrnehmbare Formen, geometrische Muster, die sich unter dem Druck meiner Augenlider vergrößern oder verkleinern. Die Musik ist mit diesem eigenartigen Mandala verwoben; wenn ich die Augen besonders fest zukneife, erscheint eine plötzliche Aufwallung blauer Geometrie mit schwarzer Mitte, dazu ein Wirbel auf Kesselpauken und Quecksilbertrommel, ein Aufheulen der Holzbläser, all das fügt sich nahtlos in die phantastischen blauen Muster, die vor mir aufblühen. De Bruiks monumentale Zehnte Symphonie, gespielt mit einer Leichtigkeit, als sei ich der Dirigent und nicht der Ausführende. Mein inneres Blickfeld hellt sich auf und nimmt eine neutrale Färbung an, grau oder ein stumpfes Lila. Zehn gerade leere Linien laufen in zwei Gruppen zu je fünf darüber hinweg. Die Partitur. Die Noten erscheinen, während ich sie spiele, übereinander angeordnet wie in einer Dirigentenpartitur. Sie schieben sich wie auf einem Computerschirm von rechts nach links. Hervorragend. Halbe und Viertelnoten im Bass; darüber lange Läufe von Sechzehntelnoten, jede einzelne sieht aus, als scheine die Sonne durch Nadellöcher in dunklem Papier. Soweit ich feststellen kann, stimmt die Partitur in allen Einzelheiten. Es ist mehr, als einer allein spielen kann, und ich erinnere mich nicht, das Band der Symphonie, das wohl irgendwo gespeichert ist, als Begleitung eingegeben zu haben, aber als ich denke: »Es wäre nett, durch diese Passage das Äolodion heulen zu lassen«, durchzieht das luftige Pfeifen die Musik, treibt sie vor sich her, wie ein Luftstoß ein Blatt Papier aufwirbelt. Meine Finger bewirken das, ohne Zutun meines Bewusstseins. Lege alles hinein, was in dir steckt: Jetzt erklingt jedes einzelne Instrument des Gebildes, das Orchester dreht sich, die gläsernen Arme fingern und tasten und zucken wild umher, das großartige Finale von De Bruiks größter Symphonie hallt durch den Raum, reißt mich mit, dass mir das Herz in der Brust pocht wie ein Kind, das dort gefangen ist und um seine Freiheit kämpft. Neunzehn Jahre, Holywelkin, ist es das, was du gemeint hast? Mein Bewusstsein bewirkt das, ohne Zutun meiner Finger.
Das Orchester spielt, was ich hören möchte.
Ich bewege mich in Bereiche, die ganz mir gehören, springe von Passage zu Passage, spiele die Musik, nach der ich mich immer gesehnt habe, die halb erinnerten Tonfetzen und majestätischen Akkorde, wegen derer ich mitten in der Nacht aufwachte und mir wünschte, ich könnte sie festhalten; und nun ist die verlorene Zeit zurückgekehrt, die verlorene Musik mein eigen. Die architektonischen Strukturen Bachs, die Ausdruckskraft Beethovens, die überwältigende Schönheit De Bruiks, alles verwoben zu einem phantastischen Gedankenknäuel: ein Gedanke, und schon spielt ihn das Orchester. Der Künstler wird zum Instrument, meine Hände wirbeln in der Kontrollkammer umher, Füße, Ellbogen und Stirn spielen mit, während mein eigentliches Ich über dem Körper schwebt, um zu beobachten und zu lauschen, in ekstatischer Verblüffung.
Musik. Wer ihr gegenüber auch nur ein wenig aufgeschlossen ist, wird Passagen kennen, die ihm einen Schauer über den Rücken laufen lassen und das Blut in die Wangen treiben, die Haut prickeln lassen: Es ist die physische Reaktion auf das Erleben von Schönheit. Die Musik, die ich jetzt spiele, ist die Essenz dieses Gefühls, oh, hört nur! – sie schwebt hoch hinaus, ich schließe die Augen, aber die abrollende Partitur folgt keiner präzisen Notation mehr, sie ist die phantastische Impression eines Musikstücks, der Hintergrund blutrot, die Noten sind unversehens auftauchende Juwelenhaufen oder langverfließende Farben, die ich nicht einmal im Augenblick des Sehens benennen könnte; und doch sehe ich sie – donnernde Trommeln, vorwärtsdrängende, übereinanderpurzelnde Streicher, getrieben von einer Welle jauchzender Bläserfortissimi, schimmernder Bläser, triumphal!
… triumphal ist sie, als ich das Podium besteige, ich kann ihr Gesicht sehen, und sie ist angespannt in ihrer Ekstase, als gebäre sie, für sie werde ich wiedergeboren, und während der ganzen Zeremonie sehe ich nur ihr leuchtendes Gesicht vor mir, denn ihr wurde ein Meister geboren …
… meisterhaft, chaotisch und doch perfekt durchdacht. Die Partitur ist ein mille fleurs verzerrter Farben, fallend, fallend, die Noten fallen in großen Terzen. Ich öffne die Augen und merke, dass sie bereits weit aufgerissen waren; ein Sturm, ein roter Sturm, ich sehe nur Rot, ein greller Wasserfall geschmolzenen Glases stürzt herab, dahinter tausend Sonnen.
♪
Ich erwache aus einem Traum, in dem ich … in dem ich schmale Gassen entlangrannte. Mit jemandem sprach. Mein Schicksal erkannte. Ich kann mich nicht erinnern.
♪
Ich liege auf dem gläsernen Boden der Kammer, ich spüre das Basrelief der Notenschlüssel. Mein Mund fühlt sich an, als sei er mit Säure ausgespült worden, und das mag durchaus stimmen. Meine Beine. Meine linke Hand ist eingeschlafen. Man hat mich aus meinem Gefäß gegossen, mein Skelett ist weg, ich bin ein Klumpen Fleisch. Ich bewege den Arm. Eine Leistung.
»Johannes«, ertönt die Stimme des Meisters, schrill vor Besorgnis. Wahrscheinlich war sie es, die mich geweckt hat. Seine Hand liegt auf meiner Schulter. Er plappert ohne Pause, während er mir aus dem Orchester heraushilft. »Ich bin gerade erst gekommen, dir geht es gut, dir geht es gut, die Musik, die du gespielt hast, mein Gott, wie wunderbar, hier, pass auf, es ist alles in Ordnung, mein Sohn …«
»Ich bin blind«, krächze ich. Eine Pause, ein Keuchen. Er hält mich in den Armen, schleppt mich zu einer Liege, murmelt mit verzerrter Stimme vor sich hin, während er mich bewegt.
»Entsetzlich, entsetzlich«, wiederholt er ein ums andere Mal. »Entsetzlich.« Es ist die uralte Geschichte. Erblinde, um sehen zu lernen. Oder … jedenfalls, um zu lernen. Ich blinzele die Tränen um mein verlorenes Augenlicht fort und kann mich nicht blinzeln sehen.
»Du wirst ein großer Meister«, versichert er mir.
Ich antworte nicht.
»Dein Erblinden wird daran nichts ändern.«
Und nach einer langen Pause …
»Doch«, sage ich und wünsche, er könne es verstehen, wünsche mir jemanden, der es versteht. »Ich denke, das wird es.«
Kapitel eins
SPHÄRENMUSIK
Exemplarische Kontemplation
Lieber Leser, zwei Weißsonnen umkreisen den Planeten Uranus: eine heißt Puck, die andere Bottom. Sie glühen dicht über der wirbelnden Wolkendecke dieses riesigen Planeten, und mit der Hilfe des sanften grünen Planetenlichts erhellen sie diesen finsteren Winkel des Sonnensystems. An der grünlichen Glut des Trios wärmt sich ein Heer von Welten – kleiner Welten natürlich, Welten, die nicht größer sind als der Asteroid Vesta (viele davon eher noch kleiner) –, aber immerhin Welten, jede umgeben von einer durchsichtigen Lufthülle wie Miniaturmodelle in gläsernen Briefbeschwerern, und jede eine in sich geschlossene Zivilisation und Gesellschaft. Diese Welten kreisen in elliptischen Bahnen jenseits der schmalen weißen Bänder der Uranusringe; man könnte sagen, diese Kette von Welten bildet einen neuen Ring im alten Gürtel des Planeten: Das erste Dutzend wurde aus geglätteten Eisklumpen geformt, die neueren aus unregelmäßig aneinandergereihten Seifenblasen zusammengesetzt, von Leben erfüllt. Und was verbindet all diese verschiedenen Welten, was ist ihre lingua franca? Musik.
Unsere Geschichte nimmt also ihren Anfang – einen ihrer Anfänge – auf einer dieser Welten, auf der mit Namen Holland. Holland ist ein zerklüfteter Kleinmond, sattes Grün im Tiefland, kahl und moorig auf den Hügeln, die von den Bewohnern Tòrr genannt werden. Und in einem der mit Heidekraut bewachsenen Hochtäler, an einem Bach im Kieselbett, unter einem der höchsten Tòrrs, steht im Schatten einer einzelnen Eibe eine einsame Kate. Über dieser Kate pulsierte im Frühling des Jahres 3229 die reine Luft einer klaren Morgendämmerung; ein Strahl dieses Morgenlichts, Pucks vorwitziger Schein, lugte durchs Katenfenster, und drinnen erwachte Dent Ios.
Dent kam zu sich, noch in einem Traum gefangen, und richtete sich benommen und furchtsam auf. Er hatte geträumt, Holland habe Feuer gefangen, und seine Aufgabe sei, die Nachbarn zu warnen. Er war mit einer schweren Keule in der Hand den Pfad hinuntergelaufen, brüllend wie Paul Revere auf seinem wilden Ritt, und war über jeden Stein und jede Wurzel gestolpert; hatte ungestüm an die Türen gehämmert, bis sie geöffnet wurden und seine letzten Faustschläge die Bewohner trafen; war vor den wütenden Opfern davongelaufen und hatte, wenn sie an Häusern vorbeikamen, weiter seine Warnrufe ausgestoßen; hatte zu Kanistern gegriffen, um kleine Brandherde zu löschen, nur um festzustellen, dass es sich um Benzinkanister handelte; bis er am Ende von einem heimtückischen Schlag seiner eigenen Keule gefällt keuchend im Staub lag, von Flammen umgeben.
Dent fluchte auf die zufallsbedingten Synapsensprünge, die derartige Visionen hervorriefen, kletterte aus dem Bett und hielt seinen Kopf unter den Wasserhahn in der Küche. Auf dem Herd stand noch eine große schwarze Pfanne, verkrustet mit einer dicken Schicht Speckfett. Dent rümpfte die Nase. Es war kühl; er schlüpfte in seine Hosen und zog sich ein warmes Hemd über den Kopf. Vom Außenabort kommend hörte er auf dem talaufwärts zu seinem Haus führenden Pfad Musik. Da kam jemand. Er eilte nach drinnen, um etwas Ordnung zu schaffen.
In seiner Kate herrschte Unordnung. Auf sämtlichen Flächen der Kochnische stapelte sich schmutziges Geschirr, der Boden war mit Kleidungsstücken übersät, und überall lagen Bücher und Holo-Würfel herum. Dent war einer jener Bewohner Hollands, die den hier sehr beliebten ländlichen Lebensstil pflegten, auch wenn sein Heim, vollgestopft mit Büchern, Musikinstrumenten, Notenblättern, Stichen, Holo-Würfeln und Computerkonsolen, bei näherem Hinsehen seine diversen kultivierten (manch einer auf Holland würde sagen: allzu kultivierten) Interessensgebiete offenbarte. Obwohl seine Kate dem Namen nach eine Farm war, gab es in ihrem Inneren keinerlei Anzeichen landwirtschaftlicher Tätigkeit zu entdecken – und genau genommen sah es draußen im Freien ganz ähnlich aus. Anders als die meisten seiner Nachbarn wanderte Dent ins nächstgelegene Dorf, um den größten Teil seiner Lebensmittel einzukaufen, und sein vernachlässigtes Tomatenbeet hatte den Kampf gegen das eindringende Unkraut beinahe schon aufgegeben. Jetzt stolperte er hastig um sein ungemachtes Bett herum und versuchte vergeblich, den Raum noch rechtzeitig in Ordnung zu bringen, um seine Gäste würdig empfangen zu können. Er beschloss, sie im Vorgarten zu begrüßen.
Über den schattigen Hügeln im Osten strahlte Puck exakt im Zentrum des Uranus, sodass der Planet hinter dem Diamantsplitter der Weißsonne wie ein immenser Opal wirkte. Das goldene Morgenlicht bekam dadurch einen Grünstich, der das taubenetzte Heidekraut erglühen ließ. Auf den letzten Serpentinen des Pfades aus dem Tal waren Stimmen zu hören. Dent griff mit seinen weichen, zarten Fingern nach den langen Schnurrbartenden und zupfte verzweifelt daran: ungeladene Gäste – am frühen Morgen! Eine Krise!
Drei Gestalten kamen über die steilste Kuppe des Pfades, und Dent entspannte sich. Es nahten drei seiner besten Freunde: June Winthrop, Irdar Komin und Andrew Allendale. June spielte auf einem Klavierstab, und Irdar und Andrew sangen dazu. Als sie Dent in seinem Vorgarten stehen sahen, winkten sie. »Hügelbewohner!«, sang June. »Drei Weise nähern sich mit Neuigkeiten!« Und die beiden Männer an ihrer Seite sangen harmonisches Gelächter.
Dent geleitete sie zu den Bänken unter der Eibe und rieb den Tau ins Holz. »Was führt euch so früh hierher? Ihr müsst vor Sonnenaufgang im Dorf aufgebrochen sein.«
»Nun ja«, sagte June, »du hast gestern Abend unser Treffen verpasst!« Und Andrew und Irdar lachten. Sie waren alle vier Mitglieder des Kollektivs, das Thistledown herausgab, ein Monatsjournal mit Musikkritiken und Kommentaren, das als das Beste im ganzen Uranussystem galt; das Kollektiv traf sich in unregelmäßigen Abständen im Dorf, das sich ins Tal unter Dents kleinem Kar schmiegte.
»Tut mir leid«, sagte Dent hilflos. »Einer meiner Tapire hat gekalbt.«
June lachte höhnisch. »Ich hoffe, du hattest Hilfe! Ich war das letzte Mal dabei, als eins von Dents Muttertieren geworfen hat«, erzählte sie den anderen, »und er hat einen Tierarzt kommen lassen, der die ganze Arbeit gemacht hat, während er selbst leichenblass herumgehüpft ist!«
»Deine unzähligen vergangenen und künftigen Ehen haben dich wohl zur hochqualifizierten Hebamme gemacht«, sagte Dent, was seine Freunde spöttisch aufstöhnen ließ. »Das mit dem Treffen tut mir jedenfalls leid. Hoffentlich habe ich nichts Wichtiges versäumt?«
Da brachen seine drei Freunde in schallendes Gelächter aus! Irritiert sagte Dent: »Ich bitte euch! Was ist passiert?«
June spielte den Anfang von Beethovens Fünfter: das Schicksalsmotiv. »Nach langer Debatte wurde beschlossen, dass Thistledown einen Korrespondenten abstellt, der über die Große Tournee von Holywelkins Orchester berichtet.«
»O nein«, sagte Dent voller Abscheu. »Ich hätte angenommen, das sei unter unserer Würde …« Dann sah er den Ausdruck in den Gesichtern seiner Freunde und hielt inne. »Moment mal, ihr wollt doch nicht etwa sagen …« Er stand auf. »Ihr wollt doch nicht etwa sagen, ihr habt mich …«
June nickte. »Wir haben einstimmig beschlossen, dass du für diese Aufgabe am besten geeignet bist.«
»Nein!«, rief Dent. Er umrundete erregt die Eibe, dann sagte er schlicht: »Ich mach's nicht.«
»Du musst!«, sagte Andrew fröhlich. »Es ist wie beim Posten des Vorsitzenden – wer nicht beim Treffen anwesend ist, kriegt die Sache aufgebrummt.«
»Aber das hier ist viel schlimmer«, sagte Dent. »Nein, nein. Unmöglich. Das könnte ich nicht.« Er wandte sich an June, die zur Zeit Vorsitzende des Kollektivs war. »Dieses Orchester ist doch nichts als ein Spielzeug, eine Kinderei, die benutzt wird, dem ignoranten Volk das Geld aus der Tasche zu ziehen. Warum sollten wir über irgendeine Tournee mit so einem Ding berichten?«
»Das Orchester hat einen neuen Meister«, sagte Irdar. »Hast du sein Wirken nicht verfolgt?«
»Wie ich bereits sagte, habe ich keinerlei Interesse an Holywelkins Orchester.«
»Aber dieser Wright ist anders. Er ist seit fünf Jahren Meister, und während der ganzen Zeit hat er kein einziges öffentliches Konzert gegeben.«
»Ein weiser Mann, würde ich sagen.«
»Er hat lediglich Kompositionen veröffentlicht – Etüden nennt er sie.«
June meinte: »Du hast selbst eine davon besprochen, Dent. Ich habe gestern Abend nachgeschaut. Eine von Wrights Etüden wurde im Journal der Klaviergilde von Lowell veröffentlicht, und du hast sie hoch gelobt. Originell und fremdartig hast du sie genannt.«
»Ah«, sagte Dent, der sich jetzt an den Artikel erinnerte. »Das war Wright? Wie bedauerlich, dass er an so ein monströses Instrument gekettet ist.«
»Vielleicht verändert er ja das Instrument«, sagte Andrew.
»Nein«, sagte Dent, »das Institut, dem es gehört, wird sicherstellen, dass darauf ausschließlich populäre Klassiker gespielt werden. Das ist schließlich seine Aufgabe. Der Meister ist nichts als ein Lakai des Aufsichtsrats.«
»Stimmt nicht«, widersprach June. »Für das Repertoire sind die Meister verantwortlich. Es ist nur so, dass Yablonski und sein Vorgänger gespielt haben, was der Aufsichtsrat vorgeschlagen hat. Aber auch das kann sich ändern. Gerüchteweise habe ich von Reibereien zwischen Wright und dem Rat gehört, und unser Korrespondent auf Lowell teilt mit, dass Wright unter Druck gesetzt wurde, diese Tournee zu unternehmen, und nur unter der Bedingung zugestimmt hat, dass man ihm vollständige künstlerische Freiheit zusichert.«
»Das ist bei dem Ding doch irrelevant«, sagte Dent verächtlich. »Was ist es schließlich anderes als eine Art mechanisches Klavier? Orchestrion, so hat man das doch damals in Europa genannt. Lächerlich.«
June seufzte. »Du bist unfair. Ob es dir nun gefällt oder nicht, Holywelkins Orchester ist eins der berühmtesten musikalischen … Phänomene des Sonnensystems – der gesamten Geschichte, wenn man's genau nimmt. Diese Großen Tourneen sind eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen die Musik der äußeren Welten auf den inneren Planeten aufgeführt wird, also wird dabei moderne Musik Kulturkreisen nahegebracht, die musikalisch um Jahrhunderte zurückgeblieben sind. Und das Resultat ist immer interessant. Thistledown ist das beste Journal für moderne Musik, und folglich müssen wir über die Tournee berichten.«
»Und du bist der beste Mann für die Aufgabe«, rief Andrew.
»Unsinn«, erwiderte Dent ärgerlich. »Mein Tapir kalbt, und ich werde dafür durchs ganze Sonnensystem gejagt.«
»Aber das müsste dich doch reizen«, sagte June. »Warst du schon mal auf den inneren Planeten?«
»Nein. Und ich will auch nicht hin.«
»Warst du jemals auf Pluto?«, fragte Irdar.
»Nein.«
June schüttelte den Kopf. »Wohin bist du eigentlich schon gereist?«
Dent senkte abwehrend den Kopf. »Ich war auf Titania und Oberon …«
Aber er wurde vom Gelächter seiner Freunde unterbrochen. »Wie alt bist du?«, wollte June wissen.
»Ich bin sechsundzwanzig.«
»Sechsundzwanzig Jahre alt und schon ein vergreister Stubenhocker! Sei nicht albern, Dent. Man kriegt nicht alle Tage die Chance, ins innere System zu reisen.«
»Aber es gefällt mir hier.«
»Du bist im selben Alter wie Johannes Wright«, sagte Andrew. »Das sollte es eigentlich besonders interessant für dich machen.«
»Wenigstens müsste ich dein schmieriges Grinsen nicht mehr mit ansehen, wenn ich von Holland fortkäme«, meinte Dent gereizt. »Was würdest du sagen, wenn man dich auffordert, monatelang dein Heim zu verlassen?«
»Komm schon«, sagte June. »Das Kollektiv hat einen Beschluss gefasst, und wir wissen alle, dass du ein echter Thistledowner bist, bereit, dich dem Willen der Mehrheit zu unterwerfen. Geh und hol dir ein Instrument, dann machen wir ein bisschen Musik. Du gewöhnst dich schon noch an den Gedanken, und dann wirst du ihn richtig aufregend finden.«
»Das werde ich keinesfalls«, sagte Dent förmlich und ging in seine Kate, um sich zu sammeln. Geistesabwesend griff er nach einer Voicebox und kam damit zur Eibe zurück. Pucks Licht wurde vom feuchten, verfilzten Gras reflektiert und verlieh dem vernachlässigten Rasen grauen Glanz. Ein Schwarm Neuguineapapageien ließ sich auf der Eibe nieder und verwandelte den Baum in eine mit vielfarbigen Ornamenten übersäte Statue. Dent schaute sich in seinem kleinen Hochtal um und stöhnte.
Unvermittelt setzte er sich auf eine der Bänke und stimmte sein Instrument auf die der anderen. Andrew und Irdar hatten Flöten mitgebracht und bliesen fröhlich die C-Dur-Tonleiter auf und ab. June spielte einige einleitende Akkorde auf ihrem Klavierstab, und sie begannen ein Quartett zu improvisieren. Musik war für sie eine Sprache, die ebenso subtil und ausdrucksfähig war wie jede Ansammlung von Worten, und innerhalb der einfachen Sonatenform, die sie gewählt hatten, versuchten Dents drei Freunde eine Stimmung von Leichtigkeit, Harmonie, Aufmunterung und Ermutigung zu erzeugen. Aber wie jedermann weiß, ist Harmonie eine Frage allseitiger Übereinstimmung: Ein einziger Abweichler führt sofort zu Missklang. Und Dent verfügte auch noch über den Vorteil des dominanten Instruments, über die angenehmen, klaren Töne des Klavierstabs und der beiden Flöten wob er eine heisere Oberstimme, die »neeiin, o neeiin, neeiin, neeiien« wehklagte, bis die anderen vor Lachen nicht mehr weiterspielen konnten.
»Wir versuchen's später noch mal«, sagte June. »Also, Dent, die Große Tournee beginnt in Lowell beim Maifest der Außenwelten, das in einem Monat stattfindet. Du solltest so bald wie möglich aufbrechen – am besten schon morgen. Deshalb fängst du lieber gleich an zu packen. Wir kommen dann heute Nachmittag mit einem Karren vorbei und helfen dir, dein Gepäck zum Raumhafen zu schaffen. Und hör auf, Trübsal zu blasen! Ich bin selber schon systemabwärts gereist, und ich weiß bestimmt, dass es dir guttun wird.« Irdar und Andrew fügten ihre spöttischen Glückwünsche hinzu, und die drei verabschiedeten sich.
Immer noch murrend ging Dent wieder in seine Kate, die für ihn plötzlich einen unbeschreiblichen Charme besaß, und stand eine Weile wie betäubt herum. Dann trat er an den Ausguss und kratzte die Speckreste von der Pfanne. Der Geruch stieg ihm in die Nase; aus dem Ostfenster war am grünen Hang jenseits des Bachs eine Gruppe von olivgrün, rostrot und golden schimmernden Eukalyptusbäumen zu sehen. Der Himmel über ihnen war von jener Farbe, die man hollandblau nannte. Seine Tapire heulten nach Futter – er würde das Kollektiv beauftragen müssen, für sie zu sorgen …
»Verdammt!«, sagte er und knallte die Pfanne auf den Herd. Peng!
♪
Das Dritte Jahrtausend: eine Sinfonie
Erster Satz: Allegro. Im Jahre 2052 landeten Kolonisten auf dem Mars. Die meisten stammten aus Amerika und der Sowjetunion, und die Spannungen, die dieses Zusammentreffen der irdischen Großmächte erzeugte, trugen dazu bei, der Kolonie ihre vorantreibende Kraft, ihre unablässigen Konflikte, ihren utopischen Geist zu vermitteln. Die Siedler fanden genug Wasser, um den Mars zu einer unabhängigen Welt zu machen, und dies wurde zum Hauptziel der Kolonie. Den Terraform-Ingenieuren wurden Aufgaben gestellt, deren Lösung Generationen dauern sollte, und die übrige Marsgesellschaft erhielt eine Struktur, die es ermöglichen sollte, dieses großartige Projekt zu vollenden. Keine Kolonie in der Geschichte hatte je derartigen Unternehmungsgeist bewiesen; dies war eine Gesellschaft mit einem gemeinsamen Traum.
Ritardando: Moderato. 2175 wurde die erste ortsfeste Siedlung auf und unter dem Eis von Europa erbaut. Auch hier gingen die Kolonisten die Aufgabe, sich eine Heimat zu schaffen, tatkräftig an; aber sie hatten weniger Licht, weniger Schwerkraft, ja insgesamt weniger Ressourcen zur Verfügung, einschließlich der geistigen. Die Kolonien auf Europa, Callisto, Ganymed und Io verloren nie den Charakter von Außenposten, Niederlassungen am Rande des Möglichen. Dieser Charakter war bei den Kolonien des Saturnsystems noch ausgeprägter. Im Jahre 2220 wurde auf Iapetus eine Siedlung angelegt, und auch die anderen Monde wurden bald kolonisiert. Aber diese Kolonien glichen gestrandeten Raumschiffen, und ihre Kultur trieb seltsame Blüten. Weitere Expansion zu den äußeren Planeten erschien als sinnloses Unterfangen; die Kolonien im Bereich von Jupiter und Saturn neigten zur Innerlichkeit, und Musik, die abstrakteste aller Künste, wurde zum Mittelpunkt ihres Lebens.
Zweiter Satz: Adagissimo. Inzwischen erlebte die Erde von Neuem ein finsteres Zeitalter der Unruhen und Katastrophen, der Hungersnöte und des Krieges. Diese Weltkrise bedrohte die gesamte Menschheit, denn die erdrückende Überbevölkerung des Heimatplaneten stellte eine Belastung für das ganze Sonnensystem dar. Selbst die gemeinsamen Anstrengungen aller Nationen reichten nicht aus, um verheerende Hungersnöte zu vermeiden. Sämtliche Energien der Menschheit mussten darauf konzentriert werden, die Milliardenbevölkerung der Erde zu retten. Dies war kein einfaches Unterfangen, und es bedurfte jahrhundertelanger härtester Einschränkungen. Das Wirtschaftssystem musste weltweit umstrukturiert werden, damit es in seinem Grundmuster einem geschlossenen ökologischen Kreislauf immer ähnlicher wurde; das brachte für alle ernste Härten mit sich. So richtete sich die Gattung darauf ein, ums Überleben zu kämpfen, und die Kolonien im All sahen besorgt zu, wie das finstere Zeitalter seinen Lauf nahm. Nur der Mars, wo unablässig am großen Projekt gearbeitet wurde, machte erkennbare Fortschritte.
Dritter Satz: Intermezzo agitato. Während dieser langen Krisenzeit schritt die Wissenschaft jedoch weiter voran, vor allem auf dem Merkur. Dort sorgten die Physiker der rollenden Stadt Terminator für einen beispiellosen Energiestrom für Erde und Mars, und in der Umlaufbahn um den Merkur erzielte man Fortschritte bei den subatomaren Studien für die Konstruktion des Großen Synchrotrons. Das Synchrotron und das Orbital-Gevatron lieferten ungewöhnliche Untersuchungsergebnisse, die bei den Physikern den verworrenen, aufgeregten Gärungsprozess verschiedener Theorien in Gang setzte …
Vierter Satz: Accelerando. Arthur Holywelkin schrieb seine Zehn Formen des Wandels, eine großangelegte einheitliche Feldtheorie, die sich als außerordentlich tragfähig erwies. Physiker wandten seine Ergebnisse auf die ungeahnten Energiemengen an, die knapp oberhalb der Eruptionszone der Sonnenkorona zur Verfügung standen. Und sie stellten fest, dass sie mit Hilfe der neugewonnenen Erkenntnisse diese Energie bündeln und von einem Punkt zum anderen transferieren konnten. Es gelang ihnen, sie zu Singularitäten zu komprimieren, die in den Grenzen sphärischer Diskontinuität Anziehungskräfte ausübten, die weit über ihre scheinbare Masse hinausgingen. Die Diskontinuitätsphysik war der Schlüssel; die Tür zum Sonnensystem stand ihnen offen. Kolonien mit einem g Schwerkraft, bestrahlt von projizierten Sonneneruptionen, wurden auf Hunderten von Monden und Asteroiden etabliert, und überall gedieh das organische Leben. Millionen von Menschen brachen von Erde und Mars zu den neuen Welten auf, und das als Accelerando bekannte Zeitalter begann.
♪
Erste Überfahrt
Nun kommen Sie, lieber Leser, dessen Unternehmungsgeist ich schätze, weil Sie diese Reise mitmachen, und folgen Sie Dent Ios durchs Vakuum auf Pluto, den neunten Planeten. Die Planetenebene teilt sich in dreihundertundsechzig Grad, mit dem Nullpunkt beim Sternbild Fische. Im Frühjahr 3229 liegt Uranus bei 188 Grad, Pluto bei 225. (Neptun und sein großer Satellit Triton befinden sich am anderen Ende des Systems bei 110 Grad und werden deshalb auf der Großen Tournee ausgelassen.) Wir müssen also auf unserer Reise in weniger als einem Monat über zwölf astronomische Einheiten zurücklegen: Beeilen Sie sich, lieber Leser! Dent Ios reist mit dem Raumklipper Pauline; wir folgen ihm als reine Geister durchs unreine Vakuum.
Während wir uns Pluto nähern, müssen wir Hunderten von Schiffen wie der Pauline