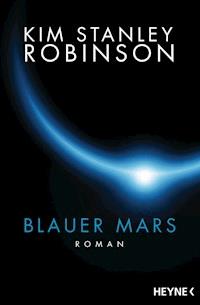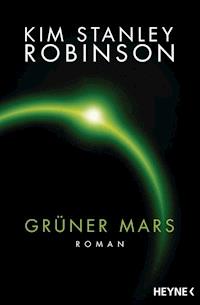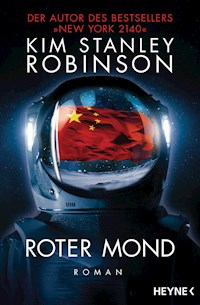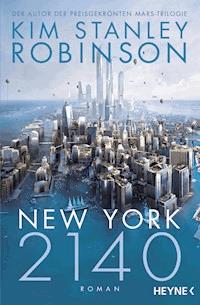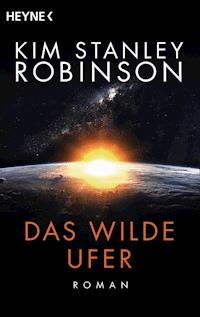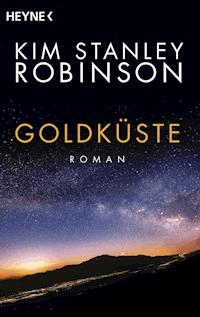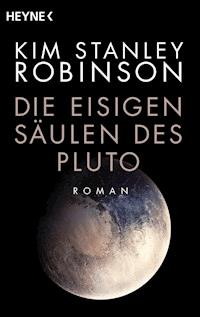8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Von Barack Obama auf Twitter empfohlen!
Indien, 2025. Das Land wird von einer gnadenlosen Hitzewelle heimgesucht, die Temperaturen erreichen mancherorts über 50 Grad. Hunderttausende Menschen sterben, manchmal werden ganze Stadtviertel ausgelöscht. Zu den Überlebenden gehört der Entwicklungshelfer Frank May. Schwer traumatisiert zieht er in die Schweiz, um mit denen abzurechnen, die seiner Meinung nach mitverantwortlich sind: dem Ministerium für die Zukunft, dessen Aufgabe es eigentlich ist, solche Katastrophen zu verhindern. In Mary Murphy, der Vorsitzenden des Ministeriums, findet Frank unerwartet eine Verbündete, die wie er gegen den Klimawandel kämpft - wenn auch mit anderen Mitteln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 842
Ähnliche
Das Buch
Indien, fünf Jahre in der Zukunft. Eine Hitzewelle lässt die Temperaturen auf weit über 50 °C steigen. Der junge Arzt Frank May versucht alles, um die Menschen in seinem Stadtviertel zu retten, doch vergeblich: Binnen einer Woche sterben Millionen.
Zürich, wenige Jahre später. Mary Murphy leitet eine UN-Behörde, die als das Ministerium für die Zukunft bekannt ist. Sie soll den Klimawandel aufhalten, doch ihr Ministerium kann nur Empfehlungen aussprechen, die von Industrie und Politik geflissentlich ignoriert werden. Eines Abends trifft Mary auf Frank, der ihr vorwirft, ihre Organisation könne auf legalem Wege nicht das tun, was wirklich nötig wäre. Doch rechtfertigt eine Katastrophe, die ohnehin nicht mehr aufzuhalten ist, den Einsatz von Gewalt?
Der Autor
Kim Stanley Robinson wurde 1952 in Illinois geboren, studierte Literatur an der University of California in San Diego und promovierte über die Romane von Philip K. Dick. Mitte der Siebzigerjahre veröffentlichte er seine ersten Science-Fiction-Kurzgeschichten, 1984 seinen ersten Roman. 1992 erschien mit Roter Mars der Auftakt der Mars-Trilogie, die ihn weltberühmt machte und für die er mit dem Hugo, dem Nebula und dem Locus Award ausgezeichnet wurde. Kim Stanley Robinson lebt mit seiner Familie in Davis, Kalifornien.
Mehr über Kim Stanley Robinson und seine Werke erfahren Sie auf:
KIM STANLEY ROBINSON
DAS MINISTERIUM FÜR DIE ZUKUNFT
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Paul Bär
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe: THE MINISTRY FOR THE FUTUREDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Redaktion: Tamara Rapp
Deutsche Ausgabe 10/2021
Copyright © 2020 by Kim Stanley Robinson
Copyright © 2021 dieser Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung eines Motivs von ssuaphotos / Shutterstock
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28018-5V004
www.diezukunft.de
1
ESWURDEHEISSER.
Frank May erhob sich von seiner Matte und tappte hinüber zum Fenster, um hinauszuschauen. Braune Putzwände und Ziegel, umbrafarben wie der Lehm aus der Gegend. Quadratische Wohnblocks wie der, in dem er sich befand, die Dachterrassen besetzt von Bewohnern, die nachts hinaufgestiegen waren, weil es drinnen zu heiß zum Schlafen war. Mehrere von ihnen standen hinter den brusthohen Mauern und spähten nach Osten. Der Himmel war braun wie die Häuser, vermischt mit dem Weiß des nahenden Sonnenaufgangs. Frank atmete tief ein. Die Luft erinnerte ihn an eine Sauna. Es war die kühlste Zeit des Tages. In seinem ganzen Leben hatte er keine fünf Minuten in einer Sauna zugebracht, er empfand das als unangenehm. Heißes Wasser ging vielleicht noch, aber heiße, feuchte Luft auf keinen Fall. Es war ihm ein Rätsel, wie jemand an so einem beklemmenden, stickigen Gefühl Gefallen finden konnte.
Hier konnte man ihm nicht entrinnen. Wenn er es sich vorher richtig überlegt hätte, wäre er bestimmt nicht hergekommen. Es war die Partnerstadt seines Heimatorts, doch es gab auch noch andere Partnerstädte, andere Hilfsorganisationen. Er hätte zum Beispiel in Alaska arbeiten können. Stattdessen tropfte ihm jetzt brennender Schweiß in die Augen. Er war nass, obwohl er nur Shorts trug, die ebenfalls nass waren; auf seiner Matte, auf der er schlaflos gelegen hatte, zeichneten sich feuchte Flecken ab. Er hatte Durst, und die Kanne neben seinem Bett war leer. Wie ein Schwarm von Riesenmücken surrten überall in der Stadt angestrengt die Klimageräte in den Fenstern.
Und dann durchbrach die Sonne den östlichen Horizont. Sie blitzte auf wie eine Atombombe – sie war ja auch eine. Die Felder und Häuser unter diesem gleißenden Lichtsplitter wurden dunkel und dunkler, als der Splitter sich zu einer lodernden Linie verbreiterte und dann zu einer Sichel anschwoll, die er nicht ansehen konnte. Die heranbrandende Hitze war spürbar wie eine Ohrfeige. Die Sonnenstrahlung erwärmte sein Gesicht und ließ ihn blinzeln. Seine Augen tränten so stark, dass er nicht viel erkennen konnte. Alles war lohfarben, beige und unerträglich grell. Eine ganz normale Stadt in Uttar Pradesh um sechs Uhr früh. Er warf einen Blick auf sein Telefon: achtunddreißig Grad. Luftfeuchtigkeit ungefähr sechzig Prozent. Die Kombination war das Entscheidende. Vor einigen Jahren wäre das noch eine der höchsten je gemessenen Feuchtkugeltemperaturen gewesen. Jetzt war man ihr schon an einem gewöhnlichen Mittwochmorgen ausgesetzt.
Vom Dach auf der anderen Straßenseite drangen bestürzte Klagen herüber. Zwei junge Frauen, die sich über die Mauer lehnten und hinunter zur Straße riefen. Jemand dort oben rührte sich offenbar nicht mehr. Frank griff nach seinem Telefon und tippte die Nummer der Polizei. Keine Antwort. Er konnte nicht erkennen, ob die Leitung noch funktionierte oder nicht. Wie in Wasser getaucht, schrillten jetzt in der Ferne Sirenen. Mit dem Morgengrauen entdeckten die Menschen angegriffene Schlafende, die nach der langen, heißen Nacht nicht mehr aufwachen wollten. Die Sirenen schienen darauf hinzudeuten, dass zumindest einige Anrufe durchgekommen waren. Frank schaute wieder auf sein Telefon. Es war geladen und zeigte eine Verbindung an. Aber keine Antwort von der Polizeistation, die er in seinen vier Monaten hier schon mehrmals eingeschaltet hatte. Zwei ganze Monate lagen noch vor ihm. Achtundfünfzig Tage, viel zu lange. 12. Juli – und noch kein Monsun in Sicht. Gut, erst mal heute überstehen. Ein Tag nach dem anderen. Dann heim nach Jacksonville, wo im Vergleich zu der Glut hier absurde Kälte auf ihn wartete. Viele Geschichten zu erzählen. Doch die armen Leute auf dem Dach gegenüber …
Mit einem Mal brach das Rauschen der Klimageräte ab. Wieder betroffene Schreie. Sein Telefon zeigte keine Balken mehr. Kein Netz. Stromausfall. Sirenen wie das Jammern von Gottheiten, der gesamte Hindu-Pantheon in Not.
Schon sprangen Generatoren an, laute Zweitaktmotoren. Benzin, Diesel, Petroleum, aufgespart für Situationen wie diese, wenn die gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Flüssigerdgas unter der Realität nachgaben. Die ohnehin schon schlechte Luft würde sich bald in einen Schleier aus Abgasen verwandeln. Als würde man direkt hinter dem Auspuffrohr eines alten Busses einatmen.
Bei dieser Vorstellung musste Frank husten und griff wieder nach der Kanne an seinem Bett. Sie war noch immer leer. Er trug sie hinunter und füllte sie aus dem Filterbehälter im Kühlschrank. Auch ohne Strom immer noch kalt, und er konnte damit rechnen, dass das Wasser in der Thermoskanne eine Weile so blieb. Zur Sicherheit warf er noch eine Jodtablette hinein und schraubte den Deckel fest zu. Das Gewicht fühlte sich beruhigend an.
Die Stiftung hatte unten in der Abstellkammer einen Generator und mehrere Kanister Benzin deponiert, genug, um ihn zwei oder drei Tage lang zu betreiben. Gut zu wissen.
Seine Kollegen drängten durch die Tür. Hans, Azalee, Heather, alle mit roten Augen und durcheinander. »Komm«, drängten sie, »wir müssen los.«
»Wohin denn?«, fragte Frank verwirrt.
»Wir brauchen Hilfe, der ganze Stadtteil ist ohne Strom, wir müssen in Lucknow Bescheid sagen, damit Ärzte kommen.«
»Ärzte?«
»Wir müssen es versuchen!«
»Ich geh hier nicht weg«, sagte Frank.
Sie starrten ihn an und wechselten Blicke.
»Lasst das Satellitenhandy hier«, fügte er hinzu. »Holt Hilfe. Ich bleibe und sage den Leuten, dass ihr auf dem Weg seid.«
Unsicher nickten sie und eilten hinaus.
Frank zog ein weißes Hemd an und hatte es ein paar Sekunden später schon wieder durchgeschwitzt. Er trat hinaus auf die Straße. Dröhnende Generatoren pumpten Abgase in die überhitzte Luft. Vermutlich für den Betrieb von Klimageräten. Er unterdrückte ein Husten. Es war einfach zu heiß dafür. Das Wiedereinsaugen der Luft war, als würde man in einem Hochofen atmen, sodass man gleich wieder husten musste. Und von der Zufuhr dampfender Luft und der Anstrengung des Hustens wurde einem noch heißer.
Leute kamen jetzt auf ihn zu und baten um Hilfe. Schon unterwegs, erklärte er ihnen. Kommt um zwei Uhr Nachmittag in die Beratungsstelle. Jetzt bringt erst mal die Alten und Kleinen in klimatisierte Räume. Die Schulen oder das Rathaus haben bestimmt Klimaanlagen. Da müsst ihr hin. Folgt dem Geräusch der Generatoren.
In jedem Hauseingang standen verzweifelte Menschen, die auf eine Ambulanz oder einen Leichenwagen warteten. Auch für heftige Klagen war es zu heiß. Selbst Reden fühlte sich bei der Glut gefährlich an. Und was gab es schon zu sagen? Es war zu heiß zum Denken.
Immer noch steuerten Leute auf ihn zu. Bitte helfen Sie uns, Sir.
Kommt um zwei in die Beratungsstelle, wiederholte Frank ein ums andere Mal. Fürs Erste zur Schule. Geht rein, sucht nach klimatisierten Räumen. Bringt die Alten und die Kinder hier weg.
Aber es gibt nichts!
Da fiel es ihm ein. »Runter zum See! Geht ins Wasser!«
Sie schienen nicht zu begreifen. Wie bei der Kumbh Mela, versuchte er ihnen zu erklären, wenn die Leute nach Varanasi fuhren und im Ganges badeten. »Zum Kühlen. Im Wasser bleibt ihr kühler.«
Ein Mann schüttelte den Kopf. »Das Wasser liegt in der Sonne. Da ist es so heiß wie im Bad. Schlimmer als an der Luft.«
Frank atmete schwer, als er angespannt und beunruhigt zum See marschierte. Überall vor den Häusern Leute, zusammengedrängt in Eingängen. Einige beäugten ihn, doch die meisten waren zu sehr mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Die Augen groß vor Leid und Angst, rot von der Hitze und den Abgasen, dem Staub. Metalloberflächen backten in der Sonne, er sah Hitzewellen aufsteigen wie über einem Grill. Seine Muskeln wurden zu Brei, nur ein Draht aus Angst hielt sein Rückgrat noch aufrecht. Am liebsten wäre er gerannt, doch das war ausgeschlossen. So weit wie möglich hielt er sich im Schatten, den die eine Straßenseite jetzt am frühen Morgen noch bot. In der Sonne war es, als würde man in ein Lagerfeuer geschoben. Angetrieben von der Glut, torkelte man auf den nächsten Schattenfleck zu.
Kurz darauf stellte er ohne große Verwunderung fest, dass bereits Leute bis zum Hals im See standen, die braunen Gesichter rot vor Hitze. Dick wie Talkum hing das Licht über dem Wasser. Er trat auf die geschwungene Betonstraße, die den See an dieser Seite begrenzte, und steckte den Arm bis zum Ellbogen hinein. Es war tatsächlich so warm wie ein Bad, fast zumindest. Er ließ den Arm drin, um herauszufinden, ob das Wasser kühler oder heißer als sein Körper war. Schwer zu sagen in der brütenden Luft. Nach einer Weile kam er zu dem Schluss, dass das Wasser an der Oberfläche ungefähr die gleiche Temperatur hatte wie sein Blut. Das hieß, es war deutlich kühler als die Luft. Und wenn es doch ein wenig wärmer war als der Körper … nun, dann war es immer noch kühler als die Luft. Seltsam, es war einfach schwer zu erkennen. Er sah nach den Leuten im See. Nur ein schmaler Streifen Wasser lag noch im Morgenschatten der Häuser und Bäume, und auch dieser Streifen würde bald verschwinden. Danach war der ganze See der Sonne ausgesetzt, bis der späte Nachmittag auf der anderen Seite wieder Schatten brachte. Das war nicht gut. Aber Regenschirme – alle hatten doch einen Regenschirm. Allerdings blieb dann noch immer die Frage, wie viele Menschen im See Platz hatten. Sicher nicht genug. Angeblich hatte die Stadt zweihunderttausend Einwohner. Umgeben von Feldern und Hügeln, die nächsten Orte in allen Richtungen mehrere Kilometer entfernt. Seit Urzeiten.
Er ging zurück zur Niederlassung mit der Beratungsstelle im Erdgeschoss. Ächzend mühte er sich in sein Zimmer im ersten Stock. Sicher war es am einfachsten, sich hier hinzulegen und zu warten, bis es vorbei war. Er tippte die Kombination seines Safes ein und nahm das Satellitentelefon heraus. Schaltete es ein. Akku voll geladen.
Er rief die Zentrale in Delhi an. »Wir brauchen Hilfe«, teilte er der Frau am anderen Ende mit. »Der Strom ist ausgefallen.«
»Wir haben auch keinen Strom«, antwortete Preeti. »Er ist überall weg.«
»Überall?«
»In weiten Teilen von Delhi, in Uttar Pradesh, Jharkand, Bengalen. Teilweise auch im Westen, in Gujarat, in Rajasthan …«
»Was sollen wir tun?«
»Auf Hilfe warten.«
»Von wem?«
»Keine Ahnung.«
»Was sagt der Wetterbericht?«
»Die Hitzewelle soll noch eine Weile anhalten. Die aufsteigende Luft über dem Land könnte kühlere Luft vom Meer anziehen.«
»Wann?«
»Das weiß niemand. Das Hochdruckgebiet ist riesig. Es hängt am Himalaja fest.«
»Ist es besser, wenn man im Wasser ist statt an der Luft?«
»Klar. Sofern es kühler ist als die Körpertemperatur.«
Er schaltete ab und legte das Handy zurück in den Safe. Er blickte auf das Feinstaubmessgerät an der Wand: 1300 ppm. Für Teilchen ab 25 Nanometern und kleiner. Dann trat er erneut hinaus auf die Straße, blieb aber im Hausschatten. Das machten alle; niemand stand mehr in der Sonne. Wie Rauch lag die graue Luft über der Stadt. Es war zu heiß zum Riechen, ein Gefühl in der Nase wie von einer sengenden Flamme.
Er wandte sich ab und machte sich auf den Weg zur Abstellkammer. Er öffnete sie mit dem Schlüssel aus dem Safe und holte den Generator und einen Kanister Benzin heraus. Als er den Tank auffüllen wollte, merkte er, dass er noch voll war. Also brachte er den Kanister zurück und trug den Generator in die Ecke mit dem Fenster. Das kurze Kabel des Klimageräts war an der Wandsteckdose darunter angeschlossen. Wegen der Abgase kam es nicht infrage, den Generator im Zimmer laufen zu lassen. Aber er konnte ihn auch nicht einfach vors Fenster auf die Straße stellen, weil ihn sonst garantiert jemand stahl. Die Leute waren verzweifelt. Also … Er kehrte in die Abstellkammer zurück und wühlte herum, bis er ein Verlängerungskabel fand. Hinauf zur Dachterrasse, die von einer Mauer geschützt war und vier Stockwerke über der Straße lag. Das Verlängerungskabel reichte allerdings nur bis zur nächsten Etage. Er stieg hinunter und nahm das Klimagerät aus dem Fenster im zweiten Stock. Schnaufend und schwitzend schleppte er es die Treppe hinauf. Kurz fühlte er einen Anflug von Schwäche, dann brannte der Schweiß in seinen Augen, und neue Kraft durchströmte ihn. Im dritten Stock öffnete er das Bürofenster, platzierte das Gerät auf dem Sims und ließ den Schieberahmen wieder herunter. Zuletzt zog er die Seitenpaneele heraus, um das Fenster ganz abzudichten. Oben auf der Terrasse warf er den Generator an und wartete, bis er hustend und röchelnd seinen Zweitaktrhythmus fand. Nach einer ersten Rauchwolke waren keine Abgase mehr zu sehen. Aber er war laut, die Leute konnten ihn sicher hören. Er hörte ja auch die anderen überall in der Stadt. Das Verlängerungskabel anschließen, die Treppe runter zum oberen Büro, das Klimagerät einstecken und einschalten. Knirschendes Surren. Luftzustrom, o Gott, das Ding funktionierte nicht. Doch, es lief. Es senkte die Temperatur der Außenluft um fünf bis zehn Grad. Also waren es immer noch dreißig Grad, überlegte er, vielleicht sogar mehr. Im Schatten ging das, selbst bei der hohen Feuchtigkeit. Man musste sich bloß entspannen und Anstrengungen vermeiden. Und die kühle Luft würde durchs Treppenhaus nach unten sinken und sich im ganzen Gebäude ausbreiten.
Im zweiten Stock versuchte er, das Fenster zu schließen, aus dem er das Kühlgerät genommen hatte. Es hing fest. Er knallte die Fäuste so heftig auf die Griffe, dass fast das Glas brach. Endlich sauste es mit einem Ruck nach unten. Dann raus auf die Straße, Tür zuziehen. Los zur nächsten Schule. In einem kleinen Laden in der Nähe gab es für Kinder und Eltern Essen und Getränke zu kaufen. Die Schule war geschlossen, der Laden auch, doch es waren Leute da, von denen er einige kannte. »In der Beratungsstelle läuft eine Klimaanlage«, erklärte er ihnen. »Kommt mit rüber.«
Schweigend folgte ihm die Gruppe. Sieben oder acht Familien, auch die Ladenbesitzer, die hinter sich absperrten. So gut es ging, hielten sie sich im Schatten, auch wenn kaum noch einer zu finden war. Die Männer vor ihren Frauen, die die Kinder im Gänsemarsch antrieben, um die Sonne zu vermeiden. Die Gespräche wurden auf Awadhi geführt, dachte Frank, oder auf Bhojpuri. Er beherrschte nur ein wenig Hindi, und das wussten sie. Diese Sprache benutzten sie, wenn sie mit ihm reden wollten, oder sie wandten sich an jemanden, der sich auf Englisch mit ihm verständigen konnte. Er hatte sich nie daran gewöhnt, Menschen zu helfen, mit denen er nicht richtig reden konnte. Beschämt überwand er jetzt die Verlegenheit über sein schlechtes Hindi und erkundigte sich, wie sie sich fühlten, wo ihre Verwandten waren, ob sie einen Zufluchtsort hatten. Jedenfalls hoffte er, dass er das fragte. Sie schauten ihn so seltsam an.
Kurz darauf schloss er die Tür zur Beratungsstelle auf, und die Menschen strömten hinein. Ohne Anweisung stiegen sie hoch in das Zimmer, in dem das Klimagerät lief, und setzten sich auf den Boden. Der Raum füllte sich rasch. Er ging wieder hinunter, trat auf die Straße und bat Leute herein, wenn sie sich interessiert zeigten. Bald war das ganze Haus voll bis auf den letzten Platz. Danach sperrte er die Tür ab.
In der relativen Kühle der Zimmer schmorten die Menschen vor sich hin. Frank warf einen Blick auf den Computermonitor; Temperatur im Erdgeschoss achtunddreißig Grad. Im Zimmer mit dem Klimagerät war es vielleicht ein wenig kühler. Luftfeuchtigkeit bei sechzig Prozent. Schlecht, diese Hitze zusammen mit der hohen Luftfeuchtigkeit. Ungewöhnlich. In der Trockenzeit von Januar bis März war es kühler und trockener auf der Ganges-Ebene; danach wurde es zwar allmählich heißer, blieb aber trocken. Danach brachte der Monsun mit der Nässe kühlere Temperaturen und zahllose Wolken, die Schutz vor der Sonne boten. Das Wetter jetzt war anders. Wolkenlose Hitze und dennoch hohe Luftfeuchtigkeit. Eine schreckliche Kombination.
In der Beratungsstelle gab es zwei Badezimmer. Irgendwann versagten die Toiletten. Wahrscheinlich führten die Abwasserrohre zu einer Kläranlage, deren Notstromkapazitäten nicht für den weiteren Betrieb ausreichten, auch wenn das kaum zu glauben war. Jedenfalls war es so. Jetzt ließ Frank die Leute nach Bedarf hinaus, damit sie irgendwo in eine Seitengasse gehen konnten wie in den nepalesischen Dörfern, die keine Toiletten hatten. Es war ein Schock für ihn gewesen, als er das zum ersten Mal sah. Inzwischen hielt er nichts mehr für selbstverständlich.
Manchmal brach jemand in Tränen aus, und es bildeten sich kleine Gruppen um die Betreffenden; Ältere und Kinder, die sich schämten, weil ihnen ein Missgeschick unterlaufen war. Daher stellte er Eimer in die Badezimmer, leerte sie in den Rinnstein und brachte sie wieder zurück. Ein alter Mann starb; Frank half einigen Jüngeren, den Toten hinauf zur Dachterrasse zu tragen, wo sie ihn in ein dünnes Tuch wickelten, einen Sari vielleicht. Wesentlich schlimmer wurde es später am Abend, nachdem es ein Kind getroffen hatte. In allen Zimmern wurde geweint, als sie den kleinen Leichnam hoch aufs Dach brachten. Frank bemerkte, dass das Benzin im Generator zur Neige ging, und holte einen Kanister aus der Abstellkammer, um nachzufüllen.
Seine Thermoskanne war leer. Die Wasserhähne liefen nicht mehr. Im Kühlschrank standen zwei große Flaschen, von denen er aber nichts erzählte. Aus einer schenkte er im Dunkeln seine Kanne voll; das Wasser war sogar noch ein wenig kühl. Dann machte er sich wieder an die Arbeit.
In dieser Nacht starben vier weitere Menschen. Wie ein flammender Hochofen ging am Morgen die Sonne auf und knallte auf das Dach und seine traurige Fracht eingehüllter Toter. Ein Blick über die Häuser zeigte, dass sich sämtliche Dächer und Gehsteige in eine Leichenhalle verwandelt hatten. Die ganze Stadt war ein einziges Mausoleum, und es war so heiß wie zuvor, vielleicht sogar noch heißer. Die Temperatur lag bei zweiundvierzig Grad, die Luftfeuchtigkeit bei sechzig Prozent. Dumpf starrte Frank auf den Bildschirm. Er hatte vielleicht drei Stunden geschlafen, war immer wieder hochgeschreckt. Der Generator grummelte in seinem unregelmäßigen Takt, und das Klimagerät wälzte ruckelnd Luft. Noch immer rauschten andere Generatoren und Kühlgeräte vor sich hin. Doch nichts davon half.
Schließlich ging er hinunter zum Safe und rief noch einmal Preeti auf dem Satellitenhandy an. Nach dreißig oder vierzig Klingeltönen meldete sie sich. »Was ist?«
»Hör zu, wir brauchen hier Hilfe. Sonst sterben wir.«
»Was bildest du dir ein?«, zischte sie wütend. »Glaubst du, ihr seid die Einzigen?«
»Nein. Trotzdem brauchen wir Hilfe.«
»Wir brauchen alle Hilfe!«, schrie sie.
Frank überlegte. Schwer vorstellbar. Preeti war doch in Delhi. »Alles in Ordnung bei euch?«, fragte er endlich.
Keine Antwort. Preeti hatte abgeschaltet.
Seine Augen brannten wieder. Er wischte sich über die Lider und stieg hinauf, um die Eimer aus dem Bad zu holen. Inzwischen füllten sie sich langsamer; die Menschen waren ausgetrocknet. Ohne Wasservorräte mussten sie bald weg von hier, es blieb keine andere Wahl.
Als er von der Straße zurückkehrte und die Tür öffnete, hörte er plötzlich ein Geräusch und bekam einen Stoß in den Rücken. Drei junge Männer aus einer größeren Gruppe drückten ihn auf den Boden, einer mit einer eckigen Schusswaffe so groß wie sein Kopf. Frank starrte in die auf ihn zielende Mündung des Laufs, die das einzig Runde an dem schwarzen Metallding war. Die ganze Welt schrumpfte auf diesen kleinen Kreis zusammen. In seinen Ohren hämmerte das Blut, und er spürte, wie er am ganzen Körper erstarrte. Der Schweiß lief ihm über Gesicht und Hände.
»Keine Bewegung«, fauchte einer von denen, die sich zur Treppe wandten. »Wenn du dich bewegst, bist du tot.«
Schreie von oben begleiteten den Vormarsch der Eindringlinge. Die gedämpften Geräusche des Generators und des Klimageräts brachen ab. Dann drang nur noch das allgemeine Brausen der Stadt durch die offene Tür. Passanten starrten neugierig herein und setzten ihren Weg fort. Es waren nicht viele. Frank atmete so flach wie möglich. In seinem rechten Auge war ein heftiges Brennen, doch er schloss es einfach und schaute mit dem anderen entschlossen weg. Er hatte das Gefühl, sich wehren zu müssen, aber er wollte nicht sterben. Es war, als würde er das Ganze vom zweiten Stock aus beobachten, außerhalb seines Körpers und losgelöst von dessen Empfindungen. Nur das Brennen im Auge blieb.
Schließlich polterten die Kerle mit dem Generator und dem Klimagerät wieder die Treppe herab und hinaus auf die Straße. Die Männer, die Frank festhielten, ließen ihn los. »Wir brauchen das dringender als ihr«, bemerkte einer.
Der mit der Schusswaffe machte ein finsteres Gesicht, als er das hörte. Er zielte ein letztes Mal auf Frank. »Das ist alles eure Schuld.« Dann knallte die Tür zu, und sie waren verschwunden.
Frank stand auf und rieb sich die Arme, wo ihn die Männer gepackt hatten. Sein Herz raste noch immer, und ihm war speiübel. Von oben wagten sich einige Leute herunter und fragten, wie es ihm ging. Sie machten sich Sorgen um ihn, hatten Angst, er könnte eine Verletzung erlitten haben. Diese Aufmerksamkeit versetzte ihm einen Stich, und auf einmal überwältigten ihn seine Gefühle. Er hockte sich auf die unterste Stufe und vergrub das Gesicht in den Händen, weil ihn ein Weinkrampf schüttelte. Immerhin linderten die Tränen das Brennen in den Augen.
Schließlich rappelte er sich auf. »Wir müssen runter zum See. Dort ist es bestimmt kühler. Im Wasser und auf dem Gehsteig.«
Mehrere der Frauen wirkten nicht besonders glücklich, und eine von ihnen meldete sich zu Wort. »Sie haben sicher recht, aber die Sonne ist zu stark. Wir sollten bis zum Einbruch der Dunkelheit warten.«
Frank nickte. »Da ist was dran.«
Immer noch schwach und schwindlig, ging er mit dem Ladenbesitzer zu dessen kleinem Geschäft. Das Saunagefühl drosch auf ihn ein, und es kostete ihn viel Kraft, Lebensmittel und Getränke in Säcken zur Beratungsstelle zu bringen. Trotzdem half er beim Tragen von sechs Ladungen. So schlecht er sich auch fühlte, er hatte den Eindruck, stärker als die meisten anderen in der kleinen Gruppe zu sein. Bei einigen fragte er sich, wie lang sie sich wohl noch so dahinschleppen konnten. Keiner von ihnen sprach ein Wort oder schaute ihm in die Augen.
»Wir können später noch mehr holen«, erklärte der Ladeninhaber schließlich.
Der Tag zog sich in die Länge. Das Jammern hatte sich zu vereinzeltem Stöhnen abgeschwächt. Erschöpft von Hitze und Durst, regten sich die Leute nicht einmal mehr auf, wenn ihre Kinder starben. Rote Augen in braunen Gesichtern, die Frank anstarrten, wenn er zwischen ihnen herumstolperte und mithalf, Tote hoch aufs Dach zu bringen, wo sie voll der Sonne ausgesetzt waren. Natürlich war zu befürchten, dass sie dort oben verwesten, aber vielleicht würden sie auch einfach ausglühen und vertrocknen, weil es so heiß war. In dieser Glut konnten sich keine Gerüche halten außer dem der sengend feuchten Luft. Oder doch: Auf einmal stank es nach fauligem Fleisch. Niemand hielt sich mehr hier oben auf. Frank registrierte vierzehn eingewickelte Tote, Erwachsene und Kinder. Ein kurzer Blick über die Stadt zeigte ihm, dass andere Menschen mit ähnlichen Verrichtungen beschäftigt waren: schweigsam, in sich gekehrt, hastig, mit gesenktem Kopf. Niemand von ihnen schenkte der Umgebung Beachtung.
Unten waren Lebensmittel und Getränke bereits aufgebraucht. Frank zählte durch, so schwer es ihm auch fiel. Ungefähr zweiundfünfzig Leute in der Beratungsstelle. Eine Weile saß er auf der Treppe, dann trat er in die Abstellkammer und sah sich um. Er füllte seine Thermoskanne auf, trank ausgiebig, füllte wieder nach. Nicht mehr kühl, aber auch nicht heiß. Da standen noch die Benzinkanister; wenn nötig, konnten sie die Leichen verbrennen. Ansonsten ließ sich mit dem Benzin wenig anfangen, da sie keinen Generator mehr hatten. Das Satellitentelefon war noch aufgeladen, aber er wusste nicht, wen er hätte anrufen sollen. Seine Mutter vielleicht? Hi, Mom. Ich sterbe gleich.
Nein.
Quälend langsam krochen die Sekunden dahin, und dann beriet sich Frank mit dem Ladenbesitzer und dessen Bekannten. Murmelnd kamen sie überein: Zeit aufzubrechen. Sie weckten die anderen Leute, erklärten ihnen den Plan, halfen denen, die es nötig hatten, aufzustehen und die Treppe hinunterzusteigen. Einige schafften es nicht – ein Dilemma. Mehrere Alte wollten angeblich noch bleiben, solange sie gebraucht wurden, und später nachkommen. Sie verabschiedeten sich von den anderen, als wäre alles normal, doch ihre Augen verrieten sie. Viele weinten, als sie die Beratungsstelle verließen.
Im Nachmittagsschatten machten sie sich auf den Weg zum See. Heißer denn je. Kein Mensch auf den Straßen und Gehsteigen. Kein Klagegeschrei in den Häusern. Immer noch dröhnten einige Generatoren, surrten einige Klimageräte. Die bleierne Luft schien alle Geräusche zu verschlucken.
Am See bot sich ihnen ein verzweifelter Anblick. Es waren viele, viele Leute im Wasser, Kopf an Kopf um die Ufer herum, und auch weiter draußen, wo es wahrscheinlich tiefer war, lagen Menschen halb untergetaucht auf behelfsmäßigen Flößen. Doch nicht alle lebten noch. Von der Wasseroberfläche stieg ein giftiger Todeshauch auf, und der Gestank nach Verwesung stahl sich langsam in die versengten Nasenlöcher.
Sie einigten sich darauf, dass es vielleicht das Beste war, sich zuerst auf den niedrigen Uferweg zu hocken und die Beine ins Wasser zu hängen. So stapften sie zum Ende des Wegs, wo noch Platz war, und setzten sich einer neben dem anderen als geschlossene Gruppe hin. Der Beton unter ihnen strahlte noch immer die Hitze des Tages ab. Alle schwitzten, bis auf einige, die röter waren als die anderen und förmlich im Schatten des Spätnachmittags glühten. Als die Dämmerung hereinbrach, brachten sie diese Menschen in eine halb aufrechte Lage und halfen ihnen beim Sterben. Der See war heiß wie Badewasser, wärmer als die Körpertemperatur. Eindeutig wärmer als gestern, fand Frank. Und das lag ja auch nahe. Er hatte einmal gelesen, dass die Temperaturen steigen würden, bis die Meere kochten, wenn die Erde die gesamte auf sie einwirkende Sonnenenergie aufnehmen würde, statt genug davon zurückzuwerfen. Er konnte sich das Ganze lebhaft vorstellen. Der See fühlte sich an, als fehlten nur noch wenige Grad bis zum Siedepunkt.
Trotzdem wateten sie nach dem Sonnenuntergang und der kurzen Abenddämmerung alle in den See. Es fühlte sich einfach besser an. Ihr Körper forderte sie dazu auf. Sie konnten sich an einer besonders seichten Stelle niederlassen, den Kopf knapp über Wasser, und versuchen durchzuhalten.
Neben Frank saß ein junger Mann, den er einmal in der Rolle des Karna in einem Stück beim örtlichen Mela-Fest gesehen hatte, und wieder fühlte er einen Stich durch seine innere Leere jagen, als er sich an den Moment erinnerte, in dem Arjuna Karna mit einem Fluch wehrlos gemacht hatte und im Begriff war, ihn zu töten. In diesem Augenblick hatte der junge Mann triumphierend gerufen: »Das ist nur das Schicksal!«, und zu einem letzten Hieb ausgeholt, bevor er, getroffen von Arjunas unbezwingbarem Schwert, zu Boden sank. Jetzt schlürfte der junge Mann das Seewasser, die Augen groß vor Angst und Leid. Frank musste den Blick abwenden.
Nach und nach stieg ihm die Hitze zu Kopf. In seinem Körper wühlte das Verlangen, dieses zu heiße Bad hinter sich zu lassen. Er wollte endlich in den eiskalten See springen, der eigentlich zu jeder Sauna gehörte, und den glückseligen Kälteschock spüren, der einem den Atem verschlug, wie damals in Finnland. Die Menschen dort sprachen vom maximalen Temperaturunterschied, von einer blitzschnellen Änderung um hundert Grad, die sie unbedingt erleben wollten.
Doch dieser Gedankengang war wie das Kratzen an einer juckenden Stelle und machte alles nur noch schlimmer. Er kostete das heiße Wasser und konnte schmecken, wie faulig es war. Ihn schauderte bei der Vorstellung, was da alles im See herumschwappte. Trotzdem empfand er einen Durst, den er nicht stillen konnte. Heißes Wasser im Magen hätte bedeutet, dass es keine Zuflucht mehr gab und dass die Wärme innen und außen weit über der Temperatur lag, die für den Körper eines Menschen gesund war. Sie wurden hier gedünstet. Heimlich schraubte er seine Kanne auf und trank. Das Wasser darin war inzwischen lauwarm, aber nicht heiß, und es war sauber. Sein Körper lechzte danach, und er hörte nicht auf zu trinken, bis die Kanne leer war.
Die Leute starben immer schneller. Es gab keine Kühlung mehr. Alle Kinder waren tot, alle Alten waren tot. Statt Wehgeschrei brachten die, die noch lebten, nur ein Murmeln heraus. Wer noch konnte, zog Leichen aus dem See oder schob sie hinaus in die Mitte, wo sie wie Holz trieben oder untergingen.
Frank schloss die Augen und versuchte, die Stimmen um ihn herum zu ignorieren. Er lag, von seichtem Wasser bedeckt, da und konnte den Kopf auf den Betonrand des Wegs und den Schlamm darunter lehnen. Langsam sank er tiefer, bis er im Morast steckte und nur noch sein Gesicht in die sengende Luft ragte.
So verstrichen die Stunden. Oben waren lediglich die hellsten Sterne als verschwommene Flecken zu erkennen. Eine mondlose Nacht. Satelliten zogen vorüber, von Osten nach Westen, von Westen nach Osten, einmal sogar von Norden nach Süden. Die Menschen beobachteten sie, obwohl sie wussten, was mit ihnen hier unten geschah. Sie wussten es, aber sie taten nichts. Sie konnten nicht. Es war sinnlos, jedes Wort war sinnlos. Für Frank vergingen in dieser Nacht viele Jahre. Als sich der Himmel zu einem ersten Grau erhellte, das nach Wolken aussah und sich dann als klarer, leerer Himmel entpuppte, regte er sich schließlich. Seine Fingerspitzen waren ganz schrumpelig. Er war langsam gegart worden und war jetzt durch. Es fiel ihm schwer, den Kopf auch nur einen Zentimeter zu heben. Womöglich würde er hier ertrinken. Dieser Gedanke ließ ihn zusammenzucken. Er bohrte die Ellbogen in den Grund und stemmte sich hoch. Seine Extremitäten fühlten sich an wie gekochte Spaghetti, doch die Knochen bewegten sich wie von selbst. Er setzte sich auf. Die Luft war noch immer heißer als das Wasser. Er sah zu, wie der erste Sonnenschein die Wipfel der Bäume auf der anderen Seite des Sees berührte. Es schien, als würden sie in Flammen aufgehen. Den Kopf vorsichtig auf der Wirbelsäule balancierend, ließ er den Blick über die Szenerie wandern.
Alle waren tot.
2
ICHBINEINEGOTTHEITund bin keine Gottheit. Auf jeden Fall seid ihr meine Geschöpfe. Ich erhalte euch am Leben.
Die Glut in meinem Innern übersteigt alle Vorstellung, und doch bin ich außen noch heißer. Von meiner Berührung fangt ihr Feuer, obwohl ich jenseits des Himmels kreise. Der Takt meiner tiefen, langsamen Atemzüge lässt euch frieren und brennen, frieren und brennen.
Eines Tages werde ich euch auffressen. Noch ernähre ich euch. Doch hütet euch vor meinem Blick. Seht mich niemals an.
3
ARTIKEL14DESÜBEREINKOMMENSvon Paris der Vereinten Nationen über Klimaänderungen verpflichtete die Unterzeichnerstaaten zu einer regelmäßigen Bestandsaufnahme ihrer CO2-Emissionen und damit des gesamten globalen Kohlenstoffausstoßes in einem bestimmten Jahr. Die nächste Überprüfung war für 2023 angesetzt, danach sollten alle fünf Jahre weitere folgen.
Die erste »weltweite Bestandsaufnahme« lief nicht gut. Die Berichte waren uneinheitlich und unvollständig, und es war unverkennbar, dass die Emissionen trotz des Rückgangs von 2020 weit höher lagen als von den Vertragsparteien zugesichert. Die wenigsten Nationen hatten die selbst gesetzten Ziele erreicht, auch wenn diese nicht besonders ehrgeizig waren. Schon vor der Bestandsaufnahme 2023 hatten 108 Länder dieses Defizit erkannt und eine Verstärkung ihrer Anstrengungen versprochen. Allerdings handelte es sich um kleinere Nationen, die zusammen nur fünfzehn Prozent der globalen Emissionen verursachten.
Daher verwiesen einige Delegationen bei der Vertragsstaatenkonferenz im nächsten Jahr auf Artikel 16, Absatz 4, wo es hieß: Die VSK »fasst im Rahmen ihres Auftrags die notwendigen Beschlüsse, um seine wirksame Durchführung zu fördern. Sie … setzt die zur Durchführung dieses Übereinkommens für notwendig erachteten Nebenorgane ein.« Außerdem brachten sie Artikel 18, Absatz 1 ins Spiel, der es der VSK gestattete, neue Nebenorgane für die Durchführung des Übereinkommens zu schaffen. Unter diesen Nebenorganen hatte man bisher Ausschüsse verstanden, die sich nur bei den jährlichen VSK-Tagungen trafen, doch nun argumentierten einige Delegierte, dass angesichts der bisherigen Misserfolge ein neues Nebenorgan mit permanenten Aufgaben benötigt wurde, um den Prozess voranzutreiben.
So kam es, dass die Vertragsparteien bei der VSK 29 in Bogotá, Kolumbien, ein neues Nebenorgan zur Durchführung des Übereinkommens ins Leben riefen. Finanziert werden sollte dieses unter Berufung auf Artikel 8, in dem sich alle Vertragsparteien zur Anwendung des Internationalen Mechanismus von Warschau für klimabedingte Verluste und Schäden verpflichteten. In der Ankündigung hieß es: »Hiermit beschließt die neunundzwanzigste Vertragsstaatenkonferenz, die als Tagung der Vertragsparteien des Klimaübereinkommens von Paris dient, die Bildung eines Nebenorgans, das in Zusammenarbeit mit der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe für Klimaveränderungen und allen Organisationen der Vereinten Nationen sowie den Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens von Paris für die zukünftigen Generationen der Welt eintreten wird, um deren in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte genannten Rechte durchzusetzen. Weiterhin erhält dieses neue Nebenorgan den Auftrag, sich für eine Verbesserung des gesetzlichen Status und den Schutz aller gegenwärtig und zukünftig existierenden Lebewesen einzusetzen, die nicht für sich sprechen können.«
Ein Journalist bezeichnete diese neue Behörde als Zukunftsministerium, und dieser Name setzte sich rasch durch. Sie wurde im Januar 2025 in Zürich gegründet.
Kurz darauf wurde Indien von der großen Hitzewelle heimgesucht.
4
ÜBERDEMGELÄNDEderEidgenössischen Technischen Hochschule zieht sich Zürich bis hinauf zu einem Wald auf dem Zürichberg, der eine Flanke des Orts bildet. Der größte Teil der Stadt erstreckt sich an den Ufern der Limmat, die als Abfluss des Zürichsees beginnt und zwischen dem Zürichberg im Osten und dem Uetliberg im Westen nordwärts verläuft. Zwischen diesen zwei Hügeln ist es ziemlich flach, zumindest für die Verhältnisse des Landes, und fast ein Viertel der Schweizer hat sich hier in einer kompakten, attraktiven Stadt versammelt. Die Glücklichen, die auf der Anhöhe des Zürichbergs wohnen, meinen oft, dass sie den besten Platz ergattert haben mit dem Blick über das Zentrum, hinaus zum großen See im Süden und manchmal sogar bis zu den aufblitzenden Alpen. In der späten Nachmittagssonne kann diese Aussicht aus menschengemachten und natürlichen Aspekten eine Stimmung lichter Ruhe ausstrahlen. Ein guter Ort. Besucher finden ihn oft langweilig, doch die Einheimischen beschweren sich nicht.
An der Haltestelle Kirche Fluntern ungefähr auf halber Höhe des Zürichbergs kann man aus einer blauen Trambahn aussteigen und auf der Hochstraße in nördlicher Richtung an der alten Kirche mit Turm und großer Uhr vorbeispazieren, deren Glocke jede Stunde schlägt. Nebenan findet man das Büro des Zukunftsministeriums. Es liegt nur wenige Gehminuten entfernt von der ETH mit all ihrem geotechnischen Fachwissen und nicht weit oberhalb der Niederlassungen der großen Schweizer Banken mit ihren riesigen Kapitalvermögen, die in keinem Verhältnis zur geringen Größe des Landes stehen. Diese Nachbarschaft ist kein Zufall; seit Jahrhunderten verfolgen die Schweizer das Ziel, durch weltweite Förderung von Frieden und Wohlstand die Stabilität ihres Landes zu gewährleisten. Sicherheit gibt es nur, wenn alle sicher sind, scheint die Devise zu lauten, und für dieses Projekt sind sowohl geotechnisches Fachwissen als auch große Geldmengen von hohem Nutzen.
Als es darum ging, wo diese neue, nach dem Übereinkommen von Paris beschlossene Institution ihre Zentrale haben sollte, wies Zürich mit Nachdruck darauf hin, dass Genf bereits Sitz zahlreicher UN-Behörden wie der Weltgesundheitsorganisation und infolgedessen stark überteuert war, und konnte sich nach einem heftigen Gerangel zwischen den Kantonen bei der Bewerbung durchsetzen. Die mietfreie Überlassung des Anwesens an der Hochstraße und mehrerer ETH-Gebäude war sicherlich einer von vielen Gründen dafür.
Die Leiterin des Ministeriums – Mary Murphy, eine Irin Mitte vierzig, ehemalige Außenministerin ihres Landes und davor Gewerkschaftsanwältin – war nicht im Geringsten überrascht, als sie beim Betreten ihrer Arbeitsräume mit einer Krise konfrontiert wurde. Die Nachricht von der tödlichen Hitzewelle in Indien hatte allgemeines Entsetzen ausgelöst, und man rechnete mit unmittelbaren Nachwirkungen. Nun war die erste davon eingetroffen.
Ihr Stabschef, ein kleiner, schmächtiger Mann namens Badim Bahadur, folgte Mary in ihr Büro. »Bestimmt hast du schon gehört, dass die indische Regierung Maßnahmen zum Strahlungsmanagement eingeleitet hat.«
»Ja, ich hab’s heute Morgen gesehen«, antwortete sie. »Haben sie genauere Einzelheiten genannt?«
»Sind vor einer halben Stunde reingekommen. Unsere Geoengineering-Leute sagen, wenn sie es machen wie geplant, dann wird es ungefähr die gleiche Wirkung haben wie der Ausbruch des Pinatubo 1991. Das hat ein, zwei Jahre lang zu einem weltweiten Temperaturabfall von ungefähr einem halben Grad Celsius geführt. Grund dafür war das Schwefeldioxid in der Aschewolke, die der Vulkan in die Stratosphäre gejagt hat. Für so einen Schwefeldioxidanstieg werden die Inder mehrere Monate brauchen, meinen unsere Leute.«
»Haben sie denn überhaupt die Kapazitäten dafür?«
»Für ihre Luftwaffe ist es wahrscheinlich machbar, ja. Jedenfalls können sie es versuchen, die nötigen Flugzeuge und Geräte haben sie. Im Wesentlichen müssen sie dafür bloß die Technik zur Luftbetankung umgestalten. Das Ablassen von Treibstoff ist für Flugzeuge ganz normal, das wird ihnen also nicht schwerfallen. Das Hauptproblem wird sein, möglichst hoch raufzukommen, dann ist es bloß noch eine Frage der Quantität, wie viele Einsätze sie brauchen. Bestimmt Tausende von Flügen.«
Mary zog ihr Telefon aus der Tasche und tippte auf den Namen Chandra. Die Leiterin der indischen Delegation für das Übereinkommen von Paris war eine gute Bekannte von ihr. In Delhi war es schon spät, doch sie unterhielten sich in der Regel immer um diese Zeit.
Als sie sich meldete, sagte Mary: »Chandra, hier ist Mary. Hast du eine Minute für mich?«
»Eine Minute, ja«, erwiderte Chandra. »Hier ist gerade viel los.«
»Kann ich mir vorstellen. Stimmt es, dass eure Luftwaffe einen Pinatubo vorbereitet?«
»Oder einen Doppel-Pinatubo, ja. Auf Empfehlung unserer Akademie der Wissenschaften und auf Anordnung unseres Premierministers.«
»Und was ist mit dem Übereinkommen?« Konzentriert auf die Stimme ihrer Kollegin, setzte sich Mary auf ihren Stuhl. »Du kennst doch den Wortlaut. Keine Eingriffe in die Atmosphäre ohne Beratung und Absprache.«
»Wir brechen den Vertrag«, bemerkte Chandra schlicht.
»Aber niemand hat eine Ahnung, was das für Auswirkungen haben wird!«
»Es wird sein wie nach dem Pinatubo-Ausbruch oder hoffentlich doppelt so stark. Und genau das brauchen wir.«
»Ihr könnt doch nicht sicher sein, dass es keine anderen Auswirkungen nach sich zieht, wenn …«
Chandra schnitt ihr das Wort ab. »Mary! Schluss jetzt. Ich weiß genau, worauf du hinauswillst. Sicher ist für uns in Indien bloß eins: Gerade sind Millionen von Menschen ums Leben gekommen. Wie viele genau, werden wir nie erfahren. Wir können nicht nachzählen. Möglicherweise sind es zwanzig Millionen. Begreifst du, was das bedeutet?«
»Ja.«
»Nein, du begreifst es nicht. Ich lade dich ein, schau es dir persönlich an. Das solltest du wirklich, damit du dir ein Bild machen kannst.«
Mary merkte, dass sie kaum Luft bekam. Sie schluckte. »Wenn du willst, dann komme ich.«
Langes Schweigen folgte. Schließlich sprach Chandra mit angespannter, erstickter Stimme weiter. »Danke, aber zurzeit haben wir so viel um die Ohren, da wären wir mit so einem Besuch vielleicht überfordert. Ich schick dir ein paar von unseren Berichten, da kannst du es nachlesen. Im Moment musst du vor allem wissen, dass wir hier Angst haben – und eine Riesenwut. Diese Hitzewelle haben nicht wir verursacht, sondern Europa, Amerika und China. Sicher, auch wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Menge Kohle verbrannt, aber das ist nichts im Vergleich mit dem Westen. Trotzdem haben wir das Abkommen unterschrieben. Und wir haben unsere Verpflichtungen eingehalten. Bloß sonst erfüllt niemand seine Zusagen, niemand leistet Zahlungen an die Entwicklungsländer, und jetzt noch diese Hitzewelle. Und schon nächste Woche könnte wieder eine kommen! Die Wetterlage hat sich kaum geändert.«
»Ich weiß.«
»Sicher, du weißt es. Alle wissen es, aber niemand tut was. Deswegen nehmen wir die Sache jetzt selbst in die Hand. Mit unseren Maßnahmen werden wir die weltweiten Temperaturen für ein paar Jahre senken, davon profitieren alle. Und vielleicht können wir dadurch die nächste Katastrophe dieser Art verhindern.«
»In Ordnung.«
»Wir brauchen deine Erlaubnis nicht!«, rief Chandra.
»Das habe ich gar nicht gemeint …« Mary merkte, dass die Verbindung abgebrochen war.
5
WIRBRACHENMITTANKLASTERNAUF. Für Benzin, für Wasser, für alles. Es war wie eine Fahrt ins Nichts. Ohne Strom funktionierten die Pumpen nicht, nichts funktionierte. Also machten wir uns in den Kraftwerken an die Arbeit, bevor wir uns um die Toten kümmerten. Helfen konnten wir ihnen sowieso nicht mehr, sie lagen, wo sie umgefallen waren. Und damit meine ich nicht bloß Menschen, sondern auch Tiere. Beim Anblick der vielen leblosen Kühe, Menschen, Hunde fiel jemandem das mit der Himmelsbestattung der Tibeter ein – die Leichen wurden einfach den Geiern überlassen. Und auch hier gab es tatsächlich Geier, die sich der Körper annahmen. Ganze Schwärme von Geiern und Krähen. Sie waren anscheinend hinterher eingeflogen. Manchmal war der Gestank entsetzlich, aber dann zogen wir weiter, oder der Wind drehte, und es ging wieder. Anscheinend war es zu heiß für Gerüche, die Luft war wie gebacken. Hauptsächlich roch es verbrannt. Und da brannte ja auch einiges. Als der Strom wieder lief, brachen östlich von Lucknow durch umgeknickte Leitungsmasten Buschfeuer aus. Am nächsten Tag kam Wind auf, und das Feuer breitete sich bis in die Ortschaften aus. Natürlich mussten wir zuerst die Brände bekämpfen. Und das bei Feinstaubmessungen von 1500 ppm.
Am Rand einer Stadt in der Nähe von Lucknow war ein See, aus dem wir pumpen konnten. Eine einzige Brühe, in der überall Leichen herumtrieben, es war furchtbar, trotzdem warfen wir den Ansaugschlauch hinein, weil wir das Wasser einfach brauchten. Starker Wind blies in unsere Richtung, und eines der Buschfeuer rollte direkt auf uns zu. Wir waren erleichtert, als die Pumpen nach und nach die Tankwagen füllten.
Dann hörte ich auf einmal ein Geräusch, so eine Art Kieksen. Zuerst dachte ich, es ist was in der Schlauchleitung. Doch es kam anscheinend vom Ufer, wo ein Gehweg am See entlangführte. Also lief ich rüber und schaute nach. Keine Ahnung, warum. Wahrscheinlich klang es irgendwie nach was Lebendem.
Er lag gegenüber dem Weg an ein Haus gelehnt. Hatte sich sein Hemd über den Kopf gezogen. Ich bemerkte, wie er sich bewegte, und rief nach den anderen. Dann ging ich hin. Es war ein Firangi mit braunem Haar und völlig abgeblätterter Haut. Wie verbrannt oder gekocht, ich weiß auch nicht – jedenfalls sah er aus wie tot, obwohl er sich schwach bewegte. Die Augen waren fast ganz zugeschwollen, aber mir war klar, dass er mich beobachtete. Als wir ihm schließlich halfen, sagte er kein Wort, gab keinen Laut mehr von sich. Seine Lippen waren aufgesprungen und blutig. Ich vermutete, dass er vielleicht die Stimme verloren hatte, weil er so durchgekocht war. Mit einem Löffel flößten wir ihm Wasser ein. Wir hatten Angst, ihm zu viel auf einmal zu geben. Wir informierten die Einsatzleitung, und kurz darauf waren dann die Ärzte da. Sie übernahmen die Sache und gaben ihm Infusionen. Er schaute einfach zu. Sah sich nach uns um, nach dem See. Und die ganze Zeit kam ihm kein Wort über die Lippen. Seine Augen waren bloß noch Schlitze und komplett rot. Er sah aus wie ein Irrer. Wie ein Wesen von einem anderen Stern.
6
NACHDERGROSSENINDISCHENHitzewelle kam es zu einem äußerst angespannten Krisentreffen der Unterzeichner des Übereinkommens von Paris. Die indische Delegation erschien in voller Stärke, und die Rede ihrer Leiterin Chandra Mukajee geriet zu einer schonungslosen Abrechnung mit der internationalen Gemeinschaft. Alle Nationen der Erde hatten das Abkommen unterschrieben, doch keine hatte sich daran gehalten. Versprochene Emissionssenkungen waren ebenso ausgeblieben wie Investitionen für eine Reduktion des CO2-Ausstoßes. Der Vertrag war in jeder Hinsicht ignoriert und unterlaufen worden. Ein Manöver ohne Substanz, ein Witz, eine Lüge. Und nun hatte Indien dafür bezahlt. Bei der Hitzewelle hatten mehr Menschen ihr Leben verloren als im gesamten Ersten Weltkrieg, und das alles in einer Woche und in einer einzigen Region der Erde. Der Makel dieses Verbrechens war unauslöschlich.
Niemand brachte es über sich, darauf hinzuweisen, dass auch Indien seine Ziele nicht erreicht hatte. Denn natürlich wussten alle, dass Indien weit hinter allen entwickelten Ländern der westlichen Welt landete, wenn man den Gesamtausstoß im Lauf der Geschichte zusammenrechnete. Zur Bekämpfung der Armut, unter der große Teile der indischen Bevölkerung noch immer litten, hatte die Regierung des Landes die Stromkapazitäten so rasch wie möglich und auch so billig wie möglich ausbauen müssen, weil man schließlich in einer vom Markt bestimmten Welt lebte. Ohne ausreichende Rendite hätten ausländische Anleger nicht investiert. Also hatten sie Kohle verbrannt. Wie alle anderen bis vor einigen Jahren. Und jetzt, nachdem alle anderen durch den Einsatz von Kohle genug Kapital für einen Wechsel zu sauberen Energien angesammelt hatten, wollte man Indien das Gleiche vorschreiben. Indien sollte diesen Schritt ohne jede finanzielle Hilfe machen. Den Gürtel enger schnallen und den Weg der Austerität einschlagen; als Arbeiterklasse für die Bourgeoisie der entwickelten Welt stumm leiden, bis bessere Zeiten kamen. Bloß dass diese besseren Zeiten nie kommen würden. Dieses Spiel war jetzt vorbei, die einseitigen Regeln galten nicht mehr. Zwanzig Millionen Menschen waren gestorben.
Die Gäste im großen Saal des Zürcher Kongresshauses saßen stumm da. Dieses Schweigen war nicht das Gleiche wie die Minute um Minute währende Stille, mit der man der Opfer gedacht hatte. Jetzt war es ein Schweigen der Scham, der Verwirrung, der Bestürzung, des Schuldbewusstseins. Die indische Delegation hatte alles gesagt und wollte nichts mehr hinzufügen. Zeit für eine Erwiderung, eine Reaktion; doch sie kam nicht. Eine Antwort war nicht möglich. Das Ganze war, was es war: Geschichte, der Albtraum, aus dem man nicht erwachen konnte.
Schließlich stand die aktuelle Präsidentin der Organisation für die Durchführung des Übereinkommens von Paris auf und ging zum Podium. Die Frau aus Simbabwe umarmte Chandra kurz und nickte den anderen Indern kurz zu. Dann trat sie ans Mikrofon.
»Es ist klar, dass wir es besser machen müssen. Der Vertrag von Paris wurde geschlossen, um genau solche Tragödien zu vermeiden. Wir leben heute alle in einem einzigen Weltdorf. Wir teilen Luft und Wasser miteinander, und deshalb ist das eine Katastrophe, die uns alle betrifft. Weil wir sie nicht ungeschehen machen können, müssen wir sie irgendwie zum Guten wenden, wenn wir nicht wollen, dass die dafür verantwortlichen Verbrechen ungesühnt bleiben und weitere solche Katastrophen geschehen. Also müssen wir handeln. Wir müssen die Klimasituation endlich ernst nehmen und sie als die Realität begreifen, der sich alles andere unterzuordnen hat. Wir müssen unserem Wissen und unserem Gewissen folgen.«
Alle nickten. Applaudieren durften sie nicht, nicht jetzt, aber nicken konnten sie. Immerhin konnten sie die Hände heben, manche mit geballter Faust, und so ihren Willen zum Handeln bekunden.
So weit war alles schön und gut. Ein berührender Moment, vielleicht sogar ein denkwürdiger. Doch schon bald darauf steckten sie wieder mitten in ihrem üblichen Gefeilsche um nationale Interessen und Verpflichtungen. Die Katastrophe war in Indien passiert, noch dazu in einer Region, die Ausländer nur selten besuchten und die dem Vernehmen nach sehr heiß, überbevölkert und arm war. Wahrscheinlich würden solche Ereignisse am häufigsten zwischen dem südlichen und nördlichen Wendekreis und auch knapp außerhalb dieser Linien auftreten. Ungefähr zwischen dreißig Grad nördlicher und dreißig Grad südlicher Breite: also in den ärmsten Regionen der Welt. Natürlich war außerhalb dieses Gürtels ebenfalls mit Hitzewellen zu rechnen, doch bei Weitem nicht so häufig und nicht so verheerend. Im Grunde handelte es sich also um ein regionales Problem. Und solche Probleme gab es überall. Daher gingen viele Staaten und ihre Regierungen nach den Begräbnissen und den Bekundungen tiefer Betroffenheit wieder zur Tagesordnung über. Und überall auf der Welt wurde weiter CO2 ausgestoßen.
Eine Weile sah es so aus, als würde es mit der großen Hitzewelle so laufen wie mit den Schusswaffenmassakern in den USA – von allen beklagt und verurteilt und dann sofort wieder vergessen oder verdrängt vom nächsten, bis sie zum täglichen Trommelfeuer, zur neuen Normalität wurden. Es schien durchaus möglich, dass auch dieses Ereignis, die schlimmste Woche der Menschheitsgeschichte, vom Alltag eingeholt wurde. Und wie lange würde die Bezeichnung schlimmste Woche überhaupt zutreffen? Und was konnte man schon machen? Es war leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus: Das alte Sprichwort hatte Zähne bekommen und war zur grausamen Realität geworden.
Allerdings nicht in Indien. Bei den nächsten Wahlen erlitt die regierende rechtskonservative, nationalistische BJP eine vernichtende Niederlage. Man hielt ihr Inkompetenz und eine Mitschuld an der Katastrophe vor, weil sie die Nation an fremde Anleger verkauft, Kohle verbrannt, die Landschaft verwüstet und zur stetig wachsenden Ungleichheit beigetragen hatte. Auch der rechtsradikale RSS, der in der Regierungszeit der BJP einen starken Aufschwung erlebt hatte, wurde endlich als schädliche Kraft im Leben Indiens entlarvt und diskreditiert. Ins Amt gewählt wurde die neue Einheitspartei, die sich aus allen Religionen und Kasten, aus städtischen und ländlichen Armen sowie aus gebildeten Schichten rekrutierte. Die Katastrophe hatte sie zusammengeschweißt, und sie waren entschlossen zu einem echten Wandel. Der unausgeformte, zersplitterte Widerstand der Opfer verschmolz zu einer unaufhaltsamen Bewegung, und die alten Eliten verloren ihre Legitimität und Vorherrschaft. Die größte Demokratie der Welt schlug einen neuen Weg ein. Die Energieunternehmen des Landes wurden verstaatlicht, sofern das noch nicht geschehen war, und ein riesiges Heer von Arbeitern machte sich daran, Kohlekraftwerke stillzulegen und sie durch solche zu ersetzen, die mit Wind-, Sonnen- und Wasserkraft betrieben wurden. Man entwickelte Energiespeicher, die die weitverbreiteten Akkumulatoren verdrängen sollten. Überall in Indien kam es zu einem Umdenken. Die bis dahin eher halbherzigen Anstrengungen zur Eindämmung der schlimmsten Auswirkungen des Kastensystems wurden verstärkt und zur nationalen Priorität und neuen Realität gemacht, und es gab genügend Inder, die sich dafür einsetzten. Im ganzen Land fingen Regierungsbehörden aller Ebenen an, diese Veränderungen voranzutreiben.
Wenngleich dies von vielen bedauert wurde, kam es im Rahmen dieser neuen indischen Politik auch zu einer Radikalisierung mit einer klaren Botschaft an die Welt: Ändert euch mit uns, und zwar sofort, sonst ereilt euch der Zorn Kalis. Schluss mit billigen Arbeitern, Schluss mit dem Ausverkauf von indischen Ressourcen. Wenn die Länder, die das Übereinkommen von Paris unterzeichnet hatten – also alle –, tatenlos blieben, machten sie sich Indien zum Feind und mussten nicht nur mit dem Abbruch diplomatischer Beziehungen rechnen, sondern mit allem unterhalb der Schwelle einer offenen Kriegserklärung. Mit einem Wirtschaftskrieg zum Beispiel. Bald würde die Welt erleben, was das Sechstel ihrer Bevölkerung, das bisher ihre Arbeiterklasse gestellt hatte, leisten konnte. Die lange Ära postkolonialer Subalternität war zu Ende. Höchste Zeit, dass Indien die Bühne betrat, wie es zu Beginn der Geschichte geschehen war, und eine bessere Welt forderte. Und dann seinen Beitrag dazu leistete.
Ob diese aggressive Haltung sich als echte nationale Auffassung oder als Position einer radikalen Minderheit erweisen würde, blieb abzuwarten. Nach Meinung einiger hing das davon ab, ob die neue Regierung beabsichtigte, sich hinter die Drohungen des Kali-Lagers zu stellen und sie in die Tat umzusetzen. Krieg im Zeitalter des Internets, der Globalisierung, der Drohnen, der synthetischen Biologie und der künstlichen Pandemien war nicht das Gleiche wie der Krieg der Vergangenheit. Wenn sie es ernst meinten, konnte es hässlich werden. Selbst wenn nur die Kali-Fraktion der indischen Politik es ernst meinte, konnte es sehr, sehr hässlich werden.
Aber dieses Spiel stand auch anderen offen; tatsächlich stand es allen offen – nicht bloß den 195 Nationen, die das Übereinkommen von Paris unterzeichnet hatten, sondern auch den verschiedensten nicht staatlichen Gruppierungen bis hin zu einzelnen Akteuren.
Und so begann eine Zeit der Konflikte.
7
IMMERWENNIHMHEISSWURDE, bekam er Panikanfälle, und von der Panik wurde ihm noch heißer. Eine echte Feedbackschleife. Als sein Zustand halbwegs stabil war, flogen wir ihn nach Schottland aus. Dort hatte er schon einmal ein Jahr gelebt, und wir hofften, dass ihm die vertraute Landschaft irgendwie helfen würde. Nach Hause in die Staaten wollte er auf keinen Fall. Also brachten wir ihn nach Glasgow und achteten darauf, dass er es immer kühl hatte. Abends machten wir Spaziergänge mit ihm durch sein altes Viertel. Es war Oktober, mit viel Regen und rauem Seewind, wie üblich. Das tat ihm anscheinend gut.
Eines Abends war ich wieder mal auf den Straßen mit ihm unterwegs und ließ ihn vorangehen. Er sagte nur selten was, und ich bedrängte ihn nicht. Diesmal war er ein wenig gesprächiger als sonst. Er zeigte mir die Universität, wo er studiert hatte, Theater, die er besucht hatte. Anscheinend hatte er sich fürs Theater interessiert und hinter der Bühne mit Beleuchtung, Kulissen und Kostümen gearbeitet. Als wir zur Clyde Street kamen, wollte er zur Fußgängerbrücke laufen, die zum Südufer des Flusses führte.
In der Dunkelheit wirkte die Stadt vierschrötig und massiv. Die Häuser niedrig, nicht viel anders wohl als vor ein oder zwei Jahrhunderten. Irgendwie ein bisschen unheimlich, wie eine Stadt aus einer düsteren Fantasy-Saga. Er stand da und starrte hinab auf das schwarze Wasser, die Ellbogen auf der Brüstung.
Wir redeten über Verschiedenes. Einmal fragte ich ihn – wie schon oft –, ob er nicht nach Hause wollte.
Nein, antwortete er in scharfem Ton. Da möchte ich nie wieder hin. So eine finstere Miene hatte ich bei ihm noch nie gesehen. Nie mehr, wiederholte er.
Ich ließ das einfach mal stehen. Wollte nicht aufdringlich sein. So standen wir am Geländer. Es sah aus, als würde die Stadt langsam auf die Hügel zutreiben.
Warum habe ich überlebt?, fragte er auf einmal. Warum ich, als Einziger von all diesen Leuten?
Ich wusste nicht, was ich erwidern sollte. Du hast einfach überlebt, sagte ich. Wahrscheinlich warst du der Gesündeste dort. Vielleicht der Kräftigste, keine Ahnung. So kräftig bist du ja nicht, aber vielleicht kräftiger als die meisten Inder.
Er zuckte mit den Achseln. Eigentlich nicht.
Da hilft schon ein bisschen mehr Körpermasse. Die Kerntemperatur muss unter vierzig Grad bleiben. Da machen selbst ein paar Pfund was aus. Auch die bessere Ernährung und medizinische Versorgung, die man ein Leben lang gehabt hat. Und du bist Läufer, oder?
Ich war Schwimmer.
Das hat wahrscheinlich geholfen. Robusteres Herz, dünneres Blut. So was in der Art. Letztlich bedeutet das bloß, dass du der Stärkste dort warst, und nur die Stärksten haben überlebt.
Ich glaube nicht, dass ich dort der Stärkste war.
Na ja, vielleicht warst du weniger dehydriert? Oder länger im Wasser? Sie haben dich doch am See gefunden.
Ja. Irgendetwas an meinen Worten hatte ihn sichtlich aus der Fassung gebracht. Ich war … so weit wie möglich drin. Bloß mein Gesicht oben, damit ich Luft bekam. Die ganze Nacht. Aber das haben viele so gemacht.
Jedenfalls hat es zum Überleben gereicht, bemerkte ich. Du hast es geschafft. Glück gehabt.
Sag das nicht.
Hab’s nicht so gemeint. Es war Zufall. Da ist immer Zufall im Spiel.
Er blickte auf die dunkle, geduckte Stadt mit ihren verstreuten Lichttupfern. Es war einfach Schicksal. Er presste die Stirn auf die Brüstung.
Ich legte ihm die Hand auf die Schulter. Schicksal, du hast recht.
8
MENSCHENVERBRENNENUNGEFÄHRVIERZIGGigatonnen – also vierzig Milliarden Tonnen – fossilen Kohlenstoff pro Jahr. Nach wissenschaftlichen Berechnungen können wir noch fünfhundert Gigatonnen verbrauchen, bis die durchschnittliche Erdtemperatur um zwei Grad Celsius höher steigt als zu Beginn der industriellen Revolution. So weit können wir sie in die Höhe treiben, so die Berechnungen, dann kommt es zu gefährlichen Auswirkungen auf die meisten Bioregionen der Erde, das heißt auch auf die Produktion von Nahrung.
Bis vor Kurzem wurde die Bedrohlichkeit dieser Auswirkungen von einigen in Zweifel gezogen. Doch schon jetzt bleibt 0,7 Watt pro Quadratmeter mehr Sonnenenergie im Erdsystem, als wieder abgestrahlt wird. Das läuft auf einen unaufhaltsamen Anstieg der Durchschnittstemperaturen hinaus. Und eine Feuchtkugeltemperatur von fünfunddreißig Grad ist für einen Menschen tödlich, selbst wenn er unbekleidet im Schatten sitzt; durch die Kombination aus Hitze und Feuchtigkeit kann der Schweiß die Wärme nicht mehr ableiten, und es kommt zum Tod durch Hyperthermie. Feuchtkugeltemperaturen von 34 Grad wurden bereits seit 1990 aufgezeichnet, einmal sogar in Chicago. Die Gefahr liegt also auf der Hand.
Fünfhundert Gigatonnen also. Dummerweise hat man bereits dreitausend Gigatonnen an in der Erde lagernden fossilen Brennstoffen ermittelt. Von den Konzernen, die diese Lagerstätten entdeckt haben, werden diese als Vermögen gelistet, und in den Ländern, in denen sie gefunden wurden, gelten sie als nationale Ressourcen. Nur ungefähr ein Viertel dieser Bodenschätze gehört privaten Unternehmen, der Rest ist im Besitz verschiedener Nationalstaaten. Der Nennwert der zweitausendfünfhundert Gigatonnen Kohlenstoff, die in der Erde bleiben sollten, liegt ausgehend vom aktuellen Ölpreis bei ungefähr tausendfünfhundert Billionen US-Dollar.
Es scheint durchaus denkbar, dass man diese zweitausendfünfhundert Gigatonnen Kohlenstoff eines Tages als verlorenes Vermögen betrachten wird, doch solange es noch möglich ist, werden einige Leute versuchen, den Anteil in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle zu veräußern oder zu verbrauchen. Nur so viel, dass sie ein, zwei Billionen verdienen, werden sie sich sagen – auf keinen Fall eine Menge, die uns in den Abgrund reißt. Ein kleiner Bruchteil. Die Menschen brauchen es doch.
Die neunzehn bedeutendsten Konzerne, die dafür infrage kommen, sind in der Reihenfolge abnehmender Größe: SaudiAramco, Chevron, Gazprom, ExxonMobil, National Iranian Oil Company, BP, Royal Dutch Shell, PEMEX, Petróleos de Venezuela, PetroChina, Peabody Energy, ConocoPhillips, Abu Dhabi National Oil Company, Kuwait Petroleum Corporation, Iraq National Oil Company, Total SE, Sonatrach, BHP Group und Petrobras.
Die Managemententscheidungen über das Handeln dieser Organisationen werden von ungefähr fünfhundert Leuten getroffen. Bestimmt alles gute Menschen. Patriotische Politiker, die sich um das Wohl der Bürger ihrer geliebten Nation sorgen; gewissenhafte, fleißige Unternehmensführer, die ihre Verpflichtungen gegenüber dem Vorstand und den Aktionären erfüllen. Überwiegend Männer und Familienväter; gebildet, mit den besten Absichten. Stützen der Gesellschaft. Großzügige Spender. Wenn sie am Abend ein klassisches Konzert besuchen, wird der düstere Ernst von Brahms’ vierter Sinfonie ihr Herz rühren. Sicher wollen sie nur das Beste für ihre Kinder.
9
INDEMMITTELALTERLICHENSTADTTEILNiederdorf an der Ostseite der Limmat unter den Türmen des Großmünsters, einer kargen Kathedrale mit Lagerhallencharakter nach Zwinglis Geschmack, gab es noch immer kleine, versteckte Bars, die mit ihrem spießigen Erscheinungsbild kaum Touristen anlockten. Nicht dass sich im November viele Touristen nach Zürich verirrten. Der Regen ging in Graupel über, und das alte schwarze Pflaster mit den versetzt angeordneten Kopfsteinen wurde rutschig. Mary Murphy spähte in eine breitere Straße, die zum Fluss führte; dort stand der Hafenkran, der in Wirklichkeit keiner war, sondern das Werk einer Künstlergruppe, die sich damit über die Allgegenwart von Kränen in Zürich mokierte.
In einer winzigen Bar steuerte sie auf ihren Stabschef Badim Bahadur zu, der, über ein Glas Whiskey gebeugt, etwas auf seinem Smartphone las.
»Was Neues aus Delhi?«, fragte sie, als sie sich zu ihm setzte.
»Morgen soll es losgehen.«
Sie nickte dem Kellner zu und deutete auf Badims Glas. Noch ein Whiskey. »Wie sind die Reaktionen?«
»Schlecht.« Er zuckte die Achseln. »Vielleicht wird uns Pakistan bombardieren, und wir schlagen zurück und lösen einen nuklearen Winter aus. Da wird der Planet wunderbar abkühlen!«
»Vielleicht haben die Pakistanis gar nichts gegen den Vorschlag. Eine Hitzewelle wie diese könnte dort jedem zum Verhängnis werden.«
»Das wissen sie natürlich. Sie hauen bloß aufs Blech. China genauso. Wir sind jetzt der Prügelknabe der Welt, nur weil wir tun, was notwendig ist. Wir werden massakriert, weil wir uns haben massakrieren lassen.«
»So ist es doch immer.«
»Ach ja?« Er schielte durchs Fenster nach draußen. »Ich merke jedenfalls nichts von großer Sympathie in Europa.«
»Die Schweiz ist nicht dasselbe wie Europa. Die Schweizer halten sich raus, wie immer. Und das nimmst du hier wahr.«
»Ist es im übrigen Europa so viel anders?«