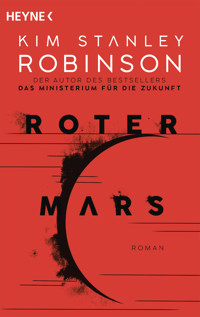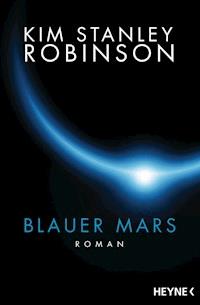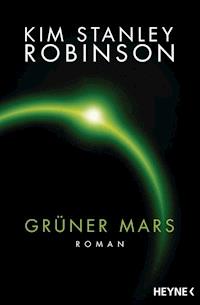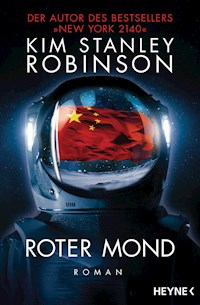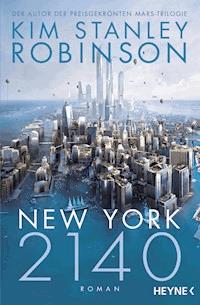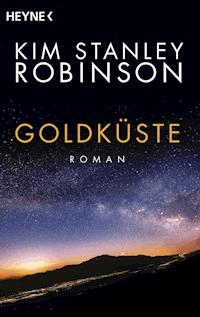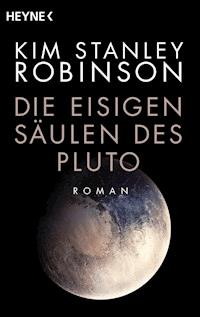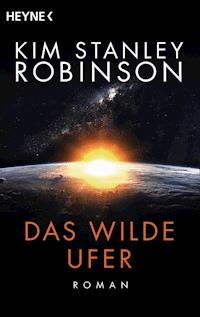
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Kalifornien-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Das große Abenteuer von der Wiederentdeckung Amerikas
Es gab einmal eine Zeit, da war Amerika die mächtigste Nation der Erde. Doch nach einem nuklearen Krieg ist das Land verwüstet, die großen Städte sind zerstört, die Bevölkerung ist nahezu ausgerottet. Die Völker der Vereinten Nationen wachen mit aller Strenge darüber, dass die wenigen, in kleinen Siedlungen verstreut lebenden Nachkommen der Kriegsgeneration nie mehr eine Chance bekommen, das Land wieder aufzubauen. Bis eines Tages in einem kleinen Fischerdorf an der kalifornischen Küste zwei Fremde auftauchen und in dem siebzehnjährigen Henry der Traum von einem wiedervereinten Amerika erwacht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
KIM STANLEY ROBINSON
DAS WILDE UFER
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Das Buch
Es gab einmal eine Zeit, da war Amerika die mächtigste Nation der Erde. Doch nach einem nuklearen Krieg ist das Land verwüstet, die großen Städte sind zerstört, die Bevölkerung ist nahezu ausgerottet. Die Völker der Vereinten Nationen wachen mit aller Strenge darüber, dass die wenigen, in kleinen Siedlungen verstreut lebenden Nachkommen der Kriegsgeneration nie mehr eine Chance bekommen, das Land wieder aufzubauen. Bis eines Tages in einem kleinen Fischerdorf an der kalifornischen Küste zwei Fremde auftauchen und in dem siebzehnjährigen Henry der Traum von einem wiedervereinten Amerika erwacht …
Der Autor
Kim Stanley Robinson wurde 1952 in Illinois geboren, studierte Literatur an der University of California in San Diego und promovierte über die Romane von Philip K. Dick. Mitte der Siebzigerjahre veröffentlichte er seine ersten Science-Fiction-Kurzgeschichten, 1984 seinen ersten Roman. 1992 erschien Roter Mars, der Auftakt der Mars-Trilogie, die ihn weltberühmte machte und für die er mit dem Hugo, dem Nebula und dem Locus Award ausgezeichnet wurde. Kim Stanley Robinson lebt mit seiner Familie in Kalifornien.
Von Kim Stanley Robinson sind im Heyne-Verlag folgende Romane lieferbar:
2312, Schamane, Roter Mars, Grüner Mars, Blauer Mars, Aurora, Das wilde Ufer, Goldküste, Pazifische Grenze, Die eisigen Säulen des Pluto, Sphärenklänge.
www.diezukunft.de
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Titel der Originalausgabe
THE WILD SHORE
Aus dem Amerikanischen von Michael Kubiak
Überarbeitete Neuausgabe
© Copyright 1984 by Kim Stanley Robinson
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Thomas Menne
ISBN 978-3-641-20870-7V002
Teil eins
I
»Von Grabschändung kann überhaupt keine Rede sein«, erklärte Nicolin. »Wir graben lediglich einen Sarg aus und montieren das ganze Silber ab. Wir machen ihn gar nicht auf. Dann graben wir ihn wieder ein, wie es sich gehört – was ist daran denn so schlimm? Die silbernen Handgriffe würden über kurz oder lang sowieso in der Erde verrotten.«
Wir fünf ließen uns das durch den Kopf gehen. Kurz vor Sonnenuntergang schimmern die Felswände am Eingang unseres Tales bernsteinfarben, und unten auf dem breiten Strand werfen die Treibholzhaufen ihre Schatten bis zu den Sandsteinriesen am Fuß der Klippen. Jedes Stück verwitterten Holzes hätte ein Grabkreuz sein können, aufgeweicht und ausgebleicht, wie es war, und ich stellte mir vor, wie ich die Erde darunter aufgrub, um nach irgendwelchen Schätzen zu suchen.
Gabby Mendez schleuderte einen Stein hinter einer vorbeisegelnden Möwe her. »Und warum soll ausgerechnet das keine Grabschändung sein?«, wollte er von Nicolin wissen.
»Die Leiche muss entweiht werden, damit eine Grabschändung daraus wird.« Nicolin zwinkerte mir zu; bei solchen Sachen war ich stets sein Partner. »Und das tun wir nun mal nicht. Wir suchen nicht nach Manschettenknöpfen oder Gürtelschnallen, wir entfernen keine Ringe und keine Goldzähne, nichts dergleichen!«
»Igittigitt.« Kristen Mariani schüttelte sich.
Wir befanden uns auf dem höchsten Punkt der Klippen oberhalb der Flussmündung – Steve Nicolin und Gabby, Kristen und Mando Costa, Del Simpson und ich – alles alte Freunde, gemeinsam aufgewachsen und nun wie so oft am Ende eines Tages in einer heftigen Diskussion und voller kühner Pläne … Letzteres war eine Spezialität von Nicolin und mir. Unter uns an der ersten Biegung des Flusses sahen wir die Fischerboote, die man aufs Land hinaufgezogen hatte. Es war ein gutes Gefühl, im Kreise meiner Freunde im warmen Sand zu sitzen, umweht von einer kühlen Brise, dabei die Sonne zu beobachten, wie sie sich den weißen Bergspitzen näherte, und gleichzeitig zu wissen, dass die Arbeit für heute erledigt war. Ich fühlte mich ein wenig schläfrig. Gabby schleuderte einen weiteren Stein hinter den Möwen her, die das Wurfgeschoss jedoch nicht beachteten und in einem dichten Schwarm nicht weit von den Booten landeten und sich um Fischköpfe balgten.
»Himmel, mit so viel Silber wären wir die Könige beim nächsten Tauschtreff«, fuhr Nicolin fort. »Und Königinnen«, sagte er zu Kristen, die heftig nickte. »Wir könnten alles, was wir wollen, gleich zweimal kaufen. Oder eine Reise entlang der Küste unternehmen. Oder ins Landesinnere vordringen. Praktisch alles tun, wozu wir Lust haben.«
Und nicht, was einem der Vater zu tun vorschreibt, dachte ich bei mir. Aber ich spürte wohl den Reiz, der von seinen Worten ausging, das gebe ich offen zu.
»Woher willst du wissen, dass ausgerechnet der Sarg, den du mühsam ausgraben willst, Silberbeschläge hat?«, fragte Gabby mit skeptischer Miene.
»Du hast doch sicher gehört, was der alte Mann über die Beerdigungen von früher erzählt hat«, entgegnete Nicolin unwirsch. »Henry, sag du es ihm.«
»Damals hatten sie vor dem Tod eine völlig unnatürliche und übertriebene Angst«, erklärte ich in einem Ton, als wäre ich eine Kapazität auf diesem Gebiet. »Deshalb veranstalteten sie großartige Begräbnisfeierlichkeiten, um von dem abgelenkt zu werden, was wirklich geschah. Tom meint, eine solche Beerdigung kostete mehr als fünftausend Dollar!«
Steve nickte mir beipflichtend zu. »Er meint, dass jeder Sarg, der in die Erde gelassen wurde, dick mit Silber beschlagen war.«
»Er glaubt auch, dass Menschen auf dem Mond gelandet sind«, hielt Gabby ihm entgegen. »Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dort oben nach Fußabdrücken Ausschau halte.« Doch ich hatte ihn schon fast überzeugt; er wusste, dass man Tom Barnard, der uns das Lesen und Schreiben beigebracht hatte (jedenfalls Steve, Mando und mir), gar nicht erst groß bitten musste, damit er auf den Reichtum der alten Zeiten zu sprechen kam.
»Demnach folgen wir also dem Freeway bis zu den Ruinen«, fuhr Nicolin fort, »und suchen uns einen besonders auffälligen Grabstein auf einem Friedhof, und schon sind wir am Ziel.«
»Einen Grabstein mit Diamantenschmuck, was?«, fragte Gabby spöttisch.
»Tom hat gesagt, wir sollten nicht dorthin gehen«, erinnerte Kristen uns.
Nicolin warf den Kopf nach hinten und lachte. »Der hat doch bloß Angst.« Er wurde wieder ernst. »Ist ja auch verständlich, nach dem, was er durchgemacht hat. Aber dort draußen gibt es nichts außer den Trümmerratten, und die kommen nachts nicht raus.«
Ganz sicher konnte er sich da auch nicht sein, da wir bisher weder bei Tag noch bei Nacht dort herumgeschlichen waren; aber ehe Gabby ihn darauf festnageln konnte, krähte Mando: »Nachts?«
»Klar!«, rief Nicolin.
»Ich hab gehört, die Aasjäger warten dort nur auf einen, um ihn aufzufressen«, sagte Kristen.
»Denkst du, dein Vater gibt dir tagsüber frei vom Hacken und Unkrautjäten?«, fragte Nicolin Mando. »Bitte sehr, dasselbe gilt für uns alle, für den ein oder anderen sogar noch mehr. Diese Truppe muss ihren Geschäften eben nachts nachgehen.« Er senkte die Stimme: »Das ist sowieso die beste Zeit, um auf Friedhöfen Gräber zu schänden.« Dann lachte er schallend, als er sah, wie Mando sein Gesicht verzog.
»Gräber schänden kann man am Strand auch tagsüber«, sagte ich mehr zu mir selbst.
»Ich könnte die Schaufeln besorgen«, bot Del an.
»Und ich könnte eine Laterne mitbringen«, sagte Mando schnell, um zu zeigen, dass er keine Angst hatte. Und plötzlich diskutierten wir über einen Plan. Ich spitzte die Ohren und begann der Diskussion etwas aufmerksamer zu folgen. Nicolin und ich hatten schon früher die ein oder andere Aktion geplant: zum Beispiel im Hinterland einen Tiger in einer Falle zu fangen oder auf dem Betonriff nach versunkenen Schätzen zu tauchen oder das Silber aus den alten Eisenbahnschienen herauszuholen, indem wir sie schmolzen. Doch die meisten dieser Ideen erwiesen sich im Laufe unserer Gespräche aus rein praktischen Gründen als undurchführbar, und wir ließen sie fallen. Sie blieben reine Träumerei. Aber was diesen speziellen Plan anging, so brauchten wir nichts anderes zu tun, als in die Ruinen zu schleichen – was wir eigentlich sowieso schon immer vorgehabt hatten – und zu graben. Deshalb berieten wir, in welcher Nacht die Aasjäger mit einer besonders hohen Wahrscheinlichkeit nicht aus ihren Löchern herauskommen würden (bei Vollmond, wie Nicolin unserem ängstlichen Mando versicherte, wenn die Gespenster zu sehen wären), wen wir zum Mitkommen auffordern könnten, vor wem wir unser Unternehmen geheim halten müssten, wie wir die silbernen Handgriffe zu tauschfähigen Scheiben zerschneiden könnten und so weiter.
Dann umspülte der Ozean den roten Saum der Sonne, und es wurde merklich kälter. Gabby erhob sich und massierte seinen Hintern und erzählte uns dabei von dem Wildbraten, den es bei ihm heute Abend zu essen geben sollte. Wir anderen standen ebenfalls auf.
»Wir werden diese Sache tatsächlich durchziehen«, sagte Nicolin eindringlich. »Und bei Gott, ich bin dazu jederzeit bereit.«
Als wir unseren Versammlungsort verließen, ließ ich mich etwas zurückfallen und folgte der Felskante. Weiter draußen am breiten Strand sammelte sich das Wasser der zurückweichenden Flut in silbernen Teichen, die mit einem roten Schimmer gesäumt war – jeder einzelne kleine Tümpel ein Abbild des unendlichen Ozeans, dessen Brandung sich donnernd am Strand brach. Auf meiner anderen Seite befand sich das Tal, unser Tal, das sich in die Berge hineinwand, die dem Meer und seinem Toben Einhalt geboten. Die Bäume des Waldes, der die Hügel bedeckte, ließen ihre Äste im abendlichen Seewind hin und her schwingen, und das Grün des Spätfrühlings erhielt durch das Licht der untergehenden Sonne einen pollenfarbenen Schimmer. Meilenweit erstreckte sich der Wald entlang der sich windenden Küste, Föhren und Fichten und Tannen, die an die Behaarung eines lebendigen Wesens erinnerten, und als ich so dahinschritt, spürte ich den Wind auch durch meine Haare streichen. An den zerklüfteten Berghängen waren keine Zeichen menschlicher Anwesenheit zu erkennen (obwohl es sie dort gab); dort gab es nichts als hohe und kleine Bäume, Redwood und Fichten und Eukalyptus, verschmolzen zu grünen Berghängen, die sich ins Meer ergossen, und als ich über die bernsteinfarbenen Felsen des Kliffs wanderte, war ich glücklich. Ich hatte nicht die leiseste Vorahnung, dass meine Freunde und ich einem Sommer entgegengingen, der … nun, der uns verändern sollte. Jetzt, da ich diesen Bericht über jene Monate niederschreibe, mitten im härtesten Winter, den ich je erlebte, ist dies alles glücklicherweise Vergangenheit, und ich erkenne, dass jener Ausflug mit dem Ziel, nach Silber zu suchen, irgendwie der Anfang war – nicht so sehr wegen dem, was geschah, als vielmehr wegen all der Dinge, die nicht geschahen, auch wegen der vielfältigen Täuschungen, denen wir unterlagen. Wegen der Erfahrungen, die wir dabei machten. Ich war hungrig, muss man wissen, nicht nur nach Essbarem (das war ein konstanter Zustand), sondern nach einem Leben, das aus mehr bestand als Fischefangen, Feldarbeit und Fallenstellen. Und Nicolin war noch hungriger als ich.
Aber ich greife meiner Geschichte vor. Als ich die steile Sandsteinrampe zwischen Wald und Meer hinunterschlenderte, hatte ich keine Vorahnung von dem, was kommen würde, noch schenkte ich den Warnungen des alten Mannes irgendwelche Beachtung. Ich war ganz einfach nur aufgeregt bei dem Gedanken an ein großes Abenteuer. Als ich über den schmalen, südwärts führenden Pfad die kleine Hütte aufsuchte, die mein Vater und ich bewohnten, reizte der Geruch nach Tannen und salzigem Meer das Innere meiner Nase und machte mich trunken vor Hunger, und zufrieden stellte ich mir Silberstücke vor, so groß wie ein ganzes Dutzend Dimes. Allmählich dämmerte es mir, dass ich und meine Freunde zum ersten Mal in unserem Leben im Begriff waren, das in die Tat umzusetzen, was wir stets so prahlerisch geplant hatten – und bei diesem Gedanken kroch mir ein Schauer der Erwartung über den Rücken, und ich sprang auf dem Pfad von Wurzel zu Wurzel; denn ich war dabei, in das Territorium der Aasjäger vorzudringen, und hielt nördlich auf die Ruinen von Orange County zu.
In der Nacht, die wir für unser Vorhaben aussuchten, wallte Nebel vom Meer hoch und trieb im Licht eines zunehmenden Halbmonds, das den einzelnen Schwaden ein sanftes Leuchten verlieh, landeinwärts. Ich harrte an der Tür unserer Hütte aus und achtete nicht auf Pas Schnarchen. Ich hatte ihm bereits vor einer Stunde etwas vorgelesen, bis er einschlief, und nun lag er auf der Seite, und seine schwieligen Finger bedeckten die Narbe an der einen Kopfseite. Pa ist lahm und ein wenig einfältig, seit er mal mit einem Pferd zusammengestoßen ist, als ich noch ein Kind war. Meine Mutter hat ihm abends immer vorgelesen, bis sie dann starb, und danach schickte er mich zu Tom, damit ich weiterlernte. Dabei meinte er auf seine langsame, bedächtige Art, dass es für uns beide von Nutzen wäre. Ich nehme an, er hatte damit ganz recht.
Ab und zu wärmte ich meine Hände über den aschegrauen Kohlen im Herd. Die Hüttentür stand nämlich einen Spaltbreit offen, und es war kalt. Draußen wurde der große Eukalyptus vom Wind heftig gebeutelt, sodass er manchmal kaum mehr zu sehen war. Einmal glaubte ich, Gestalten darunter stehen zu sehen; dann trieb eine dichte Nebelbank auf das Haus zu, brachte den Geruch der Sümpfe an der Flussmündung mit, und als der Nebel sich verzogen hatte, stand der Baum wieder völlig alleine da. Ich wünschte, dass die anderen hoffentlich bald auftauchten. Neben Pas Schnarchen war da kein Geräusch außer dem leisen Rieseln des Nebels, der als Tau von den Blättern der Bäume auf unser Hausdach herabtropfte.
Huuhuuuu, huuhuuuu. Nicolins Ruf schreckte mich aus dem Halbschlaf hoch. Es war eine gute Imitation der großen Canyoneulen, obgleich die Eulen sich nur einmal im Jahr oder so in dieser Form bemerkbar machten. Wenn Sie mich fragen, dann meine ich, dass ein solcher Vogelschrei als Geheimzeichen irgendwie ungeeignet war. Immerhin war dieser Ruf besser als das Leopardenhusten, mit dem Nicolin sich ursprünglich bemerkbar gemacht hatte und welches vielleicht irgendwann dafür gesorgt hätte, dass er eine Kugel zwischen die Rippen bekam.
Ich huschte nach draußen und rannte den Pfad zum Eukalyptus hinab. Nicolin trug Dels beide Schaufeln auf der Schulter; Del und Gabby standen hinter ihm.
»Wir müssen Mando holen«, sagte ich.
Del und Gabby warfen sich bedeutsame Blicke zu. »Costa?«, fragte Nicolin.
Ich starrte ihn an. »Er wartet sicher auf uns.« Mando und ich waren jünger als die anderen drei – ich um ein Jahr, Mando um drei –, und ich fühlte mich manchmal so etwas wie verpflichtet, ein gutes Wort für ihn einzulegen.
»Sein Haus liegt sowieso am Weg«, erklärte Nicolin den anderen. Wir entschieden uns für den Weg am Fluss entlang bis zur Brücke, überquerten sie und stiegen auf dem Bergpfad zum Haus der Costas hoch.
Doc Costas unheimliches Ölfassbauwerk sah entfernt aus wie eine kleine schwarze Burg aus einem von Toms Büchern – wie eine dicke, fette Kröte und finsterer noch, als alle natürlichen Dinge im Nebel erschienen. Nicolin ließ seinen Geheimruf ertönen, und schon nach kurzer Zeit kam Mando heraus und gesellte sich zu uns.
»Dann wollt ihr es also wirklich noch heute Nacht hinter euch bringen?«, fragte er und versuchte blinzelnd den Nebel mit seinen Blicken zu durchdringen.
»Klar«, erwiderte ich schnell, ehe die anderen sein Zögern als Grund dafür nahmen, ihn nun doch zurückzulassen. »Hast du eine Laterne?«
»Hätte ich fast vergessen.« Er kehrte wieder in die Hütte zurück und holte eine. Als er wieder da war, begaben wir uns zum alten Freeway und marschierten auf ihm in nördlicher Richtung los.
Wir legten ein zügiges Tempo vor, um warm zu werden. Der Freeway erstreckte sich als zwei hellere Bänder im Nebel, die von Spalten und Rissen durchzogen waren, in denen schwarze Flechten wucherten. Schon bald überquerten wir den Felskamm, der das nördliche Ende unseres Tals markierte, und kurz darauf das schmale San Mateo Valley, das sich nach Norden an den Felskamm anschloss. Danach ging es bergauf und bergab durch die zerklüftete Hügellandschaft von San Clemente. Wir blieben dicht zusammen und redeten nicht viel. Rechts und links von uns standen Ruinen im Wald: Mauern aus Zementquadern, Dächer, die von skelettartigen Konstruktionen aufrecht gehalten wurden, verknotete Drahtknäuel, die sich von Baum zu Baum spannten – dazwischen Düsternis und völlige Stille. Doch wir wussten, dass die Aasjäger hier oben irgendwo hausten, und wir eilten so leise weiter wie die Geister, über die Del und Gab eine Meile vorher, als sie sich noch sicher und mutig fühlten, ihre Witze gemacht hatten. Eine feuchte Nebelzunge leckte über uns hinweg, als der Freeway in einen breiten Canyon abknickte, und wir konnten nichts weiter erkennen als die rissige Straßenoberfläche. Seltsam knarrende Laute drangen aus der dunklen, nassen Stille zu uns, ab und zu ein Rascheln und Tropfen, als würde etwas durch das Dickicht schleichen, etwas, das uns verfolgte, zum Beispiel.
Nicolin blieb stehen, um eine Abzweigung nach rechts zu untersuchen. »Hier muss es sein«, flüsterte er. »Der Friedhof liegt am Ende dieses Tales.«
»Woher weißt du das?«, fragte Gab mit seiner normalen Stimme, die furchtbar laut war.
»Ich war hier und hab ihn gefunden«, erwiderte Nicolin. »Was meinst du denn, woher ich das weiß?«
Wir folgten ihm und verließen den Freeway. Wir waren ausgesprochen beeindruckt, dass er sich ganz alleine hierher gewagt hatte. Noch nicht einmal ich wusste von dieser Stelle. Unten im Wald gab es fast mehr Gebäude als Bäume, und es waren große Bauwerke. Sie verfielen auf jede erdenkliche Art; Fenster und Türen waren ihnen wie Zähne ausgeschlagen worden, und in jeder Öffnung hatten sich Gräser und Sträucher festgesetzt; Wände neigten sich, Dächer bildeten auf dem Erdboden wüste Ziegelhaufen. Der Nebel folgte uns die Straße entlang und strich durch das Geäst der Bäume und brachte sie zum Schwingen, sodass es uns vorkam, als würden wir von Tausenden scharrender Füße verfolgt. Drahtleitungen hingen zwischen Pfählen, die manchmal ganz auf die Straße gekippt waren; wir mussten sie behutsam übersteigen, und keiner von uns berührte die Drähte.
Das Gebell eines Kojoten durchschnitt die triefnasse Dunkelheit, und wir alle erstarrten. War es ein Kojote oder ein Aasjäger? Aber kein weiterer Laut folgte, und so setzten wir unseren Weg fort, diesmal noch nervöser als vorher. Am Kopfende des Tales beschrieb die Straße einige Knicke und Kehren, und als wir die hinter uns gebracht hatten, befanden wir uns auf der von einem Canyon durchschnittenen Hochfläche, die früher einmal den oberen Teil von San Clemente ausgemacht hatte. Hier oben gab es Häuser, darunter sehr große, die in Reihen an den Straßen angeordnet waren wie Fische, die zum Trocknen auslagen, als hätte es hier zu viele Menschen gegeben, um jeder Familie einen anständigen Garten zuzugestehen. Viele von den Häusern waren nur noch Bruchbuden und von Unkraut überwuchert, einige waren vollständig verschwunden – es gab nur noch nackte Fußböden, aus denen Rohre und Leitungen aufragten wie Arme aus einem Grab. Aasjäger hatten hier früher gehaust und die Häuser nach und nach zu Feuerholz verarbeitet, um dann weiterzuziehen, sobald sie ihre provisorischen Heime verbrannt hatten; es war eine Praxis, von der ich schon gehört hatte, jedoch war ich noch nie zuvor mit den Ergebnissen konfrontiert worden und hatte auch dieses Übermaß an Zerstörung und Verschwendung noch nie mit eigenen Augen gesehen.
Nicolin blieb an einer Straßenkreuzung stehen, auf der man früher einmal ein Lagerfeuer unterhalten hatte. »Die haben ihre Straßen aber echt rechtwinklig gebaut«, stellte Del fest.
»Hier entlang«, sagte Nicolin.
Wir folgten ihm in nördlicher Richtung auf einer Straße, die am Rande des Plateaus parallel zur Küste des Ozeans verlief. Der Nebel unter uns erschien wie ein weiterer Ozean. So wanderten wir wiederum über einen Strand, an dem ab und zu weiße Wogen über uns hinwegspülten. Die Häuserreihe, die die Straße gesäumt hatte, hörte auf, und ein Zaun begann, der aus Steinpfeilern bestand, die durch Metallstreben verbunden waren. Auf der anderen Seite des Zauns war das wellige Plateau mit rechteckigen Steinen übersät, die aus dem hohen Gras herausragten: der Friedhof. Wegen des Nebels war es unmöglich, festzustellen, wo das Areal endete; jedenfalls schien es sich um einen enorm großen Friedhof zu handeln. Schließlich fanden wir eine Lücke im Zaun, stiegen hindurch und wanderten im hohen Gras zwischen Buschwerk und Grabsteinen weiter.
Sie hatten die Gräber genauso schnurgerade ausgerichtet wie ihre Häuser. Plötzlich blickte Nicolin zum Himmel auf und stieß seinen Kojotenschrei aus, yip yip yoo-ee-oo-ee-oo-eee, und gebärdete sich dabei wie ein verwilderter Hund.
»Hör auf«, schimpfte Gabby unwirsch. »Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Hund, der uns anbellt.«
»Oder Aasjäger«, fügte Mando ängstlich hinzu.
Nicolin lachte. »Freunde, wir stehen auf einer Silbermine, mehr nicht.« Er bückte sich, um die Inschrift auf einem Grabstein zu lesen; es war zu dunkel; er ging zum nächsten. »Seht mal, wie groß der ist.« Er tastete mit den Fingern die Inschrift ab. »Hier liegt demnach ein John Appleby, geboren 1919, gestorben 1984. Ein hübscher großer Stein, starb genau zur richtigen Zeit – hat wahrscheinlich in einem der großen Häuser unten an der Straße gewohnt – ganz bestimmt sehr reich, stimmt's?«
»Auf dem Grabstein müsste eigentlich noch viel mehr stehen«, wandte ich ein. »Das würde beweisen, dass er reich war.«
»Da steht aber noch mehr«, meldete Nicolin. »Geliebter Vater, glaube ich … und noch anderes. Sollen wir es hier versuchen?«
Für eine Weile sagte niemand etwas. Dann bequemte Gab sich zu einer Antwort. »Ob hier oder woanders, das ist doch egal.«
»Nicht ganz«, widersprach Nicolin. Er legte eine Schaufel beiseite und packte die andere mit beiden Händen. »Wir müssen erst mal das Gras entfernen.« Er begann damit, die Schaufel ins Erdreich zu stoßen und eine gerade Linie auszustechen. Gabby und Del und Mando und ich standen bloß da und schauten ihm zu. Er sah auf und bemerkte unsere Blicke. »Was ist?«, fragte er. »Ihr wollt doch auch was von dem Silber, oder etwa nicht?«
Also ging ich zu ihm hin und begann ebenfalls zu graben; ich hatte es eigentlich die ganze Zeit gewollt, doch irgendwie machte mich die Umgebung nervös. Als wir das Gras so weit entfernt hatten, dass das Erdreich zu Tage trat, begannen wir richtig zu graben. Nachdem wir uns so tief gewühlt hatten, dass wir bis zu den Knien im Loch standen, gaben wir außer Atem die Schaufeln an Gabby und Del weiter. Ich schwitzte leicht in dem dichten Nebel, doch ich kühlte schnell wieder ab. Nasse Lehmbrocken schmatzten unter meinen Füßen. Nicht lange, und Gabby meinte: »Hier unten wird es allmählich finster: macht mal lieber die Laterne an.« Mando holte sein Funkenrad aus der Tasche und schickte sich an, den Docht in Brand zu setzen.
Die Laterne spendete ein unangenehmes gelbes Licht, das mich blendete und mehr Schatten verursachte, als vorher da gewesen waren. Ich entfernte mich von unserem Ausgrabungsort, um meine Augen wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen und meinen Blutkreislauf in Gang zu bringen. Meine Arme waren mit Erde beschmiert, und ich war noch nervöser als vorher. Aus der Ferne betrachtet, erschien die Laternenflamme größer und ihr Licht schwächer, und meine Gefährten erschienen als schwarze Schattenrisse, von denen die beiden mit den Schaufeln bis zur Taille in der Grube standen. Ich gelangte an ein Grab, das geöffnet und dann so zurückgelassen worden war. Ich erschrak und rannte wieder dorthin zurück, wo unsere Laterne leuchtete.
Gabby sah zu mir hoch. Sein Kopf ragte kaum über den Erdhaufen neben der Grube hinaus. »Den haben sie aber tief eingegraben«, sagte er mit belegter Stimme. Er schleuderte wieder eine Ladung Erdreich nach oben.
»Vielleicht ist der hier schon ausgegraben worden«, äußerte Del eine Vermutung und blickte in das Loch hinunter zu Mando, der mit jeder Schaufel eine Handvoll Erde nach oben beförderte.
»Klar doch«, machte Nicolin sich über ihn lustig. »Vielleicht haben sie ihn auch lebendig begraben, und er ist aus eigener Kraft wieder herausgekrochen.«
»Meine Hände tun weh«, sagte Mando. Sein Schaufelstiel war lediglich ein kräftiger Ast, und seine Hände waren an derartige Arbeit nicht gewöhnt.
»›Meine Hände tun weh‹«, säuselte Nicolin. »Dann mach, dass du hier rauskommst!«
Mando kletterte hinaus, und Steve sprang in die Grube, um seinen Platz einzunehmen, und attackierte den Grund des Lochs, bis das Erdreich in hohem Bogen in den Nebel flog.
Ich hielt Ausschau nach den Sternen, doch ich fand keinen einzigen. Es schien schon recht spät zu sein. Mir war kalt, und ich hatte Hunger. Der Nebel wurde immer dichter; die Gegend im Umkreis war zwar noch recht gut zu erkennen, doch schnell senkte sich auch hier der Dunst herab, und nur wenige Meter von uns entfernt entstand eine Nebelwand – grellweiß und undurchdringlich. Wir befanden uns in einer riesigen weißen Blase, und am Rand dieser Blase waren Formen zu erkennen: lange Arme, Köpfe mit zwinkernden Augen, vorbeieilende Beinpaare …
Ein dumpfer Laut. Eine von Nicolins beidhändigen Schaufelattacken schien Erfolg gehabt zu haben. Nicolin hielt inne und starrte angestrengt nach unten. Vorsichtig stieß er wieder mit der Schaufel zu. »Wir sind da«, rief er und fuhr fort, Erde nach oben zu schleudern. Nach einer kurzen Weile meldete er sich wieder. »Bringt mal die Laterne an dieses Ende.« Mando hob sie hoch und hielt sie über die Grube. Im gelben Lichtschein sah ich die Gesichter meiner Gefährten, verschwitzt und von Schmutzstreifen durchzogen, das Weiße ihrer Augen unnatürlich groß. Meine Arme waren bis hinauf zu den Ellbogen voll Dreck.
Aber das war erst der Anfang. Nicolin begann zu fluchen, und wir erfuhren von ihm, dass unser Loch, gut fünf Fuß lang und drei Fuß breit, eben erst das Ende des Sarges berührt hatte. »Das blöde Ding liegt unter dem Grabstein!« Die Holzkiste steckte also noch immer in ihrem kompakten Lehmbett.
Wir berieten eine Zeitlang, was wir jetzt tun sollten, und Nicolin kam schließlich auf die Idee, den oberen Teil und die Seiten des Sarges freizulegen und ihn in die Grube zu ziehen, die wir ausgehoben hatten. Nachdem wir das Erdreich so weit entfernt hatten, wie unsere Arme reichen konnten, meinte Nicolin: »Henry, du hast bis jetzt von uns allen am wenigsten gegraben, und du bist lang und mager. Am besten kriechst du jetzt neben den Sarg und versuchst, ihn noch weiter freizukratzen.«
Ich protestierte zwar, doch die anderen meinten, ich sei genau der richtige Spezialist für diesen Job, und plötzlich fand ich mich auf dem Sarg liegend wieder, über mir eine dicke Lehmschicht, und damit beschäftigt, mich mit den bloßen Fingern ins Erdreich hineinzuwühlen und die Lehmbrocken hinter mich zu schieben. Lediglich eine endlose Kette von Flüchen, die meinen Geist ausfüllte, lenkte mich von dem ab, was genau parallel zu meinem Körper unter mir in der Holzkiste liegen musste. Die anderen wurden nicht müde, mich mit lauten Rufen anzufeuern wie zum Beispiel: »Wir gehen am besten schon mal nach Hause«, oder »Achtung, da kommt wer«, oder »Hast du nicht gemerkt, wie der Sarg sich bewegt hat.« Ich hielt diese Bemerkungen überhaupt nicht für besonders lustig. Schließlich konnte ich meine Finger um die obere Kante des Sarges schieben, und ich sah zu, dass ich aus dem Loch herauskam und mir die Erde aus den Kleidern klopfte.
»Henry, auf dich kann man sich wirklich verlassen«, lobte Steve mich, als er ins Grab sprang. Dann war er und schließlich auch Del an der Reihe, sich zwischen Sarg und Erdreich zu zwängen und die Holzkiste freizulegen. Dann begannen sie an dem Sarg zu zerren, und unter Keuchen und Ächzen ließ der Sarg sich lockern und rutschte schließlich in die Grube, die wir ausgehoben hatten, während Steve und Del sich völlig entkräftet daneben legten.
Der Sarg war aus schwarzem Holz und mit einem grünlichen Film bedeckt, der im Laternenlicht schimmerte wie Pfauenfedern. Gabby klopfte die Erde von den Griffen, dann wischte er die Beschläge auf dem Sargdeckel ab: alles Silber.
»Seht euch mal die Handgriffe an«, sagte Del. Es gab insgesamt sechs, auf jeder Seite drei, und sie glänzten so poliert und neu, als wären sie erst am vergangenen Tag und nicht schon vor sechzig Jahren vergraben worden. Ich entdeckte die Kerbe im Holz des Deckels, wo Nicolins Schaufel ihre erste Berührung mit dem Schatz gehabt hatte. »He, Mann«, sagte Mando. »Sieh dir lieber die silberne Pracht an.«
Und wir betrachteten den Schatz. Ich stellte mir unseren nächsten Tauschtreff vor, wo wir auftauchen würden, herausgeputzt wie Aasjäger in Pelzmänteln und Stiefeln und Federhüten und in Hosen, die uns vom Gewicht des Silbers in den Taschen jeden Moment von den Hüften zu rutschen drohten. Wir stimmten ein Triumphgeheul an, brüllten und schrien und schlugen uns gegenseitig auf den Rücken. Dann verstummten wir wieder und betrachteten erneut unseren Fund, dann kam wieder ein ausgelassener Freudentanz. Gabby rieb mit seinem Daumen über einen Handgriff, er zog die Nase kraus.
»He«, sagte er. »Hhmm …« Er griff nach der Schaufel, die neben ihm an der Grubenwand lehnte, und schlug damit gegen den Handgriff. Ein dumpfer Laut ertönte. Nicht wie Metall auf Metall. Und der Schlag hinterließ eine Kerbe im Handgriff. Gabby sah Del und Steve vielsagend an und bückte sich, um den Sachverhalt eingehender zu untersuchen. Er schlug erneut gegen den Handgriff. Und wieder klang es dumpf und hohl. Er strich mit der Hand darüber.
»Das ist kein Silber«, stellte er fest. »Das Zeug ist zerkratzt. Wahrscheinlich irgend so ein … irgendein Plastikmaterial, nehme ich an.«
»Verdammt noch mal«, fluchte Nicolin. Er sprang in das Loch und griff sich eine Schaufel; er attackierte damit den Beschlag auf dem Sargdeckel und hackte ihn in zwei Teile.
Nun, wir starrten wieder die Kiste an, aber diesmal rief niemand etwas.
»Dieser verdammte alte Lügner«, schimpfte Nicolin. Er schleuderte die Schaufel auf den Erdboden. »Er hat uns erzählt, jedes dieser Begräbnisse hätte ein Vermögen gekostet. Er sagte auch …« Er hielt inne; wir alle wussten, was der alte Mann gesagt hatte. »Er erzählte uns, alles wäre aus Silber.«
Er und Gabby und Del standen jetzt im Grab. Mando brachte die Laterne zum Grabstein und setzte sie nieder. »Das ist auch kein Grabstein, sondern nur eine Warntafel für Grabräuber«, meinte er, um unsere Laune etwas aufzubessern.
Nicolin hatte die Bemerkung gehört und funkelte ihn wütend an: »Sollen wir ihm dann wenigstens den Ring abnehmen?«
»Nein!«, schrie Mando auf, und wir alle mussten über ihn lachen.
»Sollen wir uns seinen Ring, seine Gürtelschnalle und seine Goldzähne holen?«, fragte Nicolin noch einmal mit einem Seitenblick zu Gabby. Mando schüttelte heftig den Kopf und sah aus, als würde er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Del und ich lachten; Gabby kletterte mit einem trübsinnigen Gesicht aus dem Loch heraus. Nicolin warf den Kopf in den Nacken und stieß ein kurzes, abgehacktes Lachen aus. Auch er stieg nun aus dem Grab. »Kommt, wir graben unseren Freund wieder ein, und dann nehmen wir uns den alten Mann vor.«
Wir schaufelten die Erde wieder zurück. Die ersten Brocken polterten mit einem hohlen Dröhnen auf den Sarg. Es dauerte nicht lange, bis das Loch wieder voll war. Mando und ich legten die ausgestochenen Grassoden wieder an Ort und Stelle, so gut wir konnten. Als wir damit fertig waren, sah unser Werk einfach schrecklich aus. »Sieht fast so aus, als hätte er sich noch hier unten gegen sein Schicksal gewehrt«, sagte Gabby.
Wir löschten die Laternenflamme und machten uns auf den Heimweg. Nebel strömte durch die leeren Straßen wie Wasser in einem Flussbett, und es war, als bewegten wir uns dicht unter der Oberfläche zwischen versunkenen Ruinen und schwarzem Seetang dahin. Draußen auf dem Freeway kam man sich nicht mehr so eingeengt vor, doch der Nebel fegte hart über die Straße, und es war kälter. So schnell unsere Beine es erlaubten, eilten wir nach Süden. Keiner von uns sagte ein Wort. Als wir uns aufgewärmt hatten, wurden wir ein wenig langsamer, und Nicolin begann zu reden. »Wisst ihr, dass sie damals solche silbrig aussehenden Plastikgriffe hatten, kann doch nur bedeuten, dass einige Zeit vorher die Menschen mit echten Silbergriffen an den Särgen beerdigt wurden – reichere Leute, oder Leute, die vor 1984 gestorben sind, oder wer sonst noch darin liegen mag.« Wir alle begriffen, dass dies nichts anderes war als der kaum verhüllte Vorschlag, schon in Kürze eine zweite Ausgrabungsexpedition zu unternehmen. Deshalb stimmte niemand dafür, wenngleich der Vorschlag, so gesehen, durchaus sinnvoll klang. Steve zeigte sich durch unser Schweigen beleidigt und stürmte vor uns her, bis er nur noch ein winziger Fleck im Nebel war. Wir hatten San Clemente fast hinter uns.
»Bloß ein gottverdammtes Plastikzeug«, sagte Gabby zu Del. Er begann zu lachen, heftiger und heftiger, bis er sich auf Dels Schulter stützen musste. »Haaa, haaa haaa haaa … wir haben uns also die Nacht um die Ohren geschlagen, um insgesamt fünf Pfund Plastik auszugraben. Plastik!«
Plötzlich zerschnitt ein Geräusch die Nacht – ein Heulen, ein an Gesang erinnernder greller Schrei, der tief anfing und immer höher und höher stieg und dabei immer lauter wurde. Kein lebendes Wesen konnte Ursache dieses Geräusches sein; es war etwas, das ich noch nie zuvor gehört hatte. Das Geräusch erreichte einen Höhepunkt an Lautstärke und Tonhöhe. Es war ein Schwingen zwischen zwei Tönen. Das Ganze erinnerte an die Todesschreie all jener, die durch Bomben ums Leben gekommen waren.
Wir lösten unsere dichte Formation auf und rannten einfach los. Der Lärm dauerte an und schien uns zu verfolgen.
»Was ist das?«, wollte Mando wissen.
»Aasjäger!«, zischte Nicolin. Und das Heulen schwoll an und war diesmal ganz nahe. »Lauft schneller!«, trieb Nicolin uns an. Die Risse im Straßenbelag hielten uns nicht auf; wir flogen geradezu darüber hinweg. Steine krachten hinter uns auf den Beton und auf das Bankett rechts und links vom Fahrdamm. »Verliert die Schaufeln nicht«, hörte ich Del rufen. Ich hob einen anständigen Felsbrocken auf und war irgendwie erleichtert, dass wir nur von Aasjägern gejagt wurden. Hinter mir nichts als Nebel, Nebel und dieses Geheul, doch aus diesem weißen Nichts kamen die Felsbrocken recht zahlreich herangeflogen. Ich zielte mit meinem Stein auf einen dunklen Schatten und rannte hinter den anderen her, gehetzt von einem Heulen, das mindestens von einem Tier, wenn nicht gar von einem Menschen stammen konnte. Doch über allem wogte der Nebel. »Henry!«, rief Steve. Die anderen waren mit ihm unten am Straßendamm. Ich sprang ihnen nach und brach durch die Büsche. »Sammelt Steine«, befahl Nicolin. Wir führten seinen Vorschlag aus, drehten uns um und schleuderten sie alle gleichzeitig zurück auf den Freeway. Als Antwort hörten wir ein wütendes Geschrei. »Wir haben einen erwischt!«, stellte Nicolin fest. Aber Genaues konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Wir kehrten wieder auf den Freeway zurück und rannten weiter. Das Kreischen blieb allmählich hinter uns zurück, und schließlich waren wir im San Mateo Valley angelangt und auf dem Weg zur Basilone Ridge über unserem Heimattal. Hinter uns erklang immer noch das Geschrei, nun aber viel schwächer und vom Nebel gedämpft.
»Das muss eine Sirene gewesen sein«, sagte Nicolin. »Sie nennen so ein Ding Sirene. Eine Lärmmaschine. Wir müssen Rafael danach fragen.« Die Steine, die wir aufgesammelt hatten, warfen wir eher symbolisch hinter uns und trabten dann nach Onofre hinein.
»Diese widerwärtigen Aasjäger«, stieß Nicolin hervor, als wir am Fluss entlangspazierten und allmählich zu Atem kamen. »Ich frage mich nur, wie die uns haben finden können.«
»Vielleicht haben sie einen Spaziergang gemacht und sind nur zufällig auf uns gestoßen«, vermutete ich.
»Das ist nicht sehr wahrscheinlich.«
»Nein.« Aber mir fiel keine einleuchtendere Erklärung ein, und Steve hatte auch nichts Besseres zu bieten. Zumindest war es auch nicht unwahrscheinlicher als dieser fürchterliche, unheilige Lärm.
»Ich gehe nach Hause«, sagte Mando, und in seiner Stimme schwang Erleichterung mit. Seine Stimme klang irgendwie seltsam – ängstlich vielleicht –, und ich fröstelte.
»Na schön, tu das. Wir schnappen uns diese Trümmerratten ein anderes Mal.«
Fünf Minuten später waren wir an der Brücke. Wir überquerten sie, und Gabby und Del gingen flussaufwärts weiter. Steve und ich blieben an der Weggabelung zurück. Er begann über die Nacht zu reden, er verfluchte die Aasjäger, den alten Mann und John Appleby gleich dazu, und es war nicht zu übersehen, dass sein Blut noch immer in Wallung war. Er hätte bis zum Sonnenaufgang reden können, doch ich war müde. Ich hatte nicht seine Energiereserven, und mir jagte auch in der Erinnerung dieser Lärm noch immer einen Schrecken ein. Sirene oder nicht, es klang mörderisch unmenschlich. Ich wünschte Steve eine gute Nacht und schlüpfte in meine Behausung. Pas Schnarchen verstummte kurz und setzte dann wieder ein. Ich brach mir ein Stück vom Brot für den folgenden Tag ab und schlang es hinunter. Dreck knirschte zwischen meinen Zähnen. Ich tauchte meine Hände in den Wascheimer und spülte sie ab, aber sie fühlten sich noch immer schmutzig an und stanken nach Grab. Ich gab meine Reinigungsversuche auf und legte mich, schmutzig wie ich war, auf mein Bett und war schon eingeschlafen, ehe ich noch richtig warm geworden war.
II
Im Traum erlebte ich wieder den Moment, als wir damit begannen, das offene Grab zuzuschaufeln. Erdklumpen kullerten auf den Sarg und erzeugten ein gespenstisches hohles Dröhnen; doch in meinem Traum war dieses Geräusch ein Klopfen aus dem Sarg, das lauter und verzweifelter wurde, je schneller sich die Grube wieder mit Erde füllte.
Pa weckte mich mitten aus diesem Albtraum: »Heute Morgen haben sie am Strand eine angespülte Leiche gefunden.«
»Häh?«, rief ich und sprang verwirrt aus dem Bett. Erschrocken wich Pa zurück. Ich beugte mich über den Wascheimer und spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht. »Was erzählst du da?«
»Ich habe gehört, dass man einen von diesen Chinesen gefunden hat. Du bist ja völlig verdreckt. Was ist mit dir los? Warst du heute Nacht schon wieder draußen?«
Ich nickte. »Wir bauen uns ein Versteck.«
Verwirrt und missbilligend schüttelte Pa den Kopf.
»Ich habe Hunger«, fügte ich hinzu und griff nach dem Brot. Dann nahm ich einen Becher vom Wandregal und tauchte ihn in den Trinkwassereimer.
»Wir haben nichts mehr außer Brot.«
»Ich weiß.« Ich brach einige Brocken von dem Laib ab. Kathryns Brot war gut, auch wenn es schon ein bisschen alt war. Ich ging zur Tür und öffnete sie, und das Dunkel unserer fensterlosen Hütte wurde von einem Keil gedämpften Sonnenlichts zerschnitten. Ich streckte meinen Kopf hinaus in die Luft; fahler Sonnenschein, die Bäume entlang des Flusses triefend nass. Im Innern der Hütte fiel das Licht auf Pas Nähtisch. Die alte Maschine glänzte von den langen Jahren ständigen Gebrauchs. Daneben stand der Herd, und darüber, gleich neben dem Ofenrohr, welches das Dach durchstieß, befand sich das Regal mit den Küchengeräten. Das und der Tisch, die Stühle, Kleiderschränke und Betten stellten unseren gesamten Besitz dar – die bescheidene Habe eines einfachen Mannes in einem einfachen Gewerbe. Nun, die Leute hatten es eigentlich gar nicht nötig, sich ihre Kleidung von Pa nähen zu lassen …
»Du läufst jetzt besser zu den Booten hinunter«, sagte Pa ernst. »Es ist schon spät, sicher sind sie schon dabei, abzulegen.«
»Hhmmph.« Pa hatte recht; ich war wirklich spät dran. Immer noch auf meinem Stück Brot kauend, zog ich Hemd und Schuhe an. »Viel Glück!«, rief Pa mir nach, als ich durch die Tür hinausstürmte.
Als ich den Freeway überqueren wollte, wurde ich von Mando, der aus der anderen Richtung kam, angehalten. »Hast du schon von dem Chinesen gehört, der an den Strand gespült wurde?«, wollte er wissen.
»Yeah! Hast du ihn gesehen?«
»Ja! Pa ging runter, um ihn sich anzusehen, und ich bin einfach mitgegangen.«
»Ist er erschossen worden?«
»Na klar. Vier Einschusslöcher, mitten in der Brust.«
»Mann!« Sehr viele wurden bei uns angetrieben. »Ich möchte nur gerne wissen, um was die da draußen so fanatisch kämpfen.«
Mando zuckte mit den Schultern. In dem Kartoffelfeld auf der anderen Straßenseite rannte Rebel Simpson hinter einem Hund her, der eine Kartoffel ausgegraben hatte. Dabei stieß sie wütende Beschimpfungen aus. »Pa ließ einmal verlauten, dass dort draußen eine Art Küstenwache die Leute von hier fernhält.«
»Ich weiß«, sagte ich. »Ich frag mich nur, ob das wirklich der Grund ist.« Große Schiffe tauchten ab und zu vor der langen Küste auf, gewöhnlich weit draußen am Horizont, manchmal auch etwas näher, und von Zeit zu Zeit wurden Leichen angetrieben, die von Kugeln durchlöchert waren. Doch was mich betraf, so war das alles, was wir über die Welt außerhalb unserer Grenzen sagen konnten. Wenn ich voller Neugier und Wissensdurst darüber nachdachte, wurden meine Neugier und mein Wissensdurst manchmal so übermächtig, dass ich fast in Wut geriet. Andererseits war Mando sicher, dass sein Vater (der nur nachplapperte, was der alte Mann von sich gab) wusste, was das alles zu bedeuten hatte. Er begleitete mich hinaus zu den Klippen. Draußen auf See wurde der Horizont von einem breiten Wolkenband überlagert; es war die tägliche Nebelbank, die sich später, wenn der Wind sich drehte, auf das Land zuwälzen würde. Unten, nahe der Flussmündung, luden sie Netze in ihre Boote. »Ich muss an Bord«, verabschiedete ich mich von Mando. »Bis nachher.«
Als ich die Klippen zum Strand hinuntergeklettert war, war man gerade damit beschäftigt, die Boote zu Wasser zu lassen. Ich gesellte mich zu Steve, der beim kleinsten Boot, das noch auf dem Sand lag, mit anpackte. John Nicolin, Steves Vater, stapfte vorüber und funkelte mich dabei wütend an. »Ihr beide übernehmt heute die Ruten. Zu etwas anderem seid ihr sowieso nicht nütze.« Ich reagierte nicht und behielt meinen gleichmütigen Gesichtsausdruck. Er entfernte sich und brüllte einem ablegenden Boot einen letzten Befehl zu.
»Weiß er, dass wir heute Nacht weg waren?«
»Yeah.« Steves Lippen kräuselten sich. »Ich bin über ein Trockengerüst gestolpert, als ich mich ins Haus schlich.«
»Hat es Ärger gegeben?«
Er drehte den Kopf, um mir eine Schwellung vor seinem Ohr zu zeigen. »Was dachtest du denn?« Er war nicht zum Reden aufgelegt, und ich half den Männern, das nächste Boot über den Strand zu ziehen. Das kalte Wasser, das mir über die Füße spülte, sorgte dafür, dass ich endlich hellwach wurde. Draußen auf See wies das verhaltene Rauschen brechender Wellen auf eine leichte Dünung hin. Schließlich war das kleine Boot an der Reihe, und ich sprang hinein, als es in die Fahrrinne hinausgeschoben wurde. Wir ruderten nur mit halber Kraft, ließen uns mehr mit der Strömung treiben und überwanden die Brecher an der Flussmündung ohne Probleme.
Als alle Boote draußen und jenseits der Boje waren, die das Hauptriff markierte, lief alles wie gewöhnlich weiter. Die drei großen Boote begannen ihre Kreisfahrt, um das Beutelnetz auszubringen; Steve und ich ruderten nach Süden, die anderen Angelboote entfernten sich in nördlicher Richtung. Am südlichen Ende des Tales liegt eine schmale Bucht, die von einem Riffwall aus Beton nahezu vollständig ausgefüllt wird – Betonbucht nennen wir den Ort. Zwischen dem Betonwall und dem etwas größeren Riff auf der dem Strand abgewandten Seite verläuft ein Kanal, den die schnelleren Fische zur Flucht benutzen, wenn die Netze ins Wasser gebracht werden. Das Angeln ist gewöhnlich dann erfolgreich, wenn auch mit den Netzen gefischt wird. Steve und ich ließen unseren Anker über dem Hauptriff fallen und wurden von der Dünung hinüber in den Kanal und dicht vor die weißen Segmente des Betonriffs getragen. Dann mussten die Angeln klargemacht werden. Ich knotete das glänzende Metallstück, das mir als Köder diente, an die Angelschnur. »Sieht aus wie ein Sarggriff«, sagte ich zu Steve und hielt den silbern glänzenden Gegenstand hoch. Er lachte nicht. Ich ließ den Köder bis auf den Grund sinken, dann begann ich ihn langsam wieder nach oben zu drillen.
Wir angelten. Köder auf den Grund sinken lassen, dann das Drillen; und danach wurde der Köder wieder hinausgeschleudert. Gelegentlich bogen die Angelruten sich nach unten. Es folgten einige Minuten heftiger Gegenwehr, die vom Käscher beendet wurde. Anschließend wurde die Angel sofort wieder ausgeworfen. Nördlich von uns wurden Netze aus dem Wasser gezogen, in denen silbern glänzende Fische um ihre verlorene Freiheit kämpften. Die Boote bekamen unter dem Gewicht Schlagseite und neigten sich manchmal so weit, dass es schien, als könnte man deutlich die Kiele sehen und als würden die Boote jeden Moment umkippen. Auf dem Festland schienen die Berge sich zu heben und wieder zu senken, immer auf und nieder. Im Licht der von dunstartigen Wolken verhüllten Sonne war der Wald von einem satten Grün, während die Klippen und die Bergspitzen kahl und grau waren.
Vor fünf Jahren, als ich zwölf Jahre alt war und Pa mich zum ersten Mal an John Nicolin ausgeheuert hatte, war Angeln eine ganz große Sache. Alles, was damit zu tun hatte, faszinierte mich – das Angeln selbst, die unterschiedlichen Launen des Meeres, das Zusammenwirken der Männer, der grandiose Anblick des Festlandes vom Meer aus. Doch seitdem hatte ich eine ganze Reihe von Tagen auf dem Wasser zugebracht, waren Unmengen von Fischen über die Bordwand gehievt worden: große und kleine Fische, gar keine Fische und dann wieder so viele Fische, dass uns die Arme müde und die Hände ganz rau und rissig wurden; in einer steilen, aber gemächlichen Dünung oder bei heftigem, böigem Sturm oder auf spiegelglattem Wasser; unter heißen, wolkenlosen Himmeln oder in einem Regen, der die Berge zu grauen Schemen verschwimmen ließ, oder im Sturm, wenn die Wolken wie durchgehende Pferde über unseren Köpfen dahinjagten … vorwiegend jedoch an Tagen wie diesem, mittelprächtig und mit einer Sonne, die gegen die besonders hoch dahintreibenden Wolken vorgeht, und einer mittelprächtigen Fangmenge Fische.
Es schien, als hätte es schon Tausende Tage wie diesen gegeben und als wäre der ganze Reiz verflogen. Für mich war es mittlerweile nicht mehr als ganz normale Arbeit.
Zwischen den jeweiligen Beutezügen ließ ich mich vom Schwanken des Bootes einlullen. Für eine Weile machte ich mich sogar lang und bettete den Kopf auf den Bootsrand, oder ich machte es mir auf dem Sitzbrett bequem, obgleich dann die Gefahr bestand, dass ich den Schlag einer Schwanzflosse abbekam. Die übrige Zeit kauerte ich mich über meine Angelrute und wachte nur auf, wenn sie gegen meinen Bauch schlug. Dann holte ich den Fisch heran, fing ihn mit dem Netz, zog ihn über den Rand, verpasste ihm ein paar auf den Schädel, holte den Köder heraus und warf ihn wieder ins Wasser und versank sofort erneut in einen angenehmen Halbschlaf. Ich versuchte sogar, mich auf das Sitzbrett zu legen, das gerade drei Fuß lang war, indem ich die Beine kreuzte und die Füße gegen das Dollbord stemmte, um weitere zehn Minuten zu schlafen.
»Henry!«
»Ja!«, erwiderte ich, richtete mich auf und sah automatisch nach meiner Angel.
»Wir haben schon ganz hübsch was an Fischen zusammen.«
Ich betrachtete die Bonitos und Steinbarsche in unserem Boot. »Etwa ein Dutzend.«
»Ein guter Fang. Vielleicht kann ich heute Nachmittag von zu Hause verduften«, meinte Steve hoffnungsvoll.
Ich bezweifelte das, sagte aber nichts. Die Sonne war von Wolken verhüllt, und das Wasser war grau; es wurde empfindlich kühl. Die Nebelwand hatte sich in Bewegung gesetzt und näherte sich dem Festland. »Es sieht eher danach aus, als ob wir am Strand festhängen werden«, sagte ich skeptisch.
»Ja. Wir müssen uns Barnard vornehmen; dieser alte Lügner bekommt von mir eine saftige Tracht Prügel.«
»Klar doch.«
Dann bissen bei uns beiden ziemlich dicke Brocken an, und wir hatten hinreichend damit zu tun, unsere Schnüre nicht zu verknoten. Wir waren immer noch beschäftigt, als das Quäken von Rafaels Signaltrompete über das Wasser hallte. Die Netze waren eingeholt worden, der Nebel wurde schnell dichter; mit dem Fischen war es für heute vorbei. Wir stießen einen Freudenschrei aus und hievten die Fische an Bord, dann klemmten wir die Ruder in die Dollhaken und pullten zurück zu Rays Boot. Sie gaben uns einige von ihren Fischen ab, da verschiedene Boote zu schwer beladen waren, und wir ruderten in die Flussmündung hinein.
Mit tatkräftiger Hilfe der ganzen Familie Nicolin und den anderen am Strand zogen wir das Boot auf den Sand und schleppten die Fische hinüber zu den Arbeitstischen. Kreischend und heftig flatternd stießen unaufhörlich die Möwen auf uns herab. Als das Boot leer und wieder an der Felswand vertäut war, wagte Steve sich zu seinem Vater, der sich um die Netze kümmerte und Rafael schimpfend auf einige Knoten aufmerksam machte.
»Darf ich jetzt gehen, Pa?«, fragte Steve. »Hanker und ich müssen mit Tom noch Schularbeiten machen.«
Das stimmte sogar.
»Nichts da«, erwiderte der alte Nicolin und bückte sich, um das Netz zu inspizieren. »Du wirst uns erst mal mit dem Netz helfen. Und dann kannst du Mama und deinen Schwestern beim Säubern der Fische einen Teil der Arbeit abnehmen.«
Anfangs hatte John seinen Sohn Steve zu dem Alten geschickt, damit er dort lesen lernte, denn er ging davon aus, dass damit Wohlstand und Ansehen der Familie zunehmen würden. Und als Steve endlich Gefallen daran fand – was ohnehin lange genug gedauert hatte –, hielt sein Vater ihn davon ab, wann immer sich dazu eine Gelegenheit bot; er hatte damit eine weitere Waffe in der Schlacht gegen seinen Sohn in der Hand. John richtete sich auf, blickte Steve an; er war etwas kleiner als sein Sohn, dafür aber massiger; beide hatten das kantige Kinn, den braunen Haarwust, hellblaue Augen, eine gerade lange Nase … Wütend funkelten sie sich an, John voller Erwartung, dass Steve ihm vor allen Männern am Strand widersprechen würde. Für einen kurzen Moment erwartete ich, dass es tatsächlich dazu kommen würde, dass Steve aufmucken und sich in einen heftigen Disput stürzen würde. Doch Steve wandte sich ab und stapfte hinüber zu den Arbeitstischen. Nachdem ich eine Weile gewartet und ihm Gelegenheit gegeben hatte, seine erste Wut zu schlucken, folgte ich ihm.
»Ich geh schon vor und sag dem Alten, dass du später kommst.«
»In Ordnung«, meinte Steve, ohne mich dabei anzusehen. »Ich komme, sobald ich kann.«
Der alte Nicolin schenkte mir drei Felsbarsche, die ich in einem Tragnetz die Klippen hinaufschleppte, das ich später zurückgeben musste. Die Ansammlung von Häusern in der zweiten Flussbiegung war nahezu verlassen. Eine Gruppe Kinder walkte Kleidungsstücke im Wasser durch, und etwas weiter stromauf hatten sich einige Frauen um die Herde bei den Marianis versammelt. Hier oben, fern des Meeres, herrschte eine tiefe Ruhe; das Gebell eines Hundes hallte einsam über den gemächlich fließenden Strom.
Ich brachte Pa die Fische, und er stieg hungrig von seinem Schneidertisch. »Prima, prima. Ich muss sie sofort zubereiten. Einen für heute Abend, und die anderen werden zum Trocknen aufgehängt.« Ich sagte ihm, ich sei beim Alten, und er nickte, wobei er heftig an seinen Schnurrbartenden zupfte. »Wir essen, sobald es dunkel ist, okay?«
»Okay«, entgegnete ich und machte mich auf den Weg.
Das Haus des alten Mannes befindet sich auf dem Gebirgskamm, der das südliche Ende unseres Tals darstellt. Es steht auf einem Fleck, der nur wenig größer ist als seine Grundfläche, etwa auf halber Höhe zum Gipfel des höchsten Bergs der Gegend. In ganz Onofre gibt es kein Haus, von dem man eine schönere Aussicht hat. Als ich dort oben ankam, war das Haus, ein Holzkasten mit vier Zimmern und einem hübschen Panoramafenster, leer. Vorsichtig suchte ich mir meinen Weg durch das Gerümpel, das das Haus umgab. Zwischen all den Honigwaben, den Drahtzangen, den Sonnenuhren, den Gummireifen, den Regenfässern mit ihren Sammelohren, den Generatorteilen, defekten Motoren, den Großvateruhren und Gasherden und Kisten voller Was-weiß-ich-was, blinkten Glasscherben und Mause- und Rattenfallen, die er ständig anders auslegte, sodass es ratsam war, sich in Acht zu nehmen, wo man hintrat. Drüben bei Rafaels Haus würde solches Zeug, wie es in Toms Hof herumlag, repariert und wieder in Gang gebracht, oder zumindest würden alle brauchbaren Teile abmontiert und weiterverwendet, hier jedoch diente das Zeug als Anschauungsmaterial für den Unterricht. Warum hatte er einen Automotor auf einen Sägebock gestellt, und wie hatte er das Ungetüm überhaupt dort hinaufschaffen können? Genau das war Toms Absicht, nämlich dass man sich darüber den Kopf zerbrach.
Ich folgte dem ausgetretenen Pfad, der über den Gebirgskamm verlief. Im Süden erhoben sich bewaldete Spitzen über dem Strandkliff, eine neben der anderen, bis nach Pendleton hinunter. Nicht weit vom höchsten Punkt des Grates, dem ich entgegenkletterte, machte der Pfad einen Knick und fiel in die Schlucht südlich davon ab, ein Canyon, der zu schmal war, um einem Fluss Platz zu bieten, in dem sich jedoch eine Quelle befand. Die Eukalyptusbäume hielten den Erdboden vom Gestrüpp frei, und auf einem weniger steilen Hang der Schlucht hatte der alte Mann seine Bienenkörbe aufgebaut, eine Ansammlung kleiner weißer Holzkuppeln. Ich entdeckte ihn zwischen den Gebilden, eingemummt in seinen Imkermantel und mit dem Imkerhut auf dem Kopf, sodass er aussah wie ein Kind in Erwachsenenkleidung. Doch er bewegte sich ziemlich flink – jedenfalls für einen Hundertjährigen. Er huschte von Kuppel zu Kuppel, zog Holzladen heraus und betastete sie mit einer behandschuhten Hand, trat gegen eine andere Kuppel, drohte einer dritten mit erhobenem Zeigefinger und redete unaufhörlich. Trotz des Hutes, der sein Gesicht nahezu vollständig verhüllte, konnte ich das erkennen. Tom redete mit jedem und allem: Menschen, mit sich selbst, Hunden, Bäumen, mit dem Himmel, mit dem Fisch auf seinem Teller, mit Steinen, über die er stolperte … selbstverständlich unterhielt er sich auch mit seinen Bienen. Er schob eine Lade zurück in den Korb und blickte sich um, wobei er müde seine Schultern sinken ließ; dann entdeckte er mich und winkte. Als ich mich näherte, fuhr er damit fort, seine Bienenkörbe zu inspizieren, und ich beobachtete seinen Gang. Seine Knie schwangen bei jedem Schritt nach außen, als befänden sich seine Kniescheiben an den Außenseiten seiner Beine. Und seine Arme in den langen Mantelärmeln pendelten wild in alle Richtungen, wohl um das Gleichgewicht zu halten, vermute ich.
»Komm den Körben nicht zu nahe, Junge, sonst wirst du gestochen.«
»Dich stechen sie doch auch nicht.«
Er nahm den Hut ab und scheuchte eine Biene in ihren Korb zurück. »An mir gibt es mittlerweile auch nicht mehr allzu viel zu stechen, oder? Außerdem wollen sie mich auch gar nicht stechen; sie wissen schließlich, wer für sie sorgt.« Wir ließen die Körbe hinter uns. Die langen weißen Haare über seinen Ohren wurden vom Wind nach hinten geweht und verschmolzen vor meinen Augen mit den Wolken; den Bart hatte er sich ins Hemd gesteckt. »Ich fress ja auch keine von ihnen auf.« Der Nebel stieg auf und bildete schnell Wolkenfetzen. Tom massierte seinen mit Sommersprossen übersäten Schädel. »Lass uns aus dem Wind gehen, Henry, mein Junge. Es ist so kalt, dass die Bienen verrücktspielen. Du solltest mal hören, was für einen Unsinn sie reden. Als hätte ich sie ausgeräuchert. Hättest du Lust auf eine Tasse Tee?«
»Klar.« Toms Tee war so stark, dass er durchaus eine Mahlzeit ersetzen konnte.
»Hast du deine Lektion gelernt?«
»Und wie. Sag mal, hast du von dem Toten gehört, der angeschwemmt wurde?«
»Ich war sogar unten und hab ihn mir angesehen. Ein Stück nördlich der Flussmündung hat er gelegen. Ein Japaner, schätze ich. Wir haben ihn hinten auf dem Friedhof bei den anderen begraben.«
»Was meinst du, ist mit ihm passiert?«
»Nun …« Wir betraten den Pfad zu seinem Haus. »Jemand hat ihn erschossen!« Er lachte gackernd über meinen Gesichtsausdruck. »Ich nehme an, er wollte den Vereinigten Staaten von Amerika einen Besuch abstatten. Doch die Vereinigten Staaten von Amerika sind gesperrt.« Ohne besondere Vorsicht walten zu lassen, überquerte er seinen Hof, und ich folgte ihm dicht auf den Fersen. Wir betraten das Haus. »Offenbar hat jemand uns für tabu erklärt, wir sind so gut wie tot, Junge. Um uns herum sieht es ziemlich finster aus. Denk nur an die Schiffe, die dort draußen hin- und herdampfen und so schwarz sind, dass man sie sogar in einer mondlosen Nacht erkennen kann. Eigentlich ziemlich blöd, wenn sie unbedingt wollten, dass man sie nicht sieht. Ich habe keinen Fremden mehr gesehen – einen lebendigen Fremden, meine ich – diese Toten geben keine besonders gesprächigen Informanten ab, heeh, heeh – seit jenem Tag damals. Das ist schon zu lange her, als dass alles ein Zufall sein könnte, nicht dass es da nicht ein paar aufschlussreiche Begleitumstände gäbe. Aber darauf läuft es letztendlich hinaus; wo sind sie? – denn irgendwo dort draußen müssen sie ja sein.« Er füllte die Teekanne. »Meine Theorie läuft darauf hinaus, dass sie uns für tabu erklärten, um einem möglichen Streit wegen uns vorzubeugen und auch einer Vernichtung … aber über diese Vermutung haben wir beide ja schon vor längerer Zeit ausführlich gesprochen, nicht wahr?«
Ich nickte.
»Und dennoch weiß ich nicht, über wen wir eigentlich reden, wenn man es genau nimmt.«
»Die Chinesen, richtig?«
»Oder die Japaner.«
»Dann glaubst du also, dass die sich dort draußen auf Catalina nur aufhalten, um Leute von hier fernzuhalten?«
»Nun, ich weiß, dass jemand auf Catalina ist, und zwar keiner von uns. Das weiß ich genau. Ich habe von hier oben Lichter die ganze Nacht hindurch blinken gesehen. Du hast sie auch gesehen.«
»Habe ich«, gab ich zu. »Es ist wundervoll.«
»Ja, dieses Avalon muss mittlerweile ein richtig geschäftiger Hafen sein. Bestimmt hat man die Anlagen von der Seeseite her ausgebaut, mit einem vorgelagerten Damm oder so, wie das alte Alexandria, weißt du. Es ist schon ein Segen, wenn man etwas mit Sicherheit weiß, Henry. Es gibt erstaunlich wenige Dinge, von denen man das behaupten kann. Wissen ist wie Quecksilber.« Er ging zum Herd. »Aber irgendjemand ist auf Catalina.«
»Wir sollten nachschauen.«
Er schüttelte den Kopf und sah aus dem Fenster hinab auf die Brecher. »Wir kämen niemals zurück.«
Gedankenverloren warf er einige Äste auf die Kohlen in der Feuerstelle, und wir saßen in gemütlichen Sesseln am Fenster und warteten darauf, dass das Wasser kochte. Das Meer war ein Flickenteppich voller dunkler und heller Grautöne und mit Silberknöpfen, die zwischen uns und der Sonne eine unregelmäßige Linie bildeten. Es sah eher nach Regen als nach Nebel aus; der gute Nicolin würde bestimmt ganz schon wütend sein, denn Angeln kann man auch bei Regen. Tom verzog das Gesicht und zwang den zehntausend Falten darin eine neue Anordnung auf. »Whatever happened to summertime«, sang er, »yes when the living was eee-sy.« Ich warf mehr Äste aufs Feuer und zeigte keinerlei Reaktion auf die kleine Melodie, die ich schon so oft gehört hatte. Tom hatte viele Geschichten aus der alten Zeit erzählt, und er ließ sich nicht davon abbringen, dass unsere Küste in jener Zeit eine baumlose, wasserlose Wüste gewesen war. Doch indem ich aus dem Fenster auf den Wald und die sich auftürmenden Wolken blickte und spürte, wie das Feuer kalte Luft im Zimmer erwärmte, und mich dabei an das Abenteuer der vergangenen Nacht erinnerte, fragte ich mich, ob ich ihm Glauben schenken konnte. Mindestens die Hälfte seiner Geschichten konnte ich noch nicht einmal in seinen vielen Büchern überprüfen – und außerdem, war es nicht möglich, dass er mich völlig falsch zu lesen gelehrt hatte, sodass alles, was ich las, all das bestätigte, was er von sich gab?
Es wäre ganz schön schwierig, sich ein vollkommen stimmiges System auszuknobeln, sagte ich mir, während er ein Päckchen von seinem Tee – den er aus Pflanzen zusammenstellte, die er im Hinterland gesammelt hatte – in die Kanne fallen ließ. Und ich erinnerte mich an einen Tauschtreff, bei dem er auf Steve und Kathryn und mich zugerannt kam, betrunken und aufgeregt, und dabei stammelte: »Seht mal, was ich gekauft habe, seht doch, was ich da hab!« Er zerrte uns unter eine Straßenlaterne, um uns die zerfledderte Hälfte eines Lexikons zu zeigen, und er öffnete das Buch und wir sahen ein Bild von einem schwarzen Himmel über weißem Grund, auf dem zwei vollkommen weiße Gestalten neben einer amerikanischen Flagge standen. »Das ist der Mond, seht ihr? Ich hab euch doch erzählt, dass wir dort waren, und ihr wolltet es mir nicht glauben.«
»Ich glaube dir noch immer nicht«, sagte Steve und lachte sich über die aufgebrachte Reaktion des Alten halbtot. »Ich habe dieses Bild für vier Gläser Honig gekauft, um euch einen Beweis dafür zu liefern, und ihr glaubt mir immer noch nicht?«
»Nein!« Kathryn und ich bekamen fast einen Lachkrampf über die beiden – auch wir waren ziemlich betrunken. Doch er behielt das Bild – wenngleich er auch das Lexikon wegwarf –, und später erst sah ich die blaue Kugel der Erde am schwarzen Himmel, und sie war so groß wie der Mond an unserem Himmel. Eine geschlagene Stunde lang muss ich das Bild angestarrt haben. Demnach entspräche also eine seiner unglaublichsten Behauptungen den Tatsachen; und danach neigte ich gewöhnlich dazu, den ganzen Rest auch zu glauben.
»Na schön«, sagte Tom und reichte mir eine Tasse mit seinem starken, wohlriechenden Tee. »Dann lass mal hören.«
Ich verscheuchte alle ablenkenden Gedanken aus meinem Bewusstsein und konzentrierte mich auf die Buchseite, die auswendig zu lernen Tom mir als Hausaufgabe erteilt hatte. Die kurzen Gedichtzeilen erleichterten es enorm, sie einzuprägen, und ich begann laut zu deklamieren, was mein geistiges Auge las:
»›Ist dies das Land, ist dies die Weltenzone‹,
Sprach der verlorene Erzengel drauf,
›Ist dies der Wohnsitz, der uns statt des Himmels