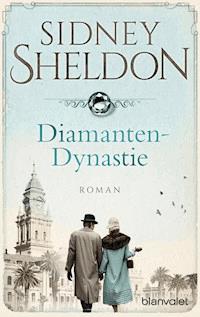2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein altes Kloster in Griechenland, eine junge Frau ohne Erinnerung und ein skrupelloser Reeder mit einem dunklen Geheimnis - Hochspannung pur von Weltbestsellerautor Sidney Sheldon.
Nach einem Unfall leidet Catherine Alexander an Amnesie und kann sich an ihr bisheriges Leben nicht erinnern. Seitdem lebt sie zurückgezogen in einem alten Kloster in Griechenland. Constantin Demiris, steinreicher Reeder und großzügiger Unterstützer des Klosters, kennt die junge Amerikanerin genau, doch er hütet sich, ihre Identität preiszugeben. Denn Demiris hatte vor Jahren dafür gesorgt, dass Catherines Mann Larry zum Tode verurteilt wurde. Während sie verzweifelt daran arbeitet, ihre Erinnerungen zurückzuholen, setzt der skrupellose Reeder alles daran, dass Catherine niemals erfährt, wer sie wirklich ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
1949, Kowloon in China: Ein Unbekannter engagiert einen Auftragskiller, der jemanden für ihn ermorden soll. Es soll wie ein Unfall aussehen … und man soll die Tote nicht mehr wiedererkennen können. Der Name dieser Person ist … Catherine Alexander.
Gut ein Jahr zuvor, in Ioannina in Griechenland. Catherine Alexander ist eine hübsche Amerikanerin Anfang dreißig, die zurückgezogen in einem Kloster lebt. Nach einem Bootsunfall hat sie ihr Gedächtnis verloren, nur ihren eigenen Namen kennt sie noch. Doch das Leben in einem Kloster ist nicht das, was sie sich vom Leben erhofft hat. Außerdem nagt die Ungewissheit an ihr … Warum sucht niemand nach ihr? Und wieso hat sie jede Nacht den gleichen Albtraum, in dem ein Mann und eine Frau sie unter Wasser drücken und ertränken wollen? Der steinreiche Reeder Constantin Demiris dagegen kennt Catherine genau. Vor Jahren hat er dafür gesorgt, dass Catherines Mann zum Tode verurteilt wurde. Und er wird alles dafür tun zu verhindern, dass Catherine die Wahrheit über ihre Vergangenheit herausfindet …
Autor
Sidney Sheldon begeisterte bis heute über 300 Millionen Leser weltweit. Vielfach preisgekrönt – u.a. erhielt er 1947 einen Oscar für das Drehbuch zu »So einfach ist die Liebe nicht« – stürmte er mit all seinen Romanen immer wieder die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. Er zählt zu den am häufigsten übersetzten Autoren und wurde dafür sogar mit einem Eintrag ins »Guinnessbuch der Rekorde« geehrt. Im Jahr 2007, kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag, verstarb Sidney Sheldon.
Von Sidney Sheldon bereits erschienen
Die Diamanten-Dynastie · Im Schatten der Götter · Kalte Glut · Zorn der Engel · Der Zorn der Götter
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet
und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
SIDNEY
SHELDON
Schattender Macht
ROMAN
Deutsch von Wulf Bergner
Für Alexandramit LiebeSing mir keine Lieder von des Tages Helligkeit,Denn die Sonne ist der Liebenden Feind;Sing mir stattdessen von Dunkel und SchattenUnd von Erinnerungen an Mitternacht.
PROLOG
Sappho
KOWLOON, MAI 1949
»Das Ganze muss wie ein Unfall aussehen. Können Sie das arrangieren?«
Das war eine Beleidigung. Der andere fühlte Zorn in sich aufsteigen. Das war eine Frage, die man einem von der Straße aufgelesenen Streuner stellte. Er war versucht, eine sarkastische Antwort zu geben: O ja, das traue ich mir zu! Hätten Sie gern einen Unfall in ihrer Wohnung? Ich kann dafür sorgen, dass sie sich bei einem Treppensturz das Genick bricht. Die Tänzerin in Marseille. Sie könnte sich auch betrinken und in ihrer Badewanne ertrinken. Die Millionenerbin in Gstaad. Sie könnte an einer ÜberdosisHeroin sterben. Damit hatte er schon drei beseitigt. Oder sie könnte mit einer brennenden Zigarette im Bett einschlafen. Der schwedische Kriminalbeamte im Pariser Hotel Capitol. Oder wäre Ihnen vielleicht etwas im Freien lieber? Ich könnte einen Verkehrsunfall, einen Flugzeugabsturz oder ein Verschwinden auf See arrangieren.
Er sagte jedoch nichts von alledem, denn in Wahrheit hatte er Angst vor dem Mann, der ihm gegenübersaß. Er hatte zu viele beängstigende Geschichten über ihn gehört – und allen Grund, sie für wahr zu halten.
Deshalb sagte er nur: »Ja, Sir, ich kann einen Unfall arrangieren. Niemand wird jemals wissen, was wirklich passiert ist.« Noch während er das sagte, fiel ihm ein: Er weiß, dass ich es wissen werde. Er wartete.
Sie befanden sich im ersten Stock eines Gebäudes in der Festungsstadt Kowloon, die 1840 von Chinesen zum Schutz vor den britischen Barbaren errichtet worden war. Die Befestigungen hatten den Zweiten Weltkrieg nicht überstanden, aber es gab andere »Mauern«, die Fremde fernhielten: Mörderbanden, Drogensüchtige und Sexualverbrecher, die über das Labyrinth aus engen, verwinkelten Gassen und dunklen, unbeleuchteten Treppen herrschten. Touristen wurde von einem Besuch abgeraten, und selbst die Polizei wagte sich nicht über die äußere Tung Tau Tsuen Street hinweg in die Innenstadt hinein.
Von draußen hörte er Straßenlärm und die für die Einwohner Kowloons typische schrille Sprachenvielfalt.
Der Mann studierte ihn mit kaltem Basiliskenblick. »Gut«, entschied er dann, »ich überlasse es Ihnen, wie Sie es anstellen wollen.«
»Ja, Sir. Hält sich die Betreffende hier in Kowloon auf?«
»In London. Ihr Name ist Catherine. Catherine Alexander.«
Eine Limousine, der ein weiteres Fahrzeug mit zwei bewaffneten Leibwächtern folgte, brachte den Mann zum Blue House in der Lascar Row im Stadtteil Tsim Sha Tsui. Das Blue House stand nur speziellen Gästen offen. Spitzenpolitiker verkehrten dort ebenso wie Filmstars und Aufsichtsratsvorsitzende. Die Direktion war stolz auf ihre absolute Diskretion. Vor einem halben Dutzend Jahren hatte eines der dort arbeitenden Mädchen einem Reporter von ihren Kunden erzählt und war am nächsten Morgen mit abgeschnittener Zunge im Aberdeen Harbor treibend aufgefunden worden. Im Blue House war alles käuflich: Jungfrauen, Knaben, Lesbierinnen, die sich ohne die »Jadestängel« von Männern befriedigten, und Tiere. Soviel er wusste, war es das einzige Etablissement, in dem die aus dem 10. Jahrhundert stammende Kunst des Ischinpo noch praktiziert wurde. Das Blue House war eine Schatzkammer verbotener Lüste.
Diesmal hatte der Mann sich die Zwillinge bestellt. Die beiden waren ein exquisites Paar mit bildhübschen Gesichtern, unglaublichen Körpern und keinerlei Hemmungen. Er dachte an seinen letzten Besuch im Blue House … an den Metallhocker mit ausgeschnittenem Sitz, ihre sanft liebkosenden Hände und Zungen, die große Wanne mit parfümiertem Wasser, das auf den Marmorboden überschwappte, und ihre heißen Lippen, die seinen Leib plünderten. Und er spürte eine beginnende Erektion.
»Wir sind da, Sir.«
Drei Stunden später, als er mit ihnen fertig war, lehnte der Mann sich befriedigt und zufrieden in die Polster seiner Limousine zurück, um sich in die Mody Road im Stadtviertel Tsim Sha Tsui fahren zu lassen. Hinter den Fenstern des Wagens glitzerten die Lichter der Großstadt, die niemals schlief. Die Chinesen hatten sie Gaulung – neun Drachen – genannt, und er stellte sich vor, wie diese auf den Bergen über der Stadt lauerten, um sich herabzustürzen und die Schwachen und Leichtsinnigen zu vernichten. Er war weder schwach noch leichtsinnig.
Sie erreichten die Mody Road.
Der taoistische Priester, der ihn erwartete, sah wie eine Gestalt aus einem alten Farbholzschnitt aus: ein ehrwürdiger Greis mit langem, ziemlich schütterem Bart und einer wallenden, schon etwas verblichenen Robe.
»Jou Sahn.«
»Jou Sahn.«
»Gei Do Chin?«
»Yat-Chin.«
»Jou.«
Der Priester schloss die Augen zu einem stummen Gebet und begann, die Tschim – eine Holzschale mit nummerierten Gebetsstäbchen – zu schütteln. Dann fiel ein Stäbchen heraus, und das Schütteln hörte auf. Der taoistische Priester zog schweigend eine Tabelle zurate, bevor er sich an seinen Besucher wandte. Er sprach ein stockendes Englisch. »Götter sagen, du bald von gefährliche Feind befreit.«
Der Mann empfand jäh aufwallende Freude. Er war zu intelligent, um nicht zu wissen, dass diese uralte Wahrsagekunst nur auf Aberglauben basierte. Und er war zu intelligent, um sie zu ignorieren. Außerdem gab es ein weiteres gutes Omen: Heute war Konstantinstag, sein Geburtstag.
»Die Götter haben dich mit gutem Fung shui gesegnet.«
»Do jeh.«
»Hou wah.«
Fünf Minuten später saß er wieder in der Limousine und war zum Kai Tak, dem Airport von Kowloon, unterwegs, wo sein Privatflugzeug bereitstand, um ihn nach Athen zurückzubringen.
1
IOANNINA, GRIECHENLAND – JULI 1948
Jede Nacht erwachte sie schreiend aus dem gleichen Traum. Sie befand sich bei heulendem Sturm mitten auf einem See, und ein Mann und eine Frau drückten ihren Kopf ins eiskalte Wasser, um sie zu ertränken. Jedes Mal schreckte sie nach Atem ringend, mit jagendem Puls und in Schweiß gebadet hoch.
Sie hatte keine Ahnung, wer sie war, und konnte sich an nichts erinnern. Sie sprach Englisch – Aber sie wusste nicht, woher sie stammte oder wie sie nach Griechenland in das kleine Karmeliterinnenkloster gekommen war, in dem sie Zuflucht gefunden hatte.
Allmählich stellten sich quälend flüchtige Erinnerungen ein: vage, schemenhafte Bilder, die aufblitzten und ebenso schnell wieder verschwanden, ohne sich festhalten und genauer betrachten zu lassen. Sie kamen stets ohne Vorankündigung, überrumpelten sie förmlich und ließen sie verwirrt zurück.
Zu Anfang hatte sie viele Fragen gestellt. Die Karmeliterinnen waren freundlich und verständnisvoll, aber sie gehörten einem Schweigeorden an, und allein Mutter Theresa, die greise, gebrechliche Oberin, durfte mit ihr sprechen.
»Wissen Sie, wer ich bin?«
»Nein, mein Kind«, antwortete Mutter Theresa.
»Wie bin ich hierhergekommen?«
»Am Fuß dieser Berge liegt das Dorf Ioannina. Letztes Jahr sind Sie während eines Sturms mit einem kleinen Boot unten auf dem See gewesen. Das Boot ist gesunken, aber durch die Gnade Gottes haben zwei unserer Schwestern Sie gesehen und gerettet. Sie haben Sie hierhergebracht.«
»Aber … wo war ich vorher?«
»Es tut mir leid, mein Kind. Das weiß ich nicht.«
Damit konnte sie sich nicht zufriedengeben. »Hat denn niemand nach mir gefragt? Hat niemand versucht, mich zu finden.«
Mutter Theresa schüttelte den Kopf. »Niemand.«
Sie war so frustriert, dass sie am liebsten geschrien hätte. Aber sie ließ nicht locker. »Die Zeitungen … Sie müssen über mein Verschwinden berichtet haben.«
»Wie Sie wissen, ist uns jeglicher Kontakt mit der Außenwelt untersagt. Wir müssen uns dem Willen Gottes fügen, mein Kind. Wir müssen ihm für seine Gnade danken, dafür, dass Sie noch leben.«
Und das war alles gewesen, was sie herausbekommen hatte. Anfangs war sie zu krank gewesen, um sich Sorgen wegen ihrer ungeklärten Vergangenheit zu machen, aber im Laufe der Monate war sie genesen und wieder zu Kräften gekommen.
Als sie sich stark genug fühlte, verbrachte sie ihre Tage damit, in dem strahlenden Licht, das die Landschaft leuchten ließ, und der nach Wein und Zitronen duftenden sanften Brise den üppig blühenden Klostergarten zu pflegen.
Die Atmosphäre, in der sie lebte, war heiter und gelassen, und doch fand sie keine Ruhe. Ich habe mich verirrt, dachte sie, aber niemanden kümmert es. Weshalb nicht? Habe ich etwas Böses getan? Wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich?
Wieder stiegen Bilder aus ihrem Unterbewusstsein auf. Eines Morgens sah sie sich beim Aufwachen plötzlich in einem Zimmer, in dem ein nackter Mann sie auszog. Nur ein Traum? Oder etwas, das in der Vergangenheit wirklich geschehen war? Wer war dieser Mann? Jemand, mit dem sie verheiratet war? Hatte sie einen Ehemann? Sie trug keinen Ehering. Tatsächlich besaß sie nichts außer der schwarzen Ordenstracht einer Karmelitin, die Mutter Theresa ihr gegeben hatte, und eine Brosche: einen kleinen goldenen Vogel mit Rubinen als Augen und ausgebreiteten Schwingen.
Sie war eine namenlose Unbekannte, eine Fremde, die unter Fremden lebte. Hier gab es niemanden, der ihr helfen konnte – keinen Psychiater, der ihr hätte sagen können, dass ihre Psyche ein so schweres Trauma erlitten hatte, dass sie nur bei Verstand bleiben konnte, indem sie die Schrecken der Vergangenheit verdrängte.
Und die Bilder folgten rascher und immer rascher aufeinander, als habe ihr Gedächtnis sich plötzlich in ein gigantisches Puzzle verwandelt, von dem hier und da einzelne Teile zusammenpassten. Einmal sah sie sich in einem riesigen Atelier voller Soldaten, in dem offenbar ein Film gedreht wurde. Bin ich Schauspielerin gewesen? Nein, sie schien für irgendetwas verantwortlich zu sein. Aber wofür?
Ein Soldat überreichte ihr einen Blumenstrauß. Den müssen Sie selbst bezahlen, sagte er lachend.
Zwei Nächte später träumte sie wieder von diesem Mann. Sie verabschiedete sich auf einem Flughafen von ihm – und wachte schluchzend auf, weil sie ihn verloren hatte.
Danach fand sie keinen Frieden mehr. Dies waren keine bloßen Träume, sondern Bruchstücke ihres Lebens, ihrer Vergangenheit. Ich muss herausfinden, wer ich gewesen bin. Wer ich bin.
Und eines Nachts gab ihr Unterbewusstsein ganz unerwartet, ohne die geringste Vorwarnung, einen Namen preis. Catherine. Ich heiße Catherine Alexander.
2
Obwohl das Imperium, das Constantin Demiris aufgebaut hatte, auf keiner Landkarte eingetragen war, herrschte er über ein Reich, das größer und mächtiger war als viele Staaten. Er gehörte zu den reichsten Männern der Welt, und sein Einfluss war unermesslich groß. Er besaß weder Titel noch bekleidete er ein offizielles Amt, doch er kaufte und verkaufte regelmäßig Botschafter, Kardinäle, Ministerpräsidenten und Staatsoberhäupter. Demiris hatte seine Tentakel überallhin ausgestreckt und entschied mit über das Wohl und Weh Dutzender von Staaten.
Constantin Demiris war eine charismatische Gestalt: hochintelligent, von imposanter Statur, relativ groß, breitschultrig und muskelbepackt. Sein Gesicht mit dem dunklen Teint beherrschten eine kräftige griechische Nase und pechschwarze Augen. Er sah wie ein Habicht aus, ein Raubvogel. Wenn er wollte, konnte er unwiderstehlich charmant sein. Er beherrschte acht Sprachen und war ein glänzender Erzähler. Er besaß eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt, mehrere Privatflugzeuge und ein Dutzend Luxusapartments, Villen und Schlösser in aller Herren Länder. Er war ein Kenner und Genießer schöner Dinge und schöner Frauen. Als Liebhaber schien er für jede Überraschung gut zu sein, und seine Liebesaffären waren so farbig wie seine finanziellen Abenteuer.
Constantin Demiris war stolz darauf, ein Patriot zu sein. Vor seiner Villa in Kolonaki und auf seiner Privatinsel Psara war stets die blau-weiße griechische Fahne aufgezogen – aber er zahlte keine Steuern. Demiris fühlte sich in keiner Weise verpflichtet, sich an die für gewöhnliche Sterbliche geltenden Gesetze zu halten. In seinen Adern floss Ichor – das Blut der Götter.
Fast alle Menschen, auf die Demiris traf, wollten etwas von ihm: Kapital für ein geschäftliches Projekt, eine Spende für wohltätige Zwecke oder einfach nur die Macht, die ihnen seine Freundschaft verleihen würde. Demiris machte sich einen Spaß daraus herauszubekommen, was diese Leute wirklich wollten – meistens etwas ganz anderes, als sie vorgaben. Sein analytischer Verstand misstraute jedem äußeren Anschein, sodass er nichts glaubte, was ihm erzählt wurde, und keinem Menschen traute. Journalisten, die aus seinem Leben berichteten, bekamen nur den liebenswürdigen Charme eines kultivierten Mannes von Welt zu sehen. Sie hatten keinen Grund, hinter dieser Fassade den Killer, den Instinkt des Raubtiers zu vermuten.
Er war ein unbarmherziger Mann, der eine Kränkung niemals vergaß. Bei den alten Griechen war das Wort Dikeossini, Gerechtigkeit, oft gleichbedeutend mit Ekdikissis, Rache, gewesen, und Demiris war von beiden besessen. Nie vergaß er eine Beleidigung, die er jemals erlitten hatte, und wer das Unglück hatte, sich seine Feindschaft zuzuziehen, musste dafür hundertfach büßen. Doch der Betroffene merkte es nicht gleich, denn Constantin Demiris machte seine Rache zu einem Spiel, bei dem er geduldig und voller Genuss komplizierte Fallen konstruierte und raffinierte Netze wob, in denen sich seine Feinde verfingen und zugrunde gingen.
Er studierte seine Opfer sorgfältig, analysierte ihre Persönlichkeit und wog ihre Stärken und Schwächen ab.
Auf einer Abendgesellschaft hatte Demiris einmal zufällig mitbekommen, wie ein Filmproduzent ihn als »diesen schmierigen Griechen« bezeichnete. Demiris wartete geduldig. Zwei Jahre später nahm der Produzent für eine Großproduktion, die er mit eigenen Mitteln drehte, eine weltbekannte Filmschauspielerin unter Vertrag. Demiris wartete, bis der Film zur Hälfte fertig war, dann brachte er die Hauptdarstellerin mit seinem beträchtlichen Charme dazu, die Dreharbeiten abzubrechen, um ihm auf seiner Jacht Gesellschaft zu leisten.
»Das werden unsere Flitterwochen«, versprach Demiris ihr.
Sie bekam die Flitterwochen, aber nicht die Hochzeit. Der Film konnte nicht zu Ende gedreht werden, und der Produzent musste schließlich Konkurs anmelden.
Es gab einige Figuren in Demiris’ Spiel, mit denen er noch alte Rechnungen zu begleichen hatte, aber er hatte es damit nicht eilig. Er genoss die Vorfreude, die Planung und die Ausführung. Heutzutage machte er sich keine Feinde mehr, weil niemand es sich leisten konnte, sein Feind zu sein, deshalb waren seine Opfer ausschließlich Menschen, die früher seine Wege gekreuzt hatten.
Aber Constantin Demiris’ Sinn für Dikeossini war ambivalent. So wie er niemals eine Kränkung vergaß, so vergaß er auch nie einen Gefallen. Ein armer Fischer, der ihn als Jungen einmal für kurze Zeit bei sich aufgenommen hatte, fand sich als Eigner einer Fischfangflotte wieder. Eine Prostituierte, die den jungen Mann zum Abendessen eingeladen hatte, als er zu arm gewesen war, um sie zu bezahlen, erbte auf geheimnisvolle Weise ein Miethaus, ohne jemals zu erfahren, wer ihr Wohltäter gewesen war.
Demiris war als Sohn eines Hafenarbeiters in Piräus auf die Welt gekommen. Er hatte vierzehn Brüder und Schwestern, für die es daheim nie genug zu essen gab.
Schon in frühester Jugend bewies Constantin Demiris seine geradezu unheimliche Geschäftstüchtigkeit. Das mit Gelegenheitsarbeiten nach der Schule verdiente Geld hielt er so eisern zusammen, dass er schon als Sechzehnjähriger mit einem älteren Partner einen Imbissstand im Hafen aufmachen konnte. Das Geschäft florierte, aber sein Partner brachte ihn durch Betrug um seinen Anteil. Demiris brauchte zehn Jahre, um den Mann zu vernichten. Der Junge brannte förmlich vor Ehrgeiz. Oft lag er nachts wach und starrte mit leuchtenden Augen in die Dunkelheit. Ich werde reich sein. Ich werde berühmt sein. Eines Tages wird jeder meinen Namen kennen. Das war das einzige Wiegenlied, bei dem er Schlaf fand. Er hatte keine Ahnung, wie es dazu kommen würde. Er wusste nur, dass es geschehen würde.
Als Constantin Demiris an seinem siebzehnten Geburtstag auf einen Zeitungsartikel über die Ölfelder Saudi-Arabiens stieß, hatte er das Gefühl, ihm würde sich plötzlich ein Zaubertor in die Zukunft öffnen.
»Ich gehe nach Saudi-Arabien«, erklärte er seinem Vater. »Ich werde auf den Ölfeldern arbeiten.«
»Stasou! Was verstehst du schon von Ölfeldern?«
»Nichts, Vater. Aber ich werde es lernen.«
Einen Monat später war Constantin Demiris unterwegs nach Saudi-Arabien.
Bei der Trans-Continental Oil Corporation war es üblich, dass ausländische Angestellte einen Zweijahresvertrag unterschrieben, aber das störte Demiris nicht weiter. Er hatte die Absicht, in Saudi-Arabien zu bleiben, bis er sein Glück gemacht hatte. Er hatte sich wundervolle Abenteuer aus Tausendundeiner Nacht und ein geheimnisvolles Märchenland mit exotischen Schönheiten und aus der Erde sprudelndem schwarzen Gold vorgestellt. Die Wirklichkeit war ein Schock.
Frühmorgens an einem Sommertag kam Demiris in Fadhili an, einem trostlosen Camp mitten in der Wüste, dessen hässliche Steingebäude von Barastis umgeben waren. In diesen kleinen Hütten aus Ästen und Zweigen hausten rund tausend einfache Arbeiter, die meisten von ihnen Saudis. Die wenigen Frauen, die über die staubigen Straßen schlurften, waren tief verschleiert.
Demiris betrat das Gebäude, in dem J. J. McIntyre, der Personalchef, sein Büro hatte.
McIntyre hob den Kopf, als der junge Mann hereinkam. »So, Sie sind von der Zentrale angestellt worden, was?«
»Ja, Sir.«
»Schon mal auf Ölfeldern gearbeitet, Sohn?«
Demiris war sekundenlang versucht zu lügen. »Nein, Sir.«
McIntyre grinste. »Hier wird’s Ihnen gefallen! Eine Million Meilen von jeglicher Zivilisation entfernt, schlechtes Essen, keine Frauen, die Sie anfassen dürfen, ohne den Pimmel abgeschnitten zu kriegen, und Abend für Abend diese gottverdammte Langeweile. Aber die Bezahlung ist gut, was?«
»Ich bin hier, um zu lernen«, sagte Demiris ernsthaft.
»Ach wirklich? Dann erzähle ich Ihnen am besten, was Sie als Erstes lernen müssen. Sie sind jetzt in einem islamischen Land. Das bedeutet absolutes Alkoholverbot. Wer beim Stehlen erwischt wird, kriegt die rechte Hand abgehackt. Beim zweiten Mal die linke. Beim dritten Mal einen Fuß. Mörder werden geköpft.«
»Ich habe nicht vor, jemanden zu ermorden.«
»Warten Sie’s ab«, grunzte McIntyre. »Sie sind eben erst angekommen.«
Im Lager herrschte ein babylonisches Sprachgewirr, weil die Arbeiter und Angestellten aus aller Herren Länder sich ihrer Muttersprache bedienten. Mit seinem guten Ohr für Sprachen war Demiris bald in der Lage, ihren Unterhaltungen zu folgen. Die Männer bauten Straßen durch die Wüste, errichteten Unterkünfte, stellten Generatoren auf, verlegten Telefonkabel, richteten Werkstätten ein, Wasserleitungen und Drainagen und erfüllten Hunderte von weiteren Aufgaben. Sie schufteten bei Temperaturen von über 40 °C im Schatten und litten unter Fliegen, Moskitos, Sandstürmen, Fieber und Ruhr. Selbst hier in der Wüste gab es eine gesellschaftliche Hierarchie. Ganz oben standen die Männer, die nach Öl suchten, und unten waren die Bauarbeiter zu finden, die »Holzköpfe« hießen, und das als »Glanzhosen« bezeichnete Büropersonal.
Fast alle Männer, die mit der eigentlichen Ölsuche zu tun hatten – die Geologen, Vermesser, Ingenieure und Petrolchemiker –, waren Amerikaner, denn der neue Gestängebohrer war in den Vereinigten Staaten entwickelt worden, und die Amerikaner beherrschten seine Handhabung am besten. Constantin Demiris bemühte sich sehr um ihre Freundschaft.
Der junge Mann verbrachte möglichst viel Zeit in Gesellschaft der Bohrleute und bestürmte sie unermüdlich mit Fragen. Die so gewonnenen Informationen sog er auf wie der heiße Wüstensand das Wasser.
»Wird der Bohrmeißel nicht stumpf, wenn er ständig arbeitet?«
»Natürlich. Dann müssen wir das gottverdammte Bohrgestänge raufziehen, unten einen neuen Bohrmeißel dranschrauben und das Gestänge wieder runterlassen. Willst du auch mal Driller werden?«
»Nein, Sir. Ich werde Ölquellen besitzen.«
»Glückwunsch. Kann ich jetzt weiterarbeiten?«
»Entschuldigung, woher wissen Sie, wo Sie bohren müssen?«
»Wir haben viele Geologen – Steinschnüffler –, die unterirdische Schichten vermessen und Gesteinsproben analysieren. Danach sind die Seilwürger an der Reihe, um …«
»Entschuldigung, was ist ein Seilwürger?«
»Ein Driller. Sobald sie …«
Constantin Demiris arbeitete vom frühen Morgen bis Sonnenuntergang, transportierte Bohrtürme durch die glutheiße Wüste, säuberte Bohrausrüstungen und lenkte Lastwagen an aus felsigen Hügeln austretenden Flammenzungen vorbei. Diese Flammen brannten Tag und Nacht und fackelten die austretenden giftigen Gase ab.
J. J. McIntyre hatte Demiris die Wahrheit gesagt. Das Essen war schlecht, die Unterkünfte waren elend, und abends gab es keinerlei Unterhaltung. Noch schlimmer war, dass Demiris das Gefühl hatte, alle Poren seines Körpers wären mit Sandkörnern verstopft. Die Wüste lebte, und niemand konnte ihr entrinnen. Der Sand drang in die Hütte, durch seine Kleidung und in seinen Körper, bis er glaubte zu verzweifeln. Aber es sollte alles noch schlimmer kommen.
Der Schamal brach los. Einen Monat lang heulten Tag für Tag Sandstürme mit einer Intensität über das Lager hinweg, die einen Mann zum Wahnsinn treiben konnte.
Demiris starrte durch einen Türspalt seines Barasti in die wirbelnden Sandschwaden hinaus. »Sollen wir etwa dort draußen arbeiten?«
»Da hast du verdammt recht, Charlie-Boy! Du bist hier nicht auf Kur!«
Überall um sie herum wurde Öl entdeckt. Aus Abu Hadriya, aber auch aus Quatif und Haradh meldete man neue Funde, und die Arbeiter mussten Überstunden machen.
Zu den Neuankömmlingen im Lager gehörten ein englischer Geologe und seine Frau. Henry Potter war Ende sechzig und seine Frau Sybil Anfang dreißig. In jeder anderen Umgebung hätte Sybil Potter als durchschnittlich aussehende, übergewichtige Frau mit hoher, schriller Stimme gegolten. Aber in Fadhili war sie eine atemberaubende Schönheit. Da Henry Potter ständig unterwegs war, um neue Öllagerstätten zu erkunden, blieb seine Frau viel allein.
Der junge Demiris wurde ihr zugeteilt, um ihr beim Einzug zu helfen und die Eingewöhnung zu erleichtern.
»Dies ist das elendste Nest, das ich in meinem Leben gesehen habe«, jammerte Sybil Potter schrill. »Henry schleppt mich ständig in schreckliche Gegenden wie diese hier. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das immer wieder mitmache.«
»Ihr Mann leistet sehr wichtige Arbeit«, erklärte Demiris ihr. Sie betrachtete den attraktiven jungen Mann abschätzend. »Mein Mann leistet nicht auf allen Gebieten das, was er leisten sollte. Verstehst du, was ich meine?«
Demiris verstand nur allzu gut. »Nein, Ma’am.«
»Wie heißt du?«
»Demiris, Ma’am. Constantin Demiris.«
»Wie nennen deine Freunde dich?«
»Costa.«
»Nun, Costa, ich glaube, wir werden sehr gute Freunde werden. Jedenfalls haben wir nichts mit diesen Bimbos gemeinsam, nicht wahr?«
»Bimbos?«
»Du weißt schon – mit diesen Ausländern.«
»Ich muss weiterarbeiten«, sagte Demiris.
In den Wochen darauf erfand Sybil Potter ständig Gründe, um den jungen Mann zu sich zu rufen.
»Henry ist seit heute Morgen unterwegs«, erklärte sie ihm. »Wieder zu seiner blöden Bohrerei.« Sie fügte kokett hinzu: »Er sollte mehr zu Hause bohren.«
Demiris wusste nicht, was er sagen sollte. In der Firmenhierarchie war der Geologe ein sehr wichtiger Mann, und Demiris hatte nicht die Absicht, sich mit seiner Frau einzulassen und dadurch seinen Job zu gefährden. Ohne es begründen zu können, wusste er bestimmt, dass dieser Job der Schlüssel zu allem war, was er sich erträumt hatte. Die Zukunft gehörte dem Öl, und Demiris war entschlossen, daran teilzuhaben.
Eines Nachts ließ Sybil Potter ihn aus dem Bett holen. Demiris betrat die Siedlung, in der sie wohnte, und klopfte an die Tür ihres kleinen Hauses.
»Herein!« Sybil trug ein hauchdünnes Nachthemd, das unglücklicherweise nichts verbarg.
»Ich … Sie haben nach mir geschickt, Ma’am?«
»Ja, komm herein, Costa. Diese Nachttischlampe scheint defekt zu sein.«
Demiris trat mit abgewandtem Blick an den Nachttisch und griff nach der Lampe, um sie zu begutachten. »Die Glühbirne ist locker, darum …« Er spürte, wie ihr Leib sich gegen seinen Rücken drängte und ihre Hände über seinen Körper glitten. »Mrs. Potter …«
Sie küsste ihn heißhungrig und drückte ihn aufs Bett. Von diesem Augenblick an verlor er endgültig die Kontrolle über den Gang der Dinge.
Seine Sachen lagen auf dem Fußboden, und er stieß in sie hinein, und sie kreischte vor Lust. »So ist’s richtig! Ja, so! Mein Gott, wie lange hab’ ich das entbehren müssen!«
Zuletzt stöhnte sie auf, und ein Zittern durchlief ihren Körper. »Oh, Darling, ich liebe dich!«
Demiris war kurz davor, in Panik zu geraten. Was hast du getan? Wenn Potter das rauskriegt, bist du erledigt!
Sybil Potter kicherte, als habe sie seine Gedanken erraten. »Das bleibt unser kleines Geheimnis, nicht wahr, Darling?«
Ihr kleines Geheimnis existierte noch einige Monate weiter. Demiris konnte ihr nicht aus dem Weg gehen, und da ihr Mann jeweils für einige Tage unterwegs war, gab es keine Ausrede, die ihn davor hätte bewahren können, mit ihr ins Bett gehen zu müssen. Erschwerend kam hinzu, dass Sybil Potter sich sinnlos in ihn verliebt hatte.
»Du bist viel zu gut, um hier zu arbeiten, Darling«, erklärte sie ihm. »Du und ich, wir gehen nach England zurück.«
»Meine Heimat ist Griechenland.«
»Jetzt nicht mehr.« Sie streichelte seinen schlanken, sehnigen Körper. »Du kommst mit mir nach Hause. Ich lass mich von Henry scheiden, und wir heiraten.«
Demiris wurde von panikartiger Angst erfasst. »Sybil, ich … ich habe kein Geld. Ich …«
Sie ließ ihre Lippen über seine Brust wandern. »Das ist kein Problem. Ich weiß, wie du zu Geld kommen kannst, Sweetheart.«
»Wie denn?«
Sie setzte sich im Bett auf. »Gestern Abend hat Henry mir erzählt, dass er gerade ein neues großes Ölvorkommen entdeckt hat. Darauf versteht er sich wirklich, weißt du. Jedenfalls war er ganz aufgeregt! Bevor er wieder losfuhr, hat er seinen Bericht geschrieben und mich gebeten, ihn morgen dem Kurier mitzugeben. Ich habe ihn hier. Willst du ihn lesen?«
Demiris spürte sein Herz rascher schlagen. »Ja. Ich … ich würde ihn gern lesen.« Er beobachtete, wie sie aufstand und zu dem verkratzten Tischchen unter dem Fenster hinüberwatschelte. Sie griff nach einem großen braunen Umschlag und kam damit ins Bett zurück.
»Mach ihn auf!««
Demiris zögerte nur einen Augenblick. Er riss den Umschlag auf und zog Potters fünf Seiten langen Bericht heraus. Nachdem er ihn rasch überflogen hatte, las er ihn nochmals Wort für Wort.
»Sind diese Informationen was wert?«
Sind diese Informationen was wert? Dieser Bericht betraf ein neues Ölfeld, das wahrscheinlich zu den ergiebigsten aller bisher entdeckten Felder gehören würde.
Demiris schluckte trocken. »Ja. Sie … sie könnten wertvoll sein.«
»Da hast du’s!«, meinte Sybil zufrieden. »Jetzt haben wir Geld.«
Er seufzte. »So einfach ist es leider nicht.«
»Warum nicht?«
Demiris erklärte es ihr. »Damit ist nur jemandem geholfen, der es sich leisten kann, Optionen auf das Land über den Öllagerstätten zu kaufen. Und die kosten viel Geld, sehr viel Geld.« Er hatte knapp dreihundert Dollar auf seinem Bankkonto.
»Oh, deswegen brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Henry hat Geld. Ich schreibe dir einen Scheck. Genügen fünftausend Dollar?«
Constantin Demiris wollte seinen Ohren nicht trauen. »Ja. Ich … ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Es ist für uns, Darling. Für unsere Zukunft.«
Er setzte sich im Bett auf und überlegte angestrengt. »Sybil, glaubst du, dass du diesen Bericht noch ein bis zwei Tage hierbehalten kannst?«
»Natürlich. Ich lasse ihn bis Freitag liegen. Reicht das, Darling?«
Er nickte langsam. »Das müsste reichen.«
Mit den fünftausend Dollar von Sybil – Nein, das ist kein Geschenk, sondern ein Darlehen, sagte er sich – sicherte sich Constantin Demiris die Optionen auf das Land über den vermuteten Lagerstätten. Als dann einige Monate später die ersten Ölquellen zu sprudeln begannen, war er über Nacht zum Millionär geworden.
Er zahlte Sybil Potter ihre fünftausend Dollar zurück, schickte ihr ein neues Nachthemd und kehrte nach Griechenland heim.
Sie sah ihn nie wieder.
3
Eine Theorie besagt, dass in der Natur niemals etwas verloren geht – dass jeder jemals erzeugte Ton, jedes jemals gesprochene Wort noch irgendwo in Raum und Zeit existieren und möglicherweise eines Tages zurückgeholt werden können.
Wer hätte vor der Erfindung des Radios geglaubt, sagen die Verfechter dieser Theorie, dass die Atmosphäre um uns herum voller Musik und Nachrichten und Stimmen aus aller Welt ist? Eines Tages werden wir in die Vergangenheit zurückreisen und alles hören können: Lincolns Gettysburger Ansprache, die Stimme Shakespeares, die Bergpredigt …
Catherine Alexander hörte Stimmen aus ihrer Vergangenheit – aber sie waren undeutlich und bruchstückhaft und verwirrten sie nur noch mehr …
»Weißt du, dass du eine ganz besondere Frau bist, Cathy? Ich habe es auf den ersten Blick gemerkt …«
»Es ist aus, ich liebe eine andere. Ich lasse mich scheiden …«
»Ich weiß, wie gemein ich zu dir gewesen bin. Ich will alles wiedergutmachen …«
»Er hat versucht, mich umzubringen …«
»Wer hat versucht, Sie umzubringen?«
»Mein Mann!«
Die Stimmen wollten nicht verstummen. Sie waren eine Qual. Ihre Vergangenheit wurde zu einem Kaleidoskop aus wechselnden Bildern, die durch ihren Kopf huschten.
Das Kloster, das ihr ein wunderbar friedvoller Zufluchtsort hätte sein sollen, war plötzlich zu einem Gefängnis geworden. Ich gehöre nicht hierher. Aber wohin gehöre ich? Sie wusste es nicht.
Im Kloster gab es keinen Spiegel, aber in einem Teich im Garten spiegelte sich der Himmel. Catherine hatte ihn bisher bewusst gemieden, weil sie sich davor fürchtete, was er ihr zeigen würde. Aber an diesem Morgen ging sie zum Teich, kniete langsam nieder und betrachtete ihr Spiegelbild.
Die glatte Wasserfläche zeigte ihr eine höchst attraktive Frau mit schwarzem Haar, sonnengebräuntem Teint, ebenmäßigen Zügen und ernsten grauen Augen, die todtraurig wirkten – aber das konnte auch ein Trick des Wassers sein. Sie sah volle, zum Lächeln bereite Lippen und die leichte Stupsnase einer schönen Frau von Anfang dreißig – einer Frau ohne Vergangenheit und ohne Zukunft, einer Frau ohne Gedächtnis. Ich brauche jemanden, der mir hilft, dachte Catherine verzweifelt, jemanden, mit dem ich reden kann. Sie betrat Mutter Theresas Arbeitszimmer.
»Ehrwürdige Mutter …«
»Ja, mein Kind?«
»Ich … möchte mich von einem Arzt behandeln lassen. Von jemandem, der mir helfen kann, zu mir selbst zurückzufinden.«
Die Oberin bedachte sie mit einem langen Blick. »Setzen Sie sich.«
Catherine nahm auf dem Holzstuhl vor dem alten, verschrammten Schreibtisch Platz.
»Gott ist Ihr Arzt, meine Liebe«, stellte Mutter Theresa ruhig fest. »Er wird Sie beizeiten erfahren lassen, was Sie wissen sollen. Außerdem darf kein Fremder unser Kloster betreten.«
Catherine fiel plötzlich etwas ein … eine vage Erinnerung an einen Mann, der im Klostergarten mit ihr sprach, ihr irgendetwas gab … Aber das Bild verschwand so rasch, wie es gekommen war.
»Ich gehöre nicht hierher.«
»Wohin gehören Sie dann?«
Genau das war das Problem. »Das weiß ich nicht. Ich suche irgendetwas. Verzeihen Sie, Ehrwürdige Mutter, aber ich weiß, dass ich es hier nicht finden werde.«
Mutter Theresa beobachtete sie mit nachdenklicher Miene. »Ich verstehe. Wohin würden Sie von hier aus gehen?«
»Auch das weiß ich nicht.«
»Lassen Sie mich darüber nachdenken, mein Kind. Wir sprechen bald wieder darüber.«
»Danke, Ehrwürdige Mutter.«
Nachdem Catherine gegangen war, saß Mutter Theresa lange an ihrem Schreibtisch und starrte ins Leere. Sie hatte eine sehr schwere Entscheidung zu treffen. Zuletzt griff sie nach einem Briefbogen, schraubte ihren Füllfederhalter auf und begann zu schreiben.
»Sehr geehrter Herr«, schrieb sie, »hier ist eine Veränderung eingetreten, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Unsere gemeinsame Freundin hat mir erklärt, dass sie das Kloster zu verlassen wünscht. Teilen Sie mir bitte mit, was ich tun soll.«
Er las den kurzen Brief einmal, lehnte sich in seinen Sessel zurück und dachte über die Konsequenzen dieser Mitteilung nach. Catherine Alexander will also von den Toten auferstehen! Wie schade. Ich werde sie beseitigen lassen müssen. Aber vorsichtig, sehr vorsichtig.
Der erste Schritt würde der sein, sie aus dem Kloster zu holen. Constantin Demiris fand, dass es an der Zeit war, Mutter Theresa einen Besuch abzustatten.
Am nächsten Morgen ließ Demiris sich von seinem Chauffeur nach Ioannina fahren. Auf der Fahrt über Land dachte er an Catherine Alexander. Er erinnerte sich daran, wie schön sie gewesen war, als er sie kennengelernt hatte. Eine fröhliche, intelligente und geistreiche Frau, die sich auf ihr zukünftiges Leben in Griechenland gefreut hatte. Sie hat allesgehabt, dachte Demiris, und dann haben die Götter sich an ihr gerächt. Catherine war mit einem seiner Piloten verheiratet gewesen, und die Ehe mit ihm war zur Hölle auf Erden geworden. Catherine war fast über Nacht um zehn Jahre gealtert und zu einer schwammigen, aufgedunsenen Alkoholikerin geworden. Demiris seufzte. Schade um sie!
»Es ist mir sehr unangenehm, Sie damit belästigen zu müssen«, entschuldigte die Oberin sich, »aber das Kind weiß nicht, wohin es gehen soll, und …«
»Sie haben völlig richtig gehandelt«, versicherte Constantin Demiris ihr. »Hat sie denn gar keine Erinnerung an ihre Vergangenheit?«
Mutter Theresa schüttelte den Kopf. »Nein. Die Ärmste …« Sie trat ans Fenster und blickte in den Klostergarten hinaus, in dem mehrere Nonnen arbeiteten. »Sie ist dort draußen.«
Demiris stand auf, kam ans Fenster und sah ebenfalls hinaus. Die drei Nonnen kehrten ihnen den Rücken zu. Er wartete. Dann drehte sich die mittlere um, sodass er ihr Gesicht sehen konnte. Sie war so schön, dass es ihm fast den Atem verschlug. Wo war die schwammige, aufgedunsene Alkoholikerin geblieben?
»Sie ist die in der Mitte«, sagte Mutter Theresa.
Constantin Demiris nickte wortlos.
»Was soll ich mit ihr anfangen?«
Vorsichtig. »Lassen Sie mich darüber nachdenken«, antwortete Demiris. »Ich benachrichtige Sie dann.«
Constantin Demiris musste eine Entscheidung treffen. Catherine Alexanders Aussehen hatte ihn überrascht. Sie hatte sich völlig verwandelt. Kein Mensch würde sie wiedererkennen. Der Plan, der ihm jetzt einfiel, war so teuflisch simpel, dass er beinahe laut aufgelacht hätte.
Noch am selben Abend schrieb er Mutter Theresa einen kurzen Brief.
Ein Wunder!, dachte Catherine. Ein wahrgewordener Traum. Nach dem Morgengebet war Mutter Theresa in ihre winzige Zelle gekommen.
»Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen, mein Kind.«
»Ja, Ehrwürdige Mutter?«
Die Oberin wählte ihre Worte mit Bedacht. »Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich habe einem Freund des Klosters von Ihnen berichtet, und er will Ihnen helfen.«
Catherine fühlte ihr Herz jagen. »Mir helfen … Wie?«
»Das wird er Ihnen selbst erklären. Aber er ist ein sehr freundlicher und großzügiger Mann. Sie werden uns bald verlassen.«
Ihre Worte bewirkten, dass Catherine urplötzlich ein kalter Schauer über den Rücken lief. Sie würde in eine fremde Welt hinausgehen, an die sie sich nicht einmal erinnern konnte … Und wer ist mein Wohltäter?
Aber von Mutter Theresa erfuhr sie nichts weiter als: »Er ist ein sehr fürsorglicher Mann. Sie sollten ihm dankbar sein. Sein Wagen holt Sie am Montagmorgen ab.«
In den beiden folgenden Nächten fand Catherine Alexander kaum Schlaf. Die Vorstellung, das Kloster verlassen und in die unbekannte Welt hinausgehen zu müssen, war plötzlich erschreckend. Sie fühlte sich nackt und schutzlos. Vielleicht ist es besser, wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Bitte, lieber Gott, gib auf mich acht.
Am Montagmorgen stand die Limousine schon um sieben Uhr vor dem Klostertor. Catherine hatte die ganze Nacht wach gelegen und an die vor ihr liegende unbekannte Zukunft gedacht.
Mutter Theresa begleitete sie bis zum in die Welt hinausführenden Tor.
»Wir werden für Sie beten, mein Kind. Und denken Sie daran, dass wir immer Platz für Sie haben, falls Sie zurückkommen möchten.«
»Danke, Ehrwürdige Mutter. Ich werde daran denken.«
Aber in ihrem Innersten wusste Catherine, dass sie nie zurückkommen würde.
Die lange Fahrt von Ioannina nach Athen weckte in Catherine die widersprüchlichsten Empfindungen. Obwohl es herrlich aufregend war, außerhalb der Klostermauern zu sein, wirkte die Außenwelt irgendwie bedrohlich. Werde ich erfahren, was in meiner Vergangenheit Schreckliches passiert ist? Hat es irgendwas mit meinem immer wiederkehrenden Traum zu tun, in dem jemand versucht, mich zu ertränken?
Am frühen Nachmittag fuhren sie durch größere Dörfer, erreichten die Außenbezirke von Athen und befanden sich wenig später im Gewirr der Millionenstadt. Catherine erschien alles fremd und unwirklich – und dennoch merkwürdig vertraut. Hier bin ich schon einmal gewesen!, dachte sie aufgeregt.
Der Chauffeur fuhr nach Osten weiter, und eine Viertelstunde später erreichten sie einen riesigen Landsitz hoch auf einem Hügel. Sie fuhren an einem Pförtnerhäuschen vorbei durch ein hohes schmiedeeisernes Tor, folgten einer von majestätischen Zypressen gesäumten langen Auffahrt und hielten dann vor einer weitläufigen weißen Villa im mediterranen Stil, die von einem halben Dutzend herrlicher Statuen flankiert war.
Der Chauffeur riss Catherine den Schlag auf, und sie stieg aus. Vor dem Portal wartete ein Mann.
»Kalimera.« Das »Guten Tag« kam wie von selbst von Catherines Lippen.
»Kalimera.«
»Sind Sie … sind Sie der Mann, der mich hierher eingeladen hat?«
»Nein, Miss, ich bin der Butler. Mr. Demiris erwartet Sie in der Bibliothek.«
Demiris. Den Namen habe ich noch nie gehört. Weshalb will er mir helfen?
Catherine Alexander folgte dem Butler durch eine Rotunde, deren riesige Glaskuppel von Marmorsäulen getragen wurde. Auch der Fußboden bestand aus weißem italienischen Marmor.
Das große Wohnzimmer war eine Wohnhalle mit hoher Balkendecke und zu Sitzgruppen zusammengestellten, bequem niedrigen Ledersofas und -sesseln. Ein übergroßes Gemälde – ein dunkel dräuender Goya – nahm eine ganze Wand ein. Catherines Begleiter blieb vor der Tür zur Bibliothek stehen.
»Mr. Demiris erwartet Sie drinnen.«
Die Wände der Bibliothek verschwanden hinter mit Gold abgesetzten weißen Bücherschränken, in denen lange Reihen kostbarer Lederbände mit goldgeprägten Buchrücken standen. Hinter dem riesigen Schreibtisch am Fenster saß ein Mann. Er hob den Kopf, als Catherine hereinkam, und stand auf. Er beobachtete ihre Miene, ohne darin das geringste Zeichen von Erkennen zu finden.
»Willkommen! Ich bin Constantin Demiris. Wie ist Ihr Name?« Er stellte diese Frage eher beiläufig. Ob sie sich an ihren Namen erinnerte?
»Catherine Alexander.«
Demiris ließ keine Reaktion erkennen. »Willkommen, Miss Alexander. Nehmen Sie bitte Platz.« Er setzte sich ihr gegenüber auf eine schwarze Ledercouch. Aus der Nähe war Catherine noch attraktiver. Eine herrliche Frau. Sogar in dieser schwarzen Kutte … Eine Schande, etwas so Schönes zu vernichten. Wenigstens wird sie glücklich sterben.
»Es … ist sehr freundlich von Ihnen, mich zu empfangen«, begann Catherine zögernd. »Ich weiß allerdings nicht, weshalb Sie …«
Er lächelte freundlich. »Das ist schnell erklärt. Ich gehe Mutter Theresa von Zeit zu Zeit ein bisschen zur Hand. Das Kloster ist sehr arm, und ich tue, was ich kann. Als sie mir von Ihnen geschrieben und mich gebeten hat, Ihnen zu helfen, habe ich geantwortet, dass ich es gern versuchen würde.«
»Das ist sehr …« Sie machte eine Pause, weil sie nicht recht weiterwusste.
»Hat Mutter Theresa Ihnen gesagt, dass ich … dass ich das Gedächtnis verloren habe?«
»Ja, das hat sie erwähnt.« Er machte eine Pause, bevor er wie beiläufig fragte: »Woran erinnern Sie sich noch?«
»Ich weiß meinen Namen – aber nicht, woher ich komme oder wer ich wirklich bin.« Sie fügte hoffnungsvoll hinzu: »Vielleicht finde ich hier in Athen jemanden, der mich kennt.«
Constantin Demiris musste sich beherrschen, um sich nichts anmerken zu lassen. Gerade das musste unbedingt verhindert werden! »Das ist natürlich möglich«, sagte er bedächtig. »Warum unterhalten wir uns nicht morgen früh ausführlicher darüber? Jetzt muss ich leider zu einer Besprechung. Ich habe veranlasst, dass hier im Haus eine Gästesuite für Sie hergerichtet wurde. Sie werden sich darin wohlfühlen, hoffe ich.«
»Ich … ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen für alles danken soll.«
Er winkte ab. »Das brauchen Sie nicht. Hier werden Sie gut betreut. Fühlen Sie sich bitte wie zu Hause.«
»Danke, Mr. …«
»Meine Freunde nennen mich Costa.«
Die Hausdame führte Catherine in eine in sanften Pastelltönen gehaltene phantastische Gästesuite mit einem übergroßen Himmelbett, weißen Ledersofas und -sesseln, kostbaren alten Möbeln, chinesischen Vasenlampen und impressionistischen Gemälden. Meergrüne Lamellenjalousien hielten allzu grelles Sonnenlicht ab. Ein Blick aus dem Fenster zeigte Catherine in der Ferne einen Streifen des Saronischen Golfs.
»Mr. Demiris hat veranlasst, dass Ihnen eine Kleiderkollektion vorgelegt wird«, sagte die Hausdame. »Sie möchten sich bitte aussuchen, was Ihnen gefällt.«
Catherine wurde zum ersten Mal bewusst, dass sie noch immer die Ordenstracht aus dem Kloster trug.
»Danke.« Sie sank auf das weiche Bett und kam sich vor wie in einem Traum. Wer ist dieser Unbekannte – und weshalb ist er so freundlich zu mir?
Eine Stunde später hielt ein mit Kleiderkisten vollgepackter Lieferwagen vor dem Haus. Eine Directrice wurde in Catherines Suite geführt.
»Ich bin Madame Dimas. Mal sehen, womit wir arbeiten müssen. Würden Sie sich bitte ausziehen?«
»Ich … Verzeihung?«
»Ziehen Sie sich bitte aus. Solange Sie Ordenstracht tragen, kann ich Ihre Figur nicht beurteilen.«
Wie lange war es schon her, dass sie sich einem anderen Menschen nackt gezeigt hatte? Catherine zog sich langsam und verlegen aus. Als sie dann nackt vor der Directrice stand, musterte Madame Dimas sie mit geübtem Blick. Sie war beeindruckt.
»Sie haben eine ausgezeichnete Figur. Ich glaube, dass wir Sie sehr gut werden bedienen können.«
Zwei ihrer Assistentinnen schleppten Kisten voller Kleider, Unterwäsche, Blusen, Röcke und Schuhe herein.
»Suchen Sie sich aus, was Ihnen gefällt«, forderte Madame Dimas Catherine auf. »Danach probieren wir die Sachen an.«
»Ich … ich kann mir diese teuren Sachen nicht leisten!« protestierte Catherine. »Ich habe kein Geld.««
Die Directrice lachte. »Geld dürfte kein Problem sein. Die Rechnung geht an Mr. Demiris.«
Warum tut er das für mich?
Die feinen Stoffe erinnerten sie vage an Sachen, die sie früher getragen haben musste. Es waren Seiden-, Tweed- und Baumwollgewebe in ausgesuchten Farben.
Die drei Frauen arbeiteten so rasch und geschickt, dass Catherine nach zwei Stunden Besitzerin eines halben Dutzends eleganter Garnituren war. Ein überwältigendes Gefühl! Sie saß da und wusste nicht, was sie mit sich anfangen sollte.
Jetzt bin ich todschick – und weiß nicht, wohin. Doch, es gab ein Ziel – sie konnte in die Stadt fahren. Der Schlüssel zu allem, was ihr zugestoßen war, lag in Athen. Davon war sie überzeugt. Sie stand abrupt auf. Komm, Fremde, vielleicht kriegen wir raus, wer du bist.
Als Catherine die große Eingangshalle durchquerte, trat der Butler auf sie zu. »Kann ich Ihnen behilflich sein, Miss?«
»Ja. Ich … ich möchte in die Stadt fahren. Würden Sie mir bitte ein Taxi rufen?«
»Das wird nicht nötig sein, Miss. Unsere Limousinen stehen zu Ihrer Verfügung. Ich lasse einen Fahrer für Sie kommen.«
Catherine zögerte. »Danke.« Ob Mr. Demiris böse ist, wenn ich in die Stadt fahre? Er hat nicht gesagt, dass ich’s nicht tun soll.
Wenige Minuten später saß sie im Fond einer Daimler-Limousine und war in Richtung Stadtmitte unterwegs.
Das bunte, lärmende Treiben in den belebten Straßen und die Denkmäler und Ruinen, die draußen in eindrucksvoller Folge vorbeizogen, machten Catherine zunächst fast benommen.
Der Chauffeur zeigte nach vorn und sagte stolz: »Das ist der Parthenon, Miss, oben auf der Akropolis.«
Catherine starrte zu dem so vertrauten weißen Marmortempel hinauf. »Der jungfräulichen Athene, der Göttin der Weisheit, geweiht«, hörte sie sich sagen.
Der Fahrer lächelte anerkennend. »Interessieren Sie sich für griechische Geschichte, Miss?«
Tränen der Enttäuschung ließen die Akropolis vor Catherines Blick verschwimmen. »Ich weiß es nicht«, flüsterte sie. »Ich weiß es nicht.«
Sie fuhren an einer weiteren Ruine vorbei. »Dies ist das Odeion des Herodes Atticus. Wie Sie sehen, steht ein Teil der Mauern noch. Es hat einst über fünftausend Plätze gehabt.«
»Sechstausendzweihundertsiebenundfünfzig«, sagte Catherine leise.
Überall zwischen den zeitlosen Ruinen ragten Hotels und Bürogebäude auf – eine exotische Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart. In der Innenstadt fuhr die Limousine an einem großen Park mit einem glitzernden Springbrunnen in seiner Mitte vorbei. Dutzende von Tischen mit blauen Sonnenschirmen über grünen und orangeroten Schirmständern säumten den Park.
Das habe ich alles schon einmal gesehen, dachte Catherine, deren Hände klamm wurden. Und ich bin glücklich gewesen.
In fast jedem Häuserblock gab es Straßencafés, und an den Straßenecken verkauften Männer frisch aus dem Meer geholte Schwämme. Überall priesen Blumenhändler, deren Stände ein buntes Blütenmeer waren, stimmgewaltig ihre Ware an.
Die Limousine hatte den Syntagmaplatz erreicht.
Als sie an einem Hotel an einer Ecke des Platzes vorbeikamen, rief Catherine plötzlich: »Bitte halten Sie an!«
Sie konnte vor Aufregung kaum atmen. Dieses Hotel kenne ich. Hier habe ich schon gewohnt.
Ihre Stimme zitterte, als sie weitersprach. »Ich möchte hier aussteigen. Könnten Sie mich in … zwei Stunden abholen?«
»Natürlich, Miss.« Der Chauffeur beeilte sich, ihr die Tür zu öffnen, und Catherine stieg in die heiße Sommerluft aus. Sie fühlte, wie ihr die Beine zitterten. »Alles in Ordnung, Miss?« Sie konnte nicht antworten; sie hatte das Gefühl, am Rande eines Abgrunds zu stehen, dicht davor zu sein, in unbekannte, schreckliche Tiefen zu stürzen.
Catherine bewegte sich durch das ungewohnte Gedränge und staunte über die durch die Straßen hastenden Menschenmassen, deren Stimmen sich in einer lauten Kakophonie über sie ergossen. Nach der Einsamkeit und der Stille des Klosters erschien ihr alles unwirklich. Sie schlenderte zur Plaka, der Athener Altstadt, mit ihren verwinkelten Gassen, kleinen alten Häusern, Cafés und weißverputzten größeren Gebäuden. Irgendein Instinkt, den sie nicht verstand, aber auch nicht zu unterdrücken versuchte, wies ihr den Weg. Sie kam an einer Taverne vorbei, von deren Dachterrasse aus man die Stadt überblicken konnte, und blieb stehen, um sie anzustarren.
An diesem Tisch habe ich schon einmal gesessen. Jemand hat mir eine griechische Speisekarte in die Hand gedrückt. Wir sind zu dritt gewesen.
Was möchtest du essen?, haben sie gefragt.
Bestellt ihr bitte für mich? Ich habe Angst, ich könnte den Wirt bestellen.
Sie haben gelacht. Aber wer sind »sie« gewesen?
Ein Kellner näherte sich ihr. »Boro na sas?«
»Ojchi, efcharisto.«
Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke.
Woher habe ich das gewusst? Bin ich eine Griechin?
Catherine hastete weiter und hatte jetzt das Gefühl, von irgendjemandem geführt zu werden. Sie schien genau zu wissen, wohin sie gehen musste.
Alles erschien ihr vertraut und doch wieder nicht. Großer Gott, dachte sie, ich werde verrückt! Ich habe Halluzinationen. Sie kam an einem Café Treflinkas vorbei, das vage Erinnerungen in ihr wachrief. Irgendetwas hatte sich dort ereignet, irgendetwas Wichtiges. Aber sie wusste nicht, was es gewesen war.
Sie ging durch die belebten Gassen weiter und bog an der Voukourestiou nach links ab. Auch an die eleganten Geschäfte in dieser Straße erinnerte sie sich. Hier habe ich früher oft eingekauft.
Als sie die Straße überqueren wollte, kam eine blaue Limousine um die Ecke geschossen und verfehlte sie nur um Haaresbreite.
Sie erinnerte sich an eine Stimme, die ihr erklärte: Hier scheinen alle so zu fahren. Den Übergang zum Auto haben wir Griechen noch nicht geschafft. Im Herzen sind wir Eseltreiber geblieben. Wollen Sie uns Griechen verstehen lernen, müssen Sie statt Reiseführern die alten Tragödien lesen. Wir sind von großartigen Leidenschaften, starker Eifersucht und tiefer Trauer erfüllt und haben noch nicht gelernt, sie mit zivilisiertem Benehmen zu kaschieren.
Wer hat das zu mir gesagt?
Ein Mann, der ihr eilig entgegenkam, starrte sie an. Er ging langsamer, und seine Miene schien zu besagen, dass er sie wiedererkannte. Er war groß und schwarzhaarig, und Catherine glaubte zu wissen, dass sie ihn noch nie gesehen hatte. Und trotzdem …
»Hallo.« Der Mann schien sich über diese Begegnung sehr zu freuen.
»Hallo.« Catherine holte tief Luft. »Kennen Sie mich?«
Er nickte grinsend. »Natürlich kenne ich Sie.«
Catherine Alexander fühlte ihr Herz jagen. Endlich würde sie die Wahrheit erfahren! Aber wie konnte sie auf einer belebten Straße einen Unbekannten fragen: »Wer bin ich?«
»Können … können wir irgendwo miteinander reden?« schlug sie vor.
»Ja, das sollten wir.«
Catherine war dicht davor, in Panik zu geraten. Das Rätsel ihrer Identität sollte nun endlich gelöst werden. Trotzdem hatte sie schreckliche Angst. Was ist, wenn ich die Wahrheit besser nicht hören sollte? Wenn ich irgendwas Schreckliches getan habe?
Der Mann führte sie zur nächsten Taverne. »Ich freue mich sehr, Sie getroffen zu haben«, versicherte er ihr.
Catherine schluckte trocken. »Ja, ich auch.«
Ein Kellner wies ihnen einen Tisch an.
»Was möchten Sie trinken?«, fragte der Mann.
Sie schüttelte den Kopf. »Danke, nichts.«
Es gab so viele Fragen! Wo soll ich nur anfangen?
»Sie sind sehr schön«, sagte der Mann. »Unsere Begegnung ist ein Wink des Schicksals, finden Sie nicht auch?«
»Ja.« Vor Aufregung zitterte sie beinahe. Sie holte tief Luft. »Ich … Wo haben wir uns kennengelernt?«
Er winkte grinsend ab. »Ist das wichtig, Manarimou? In Paris, in Rom, beim Rennen, auf einer Party.« Er griff über den Tisch hinweg nach ihrer Hand. »Du bist hübscher als alle, die ich je hier gesehen habe. Was kostet es bei dir?«
Catherine starrte ihn an. Sie verstand nicht gleich, was er meinte, aber dann sprang sie entsetzt auf.
»He, was hast du plötzlich? Ich zahle, was du …«
Catherine wandte sich abrupt um, verließ fluchtartig das Lokal und hastete die Straße entlang. Erst nach der nächsten Ecke ging sie wieder langsamer. In ihren Augen standen Tränen der Erniedrigung.
Dann kam sie an einer Taverne vorbei, in deren Fenster ein Schild mit der Aufschrift MADAMEPIRIS – WAHRSAGERIN hing. Catherine blieb wie angewurzelt stehen. Ich kenne Madame Piris. Hier bin ich schon einmal gewesen. Sie hatte wieder Herzklopfen, weil sie spürte, dass hinter diesem dunklen Torbogen der Anfang vom Ende ihres Lebensmysteriums lag. Sie öffnete die Tür und trat ein. Ihre Augen brauchten einige Sekunden, um sich an das Halbdunkel des höhlenartigen Raums zu gewöhnen. Die Einrichtung bestand aus einer vertraut wirkenden Eckbar und einem Dutzend Tische mit hochlehnigen Stühlen. Ein Kellner kam auf sie zu und sprach sie auf Griechisch an.
»Kalimera.«
»Kalimera. Pu ine Madame Piris?«
»Madame Piris?«
Sie nickte wortlos.
Der Kellner deutete auf einen freien Tisch in einer Ecke des Lokals, und Catherine nahm daran Platz. Alles war genau so, wie sie es in Erinnerung hatte.
Eine ganz in Schwarz gekleidete Griechin, deren hageres Gesicht nur noch aus Ecken und Kanten zu bestehen schien, kam an den Tisch geschlurft.