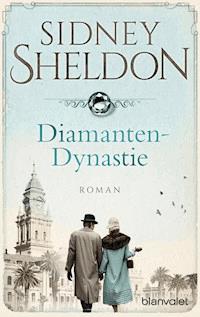2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine verhängnisvolle Affäre könnte Anwältin Jennifer nicht nur ihren Job, sondern auch ihr Leben kosten ...
Die junge Staatsanwältin Jennifer Parker begeht gleich an ihrem ersten Tag bei der Staatsanwaltschaft einen fatalen Fehler, und ihre berufliche Zukunft scheint ruiniert. Doch Jennifer kämpft um ihr Ansehen, macht sich als erfolgreiche Staranwältin einen Namen und verliebt sich in den verheirateten, aber überaus charmanten Politiker Adam Warner, der sich mit vollem Einsatz dem Kampf gegen New Yorks Mafia widmet. Damit scheint Ärger vorprogrammiert, denn Jennifer ist bald nicht nur die persönliche Anwältin des Mafia-Clans, sondern auch die heimliche Geliebte des gefürchteten Mafia-Bosses Michael Moretti.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Die junge Staatsanwältin Jennifer Parker begeht gleich an ihrem ersten Tag bei der Staatsanwaltschaft einen fatalen Fehler und ihre berufliche Zukunft scheint ruiniert. Doch Jennifer kämpft um ihr Ansehen, macht sich als erfolgreiche Staranwältin einen Namen und verliebt sich in den verheirateten aber überaus charmanten Politiker Adam Warner, der sich mit vollem Einsatz dem Kampf gegen New Yorks Mafia widmet. Damit scheint Ärger vorprogrammiert, denn Jennifer ist bald nicht nur die persönliche Anwältin des Mafia-Clans, sondern auch die heimliche Geliebte des gefürchteten Mafia-Bosses Michael Moretti.
Autor
Sidney Sheldon begeisterte bis heute über 300 Millionen Leser weltweit. Vielfach preisgekrönt – u.a. erhielt er 1947 einen Oscar für das Drehbuch zu So einfach ist die Liebe nicht –, stürmte er mit all seinen Romanen immer wieder die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. Er zählt zu den am häufigsten übersetzten Autoren und wurde dafür sogar mit einem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde geehrt. Im Jahr 2007, kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag, verstarb Sidney Sheldon.
Von Sidney Sheldon bereits erschienen:
Die Mühlen Gottes • Der Zorn der Götter • Kalte Glut •
Im Schatten der Götter • Diamanten-Dynastie • Schatten der Macht
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
SIDNEYSHELDON
Zorn der Engel
Roman
Deutsch von Claus Cornelius Fischer
Die Originalausgabe erschien 1980 unter dem Titel »Rage of Angels« bei William Morrow and Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 1880 by Sheldon Family Limited Partnership
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1980 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (© Markus Gann; © Anton Hlushchenko; © Javen)
LM • Herstellung: sam
ISBN 978-3-641-21389-3V003
www.blanvalet.de
Für Mary das achte Weltwunder in Liebe
Inhaltsverzeichnis
1
New York, 4. September 1969
Die Jäger bereiteten sich auf den Fangschuss vor.
Im Rom der Soldatenkaiser wäre der Wettkampf im Circus Neronis oder dem Kolosseum veranstaltet worden. Eine Meute hungriger Löwen hätte sich in einer blutbefleckten Arena an das Opfer herangeschlichen, begierig darauf, es in Stücke zu reißen. Aber wir leben im zivilisierten zwanzigsten Jahrhundert, und das Schauspiel fand im Sitzungssaal sechzehn des Gerichtsgebäudes von Downtown Manhattan statt.
Ah Stelle von Sueton hielt ein Gerichtsstenograf das Ereignis für die Nachwelt fest, und die täglichen Schlagzeilen über den Mordprozess hatten Dutzende Journalisten und Schaulustige angelockt, die schon um sieben Uhr morgens vor dem Gerichtssaal eine Schlange bildeten, um einen Sitzplatz zu ergattern.
Das Opfer saß auf der Anklagebank. Michael Moretti, ein schweigsamer, gutaussehender Mann Anfang Dreißig, war groß und schlank. Sein flächiges, durchfurchtes Gesicht verlieh ihm einen rauen, fast etwas groben Ausdruck. Das schwarze Haar war modisch geschnitten, er hatte ein vorspringendes Kinn mit einem Grübchen, das gar nicht zu ihm zu passen schien, und tiefliegende, olivschwarze Augen. Er trug einen maßgeschneiderten grauen Anzug, ein hellblaues Hemd mit dunkelblauem Seidenschlips und frisch geputzte, handgemachte Schuhe. Abgesehen von seinen Augen, die ununterbrochen durch den Gerichtssaal schweiften, bewegte Michael Moretti sich kaum.
Der Löwe, der auf ihn losging, war Robert Di Silva, der hitzige Bezirksstaatsanwalt von New York, der hier als Vertreter des Volkes auftrat. Im Gegensatz zu der Ruhe, die Michael Moretti ausstrahlte, schien Di Silva vor dynamischer Energie zu vibrieren. Er hastete durch das Leben, als hätte er sich schon bei der Geburt um fünf Minuten verspätet. Er war ständig in Bewegung, ein Sparringspartner unsichtbarer Gegner. Di Silva war von kleiner, kräftiger Statur und hatte graues, altmodisch kurzgeschnittenes Haar. In seiner Jugend war er Boxer gewesen, woran die Narben in seinem Gesicht und die gebrochene Nase noch heute erinnerten. Einmal hatte er einen Mann im Ring getötet. Er hatte es nie bedauert. Auch in den Jahren danach war Mitleid für ihn ein Fremdwort geblieben.
Robert Di Silva war von brennendem Ehrgeiz erfüllt, und er hatte sich bei dem Kampf um seine gegenwärtige Position weder auf Geld noch auf Beziehungen stützen können. Im Zuge seines Aufstiegs hatte er sich den Anstrich eines zivilisierten Beamten gegeben; aber unter der Tünche war er ein Straßenschläger geblieben, der weder vergaß noch vergab.
Unter normalen Umständen hätte sich der Staatsanwalt heute nicht im Gerichtssaal sehen lassen. Er verfügte über einen großen Stab, und jeder seiner gehobenen Assistenten wäre fähig gewesen, die Anklage zu vertreten. Aber im Fall von Moretti hatte Di Silva von Anfang an gewusst, dass er die Sache selber in die Hand nehmen würde.
Michael Moretti machte Schlagzeilen; er war der Schwiegersohn von Antonio Granelli, dem capo di tutti capi, dem Don der größten östlichen Mafia-Familie. Antonio Granelli wurde alt, und überall hieß es, Moretti werde den Platz seines Schwiegervaters einnehmen. Moretti war an zahllosen Verbrechen von Körperverletzung bis zum Mord beteiligt gewesen, aber kein Staatsanwalt hatte ihm jemals etwas nachweisen können. Zu viele gute Anwälte standen zwischen Moretti und den Männern, die seine Befehle ausführten. Di Silva hatte selber drei frustrierende Jahre mit dem Versuch verbracht, Beweismaterial gegen Moretti zusammenzutragen. Dann hatte er auf einmal Glück gehabt.
Camillo Stela, einer von Morettis soldati, war bei einem Mord während eines Raubüberfalls verhaftet worden. Um seinen Kopf zu retten, hatte Stela gesungen. Es war die schönste Musik, die Di Silva je gehört hatte – ein Lied, das die mächtigste Mafia-Familie des Ostens in die Knie zwingen, Michael Moretti auf den elektrischen Stuhl und Robert Di Silva auf den Gouverneurssessel des Staates New York bringen würde. Schon andere Gouverneure hatten den Sprung ins Weiße Haus geschafft: Martin Van Buren, Grover Cleveland, Teddy Roosevelt und Franklin Roosevelt. Di Silva hatte fest vor, der nächste zu sein.
Das Timing war perfekt. Im nächsten Jahr standen Gouverneurswahlen an, und der einflussreichste politische Boss des Staates war schon bei Di Silva vorstellig geworden. »Mit der Publicity, die Ihnen dieser Fall einbringen wird, haben Sie alle Chancen, für die Wahl zum Gouverneur aufgestellt zu werden und auch die nötigen Stimmen zu kriegen, Bobby. Nageln Sie Moretti fest, und Sie sind unser Kandidat.«
Robert Di Silva war kein Risiko eingegangen. Er hatte den Fall Moretti mit peinlicher Sorgfalt vorbereitet, seine Assistenten auf jedes Beweisstück, jedes lose Ende, jeden juristischen Fluchtweg angesetzt, die Morettis Anwalt vielleicht benutzen konnte, um ihnen ein Bein zu stellen. Nach und nach waren alle Schlupflöcher versiegelt worden.
Die Auswahl der Geschworenen hatte fast zwei Wochen gedauert, und der Staatsanwalt hatte darauf bestanden, sechs Ersatzgeschworene zu bestimmen, damit der Prozess nicht noch mittendrin platzte. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Mitglieder der Jury in einem Verfahren gegen einen wichtigen Mafioso verschwanden oder tödliche Unfälle erlitten. Di Silva hatte höllisch genau darauf geachtet, dass die Geschworenen von Anfang an völlig isoliert waren, dass sie jeden Abend an einem sicheren Ort eingeschlossen wurden, wo niemand sie finden konnte.
Der Schlüssel im Fall gegen Michael Moretti war Camillo Stela, und als Di Silvas Starzeuge wurde er besser bewacht als der Direktor des FBI. Der Staatsanwalt erinnerte sich nur zu gut daran, wie Abe »Kid Twist« Reles als Zeuge der Anklage aus einem Fenster im sechsten Stock des Half Moon Hotels auf Coney Island »gefallen« war, obwohl er von einem halben Dutzend Polizeibeamten bewacht wurde. Di Silva hatte Camillo Stelas Wächter persönlich ausgesucht, und vor Prozessbeginn war Stela jede Nacht in ein anderes Versteck gebracht worden. Jetzt und für die Dauer der Verhandlung wurde Stela, bewacht von vier bewaffneten Deputies, in einer isolierten Zelle unter Verschluss gehalten. Niemand durfte in seine Nähe, denn Stela war nur deswegen bereit, auszusagen, weil er glaubte, Staatsanwalt Di Silva sei fähig, ihn vor Michael Morettis Rache zu schützen.
Es war der Morgen des fünften Verhandlungstages.
Jennifer Parker wohnte der Verhandlung an diesem Tag zum ersten Mal bei. Zusammen mit fünf anderen jungen Assistenten der Staatsanwaltschaft, die an diesem Morgen mit ihr vereidigt worden waren, saß sie am Tisch des Anklägers.
Sie war eine schlanke, dunkelhaarige Frau von vierundzwanzig Jahren. Sie hatte einen blassen Teint, ein intelligentes, lebhaftes Gesicht und grüne, nachdenkliche Augen. Es war ein eher attraktives als schönes Gesicht, ein Gesicht, das Stolz, Mut und Sensibilität widerspiegelte und schwer zu vergessen war. Steif wie ein Ladestock saß sie auf ihrem Stuhl, als stemme sie sich gegen unsichtbare Geister aus der Vergangenheit.
Jennifer Parkers Tagesbeginn war eine Katastrophe gewesen. Da die Vereidigungszeremonie im Büro des Staatsanwalts auf acht Uhr morgens angesetzt worden war, hatte Jennifer bereits am Abend zuvor ihre Kleidung zurechtgelegt und den Wecker auf sechs Uhr gestellt, damit sie noch genug Zeit hatte, sich die Haare zu waschen.
Der Wecker klingelte nicht. Jennifer wurde erst um halb acht wach. In panischer Hast zog sie sich an. Dann brach ihr ein Absatz ab, und schließlich riss sie sich eine Laufmasche in den Strumpf, so dass sie sich noch einmal umziehen musste. Sie schlug die Tür ihres winzigen Appartements zu – eine Sekunde bevor ihr einfiel, dass sie ihren Schlüssel drinnen vergessen hatte. Ursprünglich hatte sie den Bus zum Gericht nehmen wollen, aber daran war jetzt nicht mehr zu denken. So hetzte sie sich nach einem Taxi ab, das sie sich nicht leisten konnte, und fiel zu allem Überfluss einem Fahrer in die Hände, der ihr während der ganzen Fahrt erzählte, warum es mit der Welt zu Ende gehe.
Als Jennifer schließlich völlig außer Atem das Gerichtsgebäude in der Leonard Street Nr. 155 erreichte, war sie eine Viertelstunde zu spät dran.
Im Büro des Staatsanwalts hatten sich fünfundzwanzig Anwälte versammelt, die meisten frisch von der Universität, jung, zu allem bereit und begierig, für den Staatsanwalt von New York zu arbeiten.
Das Büro war eindrucksvoll. Es war mit einer getäfelten Wandverkleidung versehen und ruhig und geschmackvoll eingerichtet. Es gab einen riesigen Schreibtisch mit drei Stühlen davor und einem komfortablen Ledersessel dahinter, einen mit einem guten Dutzend Stühlen bestückten Konferenztisch und mit juristischer Fachliteratur gefüllte Wandregale. An den Wänden hingen handsignierte Bilder von J. Edgar Hoover, John Lindsay, Richard Nixon und Jack Dempsey.
Als Jennifer in das Büro platzte, den Kopf voller Entschuldigungen, unterbrach sie Di Silva in der Mitte eines Satzes. Er hielt inne, blickte sie an und sagte: »Für was, zum Teufel, halten Sie das hier? Eine Teeparty?«
»Es tut mir furchtbar leid, ich …«
»Ich pfeife darauf, ob es Ihnen leid tut. Wagen Sie es nicht noch einmal, zu spät zu kommen!«
Die anderen sahen Jennifer ausdruckslos an, bemüht, ihr Mitgefühl zu verbergen.
Di Silva wandte sich wieder der Gruppe zu und sagte scharf: »Ich weiß, warum Sie alle hier sind. Sie werden mir so lange an den Fersen kleben, bis Sie glauben, mir alles abgeschaut und sämtliche Tricks im Gerichtssaal gelernt zu haben. Und wenn Sie sich dann für reif halten, werden Sie die Fronten wechseln und einer von den teuren, nassforschen Strafverteidigern werden. Aber vielleicht ist unter Ihnen ein einziger, der gut genug ist, um – vielleicht – eines Tages meinen Platz einzunehmen.« Di Silva nickte seinem Assistenten zu.
»Vereidige sie.«
Mit gedämpfter Stimme leisteten die Anwälte den Eid.
Als die Zeremonie vorbei war, sagte Di Silva: »In Ordnung, Sie sind jetzt vereidigte Justizbeamte, möge Gott uns beistehen. Es konnte Ihnen nichts Besseres passieren als dieses Büro, aber erwarten Sie nicht zu viel. Sie werden in Akten und Papierkrieg ersticken – Vorladungen, Zwangsvollstreckungen – all die wunderbaren Dinge, die man Ihnen auf der Uni beigebracht hat. Eine Verhandlung werden Sie frühestens in ein oder zwei Jahren führen.«
Di Silva unterbrach sich, um eine kurze, dicke Zigarre anzuzünden. »Zurzeit vertrete ich die Anklage in einem Fall, von dem einige von Ihnen vielleicht schon gehört haben.« Seine Stimme war scharf vor Sarkasmus. »Ich kann ein halbes Dutzend von Ihnen als Laufburschen gebrauchen.«
Jennifers Hand war als erste oben. Di Silva zögerte einen Augenblick, dann wählte er sie und fünf andere.
»Geht runter in Sitzungssaal sechzehn.«
Als sie den Raum verließen, wurden ihnen Ausweise ausgehändigt. Jennifer hatte sich von der Art des Staatsanwalts nicht einschüchtern lassen. Er muss hart sein, dachte sie. Schließlich hat er einen harten Job. Und jetzt arbeitete sie für ihn. Sie gehörte zum Stab des Staatsanwalts von New York! Die scheinbar endlosen Jahre der Schinderei an der juristischen Fakultät waren vorbei. Irgendwie hatten ihre Dozenten es geschafft, das Gesetz abstrakt und verstaubt wirken zu lassen, aber Jennifer hatte das versprochene Paradies dahinter dennoch nicht aus den Augen verloren: die wirkliche Rechtsprechung über menschliche Wesen und ihre Torheiten. Jennifer hatte als zweitbeste in ihrer Klasse abgeschnitten. Sie bestand das Examen im ersten Anlauf, während ein Drittel ihrer Kommilitonen, die es mit ihr versucht hatten, durchgefallen waren. Sie hatte das Gefühl, Robert Di Silva zu verstehen, und sie war sicher, dass sie jeder Aufgabe gewachsen war, die er ihr geben würde.
Jennifer hatte ihre Hausaufgaben erledigt. Sie wusste, dass dem Staatsanwalt vier verschiedene Büros unterstellt waren, und sie fragte sich, welchem sie zugeteilt werden würde. Es gab über zweihundert Assistenten der Staatsanwälte und fünf Staatsanwälte, einen für jeden Bezirk. Aber der bedeutendste Bezirk war natürlich Manhattan, und den beherrschte Robert Di Silva.
Jetzt, im Gerichtssaal, saß Jennifer am Tisch des Anklägers und erlebte Di Silva bei der Arbeit, einen energischen, unbarmherzigen Inquisitor.
Jennifer warf einen flüchtigen Blick auf den Angeklagten, Michael Moretti. Trotz allem, was sie über ihn gelesen hatte, konnte Jennifer ihn sich nicht als Mörder vorstellen. Er sieht wie ein junger Filmstar in einer Gerichtsszene aus, dachte sie. Er bewegte sich nicht, nur seine tiefliegenden, dunklen Augen verrieten seine innere Unruhe. Unaufhörlich blickten sie hin und her, drangen in jeden Winkel des Raums, als suchten sie nach Fluchtmöglichkeiten. Aber es gab keine. Darauf hatte Di Silva geachtet.
Camillo Stela wartete im Zeugenstand. Wäre Stela ein Tier geworden, dann hätte er als Wiesel das Licht der Welt erblickt. Er hatte ein schmales, ausgemergeltes Gesicht mit dünnen Lippen und gelben, vorstehenden Zähnen. Sein Blick war unstet, und man hielt ihn schon für einen Lügner, ehe er auch nur den Mund geöffnet hatte. Robert Di Silva war sich der Mängel seines Zeugen bewusst, aber sie zählten nicht. Das einzige, was zählte, war seine Aussage. Er hatte grauenvolle. Geschichten zu erzählen, Geschichten, die noch nie erzählt worden waren, und sie hatten den unmissverständlichen Klang der Wahrheit.
Der Staatsanwalt trat an den Zeugenstand, wo Camillo Stela vereidigt worden war.
»Mr. Stela, ich möchte, dass sich die Jury darüber im Klaren ist, dass Sie sich nicht freiwillig als Zeuge zur Verfügung gestellt haben und dass der Staat Sie nur deshalb zu dieser Aussage überreden konnte, weil er Ihnen gestattet hat, sich nur wegen Totschlags und nicht, wie ursprünglich, wegen Mordes zu verantworten. Ist das richtig?«
»Ja, Sir.« Stelas rechter Arm zuckte.
»Mr. Stela, ist der Angeklagte, Michael Moretti, Ihnen bekannt?«
»Ja, Sir.« Stela vermied es, zum Tisch des Angeklagten hinüberzublicken.
»Welcher Art war Ihre Beziehung?«
»Ich habe für Mike gearbeitet.«
»Wie lange kennen Sie Michael Moretti?«
»Ungefähr zehn Jahre.« Stelas Stimme war fast unhörbar.
»Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen?«
»Ungefähr zehn Jahre.« Jetzt begann sein Nacken zu zucken.
»Würden Sie sagen, Sie waren ein Vertrauter des Angeklagten?«
»Einspruch!« Thomas Colfax, Morettis Verteidiger, sprang auf. Er war ein großer, silberhaariger Mann in den Fünfzigern, der consigliere des Syndikats und einer der gerissensten Strafverteidiger des Landes. »Der Staatsanwalt versucht, den Zeugen zu beeinflussen.«
Richter Lawrence Waldman sagte: »Stattgegeben.«
»Ich formuliere die Frage neu. In welcher Eigenschaft arbeiteten Sie für Mr. Moretti?«
»Man könnte sagen ich war eine Art Feuerwehrmann für leichte Fälle.«
»Würden Sie das etwas genauer erklären?«
»Nun ja, also, wenn sich ein Problem stellte, wenn jemand aus der Reihe tanzte, dann beauftragte Mike mich damit, die Sache wieder in Ordnung zu bringen.«
»Wie haben Sie das gemacht?«
»Nun ja – mit Gewalt, wissen Sie.«
»Könnten Sie der Jury ein Beispiel geben?«
Thomas Colfax war wieder auf den Beinen. »Einspruch, Euer Ehren! Dieser Teil des Verhörs ist unerheblich.«
»Abgelehnt. Der Zeuge kann die Frage beantworten.«
»Also, Mike verleiht zum Beispiel Geld zu einem bestimmten Zinssatz, klar? Vor’n paar Jahren liegt Jimmy Serrano mit seinen Zahlungen im Rückstand, und da schickt Mike mich hin, damit ich Jimmy eine Lektion erteile.«
»Worin bestand diese Lektion?«
»Ich hab’ ihm die Beine gebrochen. Verstehen Sie«, erklärte Stela ernsthaft, »wenn man einem so was durchgehen lässt, probieren alle anderen es auch.«
Aus den Augenwinkeln konnte Robert Di Silva den schockierten Ausdruck auf den Gesichtern der Geschworenen erkennen.
»Abgesehen davon, dass Michael Moretti ein Kredithai war – in welche anderen Geschäfte war er noch verwickelt?«
»Ach Gott, in alles, was es so gibt. Was Sie auch aufzählen, er war dabei.«
»Ich möchte aber, dass Sie die Geschäfte aufzählen, Mr. Stela.«
»Ja, gut. Also, im Hafen, da macht Mike einen ganz guten Schnitt bei der Gewerkschaft. Genauso in der Textilbranche. Na ja, dann war Mike noch im Glücksspiel, kassierte bei den Musikboxen, der Müllabfuhr und den Wäschereien. Das war’s so ungefähr.«
»Mr. Stela, Michael Moretti steht vor Gericht wegen der Morde an Eddie und Albert Ramos. Kannten Sie die?«
»Klar.«
»Waren Sie dabei, als sie getötet wurden?«
»Ja.« Stelas ganzer Körper schien zu zucken.
»Wer genau hat sie getötet?«
»Mike.« Für eine Sekunde kreuzten sich Stelas und Morettis Blicke, dann sah Stela rasch in eine andere Richtung.
»Michael Moretti?«
»Richtig.«
»Warum wollte der Angeklagte, dass die Brüder Ramos sterben sollten?«
»Na ja, Eddie und Al nahmen Wetten an …«
»Sie waren Buchmacher? Illegale Wetten?«
»Ja. Mike hatte herausgefunden, dass sie für sich selber absahnten. Er musste ihnen eine Lektion erteilen, weil, nun schließlich arbeiteten sie für ihn, verstehen Sie? Er dachte …«
»Einspruch!«
»Stattgegeben. Der Zeuge soll sich an die Tatsachen halten.«
»Nun, tatsächlich hat Mike mir befohlen, die Jungs einzuladen …«
»Eddie und Albert Ramos?«
»Genau, zu einer Party im Pelikan. Das ist ein Privatclub am Strand.« Sein Arm begann erneut zu zucken. Als Stela das bemerkte, versuchte er, ihn mit der anderen Hand festzuhalten.
Jennifer Parker warf einen Blick auf Michael Moretti. Er verfolgte das Verhör teilnahmslos, ohne sich zu bewegen.
»Was geschah dann, Mr. Stela?«
»Ich habe Eddie und Al in den Wagen geladen und zum Parkplatz gefahren. Als die Jungs aus dem Wagen stiegen, hab’ ich gemacht, dass ich aus dem Weg kam, und Mike begann loszuballern.«
»Haben Sie die Brüder Ramos hinfallen gesehen?«
»Ja, Sir.«
»Und sie waren tot?«
»Zumindest wurden sie beerdigt, als wären sie tot gewesen.«
Ein Raunen ging durch den Gerichtssaal. Di Silva wartete, bis wieder Stille herrschte. »Mr. Stela, sind Sie sich bewusst, dass Ihre Aussage in diesem Saal Sie selbst belastet?«
»Ja, Sir.«
»Und dass Sie unter Eid stehen und dass es um das Leben eines Menschen geht?«
»Ja, Sir.«
»Sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie der Angeklagte, Michael Moretti, kaltblütig zwei Männer erschossen hat, weil sie ihn übers Ohr gehauen hatten?«
»Einspruch! Der Staatsanwalt beeinflußt den Zeugen.«
»Stattgegeben.«
Staatsanwalt Di Silva betrachtete die Gesichter der Geschworenen, und ihre Mienen sagten ihm, dass er den Fall gewonnen hatte.
Er wandte sich wieder an Camillo Stela. »Mr. Stela, ich weiß, dass es Sie sehr viel Mut gekostet hat, hier in den Zeugenstand zu treten und auszusagen. Ich möchte Ihnen im Namen der Bürger dieses Staates danken.«
Di Silva wandte sich an Thomas Colfax. »Ihr Zeuge.«
Thomas Colfax erhob sich beinahe anmutig. »Ich danke Ihnen, Mr. Di Silva.« Er warf einen kurzen Blick auf die Uhr an der Wand und wandte sich dann zur Richterbank. »Wenn Sie gestatten, Euer Ehren, es ist jetzt fast Mittag. Ich würde mein Kreuzverhör gern ohne Unterbrechung durchführen. Darf ich vorschlagen, dass das Gericht sich jetzt zum Mittagessen zurückzieht und ich mein Kreuzverhör am Nachmittag abhalte?« »Einverstanden.« Richter Lawrence Waldman ließ den Hammer auf die Richterbank fallen. »Die Verhandlung wird auf zwei Uhr vertagt.«
Alle Anwesenden im Gerichtssaal standen auf, als sich der Vorsitzende erhob und durch eine Seitentür ins Richterzimmer ging. Im Gänsemarsch verließen die Geschworenen den Saal. Vier bewaffnete Deputies umgaben Camillo Stela und eskortierten ihn durch eine Tür an der Stirnseite des Raums zum Aufenthaltsraum der Zeugen.
Fast sofort war Di Silva von Reportern umzingelt.
»Wollen Sie eine Erklärung abgeben?«
»Wie sind Sie mit dem Verlauf bis jetzt zufrieden, Herr Staatsanwalt?«
»Wie wollen Sie Stelas Sicherheit gewährleisten, wenn alles vorbei ist?«
Normalerweise hätte Robert Di Silva einen solchen Aufruhr im Gerichtssaal nicht toleriert, aber in Anbetracht seiner politischen Ambitionen wollte er sich mit der Presse gutstellen, und so beschloss er, höflich zu ihnen zu sein.
Jennifer Parker beobachtete, wie der Staatsanwalt die Fragen der Reporter parierte.
»Glauben Sie, dass Sie eine Verurteilung erreichen?«
»Ich bin kein Wahrsager«, hörte sie Di Silva bescheiden antworten. »Ich will der Jury nicht vorgreifen, meine Damen und Herren. Die Geschworenen werden entscheiden müssen, ob Mr. Moretti unschuldig oder schuldig ist.«
Jennifer bemerkte, wie sich Michael Moretti erhob. Er wirkte ruhig und entspannt. Jungenhaft war das Wort, das ihr einfiel. Es fiel ihr schwer, zu glauben, dass er all der schrecklichen Dinge, deren er angeklagt war, schuldig sein sollte. Wenn ich einen Schuldigen bestimmen müsste, dachte sie, wäre es Stela mit seinem ewigen Zucken.
Die Reporter waren abgezogen, und Di Silva beriet sich mit den Angehörigen seines Stabs. Jennifer hätte ihren rechten Arm dafür gegeben, zu hören, worüber sie sprachen. Sie bemerkte, wie einer der Männer etwas zu Di Silva sagte, sich aus der Gruppe um den Staatsanwalt löste und zu ihr eilte. Er hielt einen großen Manilaumschlag in der Hand. »Miss Parker?« Überrascht sah Jennifer auf. »Ja.«
»Der Chef möchte, dass Sie dies Mr. Stela geben. Er soll sein Gedächtnis mit den Papieren etwas auffrischen. Colfax wird heute Nachmittag versuchen, seine Aussage in der Luft zu zerfetzen, und der Chef möchte sicher sein, dass er sich nicht in Widersprüche verwickelt.«
Er händigte Jennifer den Umschlag aus, und sie sah zu Di Silva hinüber. Ein gutes Omen, dachte sie, er erinnert sich an meinen Namen.
»Am besten beeilen Sie sich. Der Chef hält Stela nicht gerade für schnell von Begriff.«
»Ja, Sir.« Jennifer sprang auf. Sie ging zu der Tür, durch die Stela verschwunden war. Ein bewaffneter Deputy versperrte ihr den Weg.
»Kann ich Ihnen helfen, Miss?«
»Büro des Staatsanwalts«, sagte Jennifer trocken. Sie förderte ihren Ausweis zutage und wies ihn vor. »Ich habe Mr. Stela einen Umschlag von Mr. Di Silva zu übergeben.«
Der Uniformierte prüfte den Ausweis sorgfältig, dann öffnete er die Tür, und Jennifer stand im Aufenthaltsraum des Zeugen. Es war ein kleines, ungemütlich wirkendes Zimmer, das lediglich einen abgenutzten Tisch, ein altes Sofa und ein paar Holzstühle enthielt. Stela saß auf einem der Stühle, sein Arm zuckte unkontrolliert. Außer ihm befanden sich noch vier bewaffnete Deputies in dem Zimmer.
2
Auf ihrem Weg zum Mittagessen kam Jennifer an der offenen Tür des verlassenen Sitzungssaals vorbei. Sie konnte nicht widerstehen und betrat den Raum für einen Moment.
Im hinteren Teil des Saals standen fünfzehn Zuschauerbänke zu beiden Seiten des Mittelgangs. Gegenüber der Richterbank gab es zwei lange Tische, der linke trug ein Schild mit der Aufschrift Kläger, der rechte eins mit dem Wort Angeklagter. Der Geschworenenstand enthielt zwei Reihen von je acht Stühlen. Ein ganz gewöhnlicher Gerichtssaal, dachte Jennifer, ganz schlicht – sogar hässlich, aber dennoch das Herz der Freiheit. Dieser Raum und alle anderen Gerichtssäle auf der ganzen Welt stellten nichts Geringeres dar als den Unterschied zwischen Zivilisation und Barbarei. Das Recht auf einen Prozess vor einer Jury von Gleichgestellten war das Kernstück einer jeden freien Nation.
Sie war jetzt ein Bestandteil dieses Justizsystems, und in diesem Augenblick, da sie allein im Gerichtssaal stand, war Jennifer von überwältigendem Stolz erfüllt. Sie würde alles tun, um sich dieses Systems würdig zu erweisen und es zu erhalten. Lange Zeit blieb sie bewegungslos stehen, dann wandte sie sich zum Gehen.
Vom anderen Ende der Halle drang plötzlich ein leises Summen an ihr Ohr, das lauter und lauter wurde und sich in einen Höllenlärm verwandelte. Alarmglocken schrillten. Jennifer hörte das Geräusch von rennenden Füßen im Korridor und sah Polizeibeamte mit gezogenen Waffen zum Eingang des Gerichtsgebäudes rennen. Ihr erster Gedanke war, dass Michael Moretti geflohen war, dass er es irgendwie geschafft hatte, den Wächtern zu entwischen. Sie stürzte auf den Korridor. Es war wie in einem Irrenhaus. Menschen liefen wie Ameisen durcheinander, versuchten, den Lärm der Klingeln zu überbrüllen. Wachen mit Schnellfeuergewehren hatten die Ausgänge besetzt. Reporter, die ihren Redaktionen telefonisch ihre Stories durchgegeben hatten, rannten auf den Korridor, um herauszufinden, was los war. Am Ende der Halle sah Jennifer Staatsanwalt Di Silva, der mit hochrotem Gesicht einem halben Dutzend Polizisten Instruktionen erteilte.
Mein Gott, gleich hat er einen Herzanfall, dachte sie.
Sie bahnte sich einen Weg durch die Menge, in der Annahme, sie könnte vielleicht von Nutzen sein. Als sie sich näherte, blickte einer der Deputies, die Camillo Stela bewacht hatten, auf. Er hob seinen Arm und deutete auf sie. Fünf Sekunden später war sie mit Handschellen gefesselt und unter Arrest gestellt.
Nur vier Leute hielten sich in Richter Lawrence Waldmans Zimmer auf: der Richter, Staatsanwalt Di Silva, Thomas Colfax und Jennifer.
»Sie haben das Recht auf die Anwesenheit eines Anwalts, bevor Sie eine Aussage machen«, informierte der Richter Jennifer, »und Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Falls Sie …«
»Ich brauche keinen Anwalt, Euer Ehren! Ich kann erklären, was passiert ist.«
Robert Di Silva beugte sich so dicht zu ihr, dass Jennifer eine Ader an seiner Schläfe pochen sehen konnte. »Wer hat Sie dafür bezahlt, dass Sie Camillo Stela das Kuvert gegeben haben?« »Mich bezahlt? Niemand hat mich bezahlt!« Jennifers Stimme zitterte vor Empörung.
Di Silva ergriff einen vertraut aussehenden Manilaumschlag auf Richter Waldmans Tisch. »Niemand hat Sie bezahlt? Waren Sie nicht gerade bei meinem Zeugen und haben ihm dies gegeben?« Er schüttelte den Umschlag, und ein gelber Kanarienvogel fiel auf den Tisch. Sein Genick war gebrochen.
Entsetzt starrte Jennifer den Vogel an. »Ich … aber einer Ihrer Männer … gab mir …«
»Welcher meiner Männer?«
»Ich – ich weiß nicht.«
»Aber Sie wissen, dass es sich um einen meiner Männer handelte.« Di Silvas Stimme klang ungläubig.
»Ich habe ihn mit Ihnen sprechen gesehen, und dann kam er zu mir, gab mir den Umschlag und sagte, Sie wollten, dass ich ihn Mr. Stela gebe … Er – er wusste sogar meinen Namen.«
»Davon bin ich überzeugt. Wie viel haben sie Ihnen bezahlt?«
Ein Alptraum, dachte Jennifer, es ist alles nur ein Alptraum. Ich werde jeden Augenblick aufwachen, und dann ist es sechs Uhr morgens, und ich ziehe mich an und mache mich auf den Weg, um in den Stab des Staatsanwalts aufgenommen zu werden.
»Wie viel?« Der Zorn in Di Silvas Stimme war so heftig, dass Jennifer aufsprang.
»Werfen Sie mir vor …?«
»Ihnen vorwerfen!« Robert Di Silva ballte die Fäuste. »Lady, ich habe noch nicht einmal angefangen. Wenn Sie aus dem Gefängnis herauskommen, werden Sie zu alt sein, um auch nur einen Penny von dem Geld auszugeben.«
»Es gibt kein Geld.«
Jennifer starrte ihn herausfordernd an.
Thomas Colfax hatte die ganze Zeit ruhig zugehört. Jetzt unterbrach er das Gespräch und sagte: »Entschuldigen Sie, Euer Ehren, aber ich fürchte, das hier führt zu nichts.«
»Der Meinung bin ich auch«, erwiderte Richter Waldman. Er wandte sich an den Staatsanwalt. »Wie sieht’s aus, Bobby? Ist Stela immer noch bereit, sich dem Kreuzverhör zu stellen?« »Kreuzverhör? Er ist ein Wrack. Hat die Hosen gestrichen voll. Er wird das nicht noch einmal durchhalten.«
Thomas Colfax sagte glatt: »Wenn ich den Hauptzeugen der Anklage nicht ins Kreuzverhör nehmen kann, Euer Ehren, muss ich auf die Einstellung des Prozesses dringen.«
Jeder in dem Raum wusste, was das bedeutete. Michael Moretti würde den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.
Richter Waldman sah den Staatsanwalt an. »Haben Sie Ihrem Zeugen mitgeteilt, dass er wegen Missachtung des Gerichts festgenagelt werden kann?«
»Ja. Aber Stela hat vor denen mehr Angst als vor uns.« Er warf Jennifer einen giftigen Blick zu. »Er glaubt nicht mehr daran, dass wir ihn beschützen können.«
Richter Waldman sagte langsam: »Dann gibt es, fürchte ich, keine Alternative, als dem Wunsch der Verteidigung zu folgen und den Prozess einzustellen.«
Robert Di Silva stand da und hörte, wie seinem Fall der Garaus gemacht wurde. Ohne Stela hatte er nichts in der Hand. Michael Moretti war jetzt außerhalb seiner Reichweite, aber nicht Jennifer Parker. Er würde sie für das bezahlen lassen, was sie ihm angetan hatte.
Richter Waldman sagte: »Ich werde Anweisung geben, den Angeklagten auf freien Fuß zu setzen und die Jury zu entlassen.«
Thomas Colfax sagte: »Danke, Euer Ehren.« Sein Gesicht drückte nicht den geringsten Triumph aus.
»Falls nichts anderes anliegt …«, begann Richter Waldman.
»Es liegt etwas anderes an!« Robert Di Silva deutete auf Jennifer Parker. »Ich möchte, dass sie belangt wird – wegen Behinderung der Justiz, wegen Bestechung eines Zeugen bei der Hauptverhandlung, wegen Verschwörung …« Vor lauter Wut verhaspelte er sich.
Endlich fand Jennifer ihre Stimme wieder. »Sie können keinen einzigen dieser Vorwürfe beweisen, weil sie nicht wahr sind. Ich … ich mag dumm gewesen sein, aber das ist auch alles, dessen ich schuldig bin. Niemand hat mich bestochen, damit ich irgendetwas tue. Ich war der festen Meinung, ein Paket für Sie abzugeben.«
Richter Waldman blickte Jennifer an und sagte: »Was auch immer Ihre Motive gewesen sein mögen, die Folgen waren äußerst unglückselig. Ich werde darauf dringen, dass die Disziplinarabteilung eine Untersuchung in die Wege leitet und Ihnen, falls die Umstände es erfordern, Ihren Titel entzieht.«
Jennifer fühlte sich plötzlich schwach. »Euer Ehren, ich …«
»Das ist soweit alles, Miss Parker.«
3
Jennifer Parker erschien nicht bloß in den Abendnachrichten – sie war die Nachricht des Abends. Eine junge Frau, die dem Starzeugen des Staatsanwalts einen toten Kanarienvogel brachte, lieferte eine unwiderstehliche Story. Jeder Fernsehsender hatte Bilder von Jennifer, wie sie Richter Waldmans Büro verließ und sich, belagert von Presse und Publikum, ihren Weg aus dem Gerichtsgebäude erkämpfte.
Jennifer stand dem plötzlichen, schrecklichen Ruhm, mit dem sie überschüttet wurde, fassungslos gegenüber. Von allen Seiten wurde auf sie eingehämmert: Kameraleute des Fernsehens, Rundfunkreporter und Zeitungsleute. Sie wünschte nichts sehnlicher, als vor ihnen zu fliehen, aber ihr Stolz ließ das nicht zu.
»Wer hat Ihnen den gelben Kanarienvogel gegeben, Miss Parker?«
»Haben Sie Michael Moretti jemals getroffen?«
»Wussten Sie, dass Di Silva diesen Fall als Sprungbrett benutzen wollte, um zum Gouverneur gewählt zu werden?«
»Der Staatsanwalt sagt, dass er Sie aus der Anwaltskammer ausschließen lassen will. Werden Sie sich dagegen zur Wehr setzen?«
Jede Frage beantwortete Jennifer mit einem schmallippigen: »Kein Kommentar.«
Die CBS-Abendnachrichten nannten sie »Blindgänger-Parker«, das Mädchen, das in die falsche Richtung losgegangen war. Ein Kommentator der ABC bezeichnete sie als den »Gelben Kanarienvogel«. Bei der NBC verglich ein Sportreporter sie mit einem Fußballspieler, der ein Eigentor schießt.
In »Tony’s Place«, einem Restaurant, das Michael Moretti gehörte, wurde der Sieg gefeiert. Der Raum war mit Dutzenden von trinkenden und lärmenden Männern gefüllt. Moretti saß allein an der Bar und betrachtete Jennifer Parker im Fernsehen. Er hob das Glas, prostete ihr stumm zu und trank.
Rechtsanwälte im ganzen Land diskutierten den Fall Jennifer Parker. Die eine Hälfte von ihnen glaubte, sie sei von der Mafia bestochen worden, die andere meinte, dass sie unschuldig war und man sie hereingelegt hatte. Aber auf welcher Seite sie auch standen, alle stimmten in einem Punkt überein: Jennifer Parkers kurze Karriere als Anwältin war zu Ende.
Sie hatte genau vier Stunden gedauert.
Jennifer stammte aus Kelso im nördlichen Bundesstaat Washington, einer kleinen Holzfällerstadt, die 1847 von einem heimwehkranken schottischen Landvermesser gegründet und nach seiner Vaterstadt in Schottland benannt worden war.
Jennifers Vater arbeitete als Anwalt, zuerst für die Holzfabriken, die die Stadt beherrschten, später für die Arbeiter in den Sägemühlen. Jennifers früheste Kindheitserinnerungen waren von Licht und Freude erfüllt. Für ein Kind war der Staat Washington ein Bilderbuch aus hohen Bergen, Gletschern und Nationalparks. Man konnte Ski laufen, Kanu fahren und später, wenn man älter war, auf dem Eis der Gletscher herumklettern und mit dem Rucksack Fußmärsche nach Orten mit wundervollen Namen unternehmen.
Ihr Vater hatte stets Zeit für sie, während ihre Mutter, schön und ruhelos, auf geheimnisvolle Weise immer beschäftigt und selten zu Hause war. Jennifer vergötterte ihren Vater. In Abner Parkers Adern floss eine Mischung aus englischem, irischem und schottischem Blut. Er war mittelgroß, hatte schwarzes Haar und blaugrüne Augen. Er war ein stets hilfsbereiter Mann mit einem tiefverwurzelten Sinn für Gerechtigkeit. Stundenlang konnte er bei Jennifer sitzen und mit ihr reden. Er erzählte ihr von seinen Fällen und den Problemen der Leute, die in sein schlichtes, kleines Büro kamen, und erst Jahre später begriff Jennifer, dass er in erster Linie mit ihr gesprochen hatte, weil er sein Leben mit niemand. anderem teilen konnte.
Nach der Schule pflegte Jennifer zum Gericht zu laufen, um ihren Vater bei der Arbeit zu beobachten. Wenn gerade keine Sitzung stattfand, saß sie in seinem Büro und hörte ihm zu, wenn er über seine Fälle und Mandanten sprach. Sie redeten nie darüber, dass sie eines Tages Jura studieren sollte; das war selbstverständlich.
Mit fünfzehn begann Jennifer, in den Sommerferien für ihren Vater zu arbeiten. In einem Alter, in dem andere Mädchen Verabredungen und feste Freunde hatten, war Jennifer voll ausgelastet mit Zivilprozessen und Testamenten.
Obwohl Jungen Interesse an ihr zeigten, ging sie selten aus. Wenn ihr Vater sie nach dem Grund dafür fragte, antwortete sie: »Sie sind alle so jung, Papa.« Sie wusste, dass sie eines Tages einen Anwalt wie ihren Vater heiraten würde.
An Jennifers sechzehntem Geburtstag verließ ihre Mutter mit dem achtzehnjährigen Sohn ihres Nachbarn die Stadt, und Jennifers Vater begann lautlos zu sterben. Sein Herz brauchte noch sieben Jahre bis zu seinem letzten Schlag, aber von dem Augenblick, in dem er die Nachricht vom Verschwinden seiner Frau erhielt, war er tot. Die ganze Stadt wusste Bescheid, hatte Mitleid, und das machte es natürlich noch schlimmer, denn Abner Parker war ein stolzer Mann. Er begann zu trinken. Jennifer tat, was sie konnte, um ihn zu trösten, aber es half nichts, und nichts war mehr wie früher.
Als im nächsten Jahr die Zeit kam, aufs College zu gehen, sagte Jennifer, sie würde lieber zu Hause bei ihrem Vater bleiben, aber er wollte davon nichts hören. »Wir werden Partner, du und ich, Jennie«, sagte er. »Beeil dich, damit du deinen Titel bekommst.«
Nachdem sie die Abschlussprüfung bestanden hatte, schrieb sich Jennifer an der Juristischen Fakultät der University of Washington ein. Während des ersten Studienjahrs, als ihre Kommilitonen in einem Sumpf aus Verträgen, Delikten, Eigentumsrecht, Verfahrensordnung und Strafrecht zu ersticken drohten, fühlte Jennifer sich, als wäre sie nach Hause zurückgekehrt.
Zwei Jungen machten Jennifer den Hof: ein junger, attraktiver Medizinstudent namens Noah Larkin und ein Jurastudent namens Ben Munro. Hin und wieder ging Jennifer mit ihnen aus, aber sie war viel zu beschäftigt, um an eine ernsthafte Romanze zu denken.
Das Wetter war rau, feucht und windig, und es schien ununterbrochen zu regnen. Jennifer trug einen blaugrün karierten Lumberjack, der die Regentropfen in seiner rauen Wolle auffing und ihre Augen wie Smaragde blitzen ließ. Sie wanderte durch den Regen, verloren in ihren geheimen Gedanken, ohne zu wissen, dass ihr Gedächtnis sie alle aufbewahrte und abheftete.
Im Frühling schienen die Studentinnen in ihren leuchtenden Baumwollkleidern zu erblühen. Die Jungen lungerten auf dem Rasen herum und beobachteten die vorbeischlendernden Mädchen, aber Jennifer hatte etwas an sich, das sie alle einschüchterte. Sie hatte eine bestimmte Ausstrahlung, die sie schwer einordnen konnten. Sie fühlten, dass Jennifer schon erreicht hatte, wonach sie immer noch suchten.
Jeden Sommer besuchte Jennifer ihren Vater zu Hause. Er hatte sich sehr verändert. Er war niemals wirklich betrunken, aber auch nie nüchtern. Er hatte sich in eine innere Festung zurückgezogen, in der ihn nichts mehr berühren konnte.
Er starb, als Jennifer im letzten Semester war. Die Stadt hatte ein gutes Gedächtnis, und zu Abner Parkers Beerdigung fanden sich fast hundert Menschen ein, Menschen, denen er im Laufe der Jahre geholfen, die er beraten und unterstützt hatte. Jennifer trug ihre Trauer nicht zur Schau. Sie hatte mehr als einen Vater verloren. Sie hatte einen Lehrer und treuen Ratgeber beerdigt.
Nach dem Begräbnis kehrte sie nach Seattle zurück, um ihr Studium zu beenden. Ihr Vater hatte ihr weniger als tausend Dollar hinterlassen, und sie musste sich nun entscheiden, wie es weitergehen sollte. Sie wusste, dass sie nicht nach Kelso zurückkehren und ihren Beruf ausüben konnte, denn dort würde sie immer das kleine Mädchen sein, dessen Mutter mit einem Halbwüchsigen weggelaufen war.
Ihr hoher Notendurchschnitt hatte Jennifer Vorstellungsgespräche in einem Dutzend der besten Anwaltskanzleien ermöglicht, und sie erhielt verschiedene Angebote. Warren Oakes, ihr Strafrechtsprofessor, erklärte: »Das ist eine große Ehre, junge Dame. Nur wenige Frauen stoßen jemals in eine gute Kanzlei vor.«
Jennifers Dilemma bestand darin, dass sie kein Zuhause und keine Wurzeln mehr hatte. Sie wusste nicht, wo sie leben wollte.
Kurz vor dem Schlussexamen wurde dieses Problem für sie gelöst. Professor Oakes bat sie, nach dem Seminar noch dazubleiben.
»Ich habe hier einen Brief vom Büro des Staatsanwalts in Manhattan. Sie bitten mich, ihnen meinen besten Prüfling für ihren Stab zu empfehlen. Würde Sie das interessieren?«
New York. »Ja, Sir.« Jennifer war so überrascht, dass ihr die Antwort einfach herausrutschte.
Sie flog nach New York, um sich der Zulassungsprüfung zu unterziehen, und kehrte anschließend nach Kelso zurück, um die Anwaltspraxis ihres Vaters zu schließen. Es war ein bittersüßes Erlebnis, überschattet von Erinnerungen. Es schien Jennifer, als wäre sie in diesem Büro aufgewachsen.
Sie nahm einen Job in der Fakultätsbücherei der Universität an, um die Zeit zu überbrücken, bis sie erfuhr, ob sie die Prüfung in New York bestanden hatte.
»Es ist eine der härtesten im ganzen Land«, hatte Professor Oakes sie gewarnt.
Aber Jennifer war sicher, dass sie es schaffen würde.
Sie erhielt die Mitteilung, dass sie bestanden hatte, und ein Angebot vom New Yorker Staatsanwaltsbüro am gleichen Tag. Eine Woche später war sie unterwegs nach Osten.
Sie fand ein winziges Appartement an der unteren Third Avenue (geräumig, Kamin, gute Lage, hatte es in der Anzeige geheißen), aber der Kamin war nur eine Imitation, und im Haus gab es keinen Fahrstuhl. Eine steile Treppe führte zu der Wohnung im vierten Stock. Das Treppensteigen wird mir guttun, sagte sich Jennifer. Schließlich gab es in Manhattan weder Berge, die man besteigen, noch Stromschnellen, über die man mit dem Kanu rasen konnte. Das Appartement bestand aus einem kleinen Wohnzimmer mit einer Couch, die sich in ein zerbeultes Bett verwandeln ließ, und einem winzigen Badezimmer, dessen Fenster vor langer Zeit von einem der Vormieter mit schwarzer Farbe überstrichen worden war, um einen Vorhang zu sparen. Das Mobiliar hätte gut und gern eine Spende der Heilsarmee sein können. Was soll’s, lange werde ich hier sowieso nicht wohnen, dachte Jennifer. Es ist nur eine vorübergehende Lösung, bis ich mir einen Namen als Anwalt gemacht habe.
Soweit der Traum. Die Wirklichkeit sah so aus, dass sie noch keine zweiundsiebzig Stunden in New York war, als man sie bereits aus dem Stab des Staatsanwalts gefeuert hatte. Und jetzt stand ihr noch der Ausschluss aus der Anwaltskammer bevor.
Jennifer hörte auf, Zeitungen oder Illustrierte zu lesen, und verzichtete aufs Fernsehen, denn überall begegnete ihr nur ihr eigenes Antlitz. Sie hatte das Gefühl, dass die Leute sie anstarrten, auf der Straße, im Bus, beim Einkaufen. Sie begann, sich regelrecht zu verstecken, ging nicht ans Telefon und weigerte sich zu öffnen, wenn an der Tür geklingelt wurde. Sie erwog, ihre Koffer zu packen und nach Washington zurückzugehen. Sie erwog, sich eine andere Tätigkeit in einem anderen Beruf zu suchen. Sie erwog, sich umzubringen. Ganze Stunden verbrachte sie damit, Briefe an Staatsanwalt Di Silva zu entwerfen. Mal griff sie seine Gefühllosigkeit und seinen Mangel an Verständnis mit beißender Schärfe an, mal bat sie mit kriecherischen Entschuldigungen um eine neue Chance. Keiner dieser Briefe wurde je abgeschickt.
Zum ersten Mal in ihrem Leben wurde Jennifer von Verzweiflung überwältigt. Sie hatte keine Freunde in New York, mit denen sie hätte sprechen können. Tagsüber schloss sie sich in ihrem Appartement ein. Erst spät nachts schlüpfte sie hinaus und wanderte durch die verlassenen Straßen der Stadt. Sie wurde nie belästigt. Vielleicht erblickte das menschliche Strandgut der Nacht seine eigene Einsamkeit und Verzweiflung in ihren Augen wie in einem Spiegel.
Während sie ging, erlebte Jennifer im Geist wieder und wieder die Szene im Gerichtssaal, und jedes Mal versah sie sie mit einem anderen Ende.
Ein Mann löste sich aus der Gruppe um Di Silva und kam an ihren Tisch. Er hielt einen Manilaumschlag in der Hand.
Miss Parker?
Ja?
Der Chef möchte, dass Sie das zu Stela bringen.
Jennifer musterte ihn mit einem kühlen Blick. Könnte ich bitte Ihren Ausweis sehen?
Der Mann erschrak und stürzte davon.
Ein Mann löste sich aus der Gruppe um Di Silva und kam an ihren Tisch. Er hielt einen Manilaumschlag in der Hand.
Miss Parker?
Ja?
Der Chef möchte, dass Sie das zu Stela bringen. Er reichte ihr den Umschlag.
Sie öffnete ihn und entdeckte den toten Kanarienvogel. Ich verhafte Sie!
Ein Mann löste sich aus der Gruppe um Di Silva und näherte sich ihrem Tisch. Er hielt einen Manilaumschlag in der Hand. Er ging anihr vorbei zu einem anderen jungen Assistenzanwalt und übergab ihm den Umschlag, Der Chef möchte, dass Sie das zu Stela bringen.
Sie konnte die Szene umschreiben, so oft sie wollte, an den Tatsachen änderte es nichts. Ein einziger Fehler hatte ihr Leben zerstört. Andererseits – wer sagte, dass es wirklich zerstört war? Die Presse? Di Silva? Noch war sie nicht ausgeschlossen, und bis das geschah, war sie immer noch Anwältin. Sie dachte an die ganzen Kanzleien, die ihr einmal Angebote gemacht hatten.
Sobald sie wieder zu Hause war, förderte Jennifer die Liste mit den Firmen zutage, bei denen sie sich vorgestellt hatte. Am nächsten Morgen begann sie zu telefonieren. Aber keiner der Männer war zu sprechen, und keiner rief zurück. Nach vier Tagen hatte sie endlich begriffen, dass sie ein Paria ihrer Zunft war. Der Staub, den der Moretti-Fall aufwirbelte, hatte sich wieder gelegt, aber jeder erinnerte sich noch daran.
Jennifer hörte nicht auf, mögliche Arbeitgeber anzurufen, und aus ihrer Verzweiflung wurde Empörung, dann Niedergeschlagenheit und schließlich wieder Verzweiflung. Sie überlegte, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen sollte, aber sie drehte sich im Kreis. Sie wollte Rechtsanwältin sein und sonst nichts. Und sie war Anwältin, und, bei Gott, sie würde diesen Beruf auch ausüben, bis man es ihr verbot.
Als nächstes stellte sie sich persönlich bei den Anwaltspraxen und Kanzleien in Manhattan vor. Sie tauchte unangemeldet auf, nannte am Empfang ihren Namen und verlangte, einen der Seniorpartner zu sprechen. Gelegentlich wurde sie sogar vorgelassen, aber sie hatte das Gefühl, dass es mehr aus Neugier geschah. Sie war ein Monster, und man wollte sehen, wie sie in natura war. Aber meistens wurde ihr lediglich bedeutet, die Kanzlei sei komplett.
Nach sechs Wochen ging Jennifers Geld zu Ende. Sie wäre ja in ein billigeres Appartement umgezogen, nur gab es keine noch billigeren. Sie ließ Frühstück und Mittagessen aus, und ihr Abendessen nahm sie nur noch in einem kleinen Eckimbiss ein, wo das Essen zwar schlecht, die Preise aber gut waren. Sie entdeckte Lokale, wo sie eine ganze Mahlzeit für eine bescheidene Summe bekam – so viel Salat, wie sie essen, so viel Bier, wie sie trinken konnte. Jennifer konnte Bier nicht ausstehen, aber es machte satt.
Nachdem sie die Liste der großen Anwaltspraxen durchgegangen war, bewaffnete sie sich mit einer Aufstellung der kleineren und rief diese ebenfalls an, aber ihr Ruf war ihr sogar dorthin vorausgeeilt. Sie erhielt einen Haufen Anträge von den verschiedensten Männern, aber keinen Job. Gut, sagte sie sich schließlich, wenn mich niemand anstellen will, eröffne ich meine eigene Praxis. Der Haken war bloß, dass sie dafür Geld brauchte. Mindestens zehntausend Dollar, für Miete, Telefon, eine Sekretärin, Gesetzbücher, einen Schreibtisch, Stühle und Büromaterial. Zurzeit hätte sie sich nicht einmal die Briefmarken leisten können.
Sie hatte auf ihr Gehalt vom Staatsanwaltsbüro gezählt, aber damit konnte sie jetzt natürlich nicht mehr rechnen. Eine Abfindung brauchte sie ebenfalls nicht zu erhoffen. Wenn jemand enthauptet wird, erhält er ja auch keine Entschädigung. Nein, es war ihr einfach nicht möglich, eine eigene Praxis zu eröffnen, nicht einmal eine kleine. Die einzige Lösung war ein gemeinsames Büro mit jemand anderem.
Jennifer kaufte die New York Times und ging die Anzeigen durch. Am Ende der letzten Spalte entdeckte sie schließlich eine Zeile, die lautete: Gesucht: Dritter Mann für kleine Bürogemeinschaft. Geringe Restmiete. Die beiden letzten Worte gefielen Jennifer außerordentlich gut. Sie war zwar kein Mann, aber bei einer Bürogemeinschaft spielte das Geschlecht ja auch keine Rolle. Sie riss die Anzeige heraus und fuhr mit der U-Bahn zur angegebenen Adresse.
Es war ein verwahrlostes, baufälliges Gebäude am unteren Broadway. Das Büro lag im zehnten Stock, und auf dem abblätternden Schild an der Tür stand:
KENNETH BAILEY AUSKUNFTEI
Und darunter:
ROCKEFELLER INKASSOBÜRO
Jennifer holte tief Luft, stieß die Tür auf und trat ein. Ihr erster Schritt brachte sie in die Mitte eines kleinen, fensterlosen Büros. In den Raum hatte man drei wackelige Tische und Stühle gezwängt. Zwei davon waren besetzt.
An einem der Tische saß ein kahlköpfiger, schäbig gekleideter Mann mittleren Alters über einen Stapel Papiere gebeugt. An einem zweiten Tisch an der gegenüberliegenden Wand arbeitete ein zweiter Mann, den Jennifer auf Anfang Dreißig schätzte. Er hatte ziegelrotes Haar und leuchtendblaue Augen. Seine Haut war blass und mit Sommersprossen übersät. Er trug hautenge Jeans, ein T-Shirt und weiße. Tennisschuhe ohne Socken. Er telefonierte.
»Keine Sorge, Mrs. Desser, zwei meiner besten Leute arbeiten an Ihrem Fall. Wir rechnen jeden Tag mit Informationen über Ihren Mann. Allerdings müsste ich Sie um einen weiteren kleinen Spesenvorschuss bitten … Nein, Sie brauchen es mir nicht zu schicken. Sie wissen ja, wie das mit der Post ist. Ich habe heute Nachmittag in Ihrer Nähe zu tun. Ich schaue kurz bei Ihnen vorbei und hole es ab.«
Er legte den Hörer auf und bemerkte Jennifer.
Er stand auf, lächelte und streckte ihr eine kräftige Hand entgegen. »Ich bin Kenneth Bailey. Was kann ich an diesem schönen Tag für Sie tun?«
Jennifer blickte sich in dem kleinen, stickigen Raum um und sagte unsicher: »Ich – ich bin wegen Ihrer Anzeige hier.«
»Oh.« Die blauen Augen wirkten erstaunt.
Der kahlköpfige Mann starrte Jennifer an.
Kenneth Bailey stellte ihn vor: »Das ist Otto Wenzel, das Rockefeller Inkassobüro.«
Jennifer nickte. »Hallo.« Dann wandte sie sich wieder Kenneth Bailey zu. »Und Sie sind die Auskunftei Bailey?«
»Richtig. Und was tun Sie?«
»Ich? Oh, ich bin Anwältin.«
Kenneth Bailey betrachtete sie skeptisch. »Und Sie wollen hier ein Büro eröffnen?«
Jennifer musterte noch einmal den trostlosen Raum und sah sich selber zwischen diesen beiden Männern an dem dritten Tisch sitzen. »Vielleicht sollte ich noch ein bisschen weitersuchen«, meinte sie. »Ich bin nicht sicher …«
»Die Miete würde nur neunzig Dollar im Monat betragen.« »Für neunzig Dollar im Monat könnte ich das ganze Haus kaufen«, gab Jennifer zurück und wandte sich zum Gehen.
»Warten Sie einen Moment.«
Jennifer blieb stehen.
Kenneth Bailey rieb sich das bleiche Kinn. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag – sechzig! Wenn Ihr Geschäft angelaufen ist, sprechen wir über eine Erhöhung, okay?«
Es war wirklich ein Vorschlag. Jennifer wusste, dass sie nirgendwo anders einen Raum für diesen Betrag finden würde. Andererseits sah sie keine Möglichkeit, jemals einen Mandanten in dieses Loch zu locken. Und dann gab es noch einen weiteren Punkt, der sie beschäftigte. Sie hatte die sechzig Dollar nicht. »Ich nehme es«, sagte sie.
»Sie werden es nicht bereuen«, versprach Kenneth Bailey. »Wann wollen Sie Ihre Sachen herbringen?«
»Die sind schon da.«
Kenneth Bailey malte ihr Geschäftsschild selber auf die Tür.
JENNIFER PARKER RECHTSANWALT
Jennifer betrachtete das Schild mit gemischten Gefühlen. Selbst in ihren dunkelsten Stunden hatte sie sich ihren Namen nicht unter denen eines Privatdetektivs und eines Geldeintreibers gesehen. Und doch, wenn sie sich das leicht gebogene Schild ansah, konnte sie einem Gefühl des Stolzes nicht widerstehen. Sie war Anwältin. Das Schild bewies es.
Jetzt, wo Jennifer einen Büroraum hatte, fehlten ihr nur noch Mandanten.
Zurzeit konnte sie sich nicht einmal mehr die Eckkneipe leisten. Ihr Frühstück bestand aus Toast und Kaffee, zubereitet auf einer Wärmplatte, die sie auf den Heizkörper in dem winzigen Badezimmer gestellt hatte. Auf das Mittagessen verzichtete sie ganz, und das Abendessen verlegte sie in das »Zum Zum«, wo es vorzugsweise große Wurstscheiben, Brotschwarten und heißen Kartoffelsalat gab.
Um Punkt neun Uhr morgens ließ sie sich an ihrem Schreibtisch nieder, aber ihre einzige Tätigkeit bestand darin, Ken Bailey und Otto Wenzel beim Telefonieren zuzuhören.
Ken Baileys Fälle bestanden in erster Linie aus verschwundenen Ehemännern oder Kindern, und am Anfang war Jennifer davon überzeugt, dass er ein Betrüger war, der hauptsächlich Versprechungen machte und dafür hohe Vorschüsse kassierte. Aber sie merkte schnell, dass Bailey hart arbeitete und oft Erfolg hatte. Er war intelligent und gewitzt.
»Otto arbeitet für Kreditgesellschaften«, erklärte er Jennifer einmal. »Sie beauftragen ihn damit, nicht abbezahlte Autos, Fernsehapparate oder Waschmaschinen zurückzuholen. Und Sie?«
»Ich?«
»Haben Sie nicht wenigstens einen Mandanten?«
»Ich habe einiges in petto«, antwortete Jennifer ausweichend.
Er nickte. »Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Jeder kann mal einen Fehler machen.«
Jennifer fühlte, wie sie rot wurde. Also wusste sogar er über sie Bescheid.
Ken Bailey packte ein großes, dickes Roastbeef-Sandwich aus. »Wollen Sie einen Bissen?«
Es sah köstlich aus. »Nein, danke«, lehnte Jennifer fest ab. »Ich esse nie zu Mittag.« »Wie Sie wollen.«
Sie sah ihm zu, wie er in das saftige Sandwich biss. Er bemerkte ihren Gesichtsausdruck und fragte noch einmal: »Sind Sie, sicher, dass Sie nicht …«
»Nein, wirklich nicht. Ich habe eine Verabredung.«
Ken Bailey blickte Jennifer nach, als sie das Büro verließ, und sein Gesicht wirkte besorgt. Er war stolz auf seine Menschenkenntnis, aber Jennifer Parker verwirrte ihn. Auf Grund der Fernseh- und Zeitungsberichte war er sicher gewesen, jemand habe sie bezahlt, damit sie die Anklage gegen Michael Moretti zu Fall bringe. Aber jetzt, nachdem er sie kennengelernt hatte, war er davon nicht mehr so überzeugt. Er war einmal verheiratet gewesen und hatte die Hölle auf Erden erlebt. Er hatte wirklich keine allzu hohe Meinung von Frauen. Aber etwas sagte ihm, dass Jennifer etwas Besonderes war. Sie war schön, intelligent und sehr stolz. Jesus, warnte er sich, sei kein Idiot. Ein Mord auf deinem Gewissen ist mehr als genug.
Kommt zu mir, ihr, die ihr hungrig, arm und verzweifelt seid, dachte Jennifer zynisch, mein Gott, die Inschrift auf der Freiheitsstatue war schon eine sentimentale Angelegenheit. In New York kümmert sich niemand darum, ob du lebst oder krepierst. Hör auf, dich selber zu bemitleiden!
Aber es war schwer. Ihre Barschaft war auf achtzehn Dollar geschrumpft, die Miete für das Appartement überfällig und die für ihren Büroanteil in zwei Tagen ebenfalls. Sie hatte nicht genug Geld, um noch länger in New York zu bleiben, und auch nicht genug, um der Stadt den Rücken zu kehren.
Noch einmal hatte sie anhand der gelben Seiten im Telefonbuch in alphabetischer Reihenfolge alle Anwaltsbüros angerufen, um einen Job zu bekommen. Sie tätigte die Gespräche von einer Zelle aus, denn sie wollte nicht, dass Ken Bailey und Otto Wenzel mithörten. Das Ergebnis war immer gleich. Niemand war an ihren Diensten interessiert. Es würde ihr nichts anderes übrigbleiben, als nach Kelso zurückzugehen und als Rechtshilfe oder Sekretärin für einen der Freunde ihres Vaters zu arbeiten. Wie unglücklich er darüber gewesen wäre. Es war eine bittere Niederlage, aber sie hatte keine Wahl. Sie würde als Versager nach Hause zurückkehren. Das Problem dabei war nur die Reise. In der Nachmittagsausgabe der New York Post fand sie eine Anzeige, in der ein zahlender Mitfahrer nach Seattle gesucht wurde. Jennifer wählte die angegebene Nummer, aber niemand hob ab. Sie beschloss, es am nächsten Morgen noch einmal zu versuchen.
Am folgenden Tag ging Jennifer zum letzten Mal ins Büro. Otto Wenzel war nicht da, aber Ken Bailey hing wie üblich am Telefon. Er trug Blue Jeans und einen Kaschmir-Pullover mit V-Ausschnitt.
»Ich habe Ihre Frau gefunden«, sagte er gerade. »Das einzige Problem ist, dass sie nicht wieder nach Hause will, alter Junge. Ich weiß … wer versteht schon die Frauen? Okay … ich sage Ihnen, wo sie sich aufhält, und dann können Sie ja Ihren Charme spielen lassen, um sie zurückzuholen.« Er gab eine Hoteladresse durch. »Nichts zu danken.« Er hängte auf und drehte sich zu Jennifer um. »Sie sind heute spät dran.«
»Mr. Bailey, ich – ich fürchte, ich muss abreisen. Ich überweise Ihnen das Geld für die Miete, sobald ich kann.«
Ken Bailey lehnte sich in seinem Stuhl zurück und sah sie nachdenklich an. Sein Blick verunsicherte Jennifer.
»Geht das in Ordnung?« fragte sie.
»Zurück nach Washington?« wollte er wissen.
Sie nickte.
Ken Bailey fragte: »Könnten Sie mir einen kleinen Gefallen tun, ehe Sie abreisen? Ein Freund von mir, ein Rechtsanwalt, bekniet mich die ganze Zeit, damit ich einige Vorladungen für ihn zustelle, aber ich habe keine Zeit. Er zahlt zwölf Dollar fünfzig für jede Vorladung, plus Kilometergeld. Würden Sie das für mich tun?«
Eine Stunde später stand Jennifer in den feudalen Büroräumen von Peabody & Peabody. Es war genau die Art von Kanzlei, in der sie sich immer arbeiten gesehen hatte, als vollwertiger Partner mit einer luxuriösen Ecksuite. Sie wurde in ein kleines Hinterzimmer geführt, wo eine geplagte Sekretärin ihr einen Stapel Vorladungen aushändigte.
»Hier. Achten Sie darauf, Ihre Kilometerzahl zu notieren. Sie haben doch einen Wagen, oder?«
»Nein, ich fürchte, ich …«
»Gut, wenn Sie die U-Bahn nehmen, heben Sie die Tickets auf.«
»Gut.«
Den Rest des Tages verbrachte Jennifer damit, Vorladungen zuzustellen – in der Bronx, Brooklyn und Queens, bei strömendem Regen. Um acht Uhr abends hatte sie fünfzig Dollar verdient. Durchfroren und erschöpft kehrte sie in ihr Appartement zurück. Aber immerhin hatte sie Geld verdient, das erste, seit sie in New York eingetroffen war. Und die Sekretärin hatte ihr erklärt, dass noch ein ganzer Haufen Vorladungen zugestellt werden müsse. Es war harte Arbeit, so durch die ganze Stadt zu rennen, und es war demütigend. Man hatte Jennifer Türen vor der Nase zugeschlagen, sie verflucht, bedroht und zweimal belästigt. Die Aussicht auf einen weiteren solchen Tag war erschreckend; dennoch, solange sie in New York bleiben konnte, bestand Hoffnung, egal, wie entfernt die auch sein möchte.
Jennifer ließ sich ein heißes Bad ein und stieg in das Wasser. Langsam ließ sie sich auf den Boden der Wanne gleiten und genoss den Luxus des über ihrem Körper zusammenschwappenden Wassers. Sie hatte gar nicht bemerkt, wie erschöpft sie war. Jeder Muskel schien zu schmerzen. Sie beschloss, dass sie außerdem noch ein gutes Abendessen brauchte, um sich aufzuheitern. Sie würde schlemmen. Ich verschreibe mir ein richtiges Restaurant, dachte sie, ein Lokal mit Tischtüchern und Gedecken. Vielleicht gibt es dort leise Musik, und ich werde ein Glas Weißwein trinken und …
Ihre Gedanken wurden von der Klingel an der Tür unterbrochen. Es war ein ungewohntes Geräusch. Seit sie hier vor zwei Monaten eingezogen war, hatte sie nicht einen einzigen Besucher gehabt. Es konnte sich nur um die mürrische Wirtin handeln, die die überfällige Miete kassieren wollte. Zu müde, sich zu bewegen, rührte Jennifer sich nicht, in der Hoffnung, die Vermieterin würde wieder verschwinden.
Das Klingelzeichen wiederholte sich. Widerstrebend stieg Jennifer aus dem warmen Bad. Sie streifte ein samtenes Hauskleid über und ging zur Tür. »Wer ist da?«
Auf der anderen Seite der Tür fragte eine männliche Stimme: »Miss Jennifer Parker?«
»Ja.«
»Mein Name ist Adam Warner. Ich bin Anwalt.«
Verwirrt legte Jennifer die Sicherheitskette vor und öffnete die Tür einen Spaltbreit. Der Mann vor der Tür war in den Dreißigern, groß, blond und breitschultrig. Er hatte graublaue, neugierige Augen und trug eine horngerahmte Brille. Sein maßgeschneiderter Anzug musste ein Vermögen gekostet haben.
»Darf ich eintreten?« fragte er.
Einbrecher pflegten keine maßgeschneiderten Anzüge, Gucci-Schuhe und Seidenschlipse zu tragen. Sie hatten im Allgemeinen auch keine langen, sensiblen Hände mit manikürten Fingernägeln.
»Einen Moment, bitte.« Jennifer hakte die Sicherheitskette aus und öffnete die Tür. Während Adam Warner eintrat, blickte Jennifer sich rasch in ihrem Appartement um. Sie versuchte, es mit seinen Augen zu sehen, und zuckte zusammen. Er sah aus, als sei er Besseres gewohnt.
»Womit kann ich Ihnen helfen, Mr. Warner?«
4
Die Anwaltskanzlei Needham, Finch, Pierce und Warner lag in der Wall Street und umfasste das gesamte oberste Stockwerk des Gebäudes Nr. 30. Hundertfünfundzwanzig Anwälte arbeiteten für die Kanzlei. Die Büroräume rochen nach altem Geld und waren mit der ruhigen Eleganz eingerichtet, die einer Firma anstand, die einige der größten Namen in der Industrie vertrat.
Adam Warner und Stewart Needham tranken ihren rituellen Morgentee. Stewart Needham war Ende Sechzig, adrett und in bester Verfassung. Er hatte einen kleinen Van-Dyke-Bart und trug einen Tweedanzug mit Weste. Er sah aus, als gehörte er in eine frühere Zeit, aber sein Verstand arbeitete, wie Hunderte von Gegnern zu ihrem Leidwesen im Lauf der Jahre hatten erfahren müssen, blendend unter den Gegebenheiten des zwanzigsten Jahrhunderts. Man konnte ihn nur als einen Titan bezeichnen, aber sein Name war lediglich in den Kreisen bekannt, die wirklich zählten. Er zog es vor, im Hintergrund zu bleiben und seinen beträchtlichen Einfluss in erster Linie dazu zu benutzen, die Gesetzgebung, Berufungen in hohe Regierungsämter und die Innenpolitik zu steuern. Er stammte aus Neuengland und war schon wortkarg erzogen worden.
Adam Warner hätte Needhams Nichte Mary Beth geheiratet und wurde von ihm protegiert. Adams Vater war ein angesehener Senator gewesen, er selber hatte sich zu einem brillanten Anwalt entwickelt. Nachdem er die juristische Ausbildung an der Harvard Universität magna cum laude abgeschlossen hatte, war er mit Angeboten der angesehensten Kanzleien des Landes überschüttet worden. Er hatte sich für Needham, Finch und Pierce entschieden und war sieben Jahre später als Partner in die Firma aufgenommen worden. Adam sah gut aus, besaß Charme, und seine Intelligenz schien seiner Ausstrahlung eine weitere Dimension zu verleihen. Seine lässige Selbstsicherheit stellte für jede Frau eine Herausforderung dar. Schon seit langem hatte er ein System entwickelt, sich weibliche Klienten mit übergroßem amourösen Interesse vom Leib zu halten. Er war seit vierzehn Jahren mit Mary Beth verheiratet und hielt nichts von Seitensprüngen.
»Noch etwas Tee, Adam?« fragte Stewart Needham.
»Nein, danke.« Adam Warner hasste Tee, und seit acht Jahren trank er ihn nur deshalb jeden Morgen, weil er seinen Partner nicht kränken wollte. Needham kochte das Gebräu selber, und es war schauerlich.