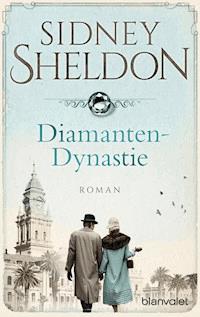8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Amerika hat einen neuen Präsidenten – und das mächtige Geheimkomitee für weltweite Terroraktionen schon bald eine unerwarteten Gegnerin: Mary Ashley. Die ehemalige Professorin für Politikwissenschaft engagiert sich als Diplomatin und verhandelt mit den Supermächten dieser Welt. Ein gefährlicher Einsatz, der ihren geliebten Mann das Leben kostet und sie selbst und ihre zwei Kinder in einen grausamen Albtraum stürzt, denn ihre mächtigen Feinde lauern überall und es gibt kein Entkommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Amerika hat einen neuen Präsidenten – und das mächtige Geheimkomitee für weltweite Terroraktionen schon bald eine unerwarteten Gegnerin: Mary Ashley. Die ehemalige Professorin für Politikwissenschaft engagiert sich als Diplomatin und verhandelt mit den Supermächten dieser Welt. Ein gefährlicher Einsatz, der ihren geliebten Mann das Leben kostet und sie selbst und ihre zwei Kinder in einen grausamen Albtraum stürzt, denn ihre mächtigen Feinde lauern überall und es gibt kein Entkommen …
Autor
Sidney Sheldon begeisterte bis heute über 300 Millionen Leser weltweit. Vielfach preisgekrönt – u.a. erhielt er 1947 einen Oscar für das Drehbuch zu So einfach ist die Liebe nicht –, stürmte er mit all seinen Romanen immer wieder die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. Er zählt zu den am häufigsten übersetzten Autoren und wurde dafür sogar mit einem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde geehrt. Im Jahr 2007, kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag, verstarb Sidney Sheldon.
Von Sidney Sheldon bereits erschienen:
Die Mühlen Gottes • Der Zorn der Götter • Kalte Glut •
Diamanten-Dynastie • Zorn der Engel • Schatten der Macht
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Sidney Sheldon
Im Schatten der Götter
Roman
Deutsch von Sigurd Engel
Inhaltsverzeichnis
Prolog
PERHO, FINNLAND
Die Konferenz fand in einer komfortablen, gutgeheizten Blockhütte in einer abgelegenen, dicht bewaldeten Gegend etwa vierhundert Kilometer nördlich von Helsinki, nicht allzu viel von der sowjetischen Grenze entfernt, statt. Die westlichen Mitglieder des Komitees waren aus Gründen der Geheimhaltung nacheinander, in unregelmäßigen Abständen eingetroffen. Sie kamen aus acht verschiedenen Ländern, aber es gab keine Visastempel in ihren Pässen. Die Zusammenkunft war in aller Stille von einem Mitglied des finnischen Staatsrats, des Valtineuvosto, organisiert worden. Bewaffnete Sicherheitskräfte geleiteten die Besucher in die Jagdhütte, und als der letzte durch die Tür verschwunden war, wurde diese von innen geschlossen. Die Wachen bezogen Posten im eisigen Januarwind, bereit auf jeden zu schießen, der sich unberechtigt zu nähern versuchte.
Die Männer, die sich um den rechteckigen Tisch versammelt hatten, waren hochrangige Regierungsmitglieder in hervorragenden Machtpositionen. Sie hatten sich schon häufiger getroffen, meist unter weniger konspirativen Umständen, und trauten einander. Es blieb ihnen auch gar nichts anderes übrig. Aus Sicherheitsgründen benutzten sie bei ihren geheimen Zusammenkünften trotzdem ausschließlich Decknamen.
Diesmal waren die Auseinandersetzungen außerordentlich heftig gewesen. Erst nach fünf Stunden kam der Vorsitzende zu dem Ergebnis, dass es Zeit für eine Abstimmung sei. Er stand auf und wandte sich an den Mann zu seiner Rechten. »Sigurd?«
»Ich bin dafür.«
»Odin?«
»Ja.«
»Baldur?«
»Das geht alles zu schnell. Wenn die Sache auffliegt, sind wir unseres Lebens nicht mehr sicher. Die –«
»Ja oder nein?«
»Nein …«
»Freyr?«
»Ja.«
»Sigmund?«
»Nein. Die Gefahr –«
»Thor?«
»Ja.«
»Thyo?«
»Ja.«
»Ich selbst stimme ebenfalls mit ja. Der Antrag ist damit angenommen. Ich werde den Controller in diesem Sinne unterrichten. Bei unserem nächsten Treffen werde ich Ihnen mitteilen, wen er für geeignet hält, unseren Auftrag auszuführen. Bitte beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßregeln. Wir gehen in Abständen von zwanzig Minuten. Vielen Dank, meine Herren.«
Zwei Stunden und fünfundvierzig Minuten später war die Blockhütte leer. Eine Spezialtruppe tränkte die Balken mit Kerosin und setzte das Gebäude anschließend in Brand. Unter den Liebkosungen des Windes schossen die Flammen rasch in die Höhe.
Als die Freiwillige Feuerwehr aus Perho anrückte, war weit und breit nichts mehr zu sehen. Nur noch ein Haufen halb verkohlte Balken glimmte im Schnee.
Der Assistent des Feuerwehrhauptmanns näherte sich dem Aschehaufen, bückte sich und schnupperte vorsichtig. »Kerosin«, sagte er. »Brandstiftung.«
Sein Chef starrte in die Ruine, er wirkte verblüfft. »Merkwürdig«, sagte er.
»Was?«
»Ich habe letzte Woche in der Gegend gejagt. Da gab es noch keine Blockhütte hier.«
Erstes Buch
1
WASHINGTON, D. C.
Stanton Rogers war der geborene Präsident der Vereinigten Staaten. Er war ein charismatischer Politiker, er war bekannt und beliebt bei der Öffentlichkeit, und er genoss die Unterstützung mächtiger Freunde. Bedauerlicherweise machte ihm seine Libido einen Strich durch die Rechnung. Oder, wie die Auguren in Washington sagten: »Der gute alte Stanton hat sich um die Präsidentschaft gebumst.«
Dabei hatte Rogers sich keineswegs für einen zweiten Casanova gehalten. Ganz im Gegenteil, bis zu jener fatalen Schlafzimmergeschichte hatte er ein mustergültiges Eheleben geführt. Obwohl er auffallend gut aussah, sehr reich und noch dazu auf dem besten Weg war, der mächtigste Mann der Vereinigten Staaten zu werden, und obwohl er dementsprechend viele Gelegenheiten hatte, seine Frau zu betrügen, hatte er nie auch nur einen einzigen Gedanken an fremde Frauen verschwendet.
Noch unerklärlicher war die Sache aus einem anderen Grunde gewesen: Rogers Frau, Elizabeth, war ebenso schön wie intelligent, sie fand Anerkennung in der Gesellschaft und teilte nahezu alle Interessen mit ihm. Barbara dagegen, die Frau, in die er sich plötzlich verliebt und die er nach einer höchst spektakulären, schlagzeilenreichen Scheidung schließlich geheiratet hatte, war fünf Jahre älter als er, nicht gerade auffallend hübsch, und sie schien sich für nichts zu interessieren, was ihn interessierte. Stanton war ein begeisterter Sportler; Barbara hasste alle körperliche Bewegung. Stanton liebte große Gesellschaften; Barbara war am liebsten mit ihm allein oder duldete allenfalls ein paar enge Freunde. Die größte Überraschung für alle, die ihn näher kannten, war aber die Tatsache, dass sich ein so notorischer Liberaler wie Stanton mit einer so erzkonservativen Frau wie Barbara abgab.
Paul Ellison, Stantons bester Freund, hatte gesagt: »Kumpel, du bist doch verrückt! Liz und du, ihr seid doch ein Ehepaar in höchster Vollendung! Eure Ehe steht praktisch im Guinness Buch der Rekorde! So etwas lässt man doch nicht für einen schnellen Fick sausen.«
Rogers hatte mit zusammengepressten Lippen geantwortet. »Lass mich in Ruhe, Paul. Ich liebe Barbara. Sobald ich geschieden bin, wollen wir heiraten.«
»Weißt du auch, dass du dir deine Karriere damit ruinierst?«
»In diesem Land wird jede zweite Ehe geschieden«, hatte Rogers geantwortet. »Meiner Karriere schadet das überhaupt nichts.«
Damit sollte er Unrecht behalten. Schon die ersten Gerüchte über die bevorstehende Scheidung wurden aufgenommen wie Manna, und die Boulevardblätter stürzten sich lüstern auf alle Details. Es erschienen Fotos von Stantons Liebesnest und ausführliche Geschichten über mitternächtliche Rendezvous. Die Scheidung ging nicht ohne bösen Prozess ab, und die Presse hielt die Geschichte so lange am Leben wie möglich. Als die Erregung sich legte, waren die mächtigen Freunde, die Stanton Roger’s Präsidentschaftskandidatur unterstützt hatten, in aller Stille verschwunden. Sie hatten einen neuen Champion gefunden: Paul Ellison.
Ellison war eine vernünftige Wahl. Er sah zwar nicht so gut aus wie Rogers, und es fehlte ihm auch dessen Charisma, aber er war freundlich und intelligent und stammte aus einer guten Familie. Er war nicht sehr groß, hatte gleichmäßige Gesichtszüge und ehrliche blaue Augen. Seit mehr als zehn Jahren war er mit der Tochter eines Stahlmagnaten glücklich verheiratet. Paul und Alice galten als liebevolles, herzliches Paar.
Ebenso wie Rogers hatte Paul Ellison in Yale und in Harvard studiert. Die beiden Männer waren zusammen aufgewachsen. Ihre Familien hatten auf Long Island benachbarte Sommerhäuser gehabt, sie waren schon als Jungen zusammen geschwommen, sie hatten zusammen Baseball gespielt und sich später gemeinsam mit Mädchen verabredet. An der juristischen Fakultät in Harvard hatten sie gemeinsam Vorlesungen gehört. Paul Ellison hatte recht gute Zeugnisse, aber Stanton Rogers war ein richtiger Star. Stantons Vater war einer der Inhaber einer angesehenen Anwaltskanzlei in der Wall Street, und Staton sorgte dafür, dass Paul immer bei ihm war, wenn er dort im Sommer seine Ferienjobs absolvierte. Nach dem Examen begann Stantons politischer Stern kometenhaft zu steigen, und wenn er der Komet war, dann war Paul Ellison der Schweif.
Stantons Scheidung änderte alles. Jetzt wurde Stanton plötzlich zu Ellisons Anhängsel. Sie brauchten fünfzehn Jahre bis zum Gipfel. Ellison verlor eine Wahl zum Senat, in der nächsten blieb er dann Sieger und wurde zu einem bekannten, sehr profilierten Senator. Er galt als ein Vorkämpfer gegen die Bürokratie und die Verschwendung von Steuergeldern. Sein Auftreten war stets populistisch, und er war ein entschiedener Befürworter der Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion. Als der Präsident sich um eine zweite Amtszeit bemühte, wurde Ellison gebeten, seine Nominierungsrede zu halten. Seine Ausführungen waren brillant, leidenschaftlich und aufsehenerregend gut formuliert. Vier Jahre später wurde Paul Ellison zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Als erstes ernannte er Stanton Rogers zu seinem außenpolitischen Berater.
Marshall McLuhans Theorie vom globalen Dorf hatte sich mittlerweile verwirklicht. Die Amtseinführung des zweiundvierzigsten Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde über Satellit in mehr als 190 Länder übertragen.
Im »Black Rooster«, einer Lieblingskneipe der Washingtoner Journalisten, saß Ben Cohn, ein Veteran unter den politischen Berichterstattern der Washington Post, mit vier Kollegen am Tisch und verfolgte die Amtseinführung auf dem großen Fernsehschirm über der Bar.
»Der Kerl hat mich fünfzig Dollar gekostet«, beschwerte sich einer der Journalisten.
»Ich hab’ dir doch gesagt, du sollst nicht gegen Ellison wetten«, höhnte Ben Cohn. »Der Mann ist ein Zauberer. Das kannst du mir glauben.«
Die Kamera ging in die Totale, um die gewaltige Menschenmenge zu zeigen, die sich auf der Pennsylvania Avenue drängte. Tausende trotzten in ihren Wintermänteln dem eisigen Januarwind, um der Zeremonie beizuwohnen. Rings um das Podium waren Lautsprecher aufgebaut. Jason Merlin, der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, hatte Ellison soeben den Eid abgenommen, und der neue Präsident schüttelte ihm die Hand. Dann trat er ans Mikrofon.
»Jetzt schaut euch diese Idioten an, die sich da draußen die Ärsche abfrieren«, spottete Ben Cohn. »Wisst ihr, warum sie nicht wie normale Menschen zu Hause sitzen und sich die Sache im Fernsehen ansehen?«
»Warum denn?«
»Weil da draußen Geschichte gemacht wird. Eines schönen Tages werden all diese Leute ihren Enkelkindern erzählen, sie seien dabei gewesen, als Paul Ellison Präsident wurde. Und jeder einzelne wird behaupten: ›Ich stand direkt neben ihm. Ich hätte ihn anfassen können.‹«
»Du bist ein Zyniker, Cohn.«
»Und ob! Die Politiker werden doch alle im selben Ofen gebacken. Sie machen bloß mit, weil sie etwas für sich dabei herausholen wollen. Macht euch nichts vor, Leute! Unser neuer Präsident ist ein Mann der Reformen, ein Idealist. Das muss einfach jeden intelligenten Menschen in Panik versetzen. Ein Liberaler, das ist für mich einer, der auf den Wolken über der Realität schwebt.«
In Wirklichkeit war Ben Cohn alles andere als ein Zyniker. Er hatte Paul Ellisons Karriere vom ersten Tag an verfolgt, und obwohl er anfangs nicht übermäßig viel von ihm hielt, hatte er seine Meinung allmählich geändert, je weiter Ellison aufstieg. Ellison war kein Jasager. Er stand wie eine Eiche in einem Wald aus schwächeren Stämmchen.
Draußen fegten Regenböen vom Himmel. Hoffentlich ist dieses Sauwetter kein bösesOmenfürdie kommenden vierJahre, dachte Ben Cohn. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Fernseher zu.
»Die Präsidentschaft ist eine hell leuchtende Fackel«, sagte Ellison gerade. »Das amerikanische Volk hat sie entzündet, und alle vier Jahre geht sie von einer Hand in die andere über. Diese Fackel, die mir jetzt anvertraut worden ist, ist die mächtigste Waffe der Welt. Sie könnte einen Brand entfachen, der die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, bis auf die Grundmauern abbrennt, sie kann aber auch das Leuchtfeuer sein, das die Zukunft erleuchtet – für uns und für alle anderen Völker. Die Entscheidung liegt bei uns. Ich möchte heute nicht nur an unsere Verbündeten, sondern auch an die Länder der sozialistischen Welt appellieren. An der Schwelle des einundzwanzigsten Jahrhunderts gibt es keinen Raum mehr für Konfrontationen, wir müssen begreifen, dass wir nur eine einzige Welt haben, und wir müssen diese eine Welt zu einer Realität machen! Jeder andere Weg führt unweigerlich in die Katastrophe. Ich bin mir der Tatsache durchaus bewusst, dass uns heute noch Abgründe von den Ostblockstaaten trennen, aber wir werden es als unsere vornehmste Aufgabe betrachten, über diese Abgründe Brücken zu bauen.«
Seine Worte klangen ernsthaft und aufrichtig. Er scheint es ernst zu meinen, dachte Ben Cohn. Ich hoffe, niemand bringt den armen Kerl um.
In Junction City, Kansas, war es ein Tag, an dem jedermann lieber hinter dem warmen Ofen geblieben wäre: trüb und kalt. Es schneite so stark, dass man auf dem Highway Nr. 6 praktisch die eigene Motorhaube nicht sah. Mary Ashley bemühte sich, ihren alten Caravan auf der Mitte der Straße zu halten, wo die Schneepflüge die Fahrbahn geräumt hatten. Sie wusste jetzt schon, dass sie zu spät zur Vorlesung kommen würde. Dennoch fuhr sie nicht schneller. Wenn sie von der Straße abkam, würden ihre Studenten den ganzen Tag auf sie warten müssen.
Aus dem Autoradio kam die Stimme des Präsidenten: »… fehlt es nicht an Stimmen, die sagen, wir sollten weniger Brücken bauen und dafür mehr Bunker. Diesen Leuten habe ich immer geantwortet, dass wir endlich aufhören müssen, uns und unsere Kinder an eine Zukunft zu fesseln, die von weltpolitischen Auseinandersetzungen bis hin zum Atomkrieg bedroht wird.«
Ich bin froh, dass ich ihn gewählt habe, dachte Mary Ashley. Paul Ellison wird ein guter Präsident werden.
Und während draußen die weißen Flocken vorbeiwirbelten, nahm sie das Steuer fest in die Hand.
In St. Croix schien eine tropische Sonne vom Himmel, aber Harry Lantz hatte trotzdem keine Lust, sein Motel zu verlassen. Er hatte drinnen genug Spaß. Er lag splitterfasernackt zwischen den Dolly-Sisters im Bett wie ein Hamburger in seinem Brötchen. Lantz hatte zwar den Verdacht, dass die Dolly-Sisters überhaupt nicht miteinander verwandt waren; denn die eine hatte schwarzes und die andere blondes Haar an den entscheidenden Stellen, aber das war ihm herzlich egal. Das einzige, worauf es ihm ankam, war die Geschicklichkeit, mit der die beiden Schwestern ihre Dienstleistungen ausführten. Und in dieser Hinsicht war er völlig zufrieden, genauer gesagt, er stöhnte vor Lust.
Am anderen Ende des Zimmers flimmerte ein Fernsehgerät. Auch in die Karibik wurde die Rede des Präsidenten live übertragen.
»… denn ich bin fest überzeugt, dass es kein Problem zwischen den Weltmächten gibt, das mit gutem Willen nicht gelöst werden könnte. Den Eisernen Vorhang können wir überwinden, die Berliner Mauer muss fallen!«
Sally unterbrach ihre Bemühungen einen Moment. »Soll ich das verdammte Ding abstellen, Schatz?«
»Nein, lass nur! Ich möchte hören, was der Kerl sagt.«
Annette hob den Kopf. »Haben Sie ihn gewählt?«
»Verdammt noch mal!« brüllte Lantz. »Quatscht nicht, sondern macht weiter!«
»Sie erinnern sich wahrscheinlich daran, dass Rumänien nach dem Tod von Präsident Ceausescu die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten abgebrochen hat. Heute kann ich Ihnen mitteilen, dass unsere Gespräche mit Präsident Alexandros Ionescu zu einem ersten Erfolg geführt haben. Rumänien wird die diplomatischen Beziehungen zu uns wiederaufnehmen.«
Die Menge auf der Pennsylvania Avenue klatschte Beifall.
Harry Lantz schoss so abrupt hoch, dass Annettes Zähne sich tief in sein Fleisch bohrten. »Verflucht!« kreischte Lantz. »Ich bin schon beschnitten. Kannst du nicht aufpassen?«
»Warum hast du so gezappelt, Schatz?«
Aber Lantz schenkte ihr keine Beachtung. Seine Augen klebten jetzt förmlich am Bildschirm.
»Eine unserer ersten Amtshandlungen«, sagte der Präsident, »wird darin bestehen, einen Botschafter nach Rumänien zu schicken. Und das ist nur der Anfang …«
In Bukarest war es Abend. Plötzliches Tauwetter hatte dafür gesorgt, dass sich die Einwohner mitten im Januar auf den Straßen bewegten, als wäre es Frühling. Überall in den Läden herrschte reges Gedränge.
Präsident Alexandros Ionescu saß, umgeben von einem halben Dutzend Beratern, in seinem Büro im alten Palast an der Calea Victoriei und verfolgte die Antrittsrede seines amerikanischen Amtskollegen über einen Kurzwellensender im Radio.
»… ich habe nicht die Absicht, es damit schon genug sein zu lassen«, sagte Paul Ellison gerade. »Albanien hat die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten schon 1946 abgebrochen. Ich habe den Wunsch, unsere Beziehungen wieder zu normalisieren. Die Beziehungen zu Bulgarien, zur ČSSR und zur Deutschen Demokratischen Republik möchte ich nachhaltig verbessern.«
Aus dem Radio war lebhafter Beifall zu hören.
»Dass wir unseren Botschafter nach Rumänien schicken, ist der Anfang einer neuen Initiative zur Völkerverständigung. Wir dürfen niemals vergessen, dass alle Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben, dass ihre Probleme überall auf der Welt die gleichen sind und dass sich ihr Schicksal gemeinsam entscheidet. Was uns verbindet, ist letztlich stärker als das, was uns trennt; und dass uns überhaupt etwas trennt, haben wir uns nur selbst zuzuschreiben.«
In einer schwerbewachten Villa des Pariser Vororts Neuilly saß Marin Groza, der Chef der rumänischen Exil-Organisation »Freies Vaterland« vor dem Fernsehgerät und verfolgte die Rede des amerikanischen Präsidenten über Chaine 2.
»… Ich verspreche Ihnen, dass ich mein Bestes tun und auch andere dazu ermutigen werde, ihr Bestes zu geben.«
Der Beifall dauerte volle fünf Minuten.
»Ich glaube, unsere Stunde ist gekommen, Lev«, sagte Groza nachdenklich.
Lev Pasternak, sein Sicherheitschef, war verblüfft. »Wird das denn Ionescu nicht helfen?« fragte er.
Groza schüttelte den Kopf. »Ionescu ist ein Tyrann, deshalb wird ihm letztendlich nichts helfen. Aber wir müssen den richtigen Zeitpunkt zum Zuschlagen wählen. Als wir ihn vor drei Jahren zu stürzen versuchten, haben wir zu früh losgeschlagen. Es darf keinen zweiten Misserfolg geben!«
Pete Connors war nicht so betrunken, wie er sein wollte. Er hatte gerade seinen fünften Scotch heruntergespült, als seine Freundin Nancy, die Sekretärin, mit der er zusammenlebte, ihm einen zögernden Blick zuwarf. »Findest du nicht, dass du allmählich genug hast?« fragte sie. Pete grinste und patschte ihr mit der flachen Hand auf den Hintern.
»Unser Präsident spricht«, sagte sie. »Benimm dich gefälligst.«
Connors drehte sich wieder zum Fernseher um. »Du verdammter kommunistischer Hurensohn!« grölte er. »Das ist mein Land hier, und die CIA wird nich’ zulassen, dass du es verkaufst! Wir werden dich stoppen, du elender Kommie! Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten!«
2
»Ich werde deine Hilfe brauchen, Stan«, sagte Paul Ellison. »Viel Hilfe!«
»Ich stehe hinter dir«, sagte Rogers.
Sie saßen im Oval Office. Der Präsident hatte seinen Platz am Schreibtisch eingenommen, hinter ihm hing eine große amerikanische Fahne. Es war ihr erstes Zusammentreffen in diesem historischen Raum, und Ellison war ziemlich befangen.
Wenn Stanton nicht diesen Fehler gemacht hätte, dachte er, dann säße er jetzt hinter dem Schreibtisch des Präsidenten.
Als ob er seine Gedanken erraten hätte, sagte Rogers jetzt: »Ich muss dir etwas gestehen, Paul. Als du nominiert worden bist, war ich unglaublich eifersüchtig und neidisch. Es war mein Traum gewesen, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden, und dann hast du angefangen, diesen Traum in die Tat umzusetzen. Aber soll ich dir etwas sagen? Als ich schließlich begriff, dass ich keine Aussichten mehr hatte, ins Weiße Haus einzuziehen, war ich froh, dass du derjenige warst, der auf dem Präsidentenstuhl sitzen würde. Ich finde, du machst da eine sehr gute Figur, Paul.«
Ellison lächelte und nickte seinem Freund zu. »Ehrlich gesagt, finde ich dieses Büro ziemlich unheimlich. Ich habe ständig das Gefühl, der Geist von George Washington, Lincoln oder Jefferson schaut mir über die Schulter.«
»Es hat aber auch Präsidenten gegeben, die …«
»Ich weiß, aber schließlich müssen wir den großen Vorbildern nacheifern.«
Er drückte auf einen Knopf auf dem Schreibtisch, und Sekunden später betrat der Butler den Raum.
»Ja, Mr. Président?«
Paul Ellison wandte sich an Rogers. »Kaffee?«
»Klingt gut.«
»Gebäck oder Sandwiches?«
»Nein, danke. Barbara sagt, ich soll auf meine Linie achten.«
Der Präsident nickte dem Butler zu, und der Mann verließ lautlos den Raum.
Barbara. Sie hatte jedermann überrascht. Die Klatschbasen in Washington waren überzeugt gewesen, dass Rogers’ zweite Ehe noch nicht einmal ein Jahr lang gutgehen würde. Aber jetzt waren schon fünfzehn Jahre vergangen, und die Ehe war immer noch ein Erfolg. Rogers hatte in Washington eine angesehene Anwaltskanzlei aufgebaut, und seine Frau hatte sich einen glänzenden Ruf als Gastgeberin erworben.
Präsident Ellison stand auf und ging unruhig auf und ab. »Meine Völkerverständigungs-Rede scheint einigen Wirbel gemacht zu haben«, sagte er. »Ich nehme an, du hast gelesen, was die Zeitungen schreiben?«
Rogers zuckte die Achseln. »Du weißt doch, wie die Journalisten sind. Sie bauen gern Helden auf, damit sie später etwas zum Abschießen haben.«
»Was die Journalisten sagen, interessiert mich eigentlich gar nicht so. Mich interessiert viel mehr: Was sagen die Leute?«
»Um ganz ehrlich zu sein: Du machst einigen Leuten ganz schön Angst, Paul. Das Militär ist entsetzt über dein Vorhaben, und einige Drahtzieher in der Stadt überlegen schon fieberhaft, wie sie deine Pläne zu Fall bringen können.«
»Meine Pläne werden nicht fehlschlagen.« Ellison lehnte sich im Sessel zurück. »Weißt du, was das Schlimmste an der heutigen Welt ist?« fragte er. »Es gibt keine Staatsmänner mehr. Die meisten Staaten werden von mittelmäßigen Politikern regiert. Dabei wurde die Welt vor nicht allzu langer Zeit noch von wahren Giganten beherrscht. Manche von ihnen waren gut, andere dagegen sehr böse, aber sie waren Giganten. Roosevelt zum Beispiel und Churchill, Hitler und Mussolini, Charles de Gaulle und Stalin. Warum haben die eigentlich alle zur gleichen Zeit leben müssen? Warum gibt es solche Gestalten denn heute nicht mehr?«
»Es ist gar nicht so einfach, als Gigant in einer 54er Bildröhre leben zu müssen.«
Der Butler erschien wieder. Er trug ein silbernes Tablett mit einer Kaffeekanne und zwei Tassen, die alle mit dem Wappen des Präsidenten geschmückt waren. Mit geübten Bewegungen schenkte er den Kaffee aus. »Brauchen Sie sonst noch etwas, Mr. Président?« fragte er.
»Nein. Das ist alles. Vielen Dank, Henry.«
Der Präsident wartete, bis der Butler den Raum verlassen hatte. »Ich wollte dich bitten, mir einen Botschafter für Rumänien vorzuschlagen«, sagte er.
»Ja.«
»Ich brauche dir nicht zu sagen, wie wichtig der Posten in Bukarest ist. Bitte mach mir bald einen Vorschlag.«
Rogers trank einen Schluck Kaffee, dann stand er auf. »Ich werde mich sofort im State Department erkundigen«, sagte er.
In Neuilly war es zwei Uhr morgens. Marin Grozas Villa lag in tiefer Dunkelheit, der Mond war hinter Sturmgewölk verborgen. In den stillen Straßen war nur gelegentlich und weit entfernt das Geräusch eines vorbeifahrenden Wagens zu hören. Lautlos bewegte sich eine schwarzgekleidete Gestalt auf die Ziegelmauer zu, die den Park der Villa umgab. Auf der einen Schulter trug der Mann eine Decke und ein Seil, über der anderen hingen eine Uzi mit Schalldämpfer und eine Betäubungswaffe. Als er die Mauer erreicht hatte, hielt der Mann inne und lauschte. Fünf Minuten lang blieb er bewegungslos stehen und wartete auf ein Geräusch. Alles blieb still. Zufrieden nahm er das Nylonseil von der Schulter und schleuderte den daran befestigten Haken über die Mauer, bis er sich auf der Mauerkrone verhakte. Geschmeidig begann er zu klettern. Ehe er sich auf die Mauer setzte, warf er die Decke darüber, um sich vor den vergifteten Eisendornen zu schützen, die oben eingelassen waren. Wieder verharrte er minutenlang reglos und lauschte. Dann löste er den Haken und drehte ihn um. Jetzt hing das Seil auf der Innenseite der Mauer herunter. Vorsichtig ließ er sich hinabgleiten. Er vergewisserte sich, dass er seinen Balisong, das tödliche philippinische Klappmesser, das sich mit einer Hand öffnen ließ, noch am Gürtel trug.
Als nächstes kamen die Wachhunde. Mit dem Rücken zur Mauer wartete der Einbrecher, dass sie seine Witterung aufnahmen. Es waren drei auf den Mann dressierte Dobermannrüden, die darauf abgerichtet waren zu töten. Aber die Hunde waren nur ein Hindernis. Der Park und die Villa waren vollgestopft mit elektronischen Sensoren und wurden ständig von Fernsehkameras überwacht. Die Post und vor allem etwaige Päckchen wurden im Wächterhaus am Tor entgegengenommen und vom Wachpersonal überprüft. Die Türen der Villa waren gegen Explosionen gesichert. Die Villa hatte eine eigene Wasserversorgung, und gegen Giftanschläge schützte sich Marin Groza durch einen Vorkoster. Die Villa war eine uneinnehmbare Festung. Oder doch nicht? Der schwarzgekleidete Mann war gekommen, um das Gegenteil zu beweisen.
Er hörte die Hunde auf sich zustürmen, ehe er sie sah. Mit gefletschten Zähnen flogen sie aus der Dunkelheit auf ihn zu, um ihm die Halsschlagader zu zerreißen. Er zielte mit der Betäubungswaffe zunächst auf den linken, der schon am nächsten heran war, und dann auf den rechten. Die Schüsse trafen, genügten aber nicht, um den Schwung der angreifenden Hundekörper zu bremsen. Der Einbrecher musste sich ducken, um nicht umgerissen zu werden. Als er sich umdrehte, sprang der dritte Hund auf ihn zu. Der Mann feuerte noch einmal, und dann herrschte Stille.
Er wusste, wo die akustischen Fallen im Boden versteckt waren, und machte einen großen Bogen darum. Leise schob er sich durch den Park und hielt sich dabei immer im toten Winkel der Fernsehkameras. Zwei Minuten, nachdem er über die Mauer gekommen war, stand er am Hintereingang der Villa.
Aber als er nach der Klinke fasste, wurde er plötzlich in Flutlicht getaucht, und eine Stimme rief: »Waffe weg! Hände hoch! Keine Bewegung!«
Der Mann ließ seine Uzi auf den Boden gleiten und sah nach oben. Auf dem Dach der Villa hockten drei oder vier Männer und hielten ihre Waffen auf ihn gerichtet. Hinter einer Hausecke standen weitere Wachen.
»Zum Teufel! Warum habt ihr so lange gebraucht?« knurrte der Einbrecher wütend. »Ich hätte nie so nahe herankommen dürfen!«
»Das sind Sie auch nicht«, sagte einer der Männer. »Wir hatten Sie schon unter Beobachtung, als Sie noch auf der anderen Seite der Mauer waren.«
Lev Pasternak war keineswegs besänftigt. »Dann hättet ihr mich auch früher aufhalten sollen. Ich hätte ja ein Selbstmordkommando durchführen können, mit einem Riesenpaket Dynamit oder einem Granatwerfer. Wir treffen uns zu einer Besprechung im kleinen Konferenzzimmer, pünktlich um acht. Sorgen Sie dafür, dass das gesamte Personal vollzählig anwesend ist. Die Hunde sind betäubt. Stellen Sie jemand zur Aufsicht ab, bis sie wieder aufwachen.«
Lev Pasternak war überzeugt, dass er der beste Leibwächter der Welt sei. Er hatte als Pilot am Sechstagekrieg teilgenommen und war anschließend Agent des Mossad geworden, des bekanntesten der fünf israelischen Geheimdienste.
Er erinnerte sich noch genau an den Tag vor zwei Jahren, als ihn sein Vorgesetzter, Oberst im Geheimdienst, zu sich ins Büro bestellt hatte.
»Lev, jemand möchte Sie für ein paar Wochen ausleihen.«
»Ich hoffe, es ist eine scharfe Blondine«, sagte Lev.
»Nein, es ist Marin Groza.«
Der Mossad hatte eine umfangreiche Akte über den rumänischen Exilpolitiker. Groza galt als Führer einer weitverzweigten Untergrundorganisation und hatte vor einigen Jahren einen Putsch gegen Präsident Ionescu geplant, der allerdings fehlschlug. Einer seiner eigenen Leute hatte Groza verraten. Zwei Dutzend seiner Helfershelfer waren hingerichtet worden, und Groza selbst hatte nur mit Mühe und Not seine Haut retten können, als er aus dem Land flüchtete. Frankreich hatte ihm schließlich Asyl gewährt. Die rumänische Regierung brandmarkte ihn als Verräter und setzte einen hohen Preis auf seinen Kopf aus. Seither hatte es ein halbes Dutzend fehlgeschlagene Attentate auf Groza gegeben. Beim letzten allerdings war er verletzt worden.
»Was will er denn von mir?« fragte Pasternak. »Er wird doch von der französischen Regierung beschützt.«
»Das genügt ihm offenbar nicht. Er möchte absolute Sicherheit haben. Deshalb hat er uns um Hilfe gebeten. Ich habe Sie als den besten Spezialisten empfohlen.«
»Heißt das, ich müsste nach Frankreich?«
»Nur für ein paar Wochen.«
»Ich mag aber nicht. Die –«
»Lev, hören Sie. Das ist ein wichtiger Mann. Soviel wir wissen, hat er in Rumänien genügend Anhänger, um Ionescu zu stürzen. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er zuschlagen. Bis dahin müssen wir ihn auf jeden Fall am Leben erhalten.«
Lev Pasternak überlegte. »Ein paar Wochen, haben Sie gesagt?«
»Ja. Länger nicht.«
In diesem Punkt hatte sich der Oberst getäuscht, aber Groza hatte Pasternak gefallen. Der Oppositionspolitiker war ein zierlicher, zerbrechlich aussehender Mann mit asketischen, sorgenvollen Gesichtszügen. Er hatte eine Adlernase und ein festes, energisches Kinn. Seine breite Stirn wurde von einem weißen Haarkranz gesäumt. Er hatte tiefschwarze Augen, die fanatisch leuchteten, wenn er sprach.
»Es ist mir egal, ob ich sterbe«, sagte er Lev gleich bei ihrer ersten Begegnung. »Sterben müssen wir alle. Aber ich will nicht zu früh sterben. Ich muss noch ein oder zwei Jahre leben. Länger brauche ich nicht mehr, um Ionescu aus meinem Vaterland zu vertreiben.« Seine Hand streichelte gedankenlos über eine blutrote Narbe auf seiner Schläfe. »Niemand hat das Recht, den Tyrannen zu spielen. Wir müssen Rumänien befreien und das Volk selbst entscheiden lassen, welche Regierung es will.«
Lev Pasternak hatte das Sicherheitssystem der Villa in Neuilly von Grund auf reformiert. Er holte ein paar seiner eigenen Leute aus Israel, und die Leute, die er neu einstellte, wurden genau überprüft. Jedes einzelne Ausrüstungsstück entsprach dem neuesten Stand der Sicherheitstechnik.
Pasternak sprach praktisch jeden Tag mit Groza, und je mehr Zeit er mit ihm verbrachte, umso mehr bewunderte er ihn. Als Groza ihn bat, auf Dauer bei ihm zu bleiben, zögerte Pasternak nicht.
»Ich werde bei Ihnen bleiben«, sagte er, »bis Sie in Rumänien die Macht übernehmen. Dann werde ich nach Israel zurückkehren.«
Groza schlug ein.
In unregelmäßigen Abständen ließ Pasternak Scheinangriffe auf die Villa durchführen, um die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen. Mit dem Verlauf der heutigen Übung war er gar nicht zufrieden. Einige der Leute sind nachlässig geworden, dachte er. Ich muss sie ersetzen.
Er ging ins Haus und überprüfte die Infrarot-Detektoren, die elektronischen Alarmsysteme und die Bewegungs-Sensoren in den Türstöcken und Wänden. Als er an Grozas Schlafzimmer vorbeikam, hörte er einen heftigen Schlag, und unmittelbar darauf begann Groza vor Schmerzen zu schreien.
Pasternak ging weiter, ohne sich darum zu kümmern.
3
Das Hauptquartier der CIA liegt in Langley, Virginia, sieben Meilen nordwestlich von Washington, auf der anderen Seite des Potomac. Die Zufahrt ist mehrfach gesichert, unter anderem mit einem Schlagbaum, auf dem eine rote Warnlampe leuchtet. Das Pförtnerhaus ist rund um die Uhr mit bewaffneten Posten besetzt, und alle Besucher erhalten farbige Plaketten, die ihnen allerdings nur zu derjenigen Abteilung Zutritt gewähren, in der sie tatsächlich zu tun haben. Vor dem grauen, siebenstöckigen Hauptgebäude, das gelegentlich im Scherz »Die Spielzeugfabrik« genannt wird, steht ein Standbild von Nathan Hale, der 1776 im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg von den Engländern hingerichtet wurde, weil er ihre Stellungen in Manhattan auszuspionieren versucht hatte. Gegenüber den Glastüren des Eingangs befindet sich ein Innenhof mit zahlreichen Magnolienenbäumen. Über dem Empfangstisch prangt eine Marmortafel mit der Inschrift:
Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, Und die Wahrheit wird euch frei machen.
Der Öffentlichkeit ist der Zutritt zu dem Gebäude verwehrt. Wer das Haus ungesehen betreten will, kann einen unterirdischen Zugang benutzen, der vor einer Mahagonitür endet, hinter der sich ein Aufzug befindet. Dieser Eingang wird ebenfalls Tag und Nacht von Sicherheitsbeamten in grauen Flanellanzügen bewacht.
Im Konferenzzimmer im siebenten Stock, das von Beamten mit kurzläufigen 38ern im Schulterhalfter bewacht wurde, fand gerade wie üblich die Montagskonferenz statt. Rund um den großen Eichentisch saßen Ned Tillingast, der Direktor der CIA, General Oliver Brooks, Stabschef der US-Army, Außenminister Floyd Baker, Pete Connors, der Leiter der Spionageabwehr und Stanton Rogers, der außenpolitische Berater des Präsidenten.
Ned Tillingast, der Direktor, war Anfang sechzig, ein kühler, schweigsamer Mann, auf dem böse Geheimnisse lasteten. Es gibt eine helle und eine dunkle Seite der CIA. Auf der dunklen Seite finden die geheimen Operationen statt, und Tillingast hatte sieben Jahre lang die viertausendfünfhundert CIA-Leute geführt, die in diesem Bereich tätig waren.
General Oliver Brooks war Absolvent der Militärakademie West Point und hatte sich sein Leben lang privat und beruflich streng an die Dienstordnung gehalten. Er gehörte mit Leib und Seele der Firma, und seine Firma war die US-Army.
Außenminister Floyd Baker war ein Anachronismus, ein Rückfall in frühere Zeiten. Er stammte aus den Südstaaten und war ein hochgewachsener, silberhaariger und aristokratisch aussehender Gentleman der alten Schule. Ein Mann, der Gamaschen zu tragen schien, wo immer er sich auch aufhielt. Er besaß im ganzen Land Zeitungen und galt als sehr reich. Es gab in ganz Washington niemand mit einem schärferen politischen Instinkt, und Bakers Antennen fingen jede kleinste Richtungsänderung in Kongress und Senat auf.
Pete Connors war Ire, hartnäckig und stur, trinkfest und furchtlos. Er hatte nur noch wenige Monate bei der CIA, im Juni würde er zwangspensioniert werden. Connors war der Chef der Spionageabwehr, der geheimsten, am besten abgeschotteten Abteilung der CIA. Er hatte in den verschiedensten Abteilungen Dienst getan und erinnerte sich noch gut an die Zeiten, als die CIA-Leute noch als die Goldjungen Amerikas galten. Pete Connors war selbst einer der Goldjungen gewesen. Er hatte zum Sturz der Regierung Mossadegh beigetragen und dafür gesorgt, dass der Schah den Pfauenthron wieder einnehmen konnte. Auch an der »Operation Mungo« im Jahre 1961, die Fidel Castro beseitigen sollte, war er beteiligt gewesen.
»Nach der Schweinebucht war es nicht mehr dasselbe«, klagte er häufig, und wie lang seine Litanei dann wurde, hing lediglich davon ab, wie betrunken er war. »Danach haben die verdammten Weltverbesserer uns auf der ganzen Welt madig gemacht. In allen Zeitungen stand, wir wären eine Bande verlogener Trottel, die über die eigenen Füße stolpern. Ein paar von diesen Saukerlen veröffentlichten sogar die Namen unserer Agenten, und Dick Welch, unser Chef in Griechenland, wurde ermordet.«
Pete Connors hatte drei miserable Ehen hinter sich gebracht, die alle an den Belastungen durch seine Arbeit gescheitert waren. Aber seiner Ansicht nach war für Amerika kein Opfer zu groß.
Auch heute schäumte er wieder einmal vor Wut. »Wenn wir dem Präsidenten diese beschissene Völkerverständigungspolitik durchgehen lassen, dann geht Amerika in kürzester Zeit völlig den Bach runter. Wir müssen ihn stoppen. Wir dürfen nicht zulassen –«
An dieser Stelle unterbrach ihn Floyd Baker. »Mr. Connors, ich muss doch sehr bitten. Der Präsident ist erst seit einer Woche im Amt. Wir sind dazu da, seine Politik in die Tat umzusetzen und nicht, um –«
»Ich bin aber nicht dazu da, mein Land an die Kommunisten zu verkaufen, Mister Baker. Von dieser neuen diplomatischen Offensive hat der Präsident vor seiner großen Rede nie ein Sterbenswörtchen verlauten lassen. Er hat uns alle damit überrumpelt. Wir hatten gar keine Gelegenheit, Widerspruch einzulegen.«
»Vielleicht war genau das seine Absicht«, sagte Baker.
Connors starrte ihn ungläubig an. »Mein Gott, Sie scheinen ja sogar seiner Meinung zu sein!«
»Er ist mein Präsident«, erklärte Baker bestimmt. »Und Ihrer übrigens auch!«
Ned Tillingast versuchte, die Situation zu entschärfen. »Connors hat nicht ganz unrecht«, sagte er zu Stanton Rogers. »Der Präsident begibt sich auf einen gefährlichen Weg. Die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen bedeutet doch letztlich nichts anderes, als dass der Präsident Rumänien, Albanien, Bulgarien und die ganzen übrigen Ostblockstaaten geradezu einlädt, ihre Spione in die Vereinigten Staaten zu schicken, getarnt als Kulturattachés, Chauffeure, Sekretärinnen, Dienstmädchen usw. Wir geben Milliarden Dollar aus, um die Hintertür zu bewachen, und der Präsident will ihnen den Vordereingang aufmachen.«
General Brooks nickte zustimmend. »Ich bin auch nicht gefragt worden. Meiner Ansicht nach könnte der Plan des Präsidenten geradewegs zum Untergang Amerikas führen.«
»Gentlemen«, sagte Rogers. »Der eine oder andere von uns ist vielleicht anderer Meinung als Präsident Ellison, aber wir wollen doch nicht außer acht lassen, dass ihn die Amerikaner gewählt haben, damit er dieses Land regiert.« Seine Augen glitten über die Gesichter der Männer hin, die vor ihm am Tisch saßen. »Wir alle gehören zur Mannschaft des Präsidenten, und es ist unsere Aufgabe, den Richtlinien zu folgen, die er bestimmt. Wir sind verpflichtet, ihn nach Kräften zu unterstützen.« Widerwilliges Schweigen antwortete ihm. »Der Präsident wünscht einen aktuellen Bericht über die Situation in Rumänien. Bitte, stellen Sie alles zusammen.«
»Auch die geheimen Informationen?« fragte Connors.
»Alles. Seien Sie ganz ehrlich. Wie sieht es aus in Rumänien?«
»Präsident Ionescu sitzt fest im Sattel«, sagte Ned Tillingast. »Er hat die Familie Ceauşescu vollkommen ausgeschaltet. Alle Anhänger Ceauşescus sind entweder tot, im Gefängnis oder im Ausland. Seit Ionescus Machtübernahme ist es wirtschaftlich rapide bergab gegangen. Die Leute hassen ihn geradezu.«
»Könnte es denn einen Aufstand gegen ihn geben?«
»Das ist eine interessante Frage«, sagte Tillingast. »Erinnern Sie sich noch an den Putsch vor drei Jahren? Damals hätte Marin Groza Ionescus Regierung beinahe gestürzt.«
»Ja. Aber musste Groza nicht fliehen? Er konnte doch nur mit knapper Not seine Haut retten.«
»Das ist richtig. Wir mussten ihm helfen. Aber die Stimmung in der Bevölkerung für ihn soll positiv sein. Aus unserer Sicht wäre es gut, wenn Groza nach Rumänien zurückkehren könnte. Und wenn er an die Macht käme, wäre das sogar ausgezeichnet. Wir beobachten die Dinge deshalb sehr genau.«
Rogers wandte sich an den Außenminister. »Haben Sie eine Liste mit Vorschlägen für den Botschafterposten in Bukarest?«
Floyd Baker klappte seinen Aktenkoffer auf, nahm einige Papiere heraus und gab Rogers das oberste Blatt. »Das sind die aussichtsreichsten Namen. Alles hochqualifizierte Karrierediplomaten. Jeder einzelne ist sicherheitsüberprüft. Keine finanziellen Probleme, keine dunklen Punkte in der Vergangenheit, nichts Belastendes.«
Als Rogers nach der Liste griff, fügte der Außenminister hinzu: »Das State Department würde natürlich einen Karrierediplomaten bevorzugen, der die entsprechende Ausbildung hat. Eine rein politische Ernennung könnte in der jetzigen, delikaten Situation Probleme schaffen. Bukarest ist ein sehr heikler Posten. Die Rumänen muss man mit Samthandschuhen anfassen.«
»Ich bin ganz Ihrer Auffassung.« Rogers erhob sich. »Ich werde die Liste mit dem Präsidenten erörtern und melde mich dann wieder bei Ihnen. Der Präsident möchte den Posten so schnell wie möglich besetzen.«
Auch die anderen Sitzungsteilnehmer standen auf. »Bleib doch bitte noch einen Augenblick, Pete«, sagte Ned Tillingast. »Ich möchte etwas mit dir besprechen.«
Als die beiden CIA-Leute allein waren, sagte Tillingast: »Du hast ja ziemlich heftig losgelegt, Pete.« »Aber ich habe doch recht«, sagte Connors. »Der Präsident will uns an die Kommunisten verkaufen. Was sollen wir denn tun?«
»Den Mund halten.«
»Ned, wir sind dazu da, den Feind zu finden und zu bekämpfen. Notfalls müssen wir ihn auch umbringen. Aber was ist, wenn der Feind sich hinter unseren Linien befindet? Wenn er im Weißen Haus sitzt?«
»Vorsichtig, Pete! Ganz vorsichtig!«
Tillingast war schon länger im Dienst als Pete Connors. Er hatte schon bei »Wild« Bill Donovans OSS mitgemacht, lange vor der Gründung der CIA. Auch er war wütend darüber, dass die Moralisten im Kongress der Organisation, die er liebte, jetzt Daumenschrauben anlegen wollten. Allerdings gab es auch im CIA selbst lebhafte Meinungsverschiedenheiten. Während die einen fest überzeugt waren, man müsse den Sowjets grundsätzlich mit Härte begegnen, gab es auch Leute, die hofften, den russischen Bären soweit zähmen zu können, dass er ein harmloses Schmusetier würde. Wir müssen um jeden Cent kämpfen, dachte Tillingast bitter, und in Moskau kann der KGB jedes Jahr tausend neue Agenten ausbilden.
Tillingast hatte sich Pete Connors gleich vom College geholt, und Connors war einer der besten geworden. Aber in den letzten Jahren hatte er sich zu einem allzu unberechenbaren, allzu schießfreudigen Cowboy entwickelt.
»Pete – hast du zufällig schon einmal etwas von einer Untergrundorganisation namens Patriots for Freedom gehört?« fragte Tillingast.
Connors runzelte die Stirn. »Nein, da müsste ich lügen. Was sind das für Leute?«
»Vorläufig sind sie nicht mehr als ein Gerücht. Viel Rauch, wenig Feuer. Sieh doch mal zu, ob du etwas mehr herausfinden kannst.«
»Wird gemacht.«
Eine Stunde später stand Pete Connors in einer öffentlichen Telefonzelle in Hains Point und wählte eine vielstellige Nummer.
»Ich habe eine Botschaft für Odin«, sagte er leise.
»Hier spricht Odin«, sagte General Oliver Brooks.
Auf dem Rückweg zu seinem Büro las Stanton Rogers in seinem Wagen die Liste der möglichen Kandidaten für den Botschafterposten in der rumänischen Hauptstadt. Die Liste war erstklassig. Der Außenminister hatte gute Arbeit geleistet. Sämtliche Kandidaten hatten sowohl in westlichen Staaten als auch im Ostblock schon wichtige Posten bekleidet, und manche waren obendrein noch in Afrika oder im Fernen Osten gewesen. Der Präsident wird zufrieden sein, dachte Rogers.
»Das sind doch alles Mumien«, fauchte Präsident Ellison wütend. Er warf die Liste auf den Tisch. »Alles Mumien.«
»Aber Paul«, protestierte Rogers. »Das sind erfahrene Diplomaten.«
»Genau«, sagte der Präsident. »Lauter bornierte Beamtenseelen. Nichts als die Kleiderordnung des State Department im Kopf. Erinnerst du dich noch daran, wie wir Rumänien vor drei Jahren verloren haben? Unser ›erfahrener Karrierediplomat‹ in Bukarest machte Mist, und wir saßen draußen. Die Jungs im Nadelstreifenanzug machen mir Sorgen. Die wollen doch nie was riskieren. Als ich von einem Programm zur Völkerverständigung geredet habe, hab’ ich das wörtlich gemeint, Stan. Wir müssen in diesem Land, das uns gegenwärtig ziemlich misstrauisch gegenübersteht, einen verdammt guten Eindruck machen.«
»Aber wenn du da einen Amateur hinschickst, der keine Erfahrungen hat, riskierst du viel zu viel, Paul.«
»Vielleicht brauchen wir jemanden, der andere Erfahrungen mitbringt. Rumänien ist eine Art Testfall, Stan. Eine Pilotstudie für mein ganzes Programm, wenn du willst.« Der Präsident zögerte. »Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, was ich riskiere. Meine ganze Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Ich weiß, dass es eine Menge mächtiger Leute gibt, die es nur zu gern sähen, wenn das Ganze ein Misserfolg würde. Wenn es in Rumänien schiefgeht, dann ist die Sache gestorben. Dann kann ich Bulgarien, Albanien, die ČSSR und die übrigen Ostblockstaaten vergessen. Das werde ich nicht zulassen.«
»Ich kann ja noch einmal überprüfen, ob einer unserer politischen Kandidaten –«
Präsident Ellison schüttelte den Kopf. »Die sind inzwischen auch schon verdorben. Ich möchte jemand ganz Neues. Jemanden mit unkonventionellen Ansichten. Jemanden, der in der Lage ist, das Eis zu schmelzen. Das Gegenteil des hässlichen Amerikaners.«
Rogers warf dem Präsidenten einen erstaunten Blick zu. »Ich habe das Gefühl, du weißt schon längst, wen du willst, Paul? Hab’ ich recht?«
Der Präsident nahm sich eine Zigarre aus dem silbernen Kästchen auf seinem Tisch. »Um ganz ehrlich zu sein«, sagte er langsam, während er mit dem Streichholz hantierte, »Ich habe tatsächlich eine Idee.«
»Wer ist es?«
»Eine Frau. Erinnerst du dich zufällig an einen Aufsatz in der neuesten Ausgabe von Foreign Affairs mit der Überschrift: ›Entspannung ist möglich‹?«
»Ja.«
»Wie findest du ihn?«
»Sehr interessant. Die Verfasserin vertrat die Ansicht, wir könnten die kommunistischen Staaten auf unsere Seite ziehen, indem wir ihnen wirtschaftliche Unterstützung anbieten und –« Rogers unterbrach sich. »Es war eigentlich fast dasselbe wie das, was du bei der Amtseinführung gesagt hast.«
»Nur dass es ein halbes Jahr früher geschrieben worden ist als meine Rede. Diese Frau hat auch in Commentary und Public Affairs ausgezeichnete Artikel geschrieben. Letztes Jahr hat sie ein Buch über Osteuropa veröffentlicht, und ich muss zugeben, ich habe eine Menge daraus gelernt.«
»Na schön. Sie teilt also deine Ansichten über den Ostblock. Aber das qualifiziert sie doch nicht unbedingt für einen so wichtigen Posten wie –«
»Stan – ihre Ausführungen gingen weit über meine Ideen hinaus. Sie hat einen detaillierten Plan ausgearbeitet, der einfach großartig ist. Sie schlägt vor, die vier größten Wirtschaftsblöcke auf ganz neuer Basis zusammenarbeiten zu lassen.«
»Und wie? Das ist doch –«
»Von heute auf morgen geht das natürlich nicht, aber langfristig … 1949 haben die Ostblockstaaten den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe gebildet, COMECON oder RGW. Und 1958 haben sich die Westeuropäer zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammengeschlossen, zur EWG.«
»Ja, und?«
»Außerdem gibt es noch die OECD, zu der die Vereinigten Staaten, einige andere westliche Staaten und Jugoslawien gehören. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Länder der Dritten Welt in der Bewegung der Blockfreien und in der OPEC inzwischen ebenfalls ökonomische und politische Organisationen haben, denen wir nicht angehören.« Die Stimme des Präsidenten spiegelte seine innere Erregung. »Überleg dir doch mal, was für Möglichkeiten sich böten, wenn es uns gelänge, all diese Organisationen zusammenzuschließen und einen einzigen großen Weltmarkt zu schaffen. Das wäre doch phantastisch, nicht wahr? Ein solcher echter Weltmarkt würde den Weltfrieden dauerhaft sichern!«
»Das ist eine interessante Idee«, sagte Rogers vorsichtig, »aber doch nur eine sehr langfristige Zielsetzung.«
»Ach, du kennst doch das alte chinesische Sprichwort: ›Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt‹.«
»Und deshalb willst du diese Frau zur Botschafterin in Bukarest machen, Paul? Sie ist eine Amateurin, eine Anfängerin!«
»Einige unserer besten Botschafter sind Amateure gewesen. Anne Armstrong zum Beispiel, unsere frühere Botschafterin in Großbritannien, war Lehrerin und hatte keinerlei politische Erfahrung. Perle Mesta haben wir nach Luxemburg geschickt. Clare Boothe Luce war Botschafterin in Italien, der Schauspieler John Gavin war unser Vertreter in Mexiko und so weiter. Ein Drittel unserer heutigen Botschafter sind sogenannte Amateure.«
»Aber du weißt doch gar nichts über diese Frau, Paul.«
»Ich weiß, dass sie verdammt intelligent ist und dass wir auf derselben Wellenlänge liegen. Ich möchte, dass du soviel wie möglich herausfindest über sie.« Er tippte mit dem Finger auf eine Ausgabe von Foreign Affairs. »Sie heißt Mary Ashley.«
Zwei Tage später frühstückte Präsident Ellison mit seinem außenpolitischen Berater.
»Ich habe jetzt ein paar Informationen über deine Kandidatin«, sagte Rogers. Er zog ein engbeschriebenes Papier aus der Tasche. »Mary Elizabeth Ashley, wohnhaft in der Milford Road 27 in Junction City im Bundesstaat Kansas. Alter: fünfunddreißig Jahre, verheiratet mit Dr. Edward Ashley, zwei Kinder. Eine zwölfjährige Tochter namens Beth und ein zehnjähriger Sohn namens Tim. Vorsitzende des Ortsvereins Junction City der politischen Frauenliga. Assistenzprofessorin an der Kansas State University. Spezialistin für osteuropäische Geschichte und Politik. Ihr Großvater stammt aus Rumänien.« Rogers nickte bedächtig. »Vielleicht hast du recht, Paul. Vielleicht ist sie wirklich eine gute Botschafterin für Rumänien.«
»Was du herausgefunden hast, klingt jedenfalls gut«, sagte der Präsident nachdenklich. »Ich finde, wir sollten eine komplette Sicherheitsüberprüfung durchführen lassen.«
»Ich sorge dafür, Paul.«
4
»Ich bin anderer Ansicht, Frau Professor.« Barry Dylan, der jüngste und zugleich intelligenteste der Studenten in Mary Ashleys politikwissenschaftlichem Seminar sah sich unsicher um. »Alexander Ionescu ist viel schlimmer, als es Ceauşescu je war.«
»Können Sie diese Behauptung mit ein paar Details untermauern?« fragte Mary.
Die zwölf Doktoranden saßen im Halbkreis um Mary herum. Die Wartelisten für ihr Seminar waren länger als die jedes anderen Professors an der Kansas State University. Sie war eine fabelhafte Lehrerin und strahlte soviel Freundlichkeit, Humor und Wärme aus, dass alle ihre Nähe suchten. Je nachdem, welcher Stimmung sie war, wirkte ihr Gesicht interessant oder ganz einfach schön. Sie hatte die hohen Backenknochen eines Fotomodells und mandelförmige braune Augen. Ihr Haar war kräftig und dunkel. Ihre fabelhafte Figur erregte den Neid der Studentinnen und ließ die Studenten tagträumen, dabei war sie sich ihrer Schönheit überhaupt nicht bewusst.
Barry hatte sich schon häufig gefragt, ob seine Professorin wohl glücklich mit ihrem Mann war. Auch jetzt konnte er sich nur mit Mühe auf ihre Frage konzentrieren.
»Nun ja, als Ionescu die Macht übernahm, gab er zum Beispiel die eigenständige Position, die Rumänien gegenüber der Sowjetunion errungen hatte, sofort wieder auf. Alle Anhänger Ceauşescus wurden eingesperrt oder außer Landes getrieben.«
Jetzt meldete sich ein anderer Student. »Warum ist dann eigentlich Präsident Ellison so scharf darauf, diplomatische Beziehungen zu Bukarest aufzunehmen?«
»Ich glaube, er will Ionescu näher an den Westen heranziehen«, sagte Barry.
»Richtig«, sagte Mary. »Wir dürfen nicht vergessen, dass ja schon Ceauşescu gute Kontakte zu beiden Lagern gehabt hat. Können Sie dazu etwas sagen?«
Wieder meldete sich Barry. »Im Jahr 1963 hat sich Rumänien in der Auseinandersetzung zwischen der Sowjetunion und China neutral verhalten und damit seine Unabhängigkeit demonstriert.«
»Und wie steht es heute mit Rumäniens Beziehungen zu den Warschauer-Pakt-Staaten und der Sowjetunion im besonderen?« fragte Mary.
»Ich würde sagen, die Bindungen sind wieder stärker geworden.«
Eine andere Stimme meldete sich. »Da bin ich anderer Meinung. Die Rumänen haben die sowjetische Intervention in Afghanistan kritisiert, und mit dem Arrangement der Sowjetunion mit der Europäischen Gemeinschaft waren sie ebenfalls nicht einverstanden. Professor Ashley hat –«
Es klingelte. Die Stunde war um.
»Am Montag werden wir über die grundlegenden Faktoren sprechen, die das Verhältnis der Sowjetunion zu den übrigen Ostblockstaaten bestimmen«, sagte Mary. »Außerdem können wir versuchen, die Erfolgsaussichten von Präsident Ellisons Völkerverständigungspolitik abzuschätzen. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.«
Mary blieb stehen und sah zu, wie die Studenten hinausgingen.
»Danke gleichfalls, Frau Professor.«
Mary Ashley liebte den offenen Gedankenaustausch im Seminar. Sowohl die Geschichte als auch die Geographie der osteuropäischen Staaten wurden dabei lebendig. Sie war jetzt seit fünf Jahren an der Kansas State University, und es machte ihr immer noch großen Spaß, zu unterrichten.
Außer den Doktorandenseminaren musste sie noch fünf politikwissenschaftliche Vorlesungen halten, die alle den Ostblock zum Gegenstand hatten. Manchmal kam sich Mary wie eine Hochstaplerin vor. Ich bin ja noch nie in Osteuropa gewesen, dachte sie. Ich war überhaupt noch nie außerhalb der Vereinigten Staaten.
Mary Ashley war, wie schon ihre Eltern, in Junction City geboren. Das einzige Mitglied ihrer Familie, das Europa aus eigener Anschauung kannte, war ihr Großvater gewesen, der aus dem rumänischen Dorf Voronet stammte.
Eigentlich hatte Mary eine größere Auslandsreise machen wollen, als sie ihr Magisterexamen abgelegt hatte, aber dann hatte sie Edward Ashley kennengelernt und aus der Europareise waren dreitägige Flitterwochen geworden, die sie in Waterville, achtzig Kilometer entfernt von Junction City verbrachten, wo Edward einen Herzpatienten in kritischem Zustand betreute.
»Aber nächstes Jahr machen wir einen richtigen Urlaub«, sagte Mary kurz nach der Hochzeit zu Edward. »Ich möchte unbedingt Rom, London, Paris und Rumänien sehen.«
»Abgemacht, Liebling. Im Juni oder Juli fliegen wir ganz bestimmt.«
Aber im Juni des folgenden Jahres wurde ihre Tochter geboren, und Edward konnte sich auch nicht von seiner Arbeit im Krankenhaus losreißen. Zwei Jahre später kam Tim auf die Welt. Mary hatte promoviert und erhielt einen Lehrauftrag an der Universität. Irgendwie waren ihr die Jahre unter den Fingern zerronnen. Abgesehen von kurzen Abstechern nach Chicago, Atlanta und Denver war Mary nie aus Kansas herausgekommen.
»Eines Tages«, hatte sie sich immer wieder gesagt. »Eines Tages …«
Mary packte ihre Papiere zusammen und warf einen Blick aus dem Fenster. Es war ein trüber Wintertag, und es hatte auch wieder zu schneien begonnen. Sie streifte ihren gefütterten Mantel über und machte sich auf den Weg zur Vattier Street, wo sie ihren Wagen geparkt hatte.
Das Campus-Gelände war riesig. Nicht weniger als achtzig Gebäude standen auf den 130 Hektar Grund. Dazu gehörten Laboratorien, Theater und Kirchen. Aus einiger Entfernung sahen die braunen Kalksteingebäude mit ihren Türmen wie eine mittelalterliche Festung aus, die feindliche Barbarenhorden abwehren sollte. Der Anblick wurde freilich durch ausgedehnte Rasenflächen und Parkanlagen gemildert. Als Mary an der Denison Hall vorbeikam, kreuzte sie den Weg eines Fremden, der seine Kamera auf die Fassade des Gebäudes gerichtet hatte. Er drückte genau in dem Augenblick auf den Auslöser, als sie ihn ansah. Zu dumm, dachte sie, ich hätte hinter ihm vorbeigehen sollen. Jetzt habe ich sein Foto verdorben.
Eine Stunde später war das Bild auf dem Weg nach Washington, D. C.
Mary Ashley kaufte bei Dillon’s Supermarkt fürs Abendessen ein und fuhr dann nach Hause. Die Ashleys wohnten in einem schönen, zweistöckigen Haus in einer der besten Wohngegenden zwischen Eichen und Ulmen und großen Grasflächen. Dr. Edward Ashley und seine Braut hatten das Haus vor dreizehn Jahren gekauft. Als sie das große Wohnzimmer, das sonnige Esszimmer, die Bibliothek, das Frühstückszimmer, die geräumige Küche, die drei Schlafzimmer und die beiden Bäder das erste Mal gesehen hatte, war Mary ungeheuer beeindruckt gewesen. »Ist das nicht viel zu groß für zwei Leute?« hatte sie schüchtern gefragt.
Edward hatte sie in die Arme geschlossen und lächelnd gesagt: »Wer hat denn behauptet, dass unser Haus bloß für zwei ist?«
Als Mary die Tür aufmachte, standen ihre beiden Kinder schon im Flur, um sie zu begrüßen.
»Soll ich dir was erzählen?« fragte Tim mit leuchtenden Augen. »Die Zeitung will ein Bild von uns drucken?«
»Bitte hilf mir erst einmal, die Sachen hier in den Kühlschrank zu tun«, sagte Mary. »Was für eine Zeitung?«
»Das wollte der Mann nicht verraten. Aber er hat uns fotografiert und gesagt, wir würden noch von ihm hören.«
Mary blieb abrupt stehen und sah ihren Sohn misstrauisch an. »Hat der Mann erklärt, warum er euch fotografiert?«
»Nein«, sagte Tim. »Aber eine tolle Nikon hat er gehabt.«
Am Sonntag feierte Mary ihren fünfunddreißigsten Geburtstag – »feiern« hätte sie selbst allerdings bestimmt nicht gesagt. Edward hatte im Country Club eine Überraschungsparty für sie arrangiert. Ihre Nachbarn, Florence und Douglas Schiffer, und weitere vier Ehepaare warteten schon, als die Ashleys hereinkamen. Edward freute sich wie ein Kind, als er Marys verblüfftes Gesicht sah. Die festliche Tafel und das große Transparent mit der Aufschrift: »Happy Birthday, Mary!« waren auch wirklich gelungen. Deshalb mochte sie ihm auch nicht sagen, dass sie schon seit vierzehn Tagen von der Party gewusst hatte. Sie liebte ihren Mann sehr. Und warum auch nicht? Wer hätte ihn nicht gemocht? Er war attraktiv, liebevoll und intelligent. Schon sein Vater und sein Großvater waren Mediziner gewesen, und es wäre Edward nie eingefallen, etwas anderes werden zu wollen. Er war der beste Chirurg im ganzen Bezirk, ein guter Vater und ein wunderbarer Ehemann.
Als Mary die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspustete, warf sie ihrem Mann einen strahlenden Blick zu und dachte: Ich muss die glücklichste Frau der Welt sein!
Am Montagmorgen erwachte Mary mit Kopfschmerzen. Sie hatte immer wieder mit Champagner auf ihren Geburtstag anstoßen müssen, und sie war Alkohol nicht gewöhnt. Aufzustehen war eine Anstrengung. Dieser Champagner hat mich geschafft, dachte sie. So was trink’ ich nie wieder.
Sie tastete sich behutsam die Treppe hinunter und machte sich seufzend daran, den Kindern das Frühstück zu machen. Sie hatte Mühe, das Pochen in ihren Schläfen zu ignorieren.
»Champagner«, stöhnte sie, »ist die Rache Frankreichs an der Menschheit.«
Mit einem Arm voller Schulbücher kam Beth in die Küche. »Mit wem hast du geredet, Mutter?«
»Mit mir selbst, glaube ich.«
»Das ist aber komisch.«
»Da könntest du recht haben.« Mary stellte eine Packung Cornflakes auf den Tisch. »Ich hab’ dir die neuen Frotzeln gekauft. Die sollen sehr gut sein.«
Beth setzte sich an den Frühstückstisch und studierte die Packung. »Solches Zeug kann ich nicht fressen. Willst du mich umbringen?«
»Bring mich nicht auf dumme Gedanken«, erwiderte Mary. »Iss lieber was!«
Der zehnjährige Tim kam in die Küche gerannt. Er setzte sich an den Tisch und sagte: »Ich will Rühreier mit Schinken.«
»Kannst du nicht guten Morgen sagen?« fragte Mary.
»Doch. Guten Morgen. Ich will Rühreier mit Schinken.«
»Bitte.«
»Ach, hör schon auf, Mutter. Ich komm’ noch zu spät in die Schule.«
»Richtig, mein Sohn. Die Schule. Mrs. Reynolds hat mich angerufen. Weißt du, was sie gesagt hat? Du fällst in Mathematik durch. Kannst du mir das bitte erklären?«
»Ja, ich hab’ schlechte Noten.«
»Soll das ein Witz sein?«
Beth mischte sich ein: »Ich finde es gar nicht komisch.«
Tim streckte seiner Schwester die Zunge heraus. »Wenn du was Komisches sehen willst, dann guck in den Spiegel!«
»Jetzt reicht’s aber!« sagte Mary. »Benehmt euch gefälligst!«
Ihre Kopfschmerzen waren noch schlimmer geworden.
»Darf ich nach der Schule Eislaufen gehen?« fragte Tim.
»Du stehst schon auf ganz dünnem Eis, lieber Sohn. Du kommst nach der Schule sofort nach Hause und lernst, ist das klar? Wie sieht das denn aus, wenn ausgerechnet der Sohn einer Universitätsprofessorin in Mathematik durchrasselt?«
»Du machst doch Politik und nicht Mathe!«
Da reden die Leute immer über die schrecklichen Zweijährigen, dachte Mary,