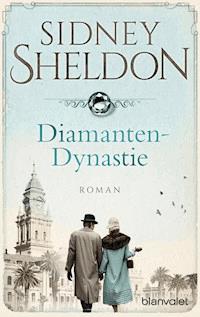
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Sheldon ist unvergleichlich. Niemand erfindet so fesselnde Geschichten wie er!« Associated Press
Ende des 19. Jahrhunderts reist der arme Schotte Jamie McGregor nach Südafrika, wo er auf den Diamantenfeldern zu großem Reichtum gelangt. Nach dem frühen Tod des Millionärs übernimmt seine ebenso ehrgeizige wie schöne Tochter Kate das Familienunternehmen und heiratet ihre Jugendliebe David Blackwell – alles scheint perfekt. Doch das Schicksal ist gnadenlos: David kommt bei einem tragischen Minenunglück ums Leben. Kate ist jetzt auf sich allein gestellt und schreckt vor nichts zurück, um das Erbe der Diamanten-Dynastie zu bewahren …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 665
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Schottland, Ende des 19. Jahrhunderts: Der achtzehnjährige Jamie McGregor heuert als Steward auf einem Dampfer mit dem Ziel Südafrika an, um auf den Feldern vor Kapstadt nach Diamanten zu suchen. Der junge Schotte hat Glück und gelangt nach kurzer Zeit zu großem Reichtum und kann so den Grundstein für ein gewaltiges Imperium legen. Doch nach dem grausamen Mord an seinem Sohn muss er erkennen, dass Reichtum allein nicht ausreicht, um glücklich zu sein. Als Jamie McGregor stirbt, ist seine Tochter Kate die alleinige Erbin des Familienunternehmens. Die ebenso ehrgeizige wie schöne Kate erkämpft sich schnell einen Namen in der von Männern dominierten Geschäftswelt und führt das Erbe ihres Vaters gemeinsam mit ihrem Mann David Blackwell zu großem Erfolg. Doch das Schicksal kennt keine Gnade: Kates geliebter Mann David kommt bei einem tragischen Minenunglück ums Leben. Jetzt ist die junge Witwe und Mutter eines kleinen Sohnes auf sich allein gestellt und schreckt vor nichts zurück, um das Ansehen der Diamanten-Dynastie zu wahren …
Autor
Sidney Sheldon begeisterte bis heute über 300 Millionen Leser weltweit. Vielfach preisgekrönt – u. a. erhielt er 1947 einen Oscar für das Drehbuch zu So einfach ist die Liebe nicht –, stürmte er mit all seinen Romanen immer wieder die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. Er zählt zu den am häufigsten übersetzten Autoren und wurde dafür sogar mit einem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde geehrt. Im Jahr 2007, kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag, verstarb Sidney Sheldon.
Von Sidney Sheldon bereits erschienen:
Die Mühlen Gottes · Der Zorn der Götter · Kalte Glut ·
Im Schatten der Götter · Zorn der Engel · Schatten der Macht
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
SIDNEY
SHELDON
Diamanten-Dynastie
ROMAN
Deutsch von Christel Rost und Gabriele Conrad
Die Originalausgabe erschien 1982 unter dem Titel »Master of the Game« bei William Morrow and Company, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 1982 by Sheldon Family Limited Partnership
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1983 by C. Bertelsmann Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung und -motiv: © Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com und Richard Jenkins Photography
LM · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21386-2V001
www.blanvalet.de
Für meinen Bruder Richardmit dem Löwenherzen
Miss Geraldine Hunter spreche ich meinen Dank ausfür ihre endlose Geduld und Hilfebei der Vorbereitung dieses Manuskripts.
»Daher entsteht, dass, wenn im Herzen, ein Trieb vor andern stärker ist,Er, so wie dorten Aarons Schlange, die übrigen verschlingt und frisst.«
Alexander Pope,Essay on Man, Epistel 2(Übs. v. B. H. Brockes, Hamburg 1740)
»… [Diamanten] verraten sich auf dem Ambosse, indem sie die Schläge so abprallen lassen, dass das Eisen nach beiden Seiten auseinanderfährt und sogar selbst der Amboss zerspringt …
… indem der Diamant mit seiner unbesiegten Kraft, welche die zwei gewaltsamsten Dinge der Natur, das Eisen und das Feuer, verachtet, sich durch Bocksblut sprengen läßt, jedoch nur, wenn er in dieses, solange es frisch und warm ist, eingeweicht wird, und nur durch viele Schläge …«
Plinius,Historia naturalis(Hrg. C. R. v. Osiander und G. Schwab, Stuttgart 1856)
PROLOG: Kate 1982
Kate1982
Der große Ballsaal war voll von vertrauten Geistern, die gekommen waren, um ihren Geburtstag mitzufeiern. Kate Blackwell beobachtete, wie sie sich unter die Menschen aus Fleisch und Blut mischten, und vor ihrem geistigen Auge wurde die Szene zu einer traumähnlichen Fantasie, in der die Besucher aus anderen Zeiten und Gefilden mit den arglosen Gästen in Smoking und langen, schimmernden Abendgewändern über den Tanzboden glitten. Zu der Feier im Cedar Hill House in Dark Harbor, Maine, hatten sich hundert Personen eingefunden. Die Geister nicht eingerechnet, dachte Kate Blackwell spöttisch.
Sie war schlank, klein und zierlich, wirkte aber durch ihre königliche Haltung größer. Sie hatte ein Gesicht, das man nicht so leicht vergaß – stolze Züge, dämmergraue Augen und ein eigensinniges Kinn, eine Mischung, die sie ihren schottischen und holländischen Vorfahren verdankte. Ihr feines weißes Haar war einst eine üppige schwarze Pracht gewesen, und ihr Kleid aus elfenbeinfarbenem Samt verlieh ihrer Haut jene zarte Durchsichtigkeit, wie sie das hohe Alter manchmal mit sich bringt.
Ich fühle mich nicht wie neunzig, dachte Kate Blackwell. Wo sind all die Jahre nur hin? Sie sah den tanzenden Geistern zu. Sie wissen Bescheid. Sie waren dabei. Sie waren ein Teil jener Jahre, ein Teil meines Lebens. Sie sah Banda, dessen stolzes schwarzes Gesicht strahlte. Und dort war David, ihr geliebter David, groß und jung und gut aussehend, so wie damals, als sie sich in ihn verliebt hatte. Er lächelte ihr zu, und sie dachte: Bald, mein Liebling, bald. Und sie wünschte, David hätte lange genug gelebt, um seinen Urenkel noch sehen zu können.
Kate suchte mit den Augen den Saal ab, bis sie ihn entdeckte. Er stand in der Nähe des Orchesters und sah den Musikern zu. Ein auffallend hübscher Achtjähriger, blond, in schwarzem Samtjackett und Schottenhose: Robert, seinem Ururgroßvater Jamie McGregor, dessen Bildnis über dem Marmorkamin hing, wie aus dem Gesicht geschnitten. Als hätte er ihren Blick gefühlt, drehte Robert sich um, und Kate winkte ihn mit einer Bewegung ihrer Hand zu sich, bei der sich die Strahlen des Kristalllüsters in dem lupenreinen zwanzigkarätigen Diamanten an ihrem Finger brachen, den ihr Vater vor beinahe hundert Jahren an einem Sandstrand aufgeklaubt hatte. Mit Freude sah Kate, wie Robert sich seinen Weg durch die Tanzenden bahnte. Ich gehöre zur Vergangenheit, dachte Kate, ihm gehört die Zukunft. Eines Tages wird mein Urenkel Kruger-Brent International übernehmen. Er trat zu ihr, und sie machte ihm neben sich Platz.
»Gefällt dir dein Geburtstag, Gran?«
»Ja, Robert. Danke.«
»Das Orchester ist super. Und der Dirigent … unheimlich.«
Kate war einen Moment lang verwirrt, dann glättete sich ihre Stirn wieder. »Aha. Das soll wohl heißen, dass er gut ist.«
Robert grinste sie an. »Genau. Du kommst mir wirklich nicht wie neunzig vor.«
Kate Blackwell lachte. »Ganz unter uns: Ich fühle mich auch nicht so.«
Seine Hand stahl sich in ihre, und eine Weile lang saßen sie schweigend und zufrieden da; der Altersunterschied von 82 Jahren ließ ein natürliches inneres Einverständnis zwischen ihnen entstehen. Kate schaute zu, wie ihre Enkelin tanzte. Sie und ihr Mann waren zweifellos das schönste Paar auf der Tanzfläche.
Roberts Mutter sah, dass ihr Sohn bei seiner Großmutter saß, und sie dachte: Was für eine unglaubliche Frau! Sie ist einfach alterslos. Kein Mensch würde glauben, was sie alles durchgemacht hat.
Die Musik hörte auf, und der Dirigent sagte: »Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Ihnen den jungen Master Robert anzukündigen.«
Robert drückte kurz die Hand seiner Großmutter und stand auf. Mit ernster und gesammelter Miene nahm er am Klavier Platz und ließ seine Finger behände über die Tasten gleiten. Er spielte Skrjabin, es war wie im Mondlicht sanft sich kräuselndes Wasser.
Roberts Mutter lauschte dem Spiel und dachte: Er ist ein Genie. Es wird noch einmal ein großer Musiker aus ihm. Er war nicht mehr nur ihr Kind. Von nun an würde er der ganzen Welt gehören. Als Robert seinen Vortrag beendet hatte, erntete er begeisterten und aufrichtigen Beifall.
Das Dinner am frühen Abend war draußen aufgetragen worden. Den weitläufigen, symmetrisch angelegten Garten hatte man mit Laternen, Bändern und Luftballons festlich geschmückt. Musiker spielten auf der Terrasse, während Butler und Serviermädchen leise und geschäftig um die Tische huschten und darauf achteten, dass die Baccarat-Gläser und die Limoges-Schüsseln stets gefüllt waren. Ein Telegramm vom Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde verlesen, und ein Richter vom Obersten Gerichtshof brachte den Toast auf Kate aus.
Der Gouverneur hielt die Festrede: »… eine der bemerkenswertesten Frauen in der Geschichte dieser Nation. Kate Blackwells Stiftungen zugunsten Hunderter wohltätiger Zwecke auf der ganzen Welt sind schon Legende. Um den verstorbenen Sir Winston Churchill zu paraphrasieren: ›Nie zuvor hatten so viele einem einzigen Menschen so viel zu verdanken.‹ Mir war es vergönnt, Kate Blackwell zu begegnen …«
So ein blöder Mist, dachte Kate. Niemand kennt mich. Das klingt ja, als redete er über eine Heilige. Was würden all diese Leute wohl dazu sagen, wenn sie die Wahrheit über Kate Blackwell wüssten? Gezeugt von einem Dieb und gekidnappt, noch bevor sie ein Jahr alt war. Was würden sie wohl denken, wenn ich ihnen meine Schussnarben zeigte?
Sie wandte den Kopf und sah den Mann an, der einst versucht hatte, sie zu töten. Ihr Blick schweifte über ihn hinweg und blieb an einer Gestalt im Hintergrund hängen, die ihr Gesicht hinter einem Schleier verbarg. Aus der Ferne vernahm Kate einen Donnerschlag, gerade als der Gouverneur seine Rede beendete und die ihre ankündigte. Sie erhob sich und ließ den Blick über die versammelten Gäste gleiten. Mit klarer und fester Stimme ergriff sie das Wort: »Mein Leben währt nun schon länger als das irgendeines anderen hier. Was ist denn schon dabei, würde die heutige Jugend sagen. Aber ich bin glücklich darüber, dass ich dieses Alter erreicht habe, denn sonst könnte ich nicht mit all meinen lieben Freunden hier zusammen sein. Ich weiß, dass etliche von Ihnen aus fernen Ländern angereist sind, um den heutigen Abend mit mir zu verbringen, und dass die Reise Sie ermüdet haben muss. Es wäre ungerecht, wollte ich von jedermann die gleiche Energie erwarten, die ich selbst besitze.« Es gab brüllendes Gelächter und Applaus für sie.
»Ich danke Ihnen dafür, dass Sie diesen Abend für mich zu einem denkwürdigen Ereignis machen. Für diejenigen, die sich zurückzuziehen wünschen, stehen die Zimmer bereits zur Verfügung. Für die anderen wird im Ballsaal zum Tanz aufgespielt.« Ein neuerlicher Donnerschlag. »Ich denke, wir begeben uns besser alle ins Haus.«
Nun waren Dinner und Tanz vorbei, die Gäste hatten sich zurückgezogen, und Kate war allein mit ihren Geistern. Sie saß in der Bibliothek, überließ sich ihren Erinnerungen und fühlte sich plötzlich niedergeschlagen. Keiner ist mehr da, der mich Kate nennt, dachte sie. Sie sind alle gegangen. Ihre Welt war klein geworden. War es nicht Longfellow gewesen, der sagte: »Die Blätter der Erinnerung rascheln voll Trauer in der Dunkelheit?« Bald würde auch sie in die Dunkelheit übergehen – aber nicht sogleich. Das Wichtigste in meinem Leben habe ich immer noch zu erledigen, dachte Kate. Hab Geduld, David. Bald werde ich bei dir sein.
»Gran …«
Kate öffnete die Augen. Ihre Familie war hereingekommen. Sie sah sie an, einen nach dem anderen, ihr Blick eine erbarmungslose Kamera, der nichts entging. Meine Familie, dachte sie. Meine Unsterblichkeit. Mörder, groteske Gestalten und Irre. Die Blackwell-Leichen. Soll das denn alles sein, was die vielen Jahre voll Hoffnung, Schmerz und Leid eingebracht haben?
Ihre Enkelin trat zu ihr. »Ist alles in Ordnung mit dir, Gran?«
»Ich bin ein bisschen müde, Kinder. Ich glaube, ich gehe jetzt zu Bett.« Sie erhob sich und ging zur Treppe, und im gleichen Moment ertönte gewaltiges Donnergrollen. Der Sturm brach los, und der Regen trommelte gegen die Fensterscheiben. Die Familienmitglieder sahen zu, wie die alte Frau den obersten Treppenabsatz erreichte – eine stolze, aufrechte Gestalt. Ein Blitz erhellte den Raum, und Sekunden später donnerte es krachend. Kate Blackwell drehte sich um und sah auf sie herab. »In Südafrika«, sagte sie, und aus ihren Worten hörte man den Akzent ihrer Vorfahren heraus, »pflegten wir so etwas einen donderstorm zu nennen.«
ERSTES BUCH: Jamie 1883–1906
Jamie1883–1906
1
»Das ist, weiß Gott, ein richtiger donderstorm!«,sagte Jamie McGregor. Er war mit den wilden Stürmen des schottischen Hochlands aufgewachsen, aber so etwas Gewaltiges wie diesen hatte er noch nie erlebt. Am Nachmittagshimmel waren plötzlich riesige Sandwolken aufgezogen und hatten den Tag in Sekundenschnelle zur Nacht gemacht. Der staubige Himmel wurde von zuckenden Blitzen erhellt – weerling nannten die Afrikaner das –, die die Luft versengten, gefolgt vom donderslag, vom Donner. Dann kam die Sintflut: Regenmassen, die gegen das Heer aus Zelten und Blechhütten klatschten und die Staubstraßen von Klipdrift in wirbelnde Schlammströme verwandelten.
Der Himmel hallte wider von rollenden Donnerschlägen, die aufeinanderfolgten wie Artilleriefeuer in einem himmlischen Krieg.
Jamie McGregor trat schnell beiseite, als sich ein Haus aus ungebrannten Ziegeln in Schlamm auflöste, und er fragte sich, ob Klipdrift dieses Unwetter überstehen würde.
Klipdrift war keine richtige Stadt. Es war ein wucherndes Zeltdorf, eine brodelnde Masse aus Planen und Hütten und Wagen, die sich am Ufer des Vaal drängten, bewohnt von wild dreinschauenden Träumern, die aus aller Welt nach Südafrika gekommen waren, alle vom gleichen Gedanken besessen: Diamanten zu finden.
Auch Jamie McGregor gehörte zu den Träumern. Er war gerade achtzehn Jahre alt, ein hübscher Bursche, groß und blond, mit verblüffend hellen grauen Augen. Er war von einnehmender Arglosigkeit und bemühte sich, allen zu gefallen, was ihm auch gelang.
Von der Farm seines Vaters im schottischen Hochland aus war er beinahe achttausend Meilen weit gereist, über Edinburgh, London und Kapstadt bis nach Klipdrift. Er hatte auf seinen Anteil an dem Land, das er, seine Brüder und sein Vater gemeinsam bestellt hatten, verzichtet, aber er bereute es nicht. Jamie McGregor wusste, dass er dafür tausendfach entschädigt würde. Er hatte die Sicherheit seines gewohnten Lebens hinter sich gelassen und war an diesen entlegenen, gottverlassenen Ort gekommen, weil er davon träumte, reich zu werden. Einmal war er auf einem Jahrmarkt in Edinburgh gewesen und hatte gesehen, was für Herrlichkeiten man für Geld kaufen konnte. Geld war dazu da, das Leben zu erleichtern, solange man gesund war, und die nötigen Bedürfnisse zu erfüllen, wenn man krank wurde. Jamie hatte zu viele Freunde und Nachbarn in Armut leben und sterben sehen.
Er entsann sich seiner Aufregung, als er zum ersten Mal von einem Diamantenlager in Südafrika gehört hatte.
Dort war der größte Diamant der Welt gefunden worden, einfach so im Sand, und es ging das Gerücht, die ganze Gegend dort sei eine Schatzkammer, die nur darauf warte, geöffnet zu werden.
An einem Samstagabend nach dem Essen hatte er seiner Familie von seinen Plänen berichtet.
Fünf Augenpaare hatten ihn angestarrt, als sei er nicht ganz bei Trost.
»Auf Diamantenjagd willst du?«, fragte sein Vater. »Du bist ja wohl verrückt, Junge. Das ist doch nur ein Märchen … eine Versuchung des Teufels, der Männer von ihrem ehrlichen Tagwerk abhalten will.«
»Verrätst du uns auch, wo du das Geld dazu hernehmen willst?«, fragte sein Bruder Ian. »Das ist die halbe Strecke um die Welt. Du hast kein Geld.«
»Wenn ich Geld hätte«, gab Jamie zurück, »dann hätte ich es auch nicht nötig, nach Diamanten zu suchen, oder? Dort hat sowieso niemand Geld. Mir geht’s also nicht anders als den anderen auch. Aber ich hab Köpfchen und ein breites Kreuz. Ich werd’s schon schaffen.«
Seine Mutter nahm wortlos die Platte mit den Resten des dampfenden Haggis vom Tisch und trug sie zum Ausguss.
Spät in dieser Nacht trat sie an Jamies Bett. Behutsam fasste sie ihn an der Schulter, und ihre Kraft übertrug sich auf ihn. »Tu, was du tun musst, mein Sohn. Ich weiß nicht, ob’s dort Diamanten gibt, aber wenn, dann wirst du sie auch finden.« Sie förderte eine abgegriffene Lederbörse zutage. »Ich hab ein paar Pfund auf die Seite gelegt. Sag den anderen aber nichts davon. Gott segne dich, Jamie.«
Als er nach Edinburgh aufbrach, hatte er fünfzig Pfund.
Die Reise nach Südafrika war mühselig, und Jamie McGregor brauchte fast ein ganzes Jahr dazu. In Edinburgh fand er eine Stelle als Kellner in einem Arbeiterlokal, wo er blieb, bis er weitere fünfzig Pfund zu den ersten legen konnte. Dann ging es weiter nach London. Die Größe der Stadt, die riesigen Menschenmengen, der Lärm und die großen Pferdebahnen schüchterten Jamie ein. Staunend sah er zu, wie Damen aus Kutschen stiegen, um einen Einkaufsbummel in der Burlington Arcade zu machen, einem verwirrenden Füllhorn voll Silber, Porzellan, Kleidern und Pelzen sowie Töpfereien und Apotheken mit geheimnisvollen Fläschchen und Tiegeln.
In der Fitzroy Street 32 fand Jamie Unterkunft. Sie kostete ihn zehn Shilling die Woche, war aber weit und breit die billigste. Die Tage verbrachte er an den Docks, wo er ein Schiff suchte, das ihn nach Südafrika bringen sollte; an den Abenden bestaunte er die Wunderdinge in London Town. Doch trotz all der Schönheiten befand sich England in jenem Winter inmitten einer sich stetig verschlimmernden Wirtschaftskrise. Die Straßen waren voll von Arbeitslosen und Hungernden, und es gab Massendemonstrationen und Straßenkämpfe. Ich muss hier unbedingt weg, dachte Jamie. Ich bin schließlich gekommen, um der Armut zu entrinnen. Am nächsten Tag heuerte er als Steward auf der Walmer Castle mit Zielhafen Kapstadt in Südafrika an.
Die Seereise dauerte drei Wochen, einschließlich der Aufenthalte in Madeira und St. Helena, wo Kohlen für die Maschinen geladen wurden. Es war eine raue, stürmische Reise im tiefsten Winter, und Jamie wurde seekrank, sobald das Schiff abgelegt hatte. Doch nie verlor er seine gute Laune, denn jeder Tag brachte ihn seiner Schatzkammer näher, und je näher das Schiff dem Äquator kam, desto wärmer wurde es. Wie durch Zauberhand wurde der Winter zum Sommer, und die Tage und Nächte wurden heiß und schwül.
Die Walmer Castle erreichte Kapstadt in der ersten Morgendämmerung, schob sich vorsichtig durch den engen Kanal, der die große Aussätzigensiedlung auf Robben Island vom Festland trennte, und ging in der Table Bay vor Anker.
Jamie war schon vor Sonnenaufgang an Deck. Fasziniert sah er, wie sich der frühe Morgennebel hob und den Blick auf den grandiosen Tafelberg freigab, der über der Stadt aufragte. Jamie war angekommen.
Sobald das Schiff am Kai anlegte, wurden die Decks überflutet von einer Horde der seltsamsten Menschen, die Jamie je gesehen hatte. Aus allen Hotels waren Werber gekommen: Schwarze, Gelbe und Braune boten ungestüm ihre Dienste als Gepäckträger an, kleine Jungen rannten hin und her und wollten Zeitungen, Süßigkeiten und Früchte verkaufen. Die Luft war voller riesiger schwarzer Fliegen. Seeleute und Gepäckträger bahnten sich stoßend und schreiend ihren Weg durch die Menge, während die Passagiere vergeblich versuchten, ihre Habseligkeiten beisammen und in Sichtweite zu halten. Die Leute redeten miteinander in einer Sprache, die Jamie noch nie gehört hatte. Er verstand kein Wort.
Kapstadt war gänzlich anders als alle Städte, die Jamie kannte. Es gab keine zwei Häuser, die einander ähnelten.
Jamie war fasziniert von den Männern, Frauen und Kindern, die sich in den Straßen drängten. Er sah einen Kaffer, der eine alte 78er Hochländerhose trug und einen Sack, den er mit Schlitzen für Kopf und Arme zum Mantel gemacht hatte. Vor dem Kaffer gingen Hand in Hand zwei Chinesen in blauen Arbeitskitteln und mit sorgfältig geflochtenen Zöpfen unter ihren spitzen Strohhüten. Da gab es dicke, rotgesichtige Buren mit sonnengebleichtem Haar, deren Karren mit Kartoffeln, Mais und Blattgemüse beladen waren. Männer in braunen Manchesterhosen und -mänteln mit breitkrempigen, weichen Filzhüten auf dem Kopf und langen Tonpfeifen im Mund schritten ihren ganz in Schwarz gekleideten vraws mit ihren dicken Tüchern und schwarzseidenen Schuten voran. Parsi-Waschfrauen, die riesige Bündel schmutziger Wäsche auf dem Kopf balancierten, schoben sich an Soldaten in roten Mänteln und Helmen vorbei. Es war ein hinreißendes Schauspiel.
Jamie suchte sich als Erstes ein preiswertes Logierhaus, das ihm von einem der Seeleute auf dem Schiff empfohlen worden war. Die Wirtin war eine dralle, vollbusige Witwe mittleren Alters. Sie sah sich Jamie von oben bis unten an und lächelte. »Zoek yulle goud?«
Er errötete. »Entschuldigung – ich verstehe Sie nicht.«
»Engländer, ja? Sind Sie wegen Gold hier? Oder Diamanten?«
»Wegen Diamanten, Ma’am.«
Sie zog ihn ins Haus. »Es wird Ihnen hier gefallen. Bei mir gibt’s alles, was ein junger Mann wie Sie braucht.«
Jamie fragte sich, ob sie zu einer gewissen Sorte gehörte. Hoffentlich nicht.
»Ich bin Mrs. Venster«, sagte sie kokett, »aber meine Freunde nennen mich Dee-Dee.« Sie lächelte, wobei ein Goldzahn sichtbar wurde. »Ich habe das Gefühl, dass wir schon bald sehr gute Freunde sein werden. Sie können mit allem zu mir kommen.«
»Das ist sehr nett von Ihnen«, sagte Jamie. »Können Sie mir sagen, wo ich einen Stadtplan kaufen kann?«
Mit dem Plan in der Hand erforschte Jamie die Stadt. Er spazierte durch das Wohngebiet der Reichen, durch die Strand Street und die Bree Street, und bewunderte die großen zweistöckigen Gebäude mit ihren flachen Dächern, ihren stuckverzierten Fronten und steilen Terrassen, die zur Straße hin abfielen. Er lief herum, bis ihn schließlich die Fliegen vertrieben, die es offenbar besonders auf ihn abgesehen hatten. Sie waren groß und schwarz und griffen in Schwärmen an. Als Jamie ins Logierhaus zurückkam, sah er, dass sie sogar in die Häuser eindrangen: In seinem Zimmer waren Wände, Tisch und Bett schwarz von Fliegen. Er ging zu seiner Wirtin. »Mrs. Venster, könnten Sie vielleicht etwas gegen die Fliegen in meinem Zimmer tun? Sie sind …«
Sie brach in sattes, glucksendes Gelächter aus und kniff Jamie in die Wange. »Myn magtig. Sie werden sich schon noch daran gewöhnen. Warten Sie’s ab.«
Die sanitären Anlagen in Kapstadt waren nicht nur primitiv, sondern auch unzureichend, und nach Sonnenuntergang hing ein fürchterlicher Gestank wie eine stickige Glocke über der Stadt. Es war unerträglich. Aber Jamie wusste, dass er es aushalten würde. Bevor er weiterziehen konnte, brauchte er noch mehr Geld. Auf den Diamantenfeldern kannst du ohne Geld nicht überleben, hatte man ihn gewarnt. Da knöpfen sie dir schon fürs bloße Atemholen Geld ab.
Am zweiten Tag in Kapstadt fand Jamie Arbeit als Kutscher bei einer Spedition. Am dritten Tag fing er in einem Restaurant an, wo er nach dem Dinner Geschirr abwusch. Er ernährte sich von den Essensresten, die er flink beiseitebrachte und mit ins Logierhaus nahm. Er war hoffnungslos einsam. Er kannte niemanden in dieser fremden Stadt, und er vermisste seine Freunde und seine Familie. Jamie war gern allein, diese Einsamkeit hier empfand er jedoch als ständigen Schmerz.
Endlich kam der wunderbare Tag: Seine Börse enthielt die fantastische Summe von zweihundert Pfund. Er war so weit. Am nächsten Morgen würde er Kapstadt verlassen und zu den Diamantenfeldern aufbrechen.
Einen Platz in den Kutschen, die zu den Diamantenfeldern bei Klipdrift fuhren, konnte man bei der Inland Transport Company in einem kleinen Holzmagazin unweit der Docks buchen. Als Jamie um sieben Uhr morgens ankam, drängte sich dort schon eine solche Menschenmenge, dass er nicht einmal in die Nähe des Depots gelangte. Hunderte von Glücksjägern balgten sich um einen Sitz in den Kutschen. Sie schrien in einem Dutzend verschiedener Sprachen herum und flehten die umlagerten Billettverkäufer an, ihnen noch ein Plätzchen zu geben. Jamie sah zu, wie ein stämmiger Ire sich zornig seinen Weg aus dem Büro zum Gehsteig frei machte, indem er sich durch den Mob kämpfte.
»Entschuldigung«, sagte Jamie. »Was geht denn vor da drinnen?«
»Nix«, grantelte der Ire voll Abscheu. »Die verfluchten Karren sind für die nächsten sechs Wochen alle schon ausgebucht.« Er sah den bestürzten Ausdruck auf Jamies Gesicht. »Und das ist noch nicht mal das Ärgste, Freundchen. Diese gottlosen Schweine kassieren fünfzig Pfund pro Nase.«
Es war nicht zu fassen! »Es muss doch noch eine andere Möglichkeit geben, zu den Diamantenfeldern zu kommen.«
»Sogar zwei: Du kannst den Dutch Express nehmen oder zu Fuß gehen.«
»Was ist denn der Dutch Express?«
»’n Ochsenkarren. Der macht zwei Meilen die Stunde. Bis du mit dem ankommst, sind die Diamanten alle weg.«
Jamie McGregor hatte nicht die Absicht, seine Reise aufzuschieben, bis die Diamanten weg waren. Den Rest des Vormittags verbrachte er mit der Suche nach anderen Transportmöglichkeiten. Kurz vor Mittag fand er eine. Er kam an einem Mietstall vorbei, an dessen Eingang ein Schild besagte: Mail Depot – Poststelle. Einem Impuls folgend, ging er hinein und fand dort den magersten Mann, den er je gesehen hatte, damit beschäftigt, große Postsäcke auf einen Dogcart zu verladen. Einen Moment lang sah Jamie ihm dabei zu.
»Entschuldigen Sie«, sagte er dann. »Bringen Sie auch Post nach Klipdrift?«
»Klar doch. Wird grade verladen.«
Jamie fühlte jäh Hoffnung in sich aufsteigen. »Nehmen Sie auch Passagiere mit?«
»Manchmal.« Der Magere sah auf und betrachtete Jamie prüfend. »Wie alt sind Sie?«
Seltsame Frage. »Achtzehn. Warum?«
»Wir nehmen keinen mit, der älter ist als 21 oder 22. Sind Sie gesund?«
Eine noch seltsamere Frage. »Yes, Sir.«
Der Dünne richtete sich auf. »Ich glaube, Sie sind in Ordnung. Ich fahre in einer Stunde los. Das macht zwanzig Pfund.« Jamie konnte sein Glück kaum fassen. »Das ist ja herrlich! Ich hole nur meinen Koffer und …«
»Keinen Koffer. Der Platz reicht bloß für ein Hemd und ’ne Zahnbürste.«
Jamie besah sich den Dogcart etwas genauer. Er war klein und nur grob zusammengezimmert. Das Chassis bestand aus einer Wanne, in der die Post untergebracht wurde; darüber befand sich ein schmaler Platz, auf den sich gerade eine Person Rücken an Rücken zum Fahrer setzen konnte. Es würde eine unbequeme Fahrt werden.
»Einverstanden«, sagte Jamie. »Ich hol nur noch mein Hemd und meine Zahnbürste.«
Als er wiederkam, spannte der Fahrer soeben ein Pferd vor den offenen Karren. Daneben standen zwei kräftige junge Männer, einer klein und dunkel, der andere ein großer blonder Schwede. Sie gaben dem Kutscher Geld.
»Moment mal«, rief Jamie dem Fahrer zu. »Sie haben versprochen, mich mitzunehmen.«
»Ich nehme Sie alle mit«, sagte der Fahrer. »Steigen Sie schon ein.«
»Uns alle drei?«
»Genau.«
Jamie hatte keine Ahnung, wie sie alle in den kleinen Wagen passen sollten. Er wusste nur eins: Wenn es losging, würde er auf Biegen und Brechen drinsitzen.
Jamie stellte sich seinen beiden Mitreisenden vor. »Ich bin Jamie McGregor.«
»Wallach«, sagte der kleine Dunkle.
»Pederson«, sagte der große Schwede.
Jamie sagte: »Wir haben ein Glück, dass wir das hier entdeckt haben, nicht? Nur gut, dass kaum einer davon weiß.«
Pederson sagte: »Ach, die Postkarren sind allgemein bekannt, McGregor. Es gibt nur nicht so viele, die gesund oder verzweifelt genug wären, damit zu fahren.«
Bevor Jamie ihn noch fragen konnte, was er damit meinte, sagte der Kutscher: »Auf geht’s.«
Die drei Männer, Jamie in der Mitte, quetschten sich in den Wagen und saßen aneinandergepresst, mit angezogenen Knien, den Rücken an die harte Holzlehne gedrückt, auf dem Bänkchen. Es war kein Platz mehr übrig, der ihnen erlaubt hätte, sich zu bewegen oder tief zu atmen. Alles halb so schlimm, machte Jamie sich Mut.
»Festhalten!«, kam es im Singsang vom Fahrer, und schon rasten sie durch die Straßen von Kapstadt und waren auf dem Weg zu den Diamantenfeldern von Klipdrift.
Im vollen Galopp ging es über unebene Straßen und Felder und Pfade mit tiefen Furchen. Der Karren war nicht gefedert, und jeder Stoß hatte etwa die gleiche Wirkung wie ein Pferdetritt. Jamie biss die Zähne zusammen und dachte: Ich halte durch, bis wir übernachten. Dann esse ich was und schlafe ein bisschen, und morgen früh bin ich wieder auf dem Damm. Aber als die Nacht hereinbrach, gab es nur einen zehnminütigen Aufenthalt, um Pferd und Fahrer zu wechseln, und schon waren sie wieder in vollem Galopp unterwegs.
»Wann halten wir und essen was?«, fragte Jamie.
»Gar nicht«, brummte der Kutscher. »Wir fahren durch. Wir befördern schließlich die Post, Mister.«
Durch das ständige Rütteln war Jamies Körper bald mit Prellungen und blauen Flecken übersät. Er war todmüde, aber an Schlaf war nicht zu denken: Sobald er eindösen wollte, wurde er sofort wieder wach geschüttelt. Er fühlte sich elend, und sein Körper war steif, aber es gab nicht genügend Platz, um sich auszustrecken. Er hatte Hunger und war reisekrank. Er hatte keine Ahnung, wie viele Tage vergehen würden, bis er wieder etwas zu essen bekäme. Die Fahrt ging über 600 Meilen, und Jamie McGregor wusste nicht, ob er sie lebend überstehen würde. Er wusste nicht einmal, ob er sie überstehen wollte.
Nach zwei Tagen und zwei Nächten war aus dem Elend Verzweiflung geworden. Jamies Reisegefährten befanden sich im gleichen mitleiderregenden Zustand und waren nicht einmal mehr in der Lage, sich zu beklagen. Jamie begriff jetzt, warum die Gesellschaft ausdrücklich Wert darauf legte, dass die Passagiere jung und kräftig waren.
In der nächsten Morgendämmerung fuhren sie in die Große Karoo hinein, wo die Einöde erst richtig anfing. Das furchtbare Buschland dehnte sich bis ins Unendliche, eine weite, abweisende Ebene unter einer erbarmungslosen Sonne. Die Passagiere erstickten fast in Hitze, Staub und Fliegen.
Erst als der Postwagen den Oranje-Fluss überquert hatte, wandelte sich das bisher tödlich monotone Bild der Steppe. Das Buschwerk wurde allmählich höher und war mit Grün durchsetzt. Die Erde war jetzt von kräftigerem Rot, und ein leichter Wind strich über Grasdecke und Dornenbäume.
Ich werde es schaffen, dachte Jamie dumpf. Ich werd’s schaffen.
Und er fühlte, wie sich in seinem erschöpften Körper wieder Hoffnung zu regen begann.
Als sie am Stadtrand von Klipdrift anlangten, waren sie vier Tage und Nächte lang ununterbrochen unterwegs gewesen. Der junge Jamie McGregor hatte keine klare Vorstellung von Klipdrift gehabt, und die Szenerie, die sich jetzt vor seinen müden, blutunterlaufenen Augen auftat, überstieg alles, was er sich hätte ausmalen können: Die Stadt bestand aus einem unübersehbaren Meer von Zelten und Wagen, die die Hauptstraßen und die Ufer des Vaal säumten. Der staubige Fahrdamm wimmelte nur so von Menschen: Kaffer, die bis auf ihre grellfarbenen Jacken nackt waren, bärtige Digger, Metzger, Bäcker, Diebe, Lehrer. Im Zentrum von Klipdrift standen reihenweise Holz- und Blechhütten, die als Läden, Kantinen, Billardsäle, Speisehäuser, Büros für Diamantenkäufer und als Anwaltspraxen dienten. An einer Straßenecke stand das baufällige Royal Arch Hotel.
Jamie stieg aus dem Dogcart – und fiel prompt zu Boden, denn seine verkrampften Beine versagten ihm den Dienst. In seinem Kopf drehte sich alles, und er lag da, bis er genügend Kraft gesammelt hatte, um sich wieder aufzurappeln. Er taumelte auf das Hotel zu und schob sich irgendwie durch die lärmende Menschenmenge, die sich auf Straßen und Gehsteigen drängte. Das Zimmer, das man ihm gab, war klein, zum Ersticken heiß und voller Fliegen. Aber Jamie sah nur das Bett. In voller Montur ließ er sich darauf fallen – und war sofort eingeschlafen. Er schlief achtzehn Stunden lang.
Beim Erwachen war Jamies Körper unglaublich steif und wund, doch seine Seele jubilierte: Ich bin angekommen! Ich hab’s geschafft! Heißhungrig machte er sich auf die Suche nach etwas zu essen. Im Hotel wurden keine Mahlzeiten serviert, aber auf der anderen Straßenseite gab es ein kleines, überfülltes Restaurant, wo er gebratenen snook, einen großen, hechtähnlichen Fisch, hinunterschlang, gefolgt von Karbonaatje, dünnen, über einem Holzfeuer am Spieß gegrillten Hammelscheiben, einer bok-Keule und schließlich koeksister zumNachtisch, einem in schwimmendem Fett gebackenen und in Sirup getränkten Krapfen.
An den Tischen um ihn herum saßen überall Digger und sprachen aufgeregt über das, was sie einzig und allein beschäftigte: über Diamanten.
Jamie war so aufgeregt, dass er seinen großen Becher Kaffee kaum austrinken konnte. Die Rechnung warf ihn fast um: zwei Pfund und drei Shilling für eine einzige Mahlzeit! Ich muss sehr vorsichtig sein, dachte er, als er auf die überfüllte, laute Straße hinaustrat. »Hast du noch immer vor, reich zu werden, McGregor?«, hörte er eine Stimme hinter sich.
Jamie drehte sich um. Es war Pederson, der Schwede, der mit ihm im Dogcart angekommen war.
»Gewiss doch«, gab Jamie zurück.
»Na, dann lass uns doch mal zu den Diamanten gehen.« Er deutete auf den Fluss. »Zum Vaal geht’s da lang.«
Sie machten sich auf den Weg.
Klipdrift lag in einer von Hügeln umgebenen Senke, und so weit das Auge reichte, war alles kahl, ohne einen einzigen Grashalm oder Busch. Dichter roter Staub stieg in die Luft und erschwerte das Atmen. Der Vaal war eine Viertelmeile entfernt, und als sie näher kamen, spürten sie, dass es hier kühler war. Hunderte von Diggern hatten sich an beiden Ufern des Flusses niedergelassen; manche buddelten nach Diamanten, andere siebten Kies durch rüttelnde Schwingtröge, wieder andere sortierten Steine an wackeligen Tischchen. Die Ausrüstungen reichten von raffinierten Apparaturen zum Ausschlämmen der Erde bis zu alten Bottichen und Eimern. Die Männer waren sonnenverbrannt, unrasiert und nachlässig, ja absonderlich gekleidet, alle trugen breite Ledergürtel mit Taschen für Diamanten oder Geld.
Jamie und Pederson gingen bis ans Flussufer und sahen zu, wie sich ein Junge und ein älterer Mann abmühten, einen riesigen Findling aus Eisenstein wegzuwälzen, um an den Kies unter ihm zu gelangen. Ihre Hemden waren völlig durchgeschwitzt. Gleich daneben beluden zwei andere eine Karre mit Kies, der in einem Schwingtrog durchgesiebt werden sollte. Einer der Digger hielt den Trog in Bewegung, während der andere eimerweise Wasser hineingoss, um den Sand auszuschwemmen. Dann wurden die großen Kiesel auf einen wackeligen Sortiertisch geschüttet und aufgeregt inspiziert.
»Das sieht leicht aus.« Jamie grinste.
»Verlass dich nicht drauf, McGregor. Ich hab mich mit ein paar Diggern unterhalten, die schon eine Weile hier sind. Weißt du, wie viele Schürfer hier reich werden wollen? Zwanzigtausend, verdammt noch mal! Für alle gibt’s gar nicht genügend Diamanten, Kumpel. Und selbst wenn, dann frag ich mich immer noch, ob das den ganzen Aufwand überhaupt lohnt. Im Winter schmorst du, im Sommer frierst du, ersäufst fast in diesen dämlichen donderstormen und plagst dich ständig mit Staub und Fliegen und Gestank ab. Baden kannste nicht, und ein ordentliches Bett kriegste auch nicht, und dann gibt’s noch nicht mal Klos in diesem Kaff. Jede Woche fischen sie Leichen aus dem Vaal. Bei manchen ist’s ein Unfall, aber ich hab mir sagen lassen, dass es für viele die einzige Möglichkeit ist, aus dieser Hölle rauszukommen. Ich weiß auch nicht, warum die es hier so lange aushalten.«
»Ich weiß es schon.« Jamie beobachtete den erwartungsvollen Jungen in dem durchgeschwitzten Hemd.
Doch auf ihrem Weg zurück in die Stadt musste sich Jamie eingestehen, dass Pederson nicht ganz unrecht hatte. Sie kamen an den Kadavern geschlachteter Ochsen, Schafe und Ziegen vorbei, die vor den Zelten gleich neben offenen Latrinengräben verfaulten. Es stank zum Himmel. Pederson musterte Jamie. »Was wirst du jetzt tun?«
»Mir eine Schürferausrüstung besorgen.«
In der Stadtmitte gab es einen Laden, an dem ein rostiges Schild hing mit der Aufschrift: SALOMONVANDERMERWE. GEMISCHTWARENHANDLUNG. Vor dem Geschäft war ein groß gewachsener Mann damit beschäftigt, einen Karren zu entladen. Er war ungefähr in Jamies Alter, breitschultrig und muskulös – einer der schönsten Männer, die Jamie je gesehen hatte. Er hatte kohlrabenschwarze Augen, eine Adlernase und ein stolzes Kinn. Eine gewisse Würde und vornehme Zurückhaltung umgaben ihn. Er hievte eine schwere Holzkiste voller Gewehre auf die Schulter, und als er sich umdrehte, rutschte er auf einem Blatt aus, das aus einer Kiste mit Kohlköpfen gefallen war. Unwillkürlich streckte Jamie die Hand aus, um ihn zu stützen. Doch der Schwarze nahm nicht einmal Notiz von ihm, drehte sich um und ging in den Laden. Ein Bure – ein Digger, der gerade sein Maultier aufzäumte – spuckte aus und sagte angewidert: »Das ist Banda vom Stamm der Barolong. Arbeitet bei van der Merwe. Ich weiß auch nicht, warum der diesen hochnäsigen Schwarzen behält. Diese beschissenen Bantu glauben alle, die Erde gehört ihnen allein.«
Im Laden war es kühl und dunkel – eine willkommene Erholung von der heißen, hellen Straße –, und exotische Düfte erfüllten den Raum. Staunend ging Jamie im Laden herum. Wer das alles besitzt, dachte Jamie, der muss ein reicher Mann sein.
»Womit kann ich Ihnen dienen?«, fragte hinter ihm eine sanfte Stimme.
Jamie drehte sich um und stand einem jungen Mädchen gegenüber. Sie hatte ein interessantes Gesicht, zart und herzförmig, mit keckem Näschen und tiefgrünen Augen. Ihr Haar war dunkel und lockig. Als er ihre Figur betrachtete, entschied Jamie, sie müsse ungefähr sechzehn sein.
»Ich bin Schürfer«, verkündete er. »Ich möchte einiges für meine Ausrüstung kaufen.«
»Was brauchen Sie denn?«
Aus irgendeinem Grunde meinte Jamie, bei dem Mädchen Eindruck schinden zu müssen. »Ich … äh … Sie wissen schon, das Übliche.«
Sie lächelte, und in ihren Augen blitzte der Schalk. »Was ist denn das Übliche, Sir?«
»Nun ja …« Er zögerte. »Eine Schaufel.«
»Ist das dann alles?« Jamie sah, dass sie ihn neckte. Er grinste und gestand: »Um die Wahrheit zu sagen, ich bin ganz neu dabei. Ich weiß gar nicht, was ich alles brauche.« Sie lächelte ihn an, und diesmal war ihr Lächeln das einer erwachsenen Frau. »Das hängt davon ab, wo Sie schürfen wollen, Mr. …?«
»McGregor, Jamie McGregor.«
»Ich bin Margaret van der Merwe.« Sie warf einen nervösen Blick in den hinteren Teil des Ladens.
»Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Miss van der Merwe.«
»Sind Sie gerade erst angekommen?«
»Jawohl. Gestern, mit dem Postwagen.«
»Die hätten Sie davor warnen sollen. Bei dem Geschäft sind schon einige umgekommen.« Sie wirkte zornig.
Jamie grinste. »Ich kann’s niemandem verdenken. Aber ich bin noch sehr lebendig, Gott sei Dank.«
»Und jetzt wollen Sie mooi klippe suchen gehen.«
»Mooi klippe?«
»Das ist unser holländisches Wort für Diamanten. Hübsche Steine.«
»Sind Sie Holländerin?«
»Meine Familie stammt aus Holland.«
»Ich komme aus Schottland.«
»Das habe ich mir gedacht.« Wieder sah sie sich vorsichtig um. »Es gibt schon Diamanten hier, Mr. McGregor, aber Sie sollten genau aufpassen, wo Sie danach suchen. Die meisten Digger drehen sich nur im Kreis und bringen es zu nichts. Wenn einer einen guten Fund tut, machen die anderen sich über die Reste her. Wenn Sie reich werden wollen, müssen Sie schon irgendwo der Erste sein.«
»Und wie soll ich das anstellen?«
»Mein Vater könnte Ihnen dabei vielleicht helfen. Er weiß einfach alles. In einer Stunde können Sie mit ihm reden.«
»Dann komme ich zurück«, versicherte Jamie. »Vielen Dank, Miss van der Merwe.«
Er trat hinaus in den Sonnenschein, und ein Hochgefühl überkam ihn. Seine Wunden und Schmerzen waren vergessen. Wenn Salomon van der Merwe ihm einen Tipp gab, wo Diamanten zu finden waren, dann konnte nichts mehr schiefgehen. Er würde allen den Rang ablaufen. Er lachte laut heraus vor lauter Freude darüber, jung und am Leben zu sein und auf dem besten Wege, reich zu werden.
Jamie ging die Hauptstraße hinunter, vorbei an einer Schmiede, einem Billardsaal und einem Dutzend Saloons. Vor einem Schild an einem heruntergekommenen Hotel blieb er stehen. Darauf stand:
R-DMILLER, HEISSEUNDKALTEBÄDER.
GEÖFFNETTÄGLICHVON 6 BIS 20 UHR.
GEPFLEGTERUMKLEIDERAUMSTEHTZURVERFÜGUNG.
Jamie dachte: Wann habe ich eigentlich zum letzten Mal gebadet? Richtig, auf dem Schiff habe ich mich über einem Eimer Wasser gewaschen. Das war … Jäh kam ihm zu Bewusstsein, wie er riechen musste. Kurz entschlossen betrat er das Bad. Drinnen gab es zwei Türen, eine für Frauen, eine für Männer. In der Männerabteilung wandte Jamie sich an den ältlichen Aufseher. »Was kostet ein Bad?«
»Ein kaltes zehn Shilling, ein heißes fünfzehn.«
Jamie zögerte. Ein heißes Bad nach der langen Reise kam ihm beinahe unwiderstehlich vor. »Ein kaltes«, sagte er. Er konnte es sich nicht leisten, sein Geld für derartigen Luxus hinauszuwerfen, er musste schließlich noch seine Schürferausrüstung kaufen.
Der Aufseher reichte ihm ein kleines Stück gelber Kernseife und ein fadenscheiniges Handtuch und deutete auf eine Tür. »Da geht’s rein, Kumpel.«
Jamie wartete, bis er allein war, bevor er sich auszog. Er sah an seinem schmutzbedeckten Körper herab und setzte einen Fuß in die Wanne. Das Wasser war, wie nicht anders zu erwarten, kalt. Jamie biss die Zähne zusammen und tauchte unter. Er seifte sich kräftig von Kopf bis Fuß ein, und als er schließlich aus der Wanne stieg, war das Wasser schwarz. So gut es ging, trocknete er sich mit dem abgenutzten Leinenhandtuch ab und zog sich wieder an. Hose und Hemd starrten vor Dreck; nur mit Widerwillen zog er sie an. Er würde sich Kleider kaufen müssen, und das erinnerte ihn erneut daran, wie wenig Geld er besaß. Und hungrig war er auch schon wieder.
Jamie verließ das Badehaus und bahnte sich seinen Weg durch die Menge. In einem Saloon, der The Sundowner hieß, bestellte er Bier und etwas zu essen: Lammkoteletts mit Tomaten, Würstchen mit Kartoffelsalat und eingelegtes Gemüse. Beim Essen lauschte er den zuversichtlichen Gesprächen um ihn herum.
An der Bar stand ein Gast mit kragenlosem Flanellhemd und Cordhosen und spielte mit seinem großen Glas. »Ich bin in Hebron ausgenommen worden«, vertraute er dem Barmixer an. »Ich muss mir ’ne neue Ausrüstung besorgen.«
Der Barmixer war ein großer, fleischiger Kahlkopf mit einer schon mal gebrochenen, schiefen Nase und Frettchenaugen. Er lachte. »Mann, wem passiert das nicht? Warum, glauben Sie, steh ich hier am Tresen? Sobald ich genug Geld beisammenhab, zisch ich ab zum Oranje.« Er wischte mit einem schmuddeligen Lappen über die Theke. »Aber ich kann Ihnen sagen, was Sie am besten tun, Mister. Gehen Sie zu Salomon van der Merwe. Dem gehört hier der Laden gegenüber und die halbe Stadt dazu.«
»Und was hab ich davon?«
»Wenn er Sie mag, greift er Ihnen vielleicht unter die Arme.«
Der Gast sah ihn an. »Ach? Glauben Sie das wirklich?«
»Ich kenn ein paar Burschen, mit denen hat er das schon gemacht. Sie machen die Arbeit, er gibt das Geld. Und dann macht ihr halbe-halbe.«
Jamie McGregors Gedanken überschlugen sich. Er hatte darauf vertraut, dass die 120 Pfund, die er noch besaß, reichen würden, um die zum Überleben notwendigen Geräte und Nahrungsmittel zu kaufen, aber die Preise in Klipdrift waren erschreckend hoch. Da würde sein Geld nicht lange reichen. Mein Gott, dachte Jamie. Zu Hause könnten wir ein ganzes Jahr lang von dem leben, was hier drei Mahlzeiten kosten. Aber wenn es ihm gelang, von einem wohlhabenden Mann wie Mr. van der Merwe unterstützt zu werden …
Jamie zahlte hastig sein Essen und eilte in das Geschäft hinüber.
Salomon van der Merwe stand hinter dem Ladentisch und packte die Gewehre aus der Holzleiste. Er war ein kleiner Mann mit schmalem, verkniffenem Gesicht, das von einem Kaiserbart eingerahmt wurde. Er hatte sandfarbenes Haar, kleine schwarze Augen, eine Knollennase und dünne Lippen. Seine Tochter muss der Mutter nachgeraten sein, dachte Jamie. »Entschuldigen Sie bitte, Sir …« Van der Merwe sah auf. »Ja?«
»Mr. van der Merwe? Ich bin Jamie McGregor, Sir. Ich komme aus Schottland und will hier Diamanten suchen.«
»Ja? So?«
»Ich habe gehört, dass Sie manchmal einem Digger aushelfen.«
Van der Merwe knurrte: »Myn magtig! Wer erzählt denn so was? Ich brauche bloß ein paar Diggern zu helfen, und schon denkt jeder, ich sei der Weihnachtsmann.«
»Ich habe 120 Pfund gespart«, sagte Jamie mit ernster Miene. »Aber wie ich sehe, kann man hier nicht viel dafür kaufen. Wenn mir nichts anderes übrig bleibt, ziehe ich auch nur mit einer Schaufel in den Busch, aber ich glaube, meine Chancen stünden wesentlich besser, wenn ich einen Maulesel und eine ordentliche Ausrüstung hätte.«
Van der Merwe betrachtete ihn eingehend mit seinen kleinen schwarzen Augen. »Wat denk ye? Was bringt Sie auf den Gedanken, ausgerechnet Sie könnten Diamanten finden?«
»Ich bin um die halbe Welt gereist, Mr. van der Merwe, und ich gehe hier nicht wieder weg, bevor ich nicht reich geworden bin. Wenn es hier Diamanten gibt, dann finde ich sie auch. Und wenn Sie mir helfen, werden wir alle beide reich.«
Van der Merwe grunzte, kehrte Jamie den Rücken zu und packte weiter seine Gewehre aus. Jamie stand verlegen herum und wusste nicht, was er noch sagen sollte. Van der Merwes nächste Frage traf ihn völlig unvorbereitet. »Sie sind hier im Ochsenwagen angekommen, ja?«
»Nein. Im Postwagen.«
Der alte Mann drehte sich um und sah den Jungen an. Schließlich sagte er: »Wir sprechen noch darüber.«
Die Besprechung fand noch am gleichen Abend beim Essen statt, und zwar im Hinterzimmer des Ladens, wo van der Merwe wohnte. Es war ein kleines Zimmer, das als Küche, Essplatz und Schlafstelle diente; zwei Betten waren hinter einem Vorhang. Die untere Hälfte der Wände bestand aus Lehm und Stein, die obere Hälfte war mit Pappe von alten Warenkartons beklebt. Aus der Mauer war ein quadratisches Loch geschlagen worden, das nun als Fenster diente. Bei feuchtem Wetter konnte man es schließen, indem man ein Brett davorstellte. Der Esstisch bestand aus einer langen, über zwei Holzkisten gelegten Planke. Eine große Kiste diente als Geschirrschrank. Jamie vermutete, dass van der Merwe zu den Leuten gehörte, die sich nicht leicht von ihrem Geld trennen.
Van der Merwes Tochter ging leise umher und bereitete das Essen zu. Von Zeit zu Zeit warf sie einen raschen Blick auf ihren Vater, während sie kein einziges Mal in Jamies Richtung sah. Warum ist sie so verängstigt?, fragte sich Jamie.
Als sie am Tisch saßen, hub van der Merwe an: »Lasset uns beten. Wir danken Dir, o Herr, für die Gaben, die wir aus Deiner Hand empfangen haben. Wir danken Dir dafür, dass Du uns unsere Sünden vergibst und uns den rechten Weg weist und uns erlösest von den Versuchungen des Lebens. Wir danken Dir für ein langes und fruchtbares Leben und dafür, dass Du all jene niederstreckst, die gegen Dein Gesetz verstoßen. Amen.« Und ohne auch nur einmal Luft zu holen, sagte er zu seiner Tochter: »Reich mir das Fleisch.«
Nachdem sie ihre Mahlzeit beendet hatten, sagte van der Merwe:
»Das war gut, meine Tochter«, und dabei klang seine Stimme stolz. Dann wendete er sich an Jamie: »Kommen wir zum Geschäftlichen, ja?«
»Ja, Sir.«
Van der Merwe nahm eine lange Tonpfeife von einer Holztruhe. Er stopfte sie mit Tabak aus einem Lederbeutelchen und setzte sie in Brand. Hinter seinen Rauchwolken nahmen seine scharfen Augen Jamie genauestens ins Visier.
»Die Digger hier in Klipdrift sind Narren. Zu wenig Diamanten, zu viele Schürfer. Hier kann sich einer ein Jahr lang totschuften und hat am Ende doch nichts anderes als schlenters vorzuweisen.«
»Ich … ich fürchte, Sir, dieses Wort ist mir nicht geläufig.«
»Narrendiamanten. Wertlos. Verstehen Sie?«
»Ich … ja, Sir, ich denke schon. Aber was ist die Lösung?«
»Die Griquas.«
Jamie sah ihn verwirrt an.
»Das ist ein afrikanischer Stamm im Norden. Die finden Diamanten … große Diamanten … und manchmal bringen sie sie mir, und ich gebe ihnen Waren dafür.« Der Holländer senkte die Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern. »Ich weiß, wo sie sie finden.«
»Und warum gehen Sie nicht selber dorthin, Mr. van der Merwe?«
Van der Merwe seufzte. »Unmöglich. Ich kann das Geschäft nicht allein lassen. Die Leute würden alles mitgehen lassen, was nicht niet- und nagelfest ist. Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann, der hingeht und die Steine holt. Wenn ich den richtigen Mann finde, rüste ich ihn mit allem aus, was er dazu braucht.« Er machte eine Pause und nahm einen langen Zug aus der Pfeife. »Und außerdem verrate ich ihm, wo die Diamanten sind.«
Jamie sprang auf. Sein Herz hämmerte wild. »Mr. van der Merwe … ich bin genau der Mann, den Sie suchen. Glauben Sie mir, Sir, ich werde Tag und Nacht arbeiten.« Seine Stimme schnappte fast über vor Aufregung. »Ich werde Ihnen mehr Diamanten bringen, als Sie zählen können.«
Van der Merwe musterte ihn schweigend, und Jamie kam es wie eine Ewigkeit vor. Und als er endlich den Mund auftat, sagte er nur ein einziges Wort: »Ja.«
Am nächsten Morgen unterschrieb Jamie den Vertrag, der in Afrikaans abgefasst war.
»Das muss ich Ihnen erklären«, sagte van der Merwe. »Hier steht, dass wir gleichberechtigte Partner sind. Ich stelle das Kapital zur Verfügung, Sie die Arbeitskraft. Wir teilen alles gerecht.«
Jamie betrachtete den Vertrag in van der Merwes Hand. Inmitten all der unverständlichen Worte konnte er nur eine Zahl entziffern: 2 Pfund.
Jamie deutete darauf. »Was hat das zu bedeuten, Mr. van der Merwe?«
»Das heißt, dass Sie zusätzlich zu Ihrem eigenen Anteil an den gefundenen Diamanten noch zwei Pfund pro Arbeitswoche bekommen für Ihre Arbeit.«
Das war wirklich mehr als gerecht. »Danke, danke vielmals, Sir.« Jamie hätte ihn umarmen können.
Van der Merwe sagte: »Dann werden wir Sie jetzt mal ausrüsten.«
Sie brauchten zwei Stunden, um alles auszusuchen, was Jamie mit in den Busch nehmen wollte. Banda, der schwarze Diener, half Jamie schweigend, alles in Rucksäcken zu verstauen. Der riesige Mann würdigte Jamie keines Blickes und sprach kein Wort. Er kann kein Englisch, folgerte Jamie.
Margaret war im Laden und bediente Kunden, doch wenn sie Jamies Anwesenheit überhaupt wahrnahm, so ließ sie es sich nicht anmerken.
Van der Merwe trat zu Jamie. »Ihr Maultier steht vor dem Haus«, sagte er. »Banda hilft Ihnen beim Aufladen.«
»Danke sehr, Mr. van der Merwe«, sagte Jamie. »Ich …«
Van der Merwe studierte ein Stück Papier, das mit Zahlen vollgeschrieben war. »Das macht 120 Pfund.«
Jamie sah ihn entsetzt an. »Wie … wie bitte? Das gehört doch zu unserem Vertrag. Wir …«
»Wat bedui’di?« Van der Merwes Gesicht lief dunkel an vor Wut. »Erwarten Sie etwa, dass ich Ihnen das alles schenke?!Dass ich Ihnen ein prima Maultier gebe, Sie zum Teilhaber mache und Ihnen obendrein noch zwei Pfund die Woche zahle? Wenn Sie meinen, Sie kriegen hier was umsonst, dann sind Sie bei mir an der falschen Stelle.« Er fing an, die Rucksäcke wieder auszupacken.
»Nein!«, sagte Jamie schnell. »Bitte, Mr. van der Merwe. Ich … ich hatte das nur nicht verstanden. Es hat schon alles seine Richtigkeit. Ich habe das Geld dabei.« Er griff in seine Börse und legte den Rest seiner Ersparnisse auf den Ladentisch.
Van der Merwe zögerte. »In Ordnung«, sagte er dann widerwillig. »Vielleicht war’s ein Missverständnis, nah? In dieser Stadt gibt es lauter Betrüger. Ich muss schon aufpassen, mit wem ich mich einlasse.«
»Ja, Sir. Natürlich müssen Sie das«, stimmte Jamie ihm zu. In seiner Aufregung musste er die Abmachung falsch verstanden haben. Ich kann von Glück sagen, dass er mir noch eine Chance einräumt, dachte er.
Van der Merwe förderte aus seiner Tasche einen kleinen, zerknitterten, von Hand gezeichneten Plan zutage. »Hier ist die Stelle, wo Sie mooi klippe finden können. Nördlich von hier in Magerdam, am Nordufer des Vaal.«
Jamie studierte die Karte, und sein Herz begann rascher zu schlagen. »Wie viele Meilen sind es bis dahin?«
»Hier messen wir Entfernungen in Tagen. Mit dem Maultier sollten Sie es in vier oder fünf Tagen schaffen. Zurück brauchen Sie länger … die Diamanten wiegen ja einiges.«
Jamie grinste. »Ja«, sagte er auf Holländisch.
Als Jamie McGregor wieder auf die Straßen von Klipdrift hinaustrat, war er kein Tourist mehr. Er war nun ein Schürfer, ein Digger auf seinem Weg ins Glück. Banda hatte mittlerweile die restlichen Sachen auf den Rücken eines schwächlich wirkenden Maultiers gepackt, das an einem Pfosten vor dem Laden angebunden war.
»Danke.« Jamie lächelte.
Banda drehte sich um und sah ihm in die Augen, dann ging er wortlos weg. Jamie nahm die Zügel vom Pfosten und sagte zu dem Maultier: »Auf geht’s, mein Freund. Zeit für mooi klippe.«
Sie zogen nach Norden.
Bei Einbruch der Nacht schlug Jamie sein Lager in der Nähe eines Flusses auf, lud den Maulesel ab, tränkte und fütterte ihn und gönnte sich selbst eine Mahlzeit aus getrocknetem Rindfleisch, gedörrten Aprikosen und Kaffee. Die Nacht hallte wider von unbekannten Geräuschen. Er hörte das Knurren, Heulen und Tappen der wilden Tiere, die zur Wasserstelle kamen. Schutzlos, umgeben von den gefährlichsten Viechern der Welt, befand er sich in einem fremden, unzivilisierten Land. Bei jedem Geräusch fuhr er hoch.
Am nächsten Morgen, als Jamie erwachte, war das Maultier tot.
2
Er konnte es nicht fassen. Er suchte nach einer Wunde, dachte, der Maulesel müsse während der Nacht von einem wilden Tier angegriffen worden sein, aber er fand nichts. Das Biest war im Schlaf gestorben. Mr. van der Merwe wird mich dafür verantwortlich machen, dachte Jamie. Aber wenn ich ihm Diamanten bringe, ist es nicht so schlimm.
Er würde ohne das Maultier nach Magerdam weiterziehen. Ein Geräusch in der Luft ließ ihn aufblicken. Riesige schwarze Geier zogen hoch über ihm ihre Kreise. Jamie zitterte. So schnell wie möglich suchte er seine Sachen zusammen, entschied dabei, was er zurücklassen musste, packte alles, was er tragen konnte, in einen Rucksack und brach auf. Als er fünf Minuten später noch einmal zurückschaute, hatten sich die großen Vögel bereits auf dem toten Tier niedergelassen. Ein langes Ohr war alles, was man noch von ihm sah. Jamie beschleunigte seinen Schritt.
Es war Dezember, also Sommer in Südafrika, und der Marsch durch die Grassteppe unter der riesigen orangeroten Sonne war ein einziger Albtraum.
Jamie kampierte immer dort, wo er ein Wasserloch fand, und seinen Schlaf begleiteten die unheimlichen nächtlichen Laute der wilden Tiere. Er hatte sich an sie gewöhnt. Sie waren ein Beweis dafür, dass es Leben in dieser elenden Hölle gab, und mit ihnen fühlte er sich weniger einsam.
Er brauchte fast zwei Wochen, um das Veld zu durchqueren. Mehrmals war er drauf und dran aufzugeben. Er fragte sich, ob er die Strapazen überhaupt überleben würde. Ich bin ein Idiot. Ich hätte nach Klipdrift zurückgehen und Mr. van der Merwe um ein neues Maultier bitten sollen. Aber wenn van der Merwe dann den Handel rückgängig gemacht hätte? Nein, ich hab’s schon richtig gemacht.
Jamie stapfte also weiter. Eines Tages sah er aus der Ferne vier Gestalten auf sich zukommen. Ich spinne ja, dachte Jamie. Das kann nur eine Fata Morgana sein. Aber die Gestalten kamen näher, und vor Schreck fing Jamies Herz an, wie wild zu schlagen. Menschen! Es gibt tatsächlich Menschen hier! Er bezweifelte, ob er überhaupt noch einen Ton herausbrachte. Er probierte seine Stimme aus, und in der Nachmittagsluft klang sie, als gehöre sie einem längst Verstorbenen. Die vier Männer erreichten ihn. Es waren Digger, die sich müde und geschlagen nach Klipdrift zurückschleppten.
»Hallo«, sagte Jamie.
Sie nickten nur. Dann sagte einer von ihnen: »Da vorn ist nichts, Junge. Wir ham’s gesehen. Du verschwendest bloß deine Zeit. Kehr lieber um.«
Und fort waren sie.
Jamie ließ keinen Gedanken mehr an sich heran. Er konzentrierte sich nur noch auf die unwegsame Einöde. Die grelle Sonne hatte Jamie schon fast blind gemacht. Seine helle Haut war verbrannt und wund, und ihm war ständig schwindelig. Bei jedem Atemzug schien seine Lunge bersten zu wollen. Er ging nicht mehr, er stolperte nur noch, setzte einen Fuß vor den anderen, taumelte kopflos vorwärts. Eines Nachmittags, als die Sonne auf ihn niederbrannte, streifte er seinen Rucksack ab und stürzte zu Boden, zu erschöpft, um auch nur noch einen Schritt zu tun. Er schloss die Augen und träumte, er befände sich in einem großen Schmelztiegel und die Sonne wäre ein riesiger, heller Diamant, der auf ihn niederflammte, ihn zerschmolz. Mitten in der Nacht erwachte er, zitternd vor Kälte. Er zwang sich, ein paar Bissen Trockenfleisch zu essen, und trank lauwarmes Wasser dazu. Er wusste, dass er aufstehen und sich fortbewegen musste, bevor die Sonne aufging, solange Erde und Luft noch kühl waren. Er versuchte es, aber die Anstrengung ging über seine Kräfte. Wie leicht wäre es, für immer dort liegen zu bleiben und nie mehr einen einzigen Schritt tun zu müssen. Nur noch ein bisschen weiterschlafen dürfen, dachte Jamie. Aber eine Stimme in seinem Innersten sagte ihm, dass er dann nie mehr aufwachen würde. Man würde seinen Körper hier draußen finden wie schon Hunderte zuvor. Die Geier fielen ihm ein, und er dachte: Nein, nicht meinen Körper … meine Knochen. Langsam und mühselig stand er wieder auf, zwang sich dazu. Sein Rucksack war so schwer, dass er ihn nicht heben konnte. Er setzte sich wieder in Bewegung, schleifte den Rucksack hinter sich her. Er registrierte nicht mehr, wie oft er in den Sand fiel und sich wieder aufrappelte. Einmal, noch vor Morgengrauen, schrie er in den Himmel: »Ich bin Jamie McGregor, und ich werde es schaffen. Ich werde leben. Hörst du mich, Gott? Ich werde leben …« In seinem Kopf dröhnten Stimmen.
Zwei Tage später stolperte Jamie in das Dorf Magerdam. Sein Sonnenbrand hatte sich längst entzündet, und aus seinen Wunden quollen Blut und Wasser. Beide Augen waren fast völlig zugeschwollen. Mitten auf der Straße brach er zusammen, ein Häufchen Elend, das lediglich an seiner ramponierten Kleidung noch als Mensch zu erkennen war. Als mitleidige Digger versuchten, ihn von seinem Rucksack zu befreien, schlug Jamie mit dem bisschen Kraft, das noch in ihm steckte, wie besessen um sich: »Nein! Hände weg von meinen Diamanten! Bleibt ja weg von meinen Diamanten …«
Drei Tage später kam er in einem kargen Zimmerchen wieder zu sich, nackt bis auf die Verbände, die man ihm angelegt hatte.
Das Erste, was er sah, als er die Augen aufschlug, war eine dralle Frau mittleren Alters, die neben seiner Pritsche saß.
»W-w-?« Seine Stimme war nur ein Krächzen. Er brachte kein Wort heraus.
»Sachte, mein Lieber. Sie sind noch krank.« Behutsam hob sie seinen verbundenen Kopf an und ließ ihn aus einer Blechtasse einen Schluck Wasser trinken.
Jamie stützte sich mühsam auf seinen Ellbogen.
»Wo …?« Er schluckte und versuchte es noch einmal. »Wo bin ich?«
»Sie sind in Magerdam. Ich bin Alice Jardine. Ich habe ein Logierhaus. Sie werden bald wieder wohlauf sein. Sie müssen sich nur ordentlich ausruhen. Legen Sie sich wieder hin.«
Jamie fielen die Fremden ein, die ihm seinen Rucksack hatten wegnehmen wollen, und panische Angst überkam ihn. »Wo … meine Sachen …?« Er versuchte aufzustehen, aber die sanfte Stimme der Frau ließ ihn innehalten.
»Keine Sorge, mein Sohn, es ist alles in Ordnung.« Sie deutete auf eine Ecke, in der der Rucksack stand.
Jamie legte sich zurück auf die sauberen weißen Laken. Ich bin angekommen. Ich hab’s geschafft. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Alice Jardine war ein wahrer Segen, nicht nur für Jamie McGregor, sondern für halb Magerdam. Für die Abenteurer, die diese Minenstadt bevölkerten und die alle dem gleichen Traum nachhingen, war sie Köchin, Pflegemutter und Seelentrösterin.
Sie hielt Jamie weitere vier Tage im Bett, fütterte ihn, wechselte seine Bandagen und half ihm, wieder zu Kräften zu kommen. Am fünften Tag konnte Jamie endlich aufstehen.
»Ich möchte, dass Sie wissen, wie dankbar ich Ihnen bin, Mrs. Jardine. Ich kann Ihnen nichts dafür bezahlen … noch nicht. Aber eines Tages, bald schon, werden Sie einen großen Diamanten von mir bekommen. Das verspreche ich Ihnen, so wahr ich Jamie McGregor heiße.«
Sie lächelte über die Unbeirrbarkeit dieses netten Jungen. Er hatte immer noch zwanzig Pfund zu wenig auf den Knochen, und in seinen grauen Augen spiegelten sich noch immer die Schrecken, die er durchgemacht hatte. Gleichzeitig aber steckte eine Kraft in ihm, eine Entschlossenheit, vor der einem angst und bange werden konnte. Er ist anders als die anderen, dachte Mrs. Jardine.
In seinen frisch gewaschenen Kleidern ging Jamie aus, um den Ort zu erkunden. Er war wie Klipdrift, nur kleiner: die gleichen Zelte und Wagen und staubigen Straßen, die irgendwie zusammengeschusterten Läden und die Massen von Diggern. Als Jamie an einem Saloon vorbeikam, hörte er brüllendes Gelächter von drinnen und ging hinein. Eine lärmende Menge hatte sich um einen rot behemdeten Iren geschart.
»Was ist denn los?«, fragte Jamie.
»Er will seinen Fund begießen.«
»Er will was?«
»Er hat ganz schön was gefunden, und jetzt hält er den ganzen Saloon frei. Er zahlt alles, was die durstigen Kehlen hier drin schlucken können.«
Jamie kam mit ein paar verdrossenen Schürfern ins Gespräch, die um einen runden Tisch saßen.
»Wo bist’n her, McGregor?«
»Schottland.«
»Na, ich weiß ja nicht, was für ’n Mist sie dir in Schottland erzählt haben, aber die Diamanten in diesem beschissenen Land reichen noch nicht mal fürs Nötigste.«
Alle Digger erzählten die gleiche Geschichte: von Monaten härtester Knochenarbeit, in der sie Gesteinsbrocken gewälzt, im harten Boden gegraben und am Flussufer gehockt und den Schlamm auf der Suche nach Diamanten durchgesiebt hatten. Die Stimmung im Ort war eine seltsame Mischung aus Optimismus und Pessimismus. Die Optimisten kamen an, die Pessimisten gingen. Jamie wusste, auf welcher Seite er stand.
Er näherte sich dem rot behemdeten Iren, der jetzt schon triefäugig vor Alkohol war, und zeigte ihm van der Merwes Landkarte.
Der Mann sah sie flüchtig an und warf sie Jamie wieder zu. »Wertlos. Die ganze Gegend ist schon durchwühlt worden. An deiner Stelle würd ich’s mit Bad Hope versuchen.«
Jamie konnte es kaum glauben. Schließlich war es van der Merwes Karte, deretwegen er gekommen war, sein Leitstern, der ihn reich machen würde.
An diesem Abend sagte Alice Jardine beim Essen: »Das ist wie in der Lotterie, Jamie: Ein Ort ist so gut wie der andere. Suchen Sie sich Ihren eigenen Platz aus, hauen Sie Ihre Spitzhacke rein und beten Sie. Etwas anderes machen diese sogenannten Experten auch nicht.«
Nach einer schlaflosen Nacht entschied er sich, van der Merwes Karte außer Acht zu lassen. Entgegen jedermanns Rat würde er den Modder River entlang nach Osten gehen. Am folgenden Morgen verabschiedete er sich von Mrs. Jardine und machte sich auf den Weg.





























