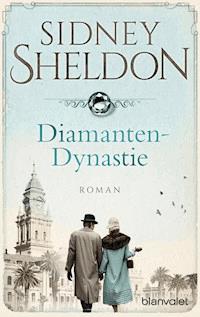2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meisterdiebin und Racheengel: Ein packender Thriller um eine Frau auf der Suche nach Gerechtigkeit – von Sidney Sheldon, dem Großmeister spannender Unterhaltung.
Tracy Whitney ist jung, intelligent, wunderschön und steht kurz vor der Hochzeit mit einem der begehrtesten Junggesellen Philadelphias. Nicht jeder gönnt ihr dieses Glück. Tracy wird Opfer einer hinterhältigen Intrige und schließlich fälschlicherweise des versuchten Mordes bezichtigt und verurteilt. Als sie aus dem Gefängnis entlassen wird, ist sie nicht mehr die unbeschwerte Frau, die sie vorher war. Angetrieben von ihrem sehnsüchtigen Wunsch nach Gerechtigkeit, schmiedet sie einen Racheplan und zeigt ihren Widersachern, mit wem sie sich besser nicht angelegt hätten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Tracy Whitney ist jung, intelligent, wunderschön und steht kurz vor der Hochzeit mit einem der begehrtesten Junggesellen Philadelphias. Nicht jeder gönnt ihr dieses Glück. Tracy wird Opfer einer hinterhältigen Intrige und schließlich fälschlicherweise des versuchten Mordes bezichtigt und verurteilt. Als sie aus dem Gefängnis entlassen wird, ist sie nicht mehr die unbeschwerte Frau, die sie vorher war. Angetrieben von ihrem sehnsüchtigen Wunsch nach Gerechtigkeit schmiedet sie einen Racheplan und zeigt ihren Widersachern, mit wem sie sich besser nicht angelegt hätten …
Autor
Sidney Sheldon begeisterte bis heute über 300 Millionen Leser weltweit. Vielfach preisgekrönt – u.a. erhielt er 1947 einen Oscar für das Drehbuch zu So einfach ist die Liebe nicht –, stürmte er mit all seinen Romanen immer wieder die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. Er zählt zu den am häufigsten übersetzten Autoren und wurde dafür sogar mit einem Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde geehrt. Im Jahr 2007, kurz vor seinem neunzigsten Geburtstag, verstarb Sidney Sheldon.
Von Sidney Sheldon bereits erschienen:
Die Mühlen Gottes • Der Zorn der Götter • Diamanten-Dynastie •
Im Schatten der Götter • Zorn der Engel • Schatten der Macht
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
SIDNEYSHELDON
Kalte Glut
Roman
Deutsch von Götz Pommer
Die Originalausgabe erschien 1985 unter dem Titel »If Tomorrow Comes« bei William Morrow and Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 1985 by Sheldon Family Limited Partnership
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1985 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (© Markus Gann; © SasinTipchai; © freedarst; © LifetimeStock; © Viktor Gladkov)
LM • Herstellung: AT
ISBN 978-3-641-21387-9V003
www.blanvalet.de
Inhaltsverzeichnis
Für Barry
ERSTES BUCH
1
NEW ORLEANS
Donnerstag, 20. Februar, 23 Uhr
Sie zog sich langsam aus, und als sie nackt war, hüllte sie sich in ein leuchtendrotes Morgenkleid, damit man das Blut nachher nicht so deutlich sah. Doris Whitney blickte sich zum letzten Mal im Schlafzimmer um. Sie wollte sicher sein, dass dieser freundliche Raum, den sie in den vergangenen dreißig Jahren so liebgewonnen hatte, sauber und ordentlich war. Sie öffnete die Nachttischschublade und nahm behutsam die Pistole heraus. Die Waffe glänzte schwarz und war erschreckend kalt. Sie legte sie neben das Telefon und wählte die Nummer ihrer Tochter in Philadelphia.
»Tracy … ich wollte nur mal eben deine Stimme hören.«
»Mutter! Das ist aber eine Überraschung!«
»Hoffentlich habe ich dich nicht geweckt.«
»Nein, ich habe noch gelesen. Charles und ich wollten zum Essen gehen, aber das Wetter ist einfach zu scheußlich. Hier schneit es wie verrückt. Und bei euch?«
Lieber Gott, wir reden über das Wetter, dachte Doris Whitney. Dabei hätte ich ihr so viel zu sagen. Und kann es nicht.
»Mutter? Bist du noch dran?«
Doris Whitney schaute aus dem Fenster. »Hier regnet es.« Wie melodramatisch, dachte sie. Und passend. Wie in einem Hitchcock-Film.
»Was ist das für ein Krach im Hintergrund?«
Donner. Doris Whitney war so in Gedanken versunken, dass sie es nicht wahrgenommen hatte. Über New Orleans tobte ein Gewitter. Anhaltende Regenfälle, hatte es im Wetterbericht geheißen. Temperaturen um neunzehn Grad. Gegen Abend gewittrige Schauer. Vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht. Sie würde keinen Regenschirm brauchen.
»Es donnert, Tracy.« Doris Whitney bemühte sich, einen heiteren Tonfall anzuschlagen. »Nun erzähl mir mal, was sich so tut in Philadelphia.«
»Ich komme mir vor wie eine Märchenprinzessin, Mutter«, sagte Tracy. »Ich habe nie geglaubt, dass man so glücklich sein kann. Morgen Abend lerne ich Charles’ Eltern kennen.« Sie senkte ihre Stimme, als hätte sie eine große Ankündigung zu machen. »Die Stanhopes vom Chestnut Hill.« Tracy lachte. »Sie sind eine Institution. Ich habe eine Heidenangst.«
»Musst du nicht, Liebling. Sie werden dich sicher mögen.«
»Charles sagt, das sei egal. Er liebt mich. Und ich bete ihn an. Ich kann es gar nicht erwarten, dass du ihn kennenlernst. Er ist phantastisch.«
»Das glaube ich dir gern.« Sie würde Charles nie kennenlernen. Und nie ein Enkelkind auf dem Schoß wiegen. Nein. Daran darf ich nicht denken. »Weiß er, wie froh er sein kann, dass er dich hat?«
»Ich sage es ihm immer wieder«, lachte Tracy. »Jetzt haben wir aber genug von mir geredet. Erzähl mir von dir. Wie fühlst du dich?«
Sie sind kerngesund, Doris, hatte Dr. Rush gesagt. Sie werden hundert Jahre alt. Eine der kleinen Ironien des Schicksals. »Ich fühle mich prächtig.«
»Hast du inzwischen einen Freund?« fragte Tracy.
Seit Tracys Vater vor fünf Jahren gestorben war, hatte Doris Whitney nicht einmal daran gedacht, mit einem anderen Mann auszugehen, obwohl Tracy ihr gut zugeredet hatte.
»Nein.« Doris Whitney wechselte das Thema. »Wie läuft es mit deinem Job? Macht er dir immer noch Spaß?«
»Ja, ich finde ihn einfach toll. Und Charles hat nichts dagegen, wenn ich nach der Hochzeit weiterarbeite.«
»Das ist schön, mein Kind. Hört sich so an, als wäre er ein sehr verständnisvoller Mann.«
»Ist er auch. Du wirst ja sehen.«
Ein gewaltiger Donnerschlag krachte – das Stichwort gewissermaßen. Es war Zeit. Es gab nichts mehr zu sagen, nur ein letztes Lebewohl. »Auf Wiedersehen, Liebling.« Doris Whitney achtete sehr darauf, dass ihre Stimme nicht zitterte.
»Wir sehen uns bei der Hochzeit, Mutter. Ich rufe dich an, sobald ich den Termin weiß.«
»Ja.« Es gab doch noch etwas zu sagen. »Ich habe dich sehr, sehr lieb, Tracy.« Doris Whitney legte behutsam den Hörer auf.
2
PHILADELPHIA
Freitag, 21. Februar, 8 Uhr
Tracy Whitney trat aus der Eingangshalle ihres Appartmenthauses in einen grauen, mit Graupeln vermischten Regen hinaus. Er fiel unparteiisch auf die eleganten Limousinen, die von uniformierten Chauffeuren die Market Street entlanggesteuert wurden, und auf die leerstehenden Behausungen, die sich in den Slums von North Philadelphia aneinanderdrängten. Er wusch die Limousinen sauber und machte ein schmieriges Chaos aus den Müllhaufen vor den heruntergekommenen Reihenhäusern. Tracy Whitney war auf dem Weg zu ihrer Arbeit in der Bank. Sie lief auf der Chestnut Street nach Osten, und wenn sie nicht so schnell gegangen wäre, hätte sie laut gesungen. Sie trug einen gelben Regenmantel, Stiefel und einen gelben Hut, der ihr üppiges, seidig glänzendes kastanienbraunes Haar kaum fassen konnte. Sie war fünfundzwanzig, hatte ein lebhaftes, kluges Gesicht, einen vollen, sinnlichen Mund, strahlende Augen, deren Farbe sich binnen Sekunden von sanftem Moosgrün zu einem tiefen Jadeton wandeln konnte, und eine hübsche, sportliche Figur.
Und als sie nun die Straße entlangging, drehten sich die Leute nach ihr um, lächelten sie an und beneideten sie um das Glück, das sie ausstrahlte. Tracy lächelte zurück.
Es ist unanständig, so glücklich zu sein, dachte sie. Ich heirate den Mann, den ich liebe, und ich werde ein Kind von ihm haben. Was will man mehr?
Als sich Tracy dem Bankgebäude näherte, warf sie einen Blick auf ihre Uhr: 8 Uhr 20. Die Pforten der Philadelphia Trust and Fidelity Bank würden sich erst in zehn Minuten für die Angestellten öffnen, aber Clarence Desmond, stellvertretender Direktor der Bank und Leiter der Auslandsabteilung, stellte bereits den Außenalarm ab und schloss die Tür auf. Es machte Tracy Spaß, das Morgenritual zu beobachten. Sie stand im Regen und wartete, während Desmond das Gebäude betrat und die Tür hinter sich abschloss.
Überall auf der Welt haben Banken ihre geheimen Sicherheitsvorkehrungen, und die Philadelphia Trust and Fidelity Bank machte da keine Ausnahme. Die Routine blieb immer die gleiche. Bis auf das »Sicherheitssignal«, das jede Woche geändert wurde. Diese Woche handelte es sich um einen halb heruntergelassenen Rollladen, der den draußen wartenden Angestellten bedeutete, dass gerade eine Überprüfung im Gange war. Clarence Desmond vergewisserte sich, dass keine Eindringlinge in der Bank versteckt waren und darauf lauerten, die Angestellten als Geiseln zu nehmen. Er schaute überall nach: auf den Toiletten, in den Nebenräumen, im Tresorraum und im Raum mit den Schließfächern. Erst wenn er sich davon überzeugt hatte, dass er allein im Gebäude war, ging der Rollladen hoch: alles in Ordnung.
Um 8 Uhr 30 betrat Tracy Whitney mit den anderen Angestellten die etwas protzige Eingangshalle, nahm ihren Hut ab, zog ihren Regenmantel und ihre Stiefel aus und hörte mit heimlicher Belustigung zu, wie die anderen über das Wetter jammerten.
Dann machte sie sich an ihre Arbeit.
Tracy leitete die Abteilung für telegrafische Überweisungen. Bis vor kurzem waren die Überweisungen von Bank zu Bank und von Land zu Land eine langweilige, umständliche Sache gewesen. Aber mit der Einführung der Computer hatte sich das durchgreifend geändert. Nun konnten ungeheure Beträge blitzschnell überwiesen werden. Alle Transaktionen waren kodiert, und der Kode wechselte regelmäßig, damit kein unbefugtes Eindringen in den Zahlungsverkehr möglich war. Tagtäglich gingen Millionen elektronischer Dollar durch Tracys Hände. Diese Arbeit faszinierte sie, und bis sie Charles kennengelernt hatte, war das Bankwesen für sie das Aufregendste auf der Welt gewesen.
Tracy hatte Charles Stanhope junior während einer Finanztagung kennengelernt, auf der er den Gastvortrag hielt. Charles leitete die Investmentgesellschaft, die sein Urgroßvater gegründet hatte, und seine Firma stand in regem Geschäftsverkehr mit der Bank, für die Tracy arbeitete. Nach Charles’ Vortrag war Tracy zum Rednerpult gegangen, um seiner Auffassung zu widersprechen, dass die Länder der dritten Welt in der Lage seien, die schwindelerregenden Beträge zurückzuzahlen, die sie von Großbanken und westlichen Regierungen geborgt hatten. Charles war anfangs belustigt, dann beeindruckt und schließlich fasziniert von den leidenschaftlichen Argumenten der schönen jungen Frau. Sie hatten das Gespräch beim Essen in einem Restaurant fortgesetzt.
Charles Stanhope junior ließ Tracy zunächst völlig kalt, obwohl sie natürlich wusste, dass man ihn für die beste Partie von Philadelphia hielt.
Charles war fünfunddreißig, maß einen Meter achtundsiebzig, hatte schütteres strohblondes Haar und braune Augen, trat ernst, ja pedantisch auf und war, so dachte Tracy, einer von jenen sterbenslangweiligen Reichen.
Als hätte er ihre Gedanken erraten, beugte sich Charles etwas vor und sagte:
»Mein Vater ist überzeugt, dass sie ihm im Krankenhaus das falsche Baby gegeben haben.«
»Wie bitte?«
»Ich bin aus der Art geschlagen. Ich finde nämlich nicht, dass Geld der Hauptzweck des Lebens ist. Aber das dürfen Sie meinem Vater bitte nie verraten.«
Er hatte etwas so bezaubernd Bescheidenes, dass sich Tracy allmählich für ihn erwärmte. Wie das wohl wäre, mit jemandem wie ihm verheiratet zu sein?
Es hatte Tracys Vater die meiste Zeit seines Lebens gekostet, ein Geschäft aufzubauen, über das die Stanhopes bloß spöttisch gelächelt hätten: unbedeutend. Zwischen den Stanhopes und den Whitneys liegen Welten, dachte Tracy. Aber was spinne ich da eigentlich vor mich hin? Ein Mann lädt mich zum Essen ein, und ich überlege mir, ob ich ihn heiraten will. Wahrscheinlich werden wir uns nie wiedersehen.
Dann sagte Charles: »Ich hoffe, Sie haben morgen Abend noch nichts vor?«
In Philadelphia gab es viel zu sehen, und man konnte eine Menge unternehmen. An den Samstagabenden gingen Tracy und Charles ins Theater oder ins Konzert, und unter der Woche bummelten sie durch New Market oder besuchten das Philadelphia Museum of Art und das Rodin-Museum.
Da Charles sich nichts aus Sport machte, Tracy dagegen Spaß an körperlicher Bewegung hatte, joggte sie jeden Samstagmorgen allein durch die Anlagen am Schuylkill River, und Samstag nachmittags besuchte sie einen Tai Chi Chuan-Kurs. Das Training dauerte eine Stunde, und danach traf sie sich, erschöpft, aber bester Laune, mit Charles in seiner·Wohnung. Er war ein Feinschmecker, kochte vorzüglich und bereitete gern für Tracy und sich Gerichte fremder Länder zu.
Charles war der förmlichste Mensch, den Tracy kannte. Sie war einmal zu einer Verabredung mit ihm eine Viertelstunde zu spät gekommen, und er ärgerte sich so darüber, dass es ihr den ganzen Abend verdarb. Danach hatte sie sich geschworen, nie wieder unpünktlich zu sein.
Tracy hatte nicht viel sexuelle Erfahrung, aber sie hatte den Eindruck, dass Charles im Bett genauso war wie im sonstigen Leben: gewissenhaft und überaus korrekt. Einmal hatte Tracy beschlossen, frech und unkonventionell zu sein. Sie hatte Charles damit so schockiert, dass sie sich fragte, ob sie vielleicht ein bisschen pervers sei.
Die Schwangerschaft kam völlig unerwartet. Und als es passierte, war Tracy entsetzlich unsicher. Charles hatte nie über eine mögliche Ehe geredet, und sie wollte nicht, dass er das Gefühl hatte, er müsse sie nun heiraten. Ganz kurz dachte sie an eine Abtreibung, aber sie merkte bald, dass sie dies nicht wirklich wollte.
Eines Abends beschloss sie, Charles nach dem Essen zu sagen, dass sie schwanger war. Sie kochte in ihrer Wohnung ein Cassoulet für ihn und ließ es anbrennen vor lauter Nervosität. Als sie ihm das angesengte Fleisch und die bräunlich verfärbten Bohnen vorsetzte, vergaß sie ihre sorgfältig einstudierte kleine Rede und platzte einfach damit heraus: »Es tut mir schrecklich leid, Charles. Ich – ich bin schwanger.«
Dem folgte ein unerträglich langes Schweigen, und als Tracy es gerade brechen wollte, sagte Charles: »Wir heiraten selbstverständlich.«
Tracy fiel ein Stein vom Herzen. »Ich will aber nicht, dass du denkst … Ich meine, du musst mich nicht heiraten.«
Er hob die Hand, winkte ab. »Ich will dich aber heiraten, Tracy. Du bist sicher eine wunderbare Ehefrau.« Langsam fügte er hinzu: »Meine Eltern werden natürlich ein bisschen überrascht sein.«
Und er lächelte Tracy an und küsste sie.
Tracy fragte ruhig: »Warum werden sie überrascht sein?«
Charles seufzte. »Ach, Liebling … ich fürchte, du bist dir nicht ganz im klaren, worauf du dich da einlässt. Die Stanhopes heiraten immer – in Anführungszeichen, wohlgemerkt – ›ihresgleichen‹. Also erstens reich und zweitens alteingesessene Prominenz von Philadelphia.«
»Und deine Eltern haben bereits eine Frau für dich ausgesucht«, vermutete Tracy.
Charles nahm sie in die Arme. »Das ist völlig egal. Wen ich ausgesucht habe – das zählt und sonst nichts. Nächsten Freitag essen wir bei meinen Eltern zu Abend. Es wird Zeit, dass du sie kennenlernst.«
Fünf Minuten vor neun nahm Tracy eine Veränderung im Geräuschpegel der Bank wahr. Die Angestellten sprachen ein wenig schneller und bewegten sich ein bisschen rascher. In fünf Minuten würden sich die Pforten der Bank öffnen, und dann musste alles bereit sein. Durch das Fenster zur Straße sah Tracy die Kunden, die im kalten Regen auf dem Bürgersteig anstanden und warteten.
Tracy beobachtete, wie der Wachmann der Bank neue Blankoformulare zur Ein- und Auszahlung in die Metallständer auf den sechs Tischen steckte, die am Mittelgang der Schalterhalle aufgereiht waren. Die Stammkundschaft der Bank erhielt Einzahlungsbelege mit einem persönlichen Kode auf Magnetstreifen im unteren Feld des Formulars. Wenn eine Einzahlung vorgenommen wurde, buchte der Computer den Betrag automatisch auf das richtige Konto. Doch es geschah oft, dass Kunden ohne ihre Einzahlungsbelege in die Bank kamen. Dann benutzten sie Blankoformulare.
Der Wachmann blickte auf die Wanduhr. Die Zeiger rückten auf 9 Uhr, und er ging zur Tür und schloss sie fast feierlich auf.
Der Bankalltag hatte begonnen.
In den nächsten Stunden war Tracy so sehr am Computer beschäftigt, dass sie an nichts anderes denken konnte. Bei jeder telegrafischen Überweisung musste nachgeprüft werden, ob sie fehlerfrei war. Wenn ein Konto belastet wurde, tippte Tracy die Kontonummer, den Betrag und die Bank ein, auf die das Geld überwiesen werden sollte. Jede Bank hatte ihre eigene Leitzahl, und die Bankleitzahlen aller größeren Banken der Welt waren in einem Verzeichnis zum Dienstgebrauch aufgeführt.
Der Vormittag verging wie im Flug, und Tracy wollte in der Mittagspause zum Friseur. Zu einem teuren, aber das würde sich hoffentlich lohnen. Charles’ Eltern sollten sie von ihrer besten Seite sehen. Ich muss sie dazu bringen, dass sie mich mögen, dachte Tracy. Es ist mir egal, wen sie für ihn ausgesucht haben. Niemand kann Charles so glücklich machen wie ich.
Es war 13 Uhr. Tracy schlüpfte gerade in ihren Regenmantel, als Clarence Desmond sie in sein Büro rief. Desmond war die Idealverkörperung eines Bankmannes; hätte die Philadelphia Trust and Fidelity Bank im Fernsehen Werbung gemacht, so wäre er der perfekte Sprecher gewesen. Er war immer konservativ gekleidet, hatte etwas von einer soliden, altmodischen Autorität und wirkte absolut vertrauenswürdig.
»Nehmen Sie Platz, Tracy«, bat er. Er rühmte sich, alle Angestellten beim Vornamen zu kennen. »Scheußlich draußen, nicht?«
»Ja.«
»Aber die Leute müssen nun mal zur Bank. Tja.« Mehr unverbindliche Floskeln fielen ihm nicht ein. Er beugte sich ein wenig vor. »Wie man hört, wollen Charles Stanhope und Sie heiraten.«
Tracy war verblüfft. »Wir haben es noch nicht bekanntgegeben. Woher …«
Desmond lächelte. »Was die Stanhopes tun, macht immer von sich reden. Das freut mich sehr für Sie. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie auch weiterhin für uns arbeiten? Nach der Hochzeitsreise natürlich. Wir möchten Sie nicht verlieren, denn Sie sind eine von unseren wertvollsten Mitarbeiterinnen.«
»Charles und ich haben schon darüber gesprochen, und wir fanden beide, dass ich sicher glücklicher bin, wenn ich weiterarbeite.«
Desmond lächelte zufrieden. Stanhope & Sons gehörte zu den wichtigsten Investitionsgesellschaften der Finanzwelt, und wenn er das Geschäftskonto dieser Firma exklusiv für sein Haus ergattern konnte, war das ein guter Fang. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Wenn Sie von der Hochzeitsreise zurückkommen, Tracy, wartet eine Beförderung auf Sie – inklusive Gehaltserhöhung.«
»Oh, vielen Dank! Das ist ja wunderbar!« Tracy wusste, dass sie es sich redlich verdient hatte. Aber sie war trotzdem aufgeregt und stolz. Sie konnte es kaum erwarten, Charles davon zu berichten. Tracy schien, als hätten sich die Götter abgesprochen, alles zu tun, was in ihrer Macht stand, um sie mit Glück zu überhäufen.
Charles’ Eltern wohnten am Rittenhouse Square in einer imposanten alten Villa, die zu den Wahrzeichen der Stadt zählte. Tracy war schon oft an ihr vorbeigekommen. Und jetzt, dachte sie, wird die Villa ein Teil meines Lebens sein.
Tracy war nervös. Die feuchte Luft hatte ihrer schönen Frisur böse zugesetzt, und sie hatte sich viermal umgezogen. Sollte sie sich einfach kleiden? Oder festlich? Sie besaß ein Yves-Saint-Laurent-Kleid, das sie sich mühsam zusammengespart hatte. Wenn ich das trage, werden sie mich für überspannt halten. Und wenn ich eines von meinen billigen Fähnchen anziehe, werden sie glauben, ihr Sohn heiratet unter seinem Niveau. Ach, was soll’s – das glauben sie sowieso, dachte Tracy. So entschied sie sich schließlich für einen schlichten grauen Wollrock und eine weiße Seidenbluse. Als einzigen Schmuck wählte sie die dünne goldene Halskette, die sie von ihrer Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte.
Ein Butler in Livree öffnete ihr die Tür. »Guten Abend, Miss Whitney.« Der Butler weiß, wie ich heiße. Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? »Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen?«
Der Butler führte Tracy durch eine marmorne Eingangshalle, die ihr zweimal so groß vorkam wie die ganze Bank. O Gott, dachte sie in plötzlicher Panik. Ich bin falsch angezogen! Ich hätte doch das Yves-Saint-Laurent-Kleid nehmen sollen. Als sie in die Bibliothek trat, spürte sie, wie sich eine Laufmasche an der Ferse ihrer Strumpfhose löste. Und dann stand sie Charles’ Eltern gegenüber.
Charles Stanhope Senior war fünfundsechzig oder sechsundsechzig. Er sah streng aus. Und wie der Erfolgsmensch überhaupt. Wenn man ihn betrachtete, wusste man, wie sein Sohn in dreißig Jahren aussehen würde. Er hatte braune Augen wie Charles, ein energisches Kinn und schüttere weiße Haare. Tracy mochte ihn sofort. Das war der ideale Großvater für ihr Kind.
Charles’ Mutter wirkte beeindruckend. Sie war ziemlich klein und mollig, aber sie hatte etwas Königliches an sich. Sie sieht solid und zuverlässig aus, dachte Tracy. Sicher eine wunderbare Großmutter!
Mrs. Stanhope streckte Tracy die Hand entgegen. »Wie nett von Ihnen, meine Liebe, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir haben Charles gebeten, ein paar Minuten mit Ihnen alleine sprechen zu dürfen. Sie haben doch nichts dagegen?«
»Natürlich hat sie nichts dagegen«, sagte Charles’ Vater. »Nehmen Sie Platz … Tracy, ja?«
»Ja, Sir.«
Charles’ Eltern setzten sich auf eine Couch ihr gegenüber. Warum habe ich das Gefühl, ich müsste gleich ein Verhör über mich ergehen lassen? Tracy hatte die Stimme ihrer Mutter im Ohr: Gott lädt dir nie mehr auf, als du tragen kannst, Kind. Du musst es schrittweise angehen, eins nach dem andern.
Tracys erster Schritt war ein dünnes Lächeln, das ihr völlig schief geriet, weil sie im selben Moment spürte, wie die Laufmasche in ihrer Strumpfhose zum Knie hinaufwanderte.
»Also!« Mr. Stanhopes Stimme klang jovial. »Sie und Charles wollen heiraten.«
Das Wort wollen beunruhigte Tracy. Charles hatte seinen Eltern doch sicher gesagt, dass sie auf jeden Fall heiraten würden. »Ja«, sagte Tracy.
Mrs. Stanhope räusperte sich. »Besonders lange kennen Sie und Charles sich eigentlich nicht, oder?«
Tracy empfand einen leisen Groll und kämpfte dagegen an. Ich hatte recht. Es wird tatsächlich ein Verhör.
»Lange genug, um zu wissen, dass wir uns lieben, Mrs. Stanhope.«
»Lieben?« murmelte Mr. Stanhope.
Mrs. Stanhope hob ihre Augenbrauen. »Um ganz ehrlich zu sein, Miss Whitney – Charles’ Ankündigung hat uns doch etwas schockiert.« Sie lächelte milde. »Charles hat Ihnen gewiss von Charlotte erzählt?« Sie sah Tracys fragenden Gesichtsausdruck. »Also nicht. Charlotte und er sind gemeinsam aufgewachsen. Sie waren immer sehr vertraut miteinander, und – nun ja, eigentlich haben alle erwartet, dass sie sich dieses Jahr verloben würden.«
Es war nicht nötig, Charlotte zu beschreiben. Tracy hätte ein Bild von ihr malen können. Wohnte in der Nachbarvilla. Reich. Derselbe soziale Hintergrund wie Charles. Eliteschulen. Eliteuniversitäten. Liebte Pferde und gewann Pokale.
»Erzählen Sie uns von Ihrer Familie«, schlug Mr. Stanhope vor.
Mein Gott, das ist wie eine Szene aus einem alten Film, dachte Tracy wütend. Ich bin Rita Hayworth und begegne Cary Grants Eltern zum ersten Mal. Ich brauche einen Drink. In den alten Filmen kam immer als letzte Rettung der Butler mit Drinks.
»Wo sind Sie her, meine Liebe?« erkundigte sich Mrs. Stanhope.
»Aus Louisiana. Mein Vater war Automechaniker.« Dieser Zusatz wäre nicht nötig gewesen, aber Tracy konnte der Versuchung nicht widerstehen. Zum Teufel mit diesem aufgeblasenen Paar. Sie war stolz auf ihren Vater.
»Automechaniker?« Charles’ Eltern starrten sie an.
»Ja. Er hat eine kleine Fabrik in New Orleans aufgemacht und sie mit der Zeit zu einem recht stattlichen Betrieb ausgebaut. Als er vor fünf Jahren starb, hat meine Mutter die Firma übernommen.«
»Und was stellt diese … äh … Firma her?«
»Auspufftöpfe und anderes Autozubehör.«
Mr. und Mrs. Stanhope tauschten einen bedeutungsvollen Blick und sagten wie aus einem Munde: »Aha!«
Ihr Ton ließ Tracy erstarren. Wie lang es wohl dauern wird, bis ich die beiden mag? fragte sie sich. Sie blickte in die zwei teilnahmslosen Gesichter ihr gegenüber und begann zu ihrem eigenen Entsetzen aufs Geratewohl draufloszuplappern. »Meine Mutter wird Ihnen bestimmt gefallen. Sie ist schön und intelligent und sehr charmant. Sie kommt auch aus dem Süden. Sie ist sehr klein, ungefähr so groß wie Sie, Mrs. Stanhope …« Das Schweigen war derart drückend, dass Tracy verstummte. Dann gab sie ein kleines, albernes Gelächter von sich und verstummte abermals unter Mrs. Stanhopes starrem Blick.
Schließlich sagte Mr. Stanhope ausdruckslos: »Wie uns Charles mitteilt, sind Sie schwanger.«
Oh, wie sehnlich wünschte sich Tracy, er hätte es ihnen nicht mitgeteilt! Sie waren so ablehnend! Als hätte ihr Sohn überhaupt nichts damit zu tun, als wäre es ein Makel, schwanger zu sein. Jetzt weiß ich, was ich hätte tragen sollen, dachte Tracy. Ein Büßerhemd.
»Ich verstehe nicht, wie man heutzutage …«, begann Mrs. Stanhope. Aber sie brachte den Satz nicht zu Ende, weil in diesem Moment Charles in die Bibliothek trat. Tracy war in ihrem ganzen Leben noch nie so froh gewesen, jemanden zu sehen.
»Na?« fragte Charles strahlend. »Wie kommt ihr miteinander aus?«
Tracy stand auf und eilte in seine Arme. »Gut, Liebling.« Sie drückte ihn an sich und dachte: Gott sei Dank, dass Charles nicht so ist wie seine Eltern. So könnte er einfach nicht sein. Er ist nicht engstirnig und snobistisch und kalt.
Hinter Tracy und Charles wurde ein diskretes Hüsteln vernehmbar, und da stand der Butler mit den Drinks. Es wird alles gut ausgehen, sagte sich Tracy. Dieser Film hat ein Happy-End.
Das Essen schmeckte vorzüglich, aber Tracy war so nervös, dass sie keinen Bissen hinunterbrachte. Das Tischgespräch drehte sich um Bankgeschäfte und Politik und die betrübliche Verfassung der Welt. Alles war sehr unpersönlich und höflich. Niemand sagte laut: »Sie haben unseren Sohn zur Ehe gezwungen.« Man muss fair sein, dachte Tracy. Sie haben natürlich das Recht, sich über die Frau Gedanken zu machen, die ihr Sohn heiratet. Eines Tages wird ihm die Firma gehören. Es ist wichtig, dass er die richtige Frau hat. Und Tracy schwor sich: Die wird er auch haben.
Charles nahm sacht die Hand, mit der Tracy unter dem Tisch an ihrer Serviette herumnestelte, lächelte und zwinkerte ihr aufmunternd zu. Ihr Herz machte einen Sprung.
»Tracy und mir wäre eine kleine Hochzeit am liebsten«, sagte Charles. »Und danach …«
Mrs. Stanhope fiel ihm ins Wort. »Unsinn. Eine kleine Hochzeit … das gibt es nicht in unserer Familie, Charles. Dutzende von Freunden und Bekannten werden erleben wollen, wie du heiratest.« Sie blickte Tracy an, betrachtete prüfend ihre Figur. »Vielleicht sollten wir die Einladungen zur Hochzeit schon in den nächsten Tagen losschicken.« Und dann fügte sie hinzu: »Das heißt, wenn es euch recht ist.«
»Ja. Natürlich ist uns das recht.« Also würde es doch eine Hochzeit geben. Warum hatte ich auch nur den Schatten eines Zweifels daran?
»Einige Gäste werden aus dem Ausland anreisen«, fuhr Mrs. Stanhope fort. »Ich sorge dafür, dass sie hier im Haus untergebracht werden können.«
»Wisst ihr schon, wo ihr eure Flitterwochen verbringen wollt?« fragte Mr. Stanhope.
Charles lächelte und drückte Tracys Hand. »Das ist unser kleines Geheimnis, Vater.«
»Und wie lange sollen eure Flitterwochen dauern?« wollte Mrs. Stanhope wissen.
»Etwa fünfzig Jahre«, antwortete Charles. Und Tracy liebte ihn dafür.
Nach dem Essen gingen sie in die Bibliothek, um einen Brandy zu trinken. Tracy sah sich in dem hübschen, alten, mit Eiche getäfelten Raum um: Regale mit ledergebundenen Büchern, zwei Corots, ein kleiner Copley und ein Reynolds. Es hätte ihr nichts ausgemacht, wenn Charles völlig unvermögend gewesen wäre, aber sie musste natürlich zugeben, dass ein Leben im Wohlstand sehr angenehm sein würde.
Kurz vor Mitternacht fuhr Charles sie zu ihrer kleinen Wohnung in der Nähe des Fairmount-Parks zurück.
»Hoffentlich war der Abend keine Strapaze für dich, Tracy. Meine Eltern können manchmal ein bisschen steif sein.«
»Ich fand sie reizend«, log Tracy.
Sie war erschöpft von der Anspannung der letzten Stunden, doch als sie mit Charles vor ihrer Wohnungstür stand, fragte sie: »Kommst du noch mit rein?« Er sollte sie jetzt in seinen Armen halten, sollte sagen: »Ich liebe dich. Kein Mensch auf der Welt wird uns je auseinanderbringen.«
Stattdessen sagte er: »Heute nicht mehr. Ich habe morgen viel zu tun.«
Tracy verbarg ihre Enttäuschung. »Natürlich, Liebling. Ich verstehe.«
»Ich rufe dich morgen an.« Er küsste sie flüchtig, wandte sich um und ging den Korridor entlang. Tracy sah ihm nach, bis er verschwunden war.
Die Wohnung stand in Flammen. Glocken klingelten hartnäckig und laut durch die Stille. Feueralarm. Tracy setzte sich schlaftrunken in ihrem Bett auf, schnupperte ins dunkle Zimmer. Roch es nach Rauch? Nein. Aber das Klingeln hörte nicht auf, und Tracy wurde klar, dass es das Telefon war. Ein Blick auf den Wecker: 2 Uhr 30. Charles ist etwas zugestoßen – das raste ihr als erster Gedanke durch den Kopf. In Panik griff sie nach dem Hörer.
Eine ferne Männerstimme fragte: »Tracy Whitney?«
Sie zögerte. Wenn es ein obszöner Anruf war … »Wer ist am Apparat?«
»Lieutenant Miller vom New Orleans Police Department. Spreche ich mit Tracy Whitney?«
»Ja.« Tracy bekam Herzklopfen.
»Ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie.«
Tracy krampfte die Hand um den Hörer.
»Es geht um Ihre Mutter.«
»Hatte sie einen Unfall?«
»Sie ist tot, Miss Whitney.«
»Nein!« schrie Tracy. Das war ein obszöner Anruf. Irgendein Irrer versuchte, ihr Angst zu machen. Es war alles in Ordnung mit ihrer Mutter. Ihre Mutter lebte. Ich habe dich sehr, sehr lieb, Tracy.
»Ich bedaure außerordentlich, Ihnen das auf diesem Wege mitteilen zu müssen.«
Es war Wirklichkeit. Ein Alptraum. Aber es geschah tatsächlich. Tracy konnte nicht sprechen, war wie gelähmt.
Und wieder die Männerstimme: »Hallo? Miss Whitney? Hallo?«
»Ich komme mit der ersten Maschine.«
Tracy saß in der winzigen Küche ihrer Wohnung und dachte an ihre Mutter. Es konnte nicht sein, dass sie tot war. Sie war immer so lebenssprühend gewesen, so vital. Sie hatten eine so enge und liebevolle Beziehung gehabt. Seit ihrer Kindheit hatte Tracy mit allen Problemen zu ihrer Mutter kommen, mit ihr über die Schule, die Jungen und später über die Männer reden können. Nach dem Tod von Tracys Vater waren viele Leute, die die Firma kaufen wollten, an Doris Whitney herangetreten. Sie hatten ihr so viel Geld geboten, dass sie den Rest ihres Lebens gut davon hätte leben können. Aber sie hatte sich beharrlich geweigert, das Geschäft zu verkaufen. »Dein Vater hat diese Firma aufgebaut. Ich kann seine Lebensarbeit nicht einfach verschleudern.« Und sie hatte dafür gesorgt, dass das Geschäft blühte.
Ach, Mutter, dachte Tracy. Ich liebe dich so sehr. Du wirst Charles nie kennenlernen. Du wirst dein Enkelkind nie sehen. Und Tracy begann zu weinen.
Sie machte sich Kaffee und ließ ihn kalt werden, während sie im Dunkeln saß. Sie sehnte sich so sehr danach, Charles anzurufen, ihm zu sagen, was geschehen war, ihn an ihrer Seite zu haben. Aber ein Blick auf die Küchenuhr zeigte ihr, dass sie ihn jetzt nicht anrufen konnte, ohne ihn zu wecken. Und das wollte sie nicht; deshalb würde sie ihn aus New Orleans anrufen. Sie fragte sich, ob der Tod ihrer Mutter einen negativen Einfluss auf die Heiratspläne haben würde, und sofort hatte sie Schuldgefühle. Wie konnte sie jetzt nur an sich denken? Lieutenant Miller hatte gesagt: »Wenn Sie hier sind, kommen Sie bitte zur Polizeidirektion.« Warum zur Polizeidirektion? Was war passiert?
Tracy stand im überfüllten Empfangsgebäude des Flughafens von New Orleans und wartete inmitten ungeduldiger Passagiere, die stießen und drängelten, auf ihren Koffer. Sie hatte das Gefühl zu ersticken und bemühte sich, näher an das Band mit dem Gepäck heranzukommen, aber niemand ließ sie durch. Nervosität stieg in ihr auf, und sie fürchtete sich vor dem, was ihr bevorstand. Sie versuchte sich einzureden, das sei alles nur ein Missverständnis, doch die Worte von Lieutenant Miller hallten wieder und wieder in ihr nach: Ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie … Sie ist tot, Miss Whitney … Ich bedaure außerordentlich, Ihnen das auf diesem Wege mitteilen zu müssen …
Als Tracy endlich ihren Koffer in der Hand hielt, stieg sie in ein Taxi und nannte die Adresse, die Lieutenant Miller ihr genannt hatte: »South Broad Street 715, bitte.«
Der Fahrer grinste sie im Rückspiegel an. »Zu den Bullen, wie?«
Kein Gespräch. Nicht jetzt. In Tracys Kopf war alles in Aufruhr, aber der Fahrer plauderte während der Fahrt munter weiter: »Hat Sie die große Show hierher geführt, Miss?«
Tracy hatte keine Ahnung, wovon er redete, aber sie dachte: Nein. Mich hat der Tod hierher geführt. Sie hörte die Stimme des Fahrers, doch sie nahm seine Worte nicht wahr. Sie saß starr im Fond und war blind für die vertraute Umgebung, die an ihr vorbeizog. Erst als sie sich dem French Quarter näherten, bemerkte Tracy den wachsenden Lärm. Es war das Getöse eines verrückt gewordenen Pöbelhaufens; Randalierer brüllten eine alte, wilde Litanei.
»Weiter kann ich Sie nicht bringen«, meinte der Fahrer.
Und dann blickte Tracy auf und sah es. Es war ein unglaubliches Bild. Hunderttausende von schreienden Menschen, die Masken trugen, als Drachen und Alligatoren und heidnische Götter verkleidet waren, füllten die Straßen und Bürgersteige. Der Lärm war ohrenbetäubend.
»Steigen Sie aus, bevor die mir mein Taxi umkippen«, befahl der Fahrer. »Dieser gottverdammte Karneval.«
Natürlich, wie hatte sie es vergessen können. Es war Februar, und die ganze Stadt stürzte sich in den Faschingstrubel. Tracy stieg aus, stand mit dem Koffer in der Hand am Bordstein und wurde im nächsten Moment hineingerissen in die lärmende, tanzende Menge. Es war obszön, ein Hexensabbat! Eine Million Furien feierte den Tod ihrer Mutter! Der Koffer wurde Tracy aus der Hand gerissen und verschwand. Ein dicker Mann mit Teufelsmaske hielt sie fest und küsste sie, ein Hirsch drückte ihr die Brüste, ein Riesenpanda packte sie von hinten und hob sie hoch. Sie kämpfte sich frei, wollte davonrennen, aber es war unmöglich. Sie war eingekeilt, saß in der Falle, ein winziger Teil der ausufernden Festivitäten, schwamm mit in der johlenden Menge. Tränen strömten ihr übers Gesicht. Schließlich konnte sie sich doch losreißen und in eine ruhige Straße fliehen. Sie war dem Zusammenbruch nahe. Lange Zeit stand sie reglos da, gegen einen Laternenpfahl gelehnt, atmete tief und bekam sich allmählich wieder in die Gewalt. Dann machte sie sich auf den Weg zur Polizeidirektion.
Lieutenant Miller war ein Mann in mittleren Jahren. Er sah bekümmert aus, hatte ein von Wind und Wetter gegerbtes Gesicht und schien sich in seiner Rolle äußerst unwohl zu fühlen. »Tut mir leid, dass ich Sie nicht vom Flughafen abholen konnte«, sagte er zu Tracy, »aber die ganze Stadt ist zur Zeit übergeschnappt. Wir haben die Sachen Ihrer Mutter durchgesehen, und Sie waren die einzige, die wir anrufen konnten.«
»Bitte, Lieutenant, bitten sagen Sie mir, was … was meiner Mutter passiert ist.«
»Sie hat Selbstmord begangen.«
Ein kalter Schauer überlief Tracy. »Aber das ist doch unmöglich! Warum sollte sie sich umbringen? Sie hatte doch allen Grund zu leben!« Tracys Stimme klang verzweifelt.
»Sie hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Er ist an Sie gerichtet.«
Das Leichenschauhaus war kalt und neutral und erschreckend. Tracy wurde durch einen langen weißen Korridor in einen großen, sterilen Raum geführt.
Ein Mann im weißen Kittel schlenderte zur nächsten Wand, streckte die Hand nach einem Griff aus und zog eine überdimensionale Schublade auf. »Wollen Sie mal schauen?«
Nein! Ich mag den leeren, leblosen Körper nicht in diesem Kasten liegen sehen. Tracy wollte nur eines: fort. Ein paar Stunden zurück in die Vergangenheit, zurück zum Klingeln der Glocken. Und es soll ein richtiger Feueralarm sein, nicht das Telefon, nicht die Nachricht vom Tod meiner Mutter. Tracy bewegte sich langsam vorwärts. Jeder Schritt war ein stummer Schrei. Dann blickte sie auf die leblose Hülle nieder, die sie ausgetragen, gestillt und genährt, mit ihr gelacht und sie geliebt hatte. Sie beugte sich herab und küsste ihre Mutter auf die Wange, die kalt war und sich gummiartig anfühlte. »Oh, Mutter«, flüsterte Tracy. »Warum? Warum hast du das getan?«
Der kurze Abschiedsbrief, den Doris Whitney hinterlassen hatte, gab keine Antwort auf diese Frage..
Liebe Tracy,
bitte verzeih mir. Ich bin gescheitert, und ich hätte es nicht ertragen,Dir zur Last zu fallen. Es ist besser so. Ich liebe Dich.
Deine Mutter
Die Zeilen waren so leblos und leer wie der Körper in der Schublade.
Am Nachmittag traf Tracy alle Vorbereitungen für die Beerdigung und fuhr dann mit dem Taxi zum Haus der Familie Whitney. In der Ferne hörte sie den Lärm der ausgelassenen, ihren Karneval feiernden Menge.
Das Haus der Whitneys stammte aus dem 19. Jahrhundert und war, wie die meisten Wohnhäuser in New Orleans, in Holzbauweise errichtet und nicht unterkellert. Hier in diesem Haus war Tracy aufgewachsen, und es barg behagliche Erinnerungen.
Sie war seit einem Jahr nicht mehr hier gewesen, und als das Taxi vor dem Haus hielt, sah sie schockiert das große Schild auf dem Rasen: ZU VERKAUFEN. Darunter der Name einer Immobilienfirma. Nein, das war unmöglich. Dieses Haus werde ich nie verkaufen, hatte Tracys Mutter oft gesagt. Wir waren hier alle so glücklich.
Von seltsamer Furcht erfüllt, ging Tracy an der großen Magnolie vorbei zur Vordertür. In der siebten Klasse hatte sie ihren eigenen Hausschlüssel bekommen, den sie seitdem stets bei sich trug – als Talisman, als Erinnerung an jenen Ort der Geborgenheit, an den sie jederzeit zurückkehren konnte.
Sie sperrte die Tür auf, trat ein und blieb wie betäubt stehen. Die Zimmer waren völlig kahl, die schönen alten Möbel fort. Tracy lief von Raum zu Raum. Sie konnte es nicht fassen. Es war, als sei eine Katastrophe über das Haus hereingebrochen. Tracy eilte in den ersten Stock und stand in der Tür zu dem Zimmer, in dem sie die meiste Zeit ihres Lebens gewohnt hatte. Kalt und leer starrte es sie an. O Gott, was ist geschehen? Tracy hörte die Türglocke und stieg wie in Trance die Treppe hinunter, um zu öffnen.
Otto Schmidt stand vor ihr, der Werkmeister der Whitney Automotive Parts Company. Er war weit über sechzig, hatte ein runzliges Gesicht und einen, abgesehen vom Bierbauch, zaundürren Körper. Ein Kranz von widerspenstigen grauen Haaren säumte seinen nackten Schädel.
»Tracy«, sagte er. »Ich habe es eben erfahren. Ich … ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das tut.«
Tracy drückte ihm beide Hände. »Ach, Otto. Ich bin so froh, Sie zu sehen. Kommen Sie herein.« Sie führte ihn in das leere Wohnzimmer. »Tut mir leid, dass man hier nirgendwo sitzen kann«, entschuldigte sie sich. »Wir müssen uns auf den Boden setzen. Macht es Ihnen was?«
»Nein, nein.«
Sie nahmen einander gegenüber Platz, die Augen verschleiert vor Kummer. Otto war schon jahrelang bei der Firma, und Tracy wusste, wie sehr sich ihr Vater auf ihn verlassen hatte. Als ihre Mutter die Firma übernommen hatte, war Schmidt geblieben und ihr bei der Leitung des Geschäfts zur Hand gegangen.
»Otto, ich verstehe das alles nicht. Die Polizei sagt, meine Mutter hat Selbstmord begangen. Aber Sie wissen ja, dass sie keinen Grund hatte, sich umzubringen.« Plötzlich durchzuckte sie ein entsetzlicher Gedanke. »Sie war doch nicht krank, oder? Sie hatte keine furchtbare …«
»Nein, das nicht.« Otto Schmidt schaute betreten weg. In seinen Worten schwang irgendetwas Unausgesprochenes mit.
Langsam sagte Tracy: »Sie wissen, woran es lag.«
Er blickte sie aus feuchten blauen Augen an. »Ihre Mutter hat Ihnen nicht erzählt, was hier in letzter Zeit passiert ist. Sie wollte nicht, dass Sie sich Sorgen machen.«
Tracy runzelte die Stirn. »Sorgen? Warum? Sprechen Sie weiter … bitte.«
Er öffnete die schwieligen Hände und schloss sie wieder. »Ist Ihnen der Name Joe Romano ein Begriff?«
»Joe Romano? Nein. Warum?«
Otto Schmidt kniff die Augen zusammen. »Vor sechs Monaten ist Romano an Ihre Mutter herangetreten. Er wollte die Firma kaufen. Sie hat abgewinkt, aber er hat ihr das Zehnfache von dem geboten, was das Geschäft wirklich wert ist, und da konnte sie nicht widerstehen. Sie war so aufgeregt. Sie wollte das ganze Geld in Wertpapieren anlegen. Die hätten so viel Zinsen gebracht, dass Sie beide den Rest Ihres Lebens gut davon hätten leben können. Sie wollte Sie überraschen. Ich habe mich so sehr für Sie gefreut. Ich wollte mich eigentlich schon vor drei Jahren zur Ruhe setzen, aber ich konnte Mrs. Doris ja nicht einfach allein lassen, nicht wahr? Dieser Romano …«, Otto spie das Wort fast aus, »… dieser Romano hat eine kleine Anzahlung geleistet. Das große Geld sollte vorigen Monat kommen.«
»Ja, und weiter?« fragte Tracy ungeduldig. »Was ist passiert?«
»Als Romano die Firma übernommen hat, hat er allen gekündigt und seine Leute in den Betrieb gesetzt. Dann hat er die Firma systematisch ausgeplündert. Er hat das gesamte Inventar verkauft, eine Menge neue Maschinen bestellt und weiterverkauft, aber nicht dafür bezahlt. Die Lieferfirmen waren zunächst nicht beunruhigt. Sie haben gedacht, sie hätten es noch mit Ihrer Mutter zu tun. Als sie Ihre Mutter schließlich angemahnt haben, ist sie zu Romano gegangen und wollte wissen, was eigentlich los ist. Romano hat gesagt, er wäre nun doch nicht interessiert, und sie könnte die Firma wiederhaben. Aber inzwischen war die Firma nichts mehr wert. Und Ihre Mutter hatte außerdem eine halbe Million Dollar Schulden, die sie nicht bezahlen konnte. Tracy – meine Frau und ich haben mitverfolgt, wie Ihre Mutter gekämpft hat, und es hat uns fast umgebracht. Sie hat mit allen Mitteln versucht, die Firma zu retten. Es ging nicht. Sie musste Konkurs anmelden. Und sie haben ihr alles genommen: das Geschäft, dieses Haus, sogar ihr Auto.«
»O Gott!«
»Es geht noch weiter. Der Staatsanwalt hat Ihrer Mutter mitgeteilt, dass er gegen sie Anklage erheben will wegen Betrugs und dass sie mit einer Gefängnisstrafe zu rechnen hat.«
Tracy kochte vor hilfloser Wut. »Aber sie hätte den Leuten doch bloß die Wahrheit sagen müssen! Sie hätte ihnen nur erklären müssen, was dieser Romano mit ihr gemacht hat!«
Der alte Werkmeister schüttelte den Kopf. »Joe Romano arbeitet für einen Mann namens Anthony Orsatti. Und Orsatti hat das Sagen in New Orleans. Ich habe zu spät herausgefunden, dass Romano dasselbe auch schon mit anderen Firmen gemacht hat. Wenn Ihre Mutter ihn verklagt hätte, hätte es Jahre gedauert, bis alles geklärt gewesen wäre. Und dafür hatte sie nicht das nötige Geld.«
»Warum hat sie mir nichts gesagt?« Es war ein Aufschrei des Schmerzes, ein Aufschrei um den Schmerz ihrer Mutter.
»Mrs. Doris war eine stolze Frau. Und was will man machen? Man kann nichts machen.«
Da irrst du dich, dachte Tracy erbost. »Ich will mit Joe Romano reden. Wo wohnt er?«
3
Sie brauchte Zeit. Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Planen. Sie konnte das leergeräumte Haus nicht ertragen. Also zog sie in ein kleines Hotel in der Magazine Street, weit entfernt vom French Quarter, wo immer noch wild gefeiert wurde. Sie hatte kein Gepäck, und der misstrauische Mann am Empfang sagte: »Sie müssen im voraus zahlen. Vierzig Dollar pro Nacht.«
Tracy rief von ihrem Zimmer aus Clarence Desmond an und teilte ihm mit, sie werde einige Tage nicht zur Arbeit kommen können.
Er kaschierte seinen Ärger über die Störung. »Da machen Sie sich nur keine Gedanken«, sagte er. »Wir finden schon jemand, der für Sie einspringt.« Er hoffte, dass sie nicht vergessen würde, Charles Stanhope zu erzählen, wie verständnisvoll er gewesen war.
Dann führte Tracy ein Telefonat mit Charles. »Charles, Liebling …«
»Wo steckst du bloß, Tracy? Meine Mutter hat den ganzen Vormittag versucht, dich zu erreichen. Sie wollte heute mit dir zu Mittag essen. Ihr müsst etliche Dinge besprechen.«
»Tut mir leid, Liebling. Ich bin in New Orleans.«
»Wo bist du? In New Orleans? Was machst du denn da?«
»Meine Mutter ist … gestorben.« Die Worte blieben Tracy fast im Hals stecken.
»Oh, das tut mir leid, Tracy. Es ist ganz plötzlich gekommen, nicht? Sie war doch noch ziemlich jung?«
Sie war noch sehr jung, dachte Tracy trübsinnig. »Ja«, antwortete sie. »Sie war noch ziemlich jung.«
»Was ist passiert? Und wie geht es dir?«
Tracy konnte sich nicht dazu überwinden, Charles zu erzählen, dass ihre Mutter Selbstmord begangen hatte. Am liebsten hätte sie die ganze entsetzliche Geschichte herausgeschrien. Was man ihrer Mutter angetan, wie man sie in den Tod getrieben hatte. Aber sie hielt sich zurück. Das ist mein Problem, dachte sie. Ich darf Charles nicht damit belasten. »Keine Bange«, sagte sie, »mir geht es gut, Liebling.«
»Soll ich kommen, Tracy?«
»Nein, danke. Ich schaffe das schon. Morgen ist die Beerdigung, und am Montag bin ich wieder in Philadelphia.«
Am späten Nachmittag verließ Tracy das Hotel. Sie ging die Canal Street entlang, bis sie zu einem Pfandhaus kam. Ein müder Mann mit altmodischem grünem Augenschirm saß hinter dem vergitterten Tresen.
»Kann ich was für Sie tun?«
»Ich … ich möchte eine Waffe kaufen.«
»Was für eine?«
»Äh … einen Revolver.«
»Wollen Sie einen 32er, einen 45er, einen …«
Tracy hatte noch nie in ihrem Leben eine Waffe in der Hand gehabt. »Einen … einen 32er. Der tut’s wohl.«
»Ich habe einen schönen Smith & Wesson für 229 Dollar oder einen Charter Arms für 159 Dollar …«
Tracy hatte nicht soviel Geld bei sich. »Etwas Billigeres haben Sie nicht?«
Der Mann zuckte die Achseln. »Billiger ist nur noch ’ne Schleuder, Lady. Aber weil Sie’s sind, kriegen Sie von mir einen 32er für 150 Dollar. Und eine Schachtel Munition gratis dazu.«
»Gut.« Tracy beobachtete, wie der Mann zu einem Tisch voll Waffen ging und einen Revolver aussuchte. Er trug ihn zum Tresen. »Wissen Sie, wie man so ein Ding bedient?«
»Man … man drückt einfach ab.«
Der Mann gab einen Grunzlaut von sich. »Soll ich Ihnen zeigen, wie man ihn lädt?«
Tracy wollte sagen, das sei nicht nötig, sie habe nicht vor, Gebrauch von der Waffe zu machen, sie wolle nur jemanden erschrecken. Aber dann würde ihr klar, wie läppisch das klingen würde. Und so bat sie den Mann, es ihr zu zeigen. Sie sah zu; wie er die Patronen in die Trommel steckte, öffnete dann ihre Handtasche und legte die 150 Dollar auf den Tresen.
»Ich brauche noch Ihren Namen und Ihre Adresse für das Polizeiregister.«
Daran hatte Tracy nicht gedacht. Es war eine strafbare Handlung, Joe Romano mit der Waffe zu bedrohen. Aber er ist der Kriminelle, nicht ich.
Der Mann blickte Tracy fragend an. Der grüne Schirm ließ seine Augen gelb erscheinen. »Name?«
»Smith. Joan Smith.«
Er notierte es auf einer Empfangsbescheinigung. »Adresse?«
»Dowman Road. Dowman Road 3020.«
Ohne aufzublicken, sagte der Mann: »Die Hausnummer gibt’s nicht. Das wäre mitten im Mississippi. Machen wir 1520 daraus.« Er schob ihr die Empfangsbescheinigung zu.
Sie unterschrieb und fragte: »Das war’s?«
»Ja, das war’s.« Der Mann reichte Tracy behutsam den Revolver durch das Gitter. Sie starrte wie gebannt auf die Waffe, nahm sie dann entgegen, verstaute sie in ihrer Handtasche, drehte sich um und eilte aus dem Pfandhaus.
»He, Lady!« rief ihr der Mann nach. »Vergessen Sie nicht, dass das Ding geladen ist!«
Am Jackson Square, der im Herzen des French Quarter lag, schirmten Hecken und schöne Magnolien die gepflegten alten Häuser vor dem brausenden Verkehr ab. In einem dieser Häuser wohnte Joe Romano.
Tracy wartete, bis es dunkel war, und machte sich dann auf den Weg. Der Karnevalszug hatte sich zur Chartres Street weitergewälzt, und Tracy hörte von fern den Widerhall des Tumults, in den sie am Vormittag geraten war.
Sie stand im Schatten, betrachtete Joe Romanos Haus, spürte das Gewicht der Waffe in ihrer Handtasche. Ihr Plan war einfach. Sie würde ruhig und vernünftig mit Joe Romano reden. Sie würde ihn bitten, die Schande vom Namen ihrer Mutter zu tilgen. Wenn er sich weigerte, würde sie ihn mit dem Revolver bedrohen und ihn zwingen, ein schriftliches Geständnis niederzulegen. Dieses Geständnis würde sie Lieutenant Miller bringen; er konnte dann Romano verhaften. Womit die Ehre ihrer Mutter wiederhergestellt war. Tracy wünschte sich sehnlich, dass Charles bei ihr wäre. Doch es war wohl besser, das allein zu tun. Charles durfte nicht in die Sache hineingezogen werden. Sie würde ihm davon berichten, wenn alles vorbei war und Joe Romano hinter Schloss und Riegel saß.
Ein Fußgänger näherte sich. Tracy wartete, bis er verschwunden war und die Straße verlassen dalag. Dann lief sie zur Haustür und drückte die Klingel. Keine Reaktion. Wahrscheinlich ist er auf einer Faschingsparty, dachte Tracy. Aber ich kann warten. Ich kann warten, bis er nach Hause kommt. Plötzlich ging das Licht auf der Veranda an. Die Tür öffnete sich, und ein Mann stand vor Tracy. Sein Aussehen verblüffte sie. Sie hatte sich eine üble Gestalt vorgestellt, eine Gangstervisage. Stattdessen hatte sie einen attraktiven, kultiviert wirkenden Mann vor sich, den man ohne weiteres für einen Professor hätte halten können. Seine Stimme war leise und freundlich. »Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Sind Sie Joseph Romano?« fragte Tracy unsicher.
»Ja. Was kann ich für Sie tun?« Er hatte eine angenehme, verbindliche Art. Kein Wunder, dass sich meine Mutter von ihm hat blenden lassen, dachte Tracy.
»Ich … ich würde gern mit Ihnen reden, Mr. Romano.«
Er warf einen prüfenden Blick auf ihre Figur. »Bitte, kommen Sie herein.«
Tracy trat in ein Wohnzimmer voll schöner antiker Möbel. Joseph Romano führte ein gutes Leben. Mit dem Geld meiner Mutter, dachte Tracy erbittert.
»Ich wollte mir gerade einen Drink machen. Mögen Sie auch einen?«
»Nein, danke.«
Er betrachtete sie neugierig. »Weshalb wollten Sie mich sprechen, Miss …«
»Tracy Whitney. Ich bin Doris Whitneys Tochter.«
Er schaute sie einen Moment völlig verständnislos an. Dann begriff er. »Ach ja. Ich hab’s gehört. Das mit Ihrer Mutter, meine ich. Zu dumm.«
Zu dumm! Er trug die Schuld am Tod ihrer Mutter, und sein einziger Kommentar war: »Zu dumm.«
»Mr. Romano, der Staatsanwalt glaubt, dass meine Mutter eine Betrügerin war. Sie wissen, das stimmt nicht. Ich möchte, dass Sie mir helfen, meine Mutter von diesem Verdacht zu entlasten.«
Er lachte. »Im Karneval rede ich nie übers Geschäft. Das verbietet mir meine Religion.« Romano ging zur Bar und mixte zwei Drinks. »Ich glaube, Sie fühlen sich besser, wenn Sie einen Schluck getrunken haben.«
Er ließ ihr keine andere Wahl. Tracy öffnete ihre Handtasche, zog den Revolver heraus und zielte auf Romano. »Ich werde Ihnen sagen, wann ich mich besser fühle, Mr. Romano. Wenn Sie gestehen, was Sie meiner Mutter angetan haben.«
Joseph Romano drehte sich um und sah die Waffe. »Stecken Sie das Schießeisen lieber weg, Miss Whitney. Es könnte losgehen.«
»Es wird losgehen, wenn Sie nicht genau das tun, was ich Ihnen sage. Sie schreiben jetzt auf ein Blatt Papier, wie Sie die Firma ausgeplündert und bankrott gemacht haben. Und wie Sie meine Mutter zum Selbstmord getrieben haben.«
Romano beobachtete Tracy nun genau, einen wachsamen Ausdruck in den dunklen Augen. »Ich verstehe. Und was ist, wenn ich mich weigere?«
»Dann töte ich Sie.« Tracy spürte, wie der Revolver in ihrer Hand zitterte.
»Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie jemand kaltblütig töten, Miss Whitney.« Er ging langsam auf sie zu, einen Drink in der Hand. Seine Stimme klang sanft und einschmeichelnd. »Ich habe nichts mit dem Tod Ihrer Mutter zu tun. Glauben Sie mir, ich …« Er schüttete Tracy den Drink ins Gesicht.
Der Alkohol brannte Tracy in den Augen, und im nächsten Moment wurde ihr der Revolver aus der Hand geschlagen.
»Ihre Frau Mama hat mir was vorenthalten«, lächelte Joe Romano. »Sie hat mir nicht verraten, dass sie eine geile Tochter hat.«
Er packte Tracy bei den Armen. Sie konnte nichts sehen und hatte Angst. Verzweifelt versuchte sie, sich loszureißen, aber er stieß sie gegen die Wand, drückte sich an sie.
»Du hast Courage, Baby. Das gefällt mir. Es macht mich scharf.« Seine Stimme war heiser. Tracy spürte seinen Körper an ihrem. Sie wollte sich wegdrehen, aber er hatte sie so fest im Griff, dass sie hilflos war.
»Du hast ein kleines Abenteuer gesucht, wie? Bei Joe bist du da an der richtigen Adresse.«
Sie wollte schreien, aber es ging nicht. Sie konnte nur keuchen. »Lassen Sie mich los!«
Er riss ihr die Bluse auf. »He! Was für tolle Titten«, flüsterte er und kniff sie in die Brustwarzen. »Wehr dich, Baby«, sagte er leise. »Ich mag das.«
»Lassen Sie mich los!«
Er drückte fester zu, er zwang Tracy zu Boden.
»Du bist bestimmt noch nie von einem richtigen Mann gefickt worden«, grinste er. Jetzt war er über ihr. Sein Körper war schwer, und seine Hände wanderten an ihren Oberschenkeln empor. Tracy schlug blindlings um sich. Da berührten ihre Finger den Revolver, und sie griff danach.
Plötzlich gab es einen ohrenbetäubenden Knall.
Sie hörte Romanos Schrei und spürte, wie sich sein Griff lockerte. Durch rote Schleier vor den Augen sah sie mit kaltem Entsetzen, wie er von ihr abglitt und zu Boden sackte. »Du hast auf mich geschossen, du Miststück. Du hast auf mich geschossen …«
Tracy war wie gelähmt. Ihr wurde schlecht, und die Augen taten ihr höllisch weh. Sie rappelte sich mühsam hoch, wandte sich um, stolperte zu der Tür am anderen Ende des Raumes und stieß sie auf. Ein Badezimmer. Sie taumelte ans Waschbecken, ließ kaltes Wasser einlaufen und nahm ein Augenbad, bis der Schmerz halbwegs erträglich war und sie wieder klar sehen konnte. Dann schaute sie in den Spiegel. Ihre Augen waren blutunterlaufen, ihr Blick flackerte unruhig. Mein Gott, ich habe eben einen Mann getötet. Sie rannte ins Wohnzimmer zurück.
Joe Romano lag auf dem Boden, und sein Blut färbte den weißen Teppich rot. Tracy stand mit leichenblassem Gesicht neben Romano. »Es tut mir leid«, stammelte sie verwirrt. »Ich wollte Sie nicht …«
»Einen Krankenwagen …« Romanos Atem ging stoßweise.
Tracy eilte zum Telefon, wählte und sprach mit erstickter Stimme in die Muschel. »Bitte schicken Sie sofort einen Krankenwagen.« Sie nannte Romanos Adresse. »Hier liegt ein Mann mit einer Schusswunde.«
Sie hängte ein und blickte auf Joe Romano nieder. Lieber Gott, betete sie, lass ihn nicht sterben. Du weißt, dass ich ihn nicht töten wollte. Sie kniete sich neben Romano, um festzustellen, ob er noch lebte. Er hatte die Augen geschlossen, aber er atmete noch. »Der Krankenwagen ist schon unterwegs«, sagte Tracy.
Dann floh sie.
Sie bemühte sich, nicht zu rennen, denn sie wollte kein Aufsehen erregen, zog deshalb auch ihre Jacke um sich, damit man die zerrissene Bluse nicht sah. Vier Straßen von Romanos Haus entfernt versuchte sie, ein Taxi zu kriegen. Sechs fuhren an ihr vorbei. Alle besetzt. Lauter glückliche, lachende Fahrgäste. Von fern hörte Tracy eine Sirene, und Sekunden später raste ein Krankenwagen an ihr vorbei, in die Richtung von Joe Romanos Haus. Ich muss schnell weg von hier, dachte Tracy. Zehn Meter vor ihr hielt ein Taxi am Bordstein. Die Fahrgäste stiegen aus. Tracy rannte auf das Taxi zu. »Sind Sie frei?«
»Kommt ganz drauf an. Wo wollen Sie hin?«
»Zum Flughafen.« Tracy hielt den Atem an.
»Steigen Sie ein.«
Auf dem Weg zum Flughafen dachte Tracy nach. Wenn der Krankenwagen zu spät gekommen war … wenn Joe Romano tot war … dann war sie eine Mörderin. Sie hatte den Revolver, der ihre Fingerabdrücke trug, nicht eingesteckt. Aber sie konnte der Polizei sagen, dass Romano versucht hatte, sie zu vergewaltigen, und dass die Waffe aus Versehen losgegangen war – nur würde ihr das niemand glauben. Sie hatte den Revolver gekauft, der neben Joe Romano auf dem Boden lag. Sie musste so rasch wie möglich fort aus New Orleans.
»Na, hat Ihnen der Karneval Spaß gemacht?« fragte der Fahrer.
Tracy schluckte. »Ich … ja.« Sie holte einen kleinen Spiegel aus ihrer Handtasche und richtete sich notdürftig her. Was für eine Dummheit von ihr, Romano zu einem Geständnis zwingen zu wollen. Alles war verkehrt gelaufen. Wie sage ich’s Charles? Sie wusste, er würde schockiert sein. Aber wenn sie ihm alles erklärt hatte, würde er sie verstehen. Und wissen, was zu tun war.
Als Tracy das Empfangsgebäude des New Orleans International Airport betrat, schien ihr, dass alle Leute sie vorwurfsvoll anstarrten. Das macht mein schlechtes Gewissen, dachte sie. Wenn sie nur in Erfahrung hätte bringen können, wie es Joe Romano ging! Aber sie hatte keine Ahnung, in welches Krankenhaus er eingeliefert worden war und an wen sie sich wenden konnte. Er wird es überleben. Charles und ich werden zu Mutters Beerdigung nach New Orleans zurückfliegen, und Joe Romano wird wieder gesund. Sie versuchte, das Bild des Mannes auf dem Boden aus ihren Gedanken zu verbannen, dessen Blut den weißen Teppich rot färbte. Sie musste nach Hause, sie musste zu Charles.
Tracy ging zum Schalter der Delta Airlines. »Ein Ticket für den nächsten Flug nach Philadelphia, bitte. Touristenklasse.«
Der Mann hinter dem Schalter zog seinen Computer zu Rat. »Flugnummer 304 … Sie haben Glück. Da ist noch ein Platz frei.«
»Wann startet die Maschine?«
»In zwanzig Minuten. Das schaffen Sie noch.«
Tracy langte in ihre Handtasche und fühlte eher, als dass sie es sah, wie zwei Polizisten neben sie traten. Der eine fragte: »Sind Sie Tracy Whitney?«
Ihr Herz hörte einen Moment auf zu schlagen. Es wäre albern zu leugnen, dass ich Tracy Whitney bin. »Ja …«
»Sie sind verhaftet.«
Und Tracy spürte, wie sich der kalte Stahl von Handschellen um ihre Gelenke schloss.
Alles geschah in Zeitlupe. Alles geschah einer anderen Person. Tracy beobachtete, wie sie aus dem Empfangsgebäude geführt wurde. Passanten drehten sich um und gafften. Sie wurde in den Fond eines Streifenwagens gestoßen. Stahldraht trennte Vorder- und Rücksitz. Der Streifenwagen fuhr los. Blaulicht an, mit jaulenden Sirenen. Tracy machte sich klein, versuchte unsichtbar zu werden. Sie war eine Mörderin. Joe Romano war gestorben. Aber es war ein Versehen gewesen. Sie würde erklären, wie es passiert war. Sie mussten ihr glauben. Sie mussten.
Das Polizeirevier, auf das Tracy gebracht wurde, befand sich im Stadtteil Algiers, am Westufer des Mississippi. Es war ein düsterer, ja drohender Bau, der Hoffnungslosigkeit ausstrahlte. Die Wachstube war voll von schäbig aussehenden Typen: Prostituierte, Zuhälter, Diebe und ihre Opfer. Tracy wurde zum Schreibtisch des diensthabenden Sergeants geführt.
»Das ist die Whitney, Sergeant«, sagte einer der Polizisten, die sie verhaftet hatten. »Wir haben sie auf dem Flughafen erwischt. Sie wollte gerade abhauen.«
»Ich wollte nicht …«
»Nehmen Sie ihr die Handschellen ab.«
Die Fesseln verschwanden, und Tracy sagte: »Es war ein Versehen. Ich wollte ihn nicht töten. Er hat versucht, mich zu vergewaltigen, und …« Sie wurde der Hysterie in ihrer Stimme nicht Herr.
Der Sergeant fragte barsch: »Sind Sie Tracy Whitney?«
»Ja. Ich …«
»Abführen.«
»Nein! Einen Moment noch«, bat Tracy. »Ich muss jemand anrufen. Ich … ich habe das Recht, ein Telefongespräch zu führen.«
Der Sergeant brummte: »Sie kennen sich aus, oder? Wie oft waren Sie denn schon im Knast, Schätzchen?«
»Noch nie. Das ist …«
»Okay, Sie können ein Telefongespräch führen. Drei Minuten. Welche Nummer?«
Tracy war so nervös, dass ihr Charles’ Telefonnummer nicht einfiel. Sie konnte sich nicht einmal an die Vorwahl von Philadelphia erinnern. Zwei-fünf-eins? Nein.
Sie zitterte.
»Na, nun machen Sie schon. Ich hab nicht die ganze Nacht lang Zeit.«
Zwei-eins-fünf … Ja! »Zwei-eins-fünf-fünf-fünf-fünf-neundrei-null-eins.«
Der Sergeant wählte die Nummer und gab Tracy den Hörer. Es klingelte einmal, zweimal, endlos. Niemand hob ab. Aber Charles muss doch zu Hause sein!
»Ihre Zeit ist um«, sagte der Sergeant, streckte die Hand aus und wollte Tracy den Hörer abnehmen.
»Bitte, warten Sie!« rief Tracy verzweifelt. Und nun fiel ihr plötzlich wieder ein, dass Charles sein Telefon nachts abstellte, um nicht gestört zu werden. Sie hörte es unablässig klingeln und erkannte mit entsetzlicher Klarheit, dass sie ihn nicht erreichen konnte.
Der Sergeant fragte: »Sind Sie fertig?«
Tracy blickte ihn an und sagte dumpf: »Ja, ich bin fertig.«
Ein hemdsärmeliger Polizist führte sie in einen Raum, wo ihre Personalien aufgeschrieben und Fingerabdrücke gemacht wurden. Dann wurde sie einen Flur entlanggeführt und in eine Einzelzelle gesperrt.
»Das Hearing ist morgen früh«, brummte der Polizist. Dann ging er. Tracy war allein.
Das ist nicht wahr, dachte sie. Das ist nur ein furchtbarer Traum. O Gott, lass es bitte nicht Wirklichkeit sein.
Aber die stinkende Pritsche war Wirklichkeit und die Toilette ohne Brille war Wirklichkeit, und die Gitterstäbe auch.
Die Nachtstunden zogen sich endlos hin. Wenn ich Charles nur erreicht hätte. Sie brauchte ihn jetzt, wie sie noch nie jemanden gebraucht hatte. Ich hätte ihm alles anvertrauen sollen. Wenn ich ihm alles anvertraut hätte, wäre das nicht passiert.
Um 6 Uhr brachte ein gelangweilter Wärter das Frühstück: lauwarmen Kaffee und kalte Hafergrütze. Tracy kriegte nichts hinunter. Ihr Magen revoltierte. Um 9 Uhr wurde sie von einer Aufseherin geholt.
»Es geht los, Süße.« Die Aufseherin schloss die Zellentür auf.
»Ich muss ein Telefongespräch führen«, sagte Tracy. »Es ist sehr …«
»Später«, erwiderte die Aufseherin. »Sie wollen den Richter doch sicher nicht warten lassen. Der kann nämlich ganz schön fies werden.«