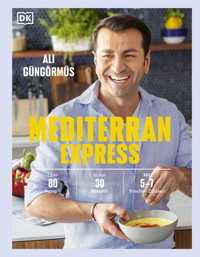9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Aufgewachsen in den anatolischen Bergen, mit zehn Jahren nach München gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen – und heute Sternekoch: Ali Güngörmüş' Lebensweg ist außergewöhnlich. Er kochte sich nach oben, gegen alle Widerstände. Mit Erfolg: Heute gehört er zu den bekanntesten Küchenchefs Deutschlands. In all den Jahren gab es immer wieder Gerichte, die für eine bestimmte Phase seines Lebens standen – die Lammfleischröllchen seiner Mutter oder der zünftige Schweinsbraten, den er in seiner Ausbildung kennen- und lieben lernte. Anhand dieser Gerichte erzählt Ali Güngörmüş von den entscheidenden Stationen seines bunten Lebens – sinnlich, sympathisch und sehr unterhaltsam.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Ähnliche
Ali Güngörmüş • Patricia Bröhm
Schau in die Sonne, schau in den Tag
Der Geschmack meines Lebens
Über dieses Buch
«Schau in die Sonne, schau in den Tag» – so lautet die wörtliche Übersetzung seines Familiennamens. Könnte es ein besseres Motto für das außergewöhnliche Leben eines der bekanntesten Küchenchefs Deutschlands geben?
Ali Güngörmüş: aufgewachsen in den anatolischen Bergen, mit zehn Jahren als Sohn eines Gastarbeiters nach München gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen – und heute Spitzenkoch. Er kochte sich nach oben, gegen alle Widerstände; in all den Jahren gab es immer wieder Gerichte, die ihn begleitet, begeistert, geprägt haben. Anhand dieser kulinarischen Meilensteine erzählt Ali Güngörmüş von den entscheidenden Stationen seines bunten Lebens – sinnlich, sympathisch und sehr unterhaltsam.
«Wir pfeifen darauf, ob Ali Güngörmüş nun Türke, Deutscher oder Klingone ist, Hauptsache, er bleibt, was er ist: ein großartiger Koch.»
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Vita
Ali Güngörmüş, geboren 1976 in Tunceli, Türkei, lebt seit 1986 in Deutschland. Nach Stationen bei Karl Ederer und im Tantris betrieb er in Hamburg das Le Canard Nouveau, das 2006 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. In München eröffnete er 2014 das Restaurant «Pageou», benannt nach seinem türkischen Heimatdorf. Ali Güngörmüş ist von Gault&Millau Deutschland 2016 zum Restaurateur des Jahres gewählt worden und regelmäßig im Fernsehen in Sendungen wie «Die Küchenschlacht» zu sehen.
Patricia Bröhm studierte Romanistik und Anglistik in der Schweiz und in England. Heute lebt sie als Autorin in München und schreibt über Kulinarik, Gastronomie, Wein und Reisen für die Süddeutsche Zeitung, den Feinschmecker und andere Publikationen. Seit 2012 ist sie Chefredakteurin des Restaurantführers Gault&Millau Deutschland.
Für meine Eltern und meine Kinder
Es ist später Abend in meinem Restaurant Pageou in München, weit nach Mitternacht, die letzten Gäste sind gegangen. Auch die Mitarbeiter haben sich schon verabschiedet. Erst jetzt beginnt mein Feierabend, der Moment, der ganz alleine mir gehört. Manchmal setze ich mich dann noch mit einem Glas Wein an den Tresen und hänge meinen Gedanken nach. Ich genieße die Stille der Nacht, nur ein paar Lampen erhellen den großen, hohen Raum. Ich betrachte das Foto meines Großvaters, das an einer Wand hängt. Es zeigt ihn vor seinem Lehmhaus, in unserem Heimatdorf Pageou in der Türkei, nach dem ich mein Restaurant benannt habe. Es ist ein altes Foto, die Qualität ist nicht berauschend, aber sein Anblick trifft mich jedes Mal mitten ins Herz. Es ist wie ein Symbol für den Weg, den ich gegangen bin – vom tiefsten Anatolien bis in dieses sehr urbane Restaurant in bester Münchner City-Lage. Mein Familienname Güngörmüş bedeutet auf Türkisch «Schau’ in die Sonne, schau’ in den Tag» – er ist wie ein Leitmotiv für mein Leben. Wenn mein Vater damals, in den 1960er Jahren, nicht den Optimismus und den Mut gehabt hätte, unser Dorf hinter sich zu lassen und ganz alleine, ohne seine Familie und ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen, dann säße ich heute nicht hier. Das Wissen darum erfüllt mich gleichzeitig mit Demut und mit Stolz. Meine Gedanken wandern zurück nach Pageou, wo meine Geschichte vor 42 Jahren begann ...
Granatapfel und Fladenbrot – Eine Kindheit wie vor 100 Jahren
Wenn ich an meine Kindheit denke, habe ich den Geschmack von reifen Feigen am Gaumen. Kaum kamen wir nachmittags aus der Schule, kletterten wir als Erstes auf die Feigenbäume hinter dem Haus und holten uns die prallen Früchte herunter. Wir wussten genau, wann sie am besten waren: wenn sie sich schon etwas weich anfühlten. Ganz vorsichtig öffneten wir sie und aßen das rote Fruchtfleisch heraus, das noch warm von der Sonne war. Dieser süße, saftige Feigengeschmack, den habe ich für immer in meinem Aromengedächtnis gespeichert. Oder die prallen, goldgelben Aprikosen, die meine Mutter auf Strohmatten in der Sonne trocknete. Und natürlich die grünen Mandeln, die wir mit den Zähnen öffneten, um zu dem köstlichen weißen Kern vorzustoßen, der war eine Delikatesse.
Wir haben gut gegessen als Kinder, obwohl wir kein Geld hatten, denn im Garten standen Obstbäume, an denen Granatäpfel, Maulbeeren und Renekloden wuchsen. Und jeden Morgen backte meine Mutter frisch Lavash, das türkische Fladenbrot aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Ganz einfach; den Teig wellte sie mit einem Holzstab dünn aus und backte dann das Brot in einer großen Pfanne über dem offenen Feuer. Das ofenwarme Brot war unser Frühstück. So einfach, so gut.
Ich glaube, dass ich Koch geworden bin, hat viel mit diesen Kinderjahren inmitten einer unberührten Natur voller intensiver Aromen zu tun. Geboren wurde ich am 15. Oktober 1976 in Pageou, einem winzigen Dorf im kurdischen Osten Anatoliens. Und wenn ich sage winzig, dann meine ich das so: Es waren nicht mehr als sechs oder acht Häuser, eine Art anatolisches Bullerbü. Sogar eine kleine Kapelle gab es in Pageou, weil in der Region früher Armenier lebten, die überwiegend Christen sind. Die Landschaft, in der anatolisches Hochland, Obermesopotamien und die Berge am Schwarzen Meer zusammentreffen, erinnert fast ein bisschen an Tirol, mit tiefen Tälern und hohen Bergen. Wenn man sich das auf der Landkarte ansieht, dann lagen für uns damals Syrien, Irak, Iran, Armenien und Georgien näher als das 800 Kilometer entfernte Ankara oder gar Istanbul.
Wir lebten, wie man so sagt, in einfachsten Verhältnissen. Die Häuser waren aus Lehm errichtet, es gab keine Ziegeldächer, die Gebäude waren oben einfach flach. Im Winter, wenn es viel schneite, war das ein Problem – und es gab Winter, da lag der Schnee zwei Meter hoch. Wir mussten aufs Dach steigen und den Schnee wegschippen, damit die Decke unter der Last nicht einbrach. Wir hatten weder Heizung noch fließendes Wasser, mussten mit Holz einheizen, in jedem Zimmer stand ein Ofen. Schon im September begannen wir, Holz einzulagern, und sobald es kalt wurde, saßen wir um die Öfen herum. Ich kann mich noch gut erinnern, wie eisig die Lehmböden sich im Winter anfühlten. Wir hielten auch Schafe und Ziegen; aus dem Fell machten die Frauen Decken, mit denen wir uns warm halten konnten, und aus der Wolle strickten sie Schals und Pullover.
Das Leben in Pageou war sehr friedlich, im Rhythmus der Jahreszeiten. Tunceli, die nächste größere Stadt und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, liegt auf 940 Meter Höhe, unser Dörfchen auf knapp 1000 Metern. In der Region herrscht ein ausgeprägtes Kontinentalklima mit sehr heißen Sommern, in denen das Thermometer bis zu 40 Grad steigt, und sehr kalten Wintern mit Temperaturen bis minus 10 Grad. Es war eine schöne Kindheit, aber wir lebten wie vor Hunderten von Jahren, als Selbstversorger. Wir hatten keinen Fernseher und keine Spielsachen, wir Kinder waren immer draußen, kletterten auf die Bäume und aßen im Sommer die Kirschen direkt vom Baum, die Brombeeren direkt vom Strauch. Wir spielten in den Feldern Verstecken und kauten den wilden Rhabarber, ich kann mich noch gut an diesen säuerlichen Geschmack erinnern, der mir die Mundwinkel zusammenzog. Manchmal pflückten wir uns junge Erbsen und pulten sie aus der Schote; ich mochte ihre feine Süße. In unserem Garten baute meine Mutter Gemüse an, Auberginen, Paprika, Tomaten, Gurken, Bohnen, Zwiebeln. Im Sommer, wenn alles im Überfluss reif war, trocknete sie Gemüse und Obst, für den Winter. Dafür waren die flachen Hausdächer sehr praktisch: Man legte große Tücher auf ihnen aus und ließ dort alles in der Sonne trocknen, Tomaten, Auberginen, Paprika, grüne Bohnen, Aprikosen, Äpfel, Walnüsse. Auch Granatäpfel ließen sich gut trocknen; die Schalen brach man dann später in Stücke und gab sie in den Tee oder ins Essen. Überhaupt tauchten viele der getrockneten Früchte in Gerichten wieder auf, zum Beispiel Quitten, die schmeckten toll im Lammragout.
Auf den Feldern bauten wir Weizen an, um daraus unser eigenes Brot zu backen. Und wir hielten Tiere, ein paar Kühe, Ziegen und Lämmer; mit ihnen lebten wir quasi unter einem Dach, unten war der Stall, darüber die Wohnräume. Besonders wertvoll waren die Kühe, weil meine Mutter aus der Milch auch Butter und Joghurt machte. Den Joghurt durften wir essen, die Butter aber wurde meistens verkauft, weil man damit ein wenig Geld verdienen konnte. Nur wenn mein Vater, der seit 1966 als Gastarbeiter in Deutschland lebte, nach Hause kam, gab es ein wenig Butter aufs Brot. Die Butter machte meine Mutter so, wie sie es von ihrer Mutter gelernt hatte: Die abgezogene Haut einer geschlachteten Ziege wurde unten zusammengebunden, sodass ein großer Beutel entstand. Dort hinein wurde die Milch gefüllt, das Ganze dann an einen hölzernen Stab gebunden, und meine Mutter schüttelte das Holz solange hin und her, bis die Butter geronnen war, eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem, wie viel Milch drin war. Wenn anschließend der Inhalt in ein Sieb geschüttet wurde, blieb die Butter im Sieb und die Molke floss durch. Und dann kam der Teil, der für uns Kinder am schönsten war: Unsere Mutter kochte die Molke auf und machte daraus für uns einen Käse, Çökelek. Eigentlich kein richtiger Käse, eher so eine Art Magerquark. Aber wir liebten es!
Wir hielten auch Hühner, die den ganzen Tag lang draußen herumpickten und sich Würmer und andere Leckerbissen aus dem Boden zogen. Die Eier wurden meistens verkauft, aber einmal in der Woche durfte jeder von uns ein Ei essen – so lernten wir von klein auf, den Wert solcher Lebensmittel zu schätzen. Und wenn zu einem besonderen Anlass einmal ein Huhn geschlachtet wurde und ausnahmsweise Fleisch auf den Tisch kam, war das ein richtiges Festmahl!
In unserem Haus in Pageou gab es keine Küche im üblichen Sinn, sondern nur eine offene Feuerstelle – was meine Mutter dort für uns Kinder zubereitete, war zwar einfach, aber immer frisch. Wir fanden es köstlich. Rote Bete zum Beispiel legte sie im Ganzen in die Asche und ließ sie dort garen. Wenn man sie dann pellte und aß, war das Aroma so intensiv, wie ich es später nie wieder erlebte. Auch der Kartoffelstampf «à la Pageou» ist für mich bis heute unerreicht: Die Kartoffeln, die wir Kinder aus der Erde buddelten, wurden gekocht, gepellt und in einem Topf mit unserer eigenen Butter, etwas Tomatenmark und angeschwitzten Zwiebeln vermischt. Das aßen wir mit Brot, ein echtes Leibgericht.
Es war das Lieblingsgericht meiner Kindheit, und wir nannten es «Feuerkartoffeln», weil meine Mutter (ihr Vorname ist Haskar) die Kartoffeln einfach in die Glut ihrer Kochstelle legte und sie dort garen ließ. Am Ende war die Schale schwarz verbrannt, und das Innere hatte feine Raucharomen angenommen. Das schmeckte köstlich! Wer im Sommer im Garten grillt, kann diese Methode übernehmen, ansonsten lassen sich die Kartoffeln natürlich auch in einem Topf kochen.
1 kg Kartoffeln (mehlig kochend)
2 weiße Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
2 EL Pinienkerne
1 EL Tomatenmark
Petersilie
Die Zwiebeln würfeln und in Butter langsam glasig dünsten, gehackten Knoblauch dazugeben. Pinienkerne und Tomatenmark dazugeben und alles rühren, bis sich das Tomatenmark aufgelöst hat. Die geschälten, gestampften Kartoffeln dazugeben und gut vermengen. Mit frischer Petersilie (im Winter getrocknete verwenden) würzen.
In Pageou saßen wir um die Feuerstelle herum und aßen die warmen Stampfkartoffeln mit Yufka-Brot (dünnes Fladenbrot, erhältlich in türkischen Lebensmittelläden) direkt aus dem Topf.
Dazu passt Ayran, der türkische Joghurtdrink: Türkischen Joghurt (10 % Fettanteil) mit Wasser verrühren, bis eine sämige Konsistenz entsteht. Salzen und zum Essen trinken.
Das Besondere am Essen meiner Kindheit war, dass alle Lebensmittel ganz natürlich und unverfälscht waren, sie hatten noch ihren ausgeprägten Eigengeschmack und waren nicht so «zurechtgezüchtet» wie heute. Chemie war ein Fremdwort, wir ernährten uns, ohne es zu wissen, hundertprozentig bio. Ich habe all diese Aromen noch am Gaumen und kann sie jederzeit abrufen. Das leistete mir in meiner Karriere oft wertvolle Dienste.
Was man damals nicht selbst erzeugen konnte, das besorgte man per Tauschgeschäft. Mein Opa zum Beispiel hatte eigenes Land und konnte Weizen anbauen. Den tauschte er in schlechten Jahren, wenn etwa ein Hagel die Obstbäume verwüstet hatte, gegen Obst oder Nüsse ein. Meine Mutter erzählt heute noch von einer Heuschreckenplage, die in einem Jahr die Felder so zerstörte, dass wir im Winter hungern mussten.
Alle vier Wochen ging ich mit meiner Mutter in die nächstgrößere Stadt, nach Tunceli, zum Markt. Heute ist Tunceli eine moderne Stadt mit fast 30000 Einwohnern. Damals, Anfang der 1980er Jahre, erschien sie mir, der ich nur Pageou kannte, riesig. Wir liehen das Pferd des Nachbarn aus, beluden es mit Butter, Eiern und manchmal auch Milch, und liefen mit ihm rund 15 Kilometer über die Berge nach Tunceli. Dort verkauften wir unsere Erzeugnisse an einen Lebensmittelhändler.
Ich bin das mittlere von sieben Kindern, ich habe drei ältere und drei jüngere Geschwister, wir sind alle etwa zwei Jahre auseinander. Meine Mutter hat früh geheiratet, sie war erst 15 Jahre alt, mein Vater sieben Jahre älter. Bis auf meinen jüngsten Bruder, der in München zur Welt kam, waren wir alle Hausgeburten, das war in Pageou normal. Die Frauen brachten ihr Kind zur Welt, und am nächsten Tag standen sie wieder auf dem Feld, mit dem Baby, das war damals so. Ein hartes Leben.
Einmal die Woche war Waschtag – für uns und für die Wäsche. Weil wir kein fließendes Wasser hatten, fand das alles an einem Brunnen statt, der etwas unterhalb des Hauses am Hang lag. Am Brunnen war eine Feuerstelle, sodass man das Wasser erwärmen konnte; dort wurden wir Kinder in einem großen Bottich von unserer Mutter geschrubbt. Sie wusch dort auch alle Wäsche: eine mühselige Arbeit, auch wenn wir sechs Kinder nicht viel Kleidung zum Wechseln besaßen.
Bei unserem Beschneidungsfest war ich der Jüngste (mit meinem Bruder Murat und unseren Cousins)
Wenn ich heute meine beiden Söhne sehe, ist es für mich schwer vorstellbar, dass wir damals keinerlei Spielsachen besaßen, nichts, keinen Teddybär, keine Puppen für meine Schwestern, keine Fahrräder, nichts. Manchmal bekamen wir von Verwandten einen Plastikball geschenkt, der aber nach zwei oder drei Tagen kaputt war. Meine Söhne werden heute zum Geburtstag von allen Seiten reich beschenkt – wir hingegen kannten so etwas überhaupt nicht. Meine erste Geburtstagsfeier fand in Deutschland statt, mit elf oder zwölf Jahren. Zur Feier des Tages wurde eine Tiefkühltorte von Dr. Oetker gekauft, aber Geschenke gab es auch damals nicht. Weil wir in Pageou nichts zum Spielen hatten, waren wir immer draußen und halfen auch mit, wo wir konnten – das war einfach so. Die älteren Schwestern mussten zum Beispiel mit den Kühen und Kälbern hinaus auf die Felder und aufpassen, dass sich kein Tier von der Herde entfernte. Einmal kam eine Kuh abhanden und wurde von Wölfen gerissen, deren Geheul wir nachts oft hörten, wenn wir im Bett lagen.
Wir kleineren Geschwister halfen unserer Mutter im Garten; es gab viel zu tun, und vielleicht wurde schon damals der Grundstein gelegt für meine spätere Entscheidung, Koch zu werden. Den Bezug zu guten Produkten bekam ich jedenfalls sehr früh, und die ganz einfachen Gerichte meiner Kindheit gehören für mich immer noch zum Besten, was ich je gegessen habe. Wenn die Walnüsse reif waren, rösteten wir sie zum Beispiel ein wenig in Butter an, vermischten sie mit getrockneten Aprikosen und aßen das auf Brot. Manchmal mache ich mir diese Walnuss-Aprikosen-Paste heute noch und esse sie auf einem schönen leichten Joghurt, in den ich ein wenig Honig einrühre. Ein paar Pistazien darübergestreut, und fertig ist eine essbare Erinnerung an Pageou. So ist das auch in der Spitzenküche: Wenn du ein sehr gutes Produkt hast, musst du nicht mehr viel darum herum machen. Und umgekehrt: Aus einem minderwertigen Lebensmittel kann niemals ein schmackhaftes Gericht werden.
Wenn ich zurückdenke, gibt es neben der Liebe zum guten Essen noch einen zweiten roten Faden, der sich durch mein Leben zieht und seine Ursprünge in der Kindheit hat: Ich übernahm schon immer Verantwortung – sicher eine gute Vorbereitung auf meine heutige Selbständigkeit. Das fing ganz früh in der Familie an; wenn ich mit sechs oder sieben Jahren zur Schule ging, ein Weg von etwa vier Kilometern zu Fuß an einer Landstraße entlang, auf der Lastwagen fuhren, musste ich immer meinen kleinen Bruder mitnehmen, um ihn in den Kindergarten zu bringen. Und später, als wir schon in Deutschland lebten und meine Mutter einmal ins Krankenhaus musste, war es selbstverständlich, dass ich als 13-Jähriger viel von ihrer Arbeit übernahm, vor allem das Kochen. Irgendwie hatte ich schon von klein auf das Gefühl, die Dinge zusammen- und am Laufen halten zu müssen, und das ist bis heute so.
Mit vier Jahren in unserem Haus in Pageou, rechts meine Schwester Nurcan, im Hintergrund ein Foto meines Vaters
In der Familie nahm ich immer eine Art Sonderrolle ein, was wohl auch mit den Umständen meiner Geburt zu tun hat. Als meine Mutter mit mir schwanger war, 1976, erlitten meine Eltern einen furchtbaren Schicksalsschlag: Sie verloren ihren ältesten Sohn, knapp 16 Jahre alt. Mein Vater lebte seit den 1960er Jahren in München, um als Schweißer Geld für die Familie zu verdienen. Meine Mutter blieb mit uns Kindern zu Hause in Pageou, sie zog uns quasi alleine groß. Und als der älteste Sohn in die Pubertät kam – es war auch die Zeit der ersten politischen Unruhen aufgrund der kurdischen Unabhängigkeitsbestrebungen in der Türkei –, da fühlte sie sich der Verantwortung für ihn nicht mehr gewachsen. Sie bat meinen Vater, ihn mit nach Deutschland zu nehmen; sie setzte auf die väterliche Autorität. Als alle nötigen Papiere beisammen waren, machten sich die beiden im Auto auf den Weg nach Ankara zum Flughafen. Unterwegs passierte dann das Unglück: Der Wagen war sehr alt und nicht gut in Schuss, irgendwann öffnete sich während der Fahrt plötzlich die Beifahrertür, mein Bruder stürzte auf die Straße und starb.
In jener Nacht, noch bevor sie von dem Unfall erfuhr, hatte meine Mutter einen seltsamen Traum: Ein Mann mit einem langen Bart kam zu ihr und sagte: «Du hast einen Sohn, den werde ich dir jetzt wegnehmen. Aber den gleichen Sohn gebe ich dir wieder zurück.» Als sie morgens aufstand, war sie überzeugt, dass ihrem ältesten Sohn etwas zugestoßen sei – nachmittags erhielt sie die tragische Nachricht. Einige Zeit später kam ich auf die Welt, und meine Mutter sagt noch heute: «Du hast genauso ausgesehen wie dein Bruder.» Meine Eltern gaben mir seinen Namen: Ali Haydar. Ich war für sie so etwas wie der wiedergeborene Sohn. Das prägte meine Rolle in der Familie von Anfang an. Natürlich liebten meine Eltern alle Kinder gleichermaßen, trotzdem hatte ich irgendwie eine besondere Stellung, schon immer. Das war manchmal positiv, oft aber auch eine Belastung. Wenn es Probleme gab, hatte ich immer das Gefühl, ich müsse etwas tun, damit meine Eltern wieder glücklich sind. Bis heute ist das so: Wenn sie irgendetwas auf dem Herzen haben, kommen meine Eltern zu mir und möchten meine Einschätzung hören, fragen mich um Rat. Das ist eine große Verantwortung, die sich durch mein Leben zieht. Irgendwie war das schon so, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich war schon immer sehr agil, wusste immer über alles Bescheid und brauchte wenig Schlaf. Schon mit acht Jahren fing ich an, Geld für die Familie dazuzuverdienen und trug Zeitungen aus. Damals hatte ich schon verinnerlicht, dass man die Dinge selbst in die Hand nehmen muss, um im Leben weiterzukommen.
Ich denke, es hat mich als Koch sehr geprägt, dass ich von ganz klein auf den Umgang mit Lebensmitteln gelernt habe. Ich wusste einfach, wie Auberginen oder Tomaten wachsen, wie man sie erntet, verarbeitet und konserviert. Ich hörte zu, wenn meine Mutter mir erklärte, die Auberginen seien noch nicht so weit, die bräuchten noch eine Woche. Sie zeigte mir auch, wie man sie erntet: nicht einfach abreißen, weil dann Bitterstoffe in die Frucht gehen, sondern vorsichtig abdrehen, genauso bei der Paprika. Auch die Tomaten durften wir erst pflücken, wenn sie ganz rot und ausgereift waren, weil sie dann am besten schmecken. Oder die Gurken: Wenn man sie zu früh erntet, schmecken sie noch ein bisschen bitter.
Ich war dabei, wenn meine Mutter aus den Sauerkirschen Sirup einkochte, Marmelade machte oder Paprika- und Tomatenmark zubereitete. Manchmal saßen zehn bis fünfzehn Leute in unserer Küche, um Kirschen oder Aprikosen zu entsteinen. Klar, das war eine mühselige Arbeit, aber es machte auch Spaß, weil es immer etwas zu erzählen gab – das war unser Unterhaltungsprogramm, Fernsehen kannten wir noch nicht.
Wir fingen auch selbst Fische, in einem kleinen Fluss in der Nähe von Pageou. Damals war das für mich einfach nur «unser Fluss». Heute weiß ich, es war der Munzur, der durch den Munzur-Vadisi-Nationalpark fließt, mittlerweile einer der größten und artenreichsten Nationalparks der Türkei. In den Seitenarmen des Flusses angelten wir Jungs stundenlang mit unseren selbstgebastelten Angelruten Forellen und Saiblinge, manchmal auch einen Flussbarsch. Heute wäre ein solcher Fisch unter uns Köchen eine begehrte Rarität: Wildfang aus frischem, klarem Wasser. Zu Hause entschuppten wir die Fische, nahmen sie aus und legten sie einfach im Ganzen in die Pfanne – ein Festmahl.
Zu Hause wurde auch geschlachtet, aber nur zu ganz besonderen Gelegenheiten, denn die Tiere waren wertvoll, und wir brauchten die Milch der Schafe und Kühe. Aber zum islamischen Opferfest, wenn ein Kind geboren wurde oder unser Vater aus Deutschland heimkam, war es zur Feier des Tages so weit. Weil es keine Kühlmöglichkeiten gab, verteilten wir das Fleisch, das wir nicht selbst essen konnten, unter den Nachbarn. Und wenn diese schlachteten, hielten sie es genauso. Mein Opa trocknete sein Fleisch in einer dunklen Kammer hinter der Küche; zu besonderen Anlässen schnitt er etwas Fleisch ab, was dann in die Eintöpfe hineingegeben wurde, mit Kichererbsen oder Linsen oder Bohnen. Damals ging man sehr bewusst mit Lebensmitteln um und wusste genau, wie man sie haltbar machen konnte, weil man noch in engem Kontakt mit der Natur lebte. Wenn geschlachtet wurde, dann wurde jedes Teil des Tieres verarbeitet; niemals wäre man auf die Idee gekommen, irgendetwas wegzuwerfen. Heute interessieren sich viele Köche nur für die Filetstücke; damals verwendete man alles, auch die Knochen. Daraus wurde eine Brühe gekocht, oder man gab sie den Hunden.
Und natürlich wurden auch die Innereien gegessen, sie spielen in der orientalischen Küche bis heute eine ganz andere Rolle als in Deutschland. Sie gelten sogar als Delikatesse: Kutteln, Nieren, Leber, Lunge und ja, auch die Hoden. Die Pansen wurden mit Essig zu einer Suppe verarbeitet. Auch die Köpfe von Lämmern oder Ziegen kamen damals bei uns auf den Tisch, man kochte sie, und dann konnte sich jeder etwas herauspulen. Wir wären nie auf die Idee gekommen, das eklig zu finden. Es war Gottes Wille, dass man einem Tier diese Wertschätzung erweist, so starb es nicht umsonst. Das ist bis heute in der Küche meine Philosophie: Wenn man ein Tier, also ein Lebewesen tötet, dann gebietet es der Respekt, dass man jedes Teil davon verarbeitet, nicht nur die Edelstücke. In der Türkei ist das auch heute noch selbstverständlich. Es gibt in Istanbul Metzgereien, die nur auf Innereien spezialisiert sind, sie verkaufen nichts anderes. Und es gibt auch Restaurants, die nur das servieren. Wenn ich heute in Istanbul bin, gehe ich oft in ein Restaurant, das nur Leber anbietet. Sie wird in ganz kleine Würfelchen geschnitten, so groß wie mein Fingernagel, dann aufgespießt, dazwischen ein Stück Speck oder anderes Fett vom Tier, meistens vom Ochsenschwanz oder vom Rind. Der Geschmack ist Wahnsinn! So haben wir früher auch immer Bries gegessen, ganz kurz gegrillt, dann Thymian drauf und leichte Chiliflocken – göttlich. Ich mag, ja, ich liebe die einfache Küche, die ganz nah an den puren Lebensmitteln ist.
Neben Salz, Zucker und Pfeffer spielen auch Chili, Minze, Dill und Petersilie in der türkischen Küche eine wichtige Rolle. Auch Mandeln, Zimt und Nelken waren in unserer Küche immer zur Hand. Und Zwiebeln! Sie wurden auch als Hausmittel genutzt, wenn wir uns verletzten oder bei Entzündungen. Meine Mutter machte die Zwiebeln warm, schlug sie in ein Baumwolltuch ein und band das um die verletzte Stelle – am nächsten Tag war die Entzündung abgeklungen.
Zum Essen wurde in meiner Kindheit Wasser, Tee oder Ayran getrunken, der türkische Joghurt mit Wasser und einer Prise Salz. Alkohol spielte so gut wie keine Rolle. Höchstens wenn mein Vater mal da war und die Nachbarn vorbeikamen, wurde der Whisky eingeschenkt, den er aus Deutschland mitgebracht hatte, eine Art Statussymbol. Im Dorf wurde sonst nur Raki getrunken, ein klarer Schnaps, aus Weintrauben gebrannt und mit Anis versetzt, eine Art türkisches Nationalgetränk. Aber Vaters Whisky war natürlich etwas Besonderes. Wein wurde damals in der Türkei wenig getrunken. Das hat überraschende Folgen für mich, wie ich vor fünf Jahren erfuhr, als ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Ayurvedakur machte. Mit dem Arzt sprach ich unter anderem auch darüber, dass ich Wein, vor allem Rotwein, nicht gut vertrage. Er löst bei mir eine Art allergische Reaktion aus, die Nase schwillt sofort zu, als ob ich Schnupfen hätte. Der Ayurvedaarzt erklärte mir, das sei genetisch bedingt; weil ich aus dem Orient komme und meine Vorfahren immer eher klaren Alkohol getrunken hätten, sei mein Körper nicht auf Wein eingestellt. Er empfahl mir, lieber ein Glas Rum oder Whisky zu trinken – aber das ist nicht ganz mein Geschmack.
Als ich acht Jahre alt war, verließen wir Pageou und zogen in ein Dorf außerhalb von Tunceli, nach Harçik. Mein Vater hatte dort von seinen Ersparnissen ein Haus gebaut. Ich weiß noch ganz genau, wie wir aus unserem Dorf weggingen. Meine Mutter und wir Kinder liefen zu Fuß von Pageou nach Harçik, bepackt mit Hausrat; das muss ausgesehen haben wie eine Art Prozession. Das neue Haus war um einiges komfortabler und größer als das alte Lehmhaus in Pageou, es hatte ein richtiges Ziegeldach. Aber fließendes Wasser oder eine Heizung hatten wir immer noch nicht. Wir mussten weiterhin das Wasser vom Brunnen holen, der weiter vom Haus entfernt war als in Pageou. Wir Kinder liefen immer alle miteinander, jeder beladen mit zwei Kanistern, den Kilometer zum Brunnen und wieder zurück. Heute undenkbar, aber damals für uns ganz normal. Zu unserer Enttäuschung durften wir aber nicht dauerhaft in dem neuen, großen Haus wohnen. Meine Mutter hatte alles schön hergerichtet, aber wir lebten dort nur, wenn mein Vater aus München nach Hause kam oder wir Gäste hatten. Die übrige Zeit verbrachten wir Kinder mit unserer Mutter in einem kleinen Häuschen nebenan, das viel einfacher war, mit einer Kochstelle. Das große Haus diente sozusagen nur zu Repräsentationszwecken. Wir Kinder konnten das natürlich nicht verstehen, aber die Begründung meiner Mutter war, das große Haus mache zu viel Arbeit, und es brauche viel mehr Holz, um es zu heizen. Man darf nicht vergessen: Meine Mutter war fast das ganze Jahr über mit uns Kindern alleine. Dazu hatte sie noch die Tiere, und teilweise pflegte sie auch noch die Eltern meines Vaters – sie leistete ungeheuer viel. Heute, da ich selbst Kinder habe, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie sie das damals alles schaffte.
Mit acht Jahren in Tunceli vor unserem neuen Haus
Meine Mutter sagt immer: «Wir haben nie Zeit gehabt für euch. Ihr musstet euch selbst beschäftigen. Deswegen seid ihr auch alle so weit gekommen.» Sie nahm uns schon als Babys zur Arbeit auf die Felder mit, und wenn eines schrie, dann gab sie ihm die Brust und ging anschließend wieder an die Arbeit, um in Handarbeit den Weizen zu dreschen. Respekt! Weil unsere Eltern kaum Zeit für uns hatten, erzogen wir uns sozusagen gegenseitig, das war damals eben so. Ich denke, deswegen haben wir Geschwister auch alle eine enge Beziehung zueinander. Mein Bruder Murat ist zwei Jahre älter als ich, wir waren als Kinder immer zusammen, und ich übernahm viel von ihm, obwohl wir charakterlich sehr unterschiedlich sind. Er ist eher wie meine Mutter, die eine echte Macherin ist, tüchtig, wenn nötig auch knallhart. Ich bin eher wie mein Vater, ich bleibe immer ruhig und bin überzeugt, dass schon alles klappen wird. Mein Vater war auch immer sehr großzügig. Wenn er nach Tunceli kam, gingen wir zum Mittagessen, und er lud alle ein. Manchmal saßen 15 oder 20 Personen am Tisch, Nachbarn, Verwandte, Freunde. Meine Mutter war eher sparsam, ihr war das nicht recht, aber mein Vater sagte zu mir: «Junge, merke dir eins: Wenn du großherzig bist und denen, die weniger haben als du, etwas gibst, dann gibt dir Allah das wieder zurück.» Das prägte sich mir ein. Sonst war von Allah zu Hause wenig die Rede, wir waren Aleviten, wie 99 Prozent der Bevölkerung in dieser Gegend, da wurde das alles recht entspannt gesehen. Wir gingen auch nicht in die Moschee.
In Harçik wohnten wir sozusagen im Kreise der Familie – unser Nachbar war der Bruder meines Vaters. Er hatte zwölf Kinder, zehn Mädchen und zwei Jungs, und ich erinnere mich noch ganz genau, dass wir Jungs bei ihnen zwei Tassen Tee trinken durften und die Mädchen nur eine, die Jungs bekamen zwei Stück Zucker, die Mädchen nur eines, denn Zucker war damals teuer. Der Onkel war hochintelligent, aber in diesen Fragen knallhart, denn so waren damals die Bräuche. Er war Förster, ging zur Jagd und schoss ab und zu mal Spechte oder wilde Tauben. Ich kann mich gut an ein Silvesterfest erinnern, als es zur Feier des Tages Taube gab. Sie wurden mit den Knochen in Stücke geschnitten und dann in Milch gegart, mit ein bisschen Zimt und Zwiebeln. Dazu aßen wir Brot; das werde ich nie vergessen, es schmeckte köstlich. Und manchmal, wenn geschlachtet wurde, gab es «Kavurma». Dafür wurde Lamm- oder Ziegenfleisch mit Zwiebeln, Paprika und Peperoni in einer weiten, großen Pfanne, ähnlich einem asiatischen Wok, im eigenen Fett schön langsam geschmort; das konnte schon mal zehn Stunden dauern. Dann ließ man alles erkalten, und wir aßen es zum Frühstück, ebenfalls mit Brot.
In Harçik ging es uns finanziell schon etwas besser, und es gab öfter Fleisch zum Essen. Und wenn gebacken wurde, dann holten wir Kinder uns ein Stück ofenwarmes Brot, pflückten im Garten reife Tomaten, streuten ein bisschen Salz drauf: göttlich! Das gehört zu den ersten eindrücklichen Geschmackserlebnissen, an die ich mich bis heute erinnere. In Harçik gingen wir auch ab und zu mal ins Restaurant, und ich begann, einzelne Gerichte wahrzunehmen und mich dafür zu interessieren, wie sie zubereitet waren. Und wenn mein Bruder und ich ein bisschen Geld bekamen, dann liefen wir in die Stadt und kauften uns einen Döner. Wenn mein Vater uns während seines Heimaturlaubs ausführte, lernte ich Linsensuppe mit Minze, Zitrone und Chili kennen oder Lammschulter mit Kartoffeln und Tomaten. Besonders gerne aß ich Nieren, die wurden ein Leibgericht.
An die Schule erinnere ich mich nicht so gerne zurück. Ich war ein eher mittelmäßiger Schüler, was auch an den Umständen lag. Die erste und zweite Klasse besuchte ich in der Grundschule in Tunceli, aber dann wurde in Harçik eine Schule gebaut, und ich wechselte dahin. Leider war der Lehrer dort sehr streng, um nicht zu sagen grausam. Er nahm mir jede Freude am Lernen. Er schlug uns Kinder regelmäßig, oft aus nichtigem Anlass, und es blieb nicht bei einer Ohrfeige, es gab immer gleich drei oder vier. Am liebsten aber haute er mit dem Holzstock auf unsere Finger, oder wir mussten die Hände hinhalten, und er schlug mit dem Lineal auf die Handflächen. Furchtbar. Ich war eines seiner bevorzugten Opfer, vielleicht auch, weil er wusste, dass mein Vater weit weg war und er von dieser Seite nichts zu befürchten hatte.
Was ich aber mein Leben lang nicht vergessen werde, war die Sache mit dem Ball. Ich hatte mir immer einen Ball gewünscht, und eines Tages kaufte mir meine Mutter einen billigen aus Plastik, aber eben: einen richtigen Ball. Stolz ging ich damit nach Hause und am Montag, zum Sportunterricht, nahm ich meinen Ball dann mit. In der Schule gab es keine Bälle oder Sportgeräte, wir spielten meistens Fangen, das war’s. Nun konnten wir alle gemeinsam Feuerball oder Völkerball spielen. Als wir anschließend wieder ins Klassenzimmer kamen und ich den Ball im Fach unter meiner Bank verstaute, sagte der Lehrer: «Ich sehe, du hast einen schönen Ball, Ali Haydar, komm’ doch mal nach vorne und zeige ihn mir.» Ich war sehr stolz und ging zu ihm. Und er sagte: «Du spielst also in deiner Freizeit Fußball? Ich habe dir doch gesagt, du sollst lernen», öffnete die Schublade seines Tisches, nahm ein kleines Messer und schlitzte meinen Ball auf. Ich traute meinen Augen nicht, es war entsetzlich. Dann schlug er mir fünfmal auf jede Handfläche; den Schmerz habe ich jedoch kaum gespürt, weil mir das Herz schon so weh tat. Die seelische Grausamkeit verletzte mich mehr als seine Schläge. Und ich lernte: Egal was ich mache, ich kriege sowieso wieder eine geschmiert.
Später, als wir schon in Deutschland lebten, hörten wir von ehemaligen Klassenkameraden aus Harçik, dass der Lehrer es zu weit getrieben hatte. Einen Jungen schlug er so heftig, dass dessen Eltern die beiden älteren Brüder in die Schule schickten, um mit dem Lehrer zu reden. Er verweigerte das Gespräch und verschanzte sich in der Schule. Ein paar Tage später brannte die Schule ab – die Umstände wurden nie geklärt.
Als ich acht Jahre alt war, veränderte sich das politische Klima in der Region. Immer öfter hörte man von Unruhen. Hinter vorgehaltener Hand wurde von Kämpfen zwischen der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung PKK und dem türkischen Militär erzählt, und plötzlich sah man viel mehr Polizisten auf den Straßen, auch Soldaten. Ich erinnere mich ganz genau an ein Wochenende im Herbst; es war später Nachmittag und wurde gerade dunkel. Da hörte ich plötzlich drei Schüsse. Ich war zu Hause und erschrak fürchterlich. Bamm. Bamm. Bamm. Eine halbe Stunde später war ganz Harçik von Soldaten und Militärfahrzeugen umringt. Es hieß, einer unserer Nachbarn sei draußen auf dem Feld erschossen worden, mit drei Schüssen. Man erzählte sich später, ein Sohn des Ermordeten sei bei den Rebellen gewesen, ins Gefängnis gekommen und hätte dort gegen die PKK