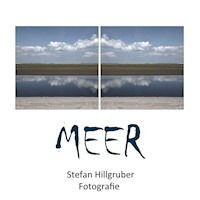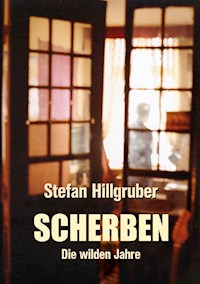
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Lupen, Kameralinsen, Fenster oder Brillengläser sind im Grunde nichts anderes als Scherben, durch die man die Welt betrachten kann. Wenn ich am Meer bin, sammle ich gern von der Brandung rundgeschliffene Glasfragmente. Die meisten sind flaschengrün, aber auch bernsteinfarbene und milchig weiße findet man häufig, die dann wie Kandiszucker aussehen. Wie die Fundstücke vom Strand einmal Teil eines nützlichen Gegenstandes waren, so setzen sich die in diesem Buch versammelten Episoden, zu einem Ganzen zusammen, erzählen einen Lebensabschnitt von zehn Jahren in meiner Geburtsstadt Lübeck und zeugen von der Brüchigkeit, die allem innewohnt, wie die trügerische Eisfläche eines überfrorenen Waldteichs. Bei dem vorliegenden Buch handelt es sich um den zweiten Teil meiner Autobiografie. Der erste Teil ist als Paperback-Ausgabe im Mai 2022 bei BoD unter dem Titel "Und sonst?- Lübecker Kindheits- und Jugenderinnerungen" erschienen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meinen Freund Thomas
Einfach war es nie gewesen, aber jetzt spürte ich, dass alles nur noch komplizierter wurde.(Paul Auster)
Kapitelübersicht
Allegorie
1977
Ennui
Disney in Kopenhagen
Eine Tür
Pappnasen und Plastikbecher
Spiegel
Beatrix
Gespenster
Abenteuer in der Silvesternacht / 1
1978
Risse
Summer in the City
Daumenkino
And Action!
Ende und Anfang
Claudia
Im Tollhaus
Einberufung
TraumTheater / 1
1979
Parallelwelt
Säure
Chaos
Ordnung
Personal-Revue
Im Wald
Steine
MAD
Klopf Klopf!
Jimmy & Speedy
Bolly
Humor Me
Schimmer
Jenseits der Null
1980
Geschenkte Zeit
TraumTheater / 2
Bitterer Frühling
Katzenterror
Machtlos
Haben und Sein
„KEINE KUNST“
„K K“-Revival 1999 - 2008
Viva España
Mord an einem Vogel
Schlingern
Unsichere Zeiten
1981
TraumTheater / 3
InstandBesetzt
TraumTheater / 4
Tagebuch / 1
Umsiedlung
Ein Männlein steht im Walde.
Gefühl und Härte
Tagebuch / 2
Déjà-vu
Geist und Fleisch
Zahnräder / 1
Schlüsselgeschichte
TraumTheater / 5
Tagebuch / 3
Karten auf den Tisch
TraumTheater / 6
Abenteuer in der Silvesternacht / 2
1982
TraumTheater / 7
Schwarze Löcher
TraumTheater / 8
Frühlingsgefühle
Alte Liebe rostet nicht
Bom Shankar
Reise auf die andere Seite
Negombo
Hikkaduwa
Arugam Bay
Willkommen in der Republik
Butter stampfen
Darf’s ein bisschen mehr sein?
Zahnräder / 2
1983
Viel Rauch um Nichts
TraumTheater / 9
Eigentum ist Diebstahl
TraumTheater / 10
Licht und Ton
Strawberry Feelings Forever
Sereetz
VorZeichen
Ungelöste Rätsel
TraumTheater / 11
Das große Blut
TraumTheater / 12
1984
Anders leben
TraumTheater / 13
Schön gesehen!
Naturkräfte
TraumTheater / 14
Klassenfahrt
TraumTheater / 15
Traumjobs
TraumTheater 16
1985
Spuren
Unterwegs in Schweden
All die schönen Blumen
Tagebuch / 4
Alpenglühen
1986
Tagebuch / 5
Fallout
Guten Abend, gute Nacht
Wiedersehen
Hochzeitspläne
1987
Hochzeitstheater
März in Paris
Allegorie
4. August 1975: Das Geräusch, das mich aus dem Schlaf riss, klang wie das hysterische Schreien einer Katze, die einem Rivalen im Kampf die Zähne zeigte. Nach einer Weile wurde mir klar, dass es das Weinen meiner Oma war, der telefonisch die Nachricht vom Tod ihrer jüngeren Schwester Ische mitgeteilt wurde. Während in mir ein diffuses Unbehagen sich ausbreitete und ich noch überlegte, wie ich reagieren sollte, kam sie tränenüberströmt in mein Zimmer und erzählte mir davon. Da ich eine ähnliche Situation bislang noch nicht erlebt hatte, fand ich in meiner Hilflosigkeit keine Worte, um sie zu trösten oder zu beruhigen und hörte einfach nur zu.
In diesem Zusammenhang erinnerte ich mich an eine Begebenheit, die ich zwei Jahre zuvor in der leergeräumten Wohnung von Ische und ihrem Lebensgefährten Fiete erlebt hatte. Die beiden hatten ihren Wohnsitz in der Lübecker Loignystraße aus Altersgründen aufgegeben und waren zu Isches Tochter Margit und deren Ehemann Gerd nach Blekendorf in die Nähe von Lütjenburg gezogen. Meine Eltern standen in einem der leeren Zimmer und unterhielten sich, während mein Bruder Karsten und ich durch die Räume liefen und die ungewohnte Raumakustik ausprobierten. Von draußen warf die Sonne einen Lichtkeil auf den alten Holzdielenboden und beleuchtete ein „Split“-Eis, das uns offenbar beim Spielen heruntergefallen war und nun schmolz. Ich beobachtete, wie die milchige Eispfütze am Boden langsam größer wurde. Seitdem ist das schmelzende Eis auf den Dielenbrettern für mich ein Sinnbild für das Ende eines Lebensabschnitts oder des Todes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1977
Ennui
Mai 1977: Im Frühjahr 1974 war ich wieder in mein Geburtshaus auf der Lübecker Altstadtinsel in den Tünkenhagen Nr.22 zurückgekehrt. Ein halbes Jahr zuvor hatte ich eine Lehrstelle als Technischer Zeichner bei der Lübecker Firma „Paul Schulze & Co.“ begonnen. Doch der Weg zu meiner Arbeitsstelle gestaltete sich schwierig, da die katastrophale Busverbindung von Hamberge, wo ich damals noch mit meinen Eltern lebte, es nicht ermöglichte, pünktlich zur Arbeit zu kommen, ohne dass mein Vater mich jeden Morgen mit seinem Auto zum Moislinger Baum brachte, von wo aus ich mit dem Bus in den Betrieb weiterfuhr. Deshalb wohnte ich nun wieder bei meiner Oma Anna Hammer und ihrem Lebensgefährten Kurt Wien, die von allen Tante Anni und Onkel Kurt genannt wurden.
Inzwischen hatte ich meine Lehrzeit beendet und war arbeitslos, da mir mein Lehrbetrieb kurz vor meiner Gesellenprüfung die Kündigung überreicht hatte. Nun schlug ich die Zeit mit Angeln und Kinobesuchen tot und langweilte mich. In dieser Stimmung kaufte ich mir nebenan im Gemischtwarenladen von Tante Gerda, die mich schon von Geburt an kannte, eine Flasche Rum, von der ich mir hin und wieder einen kleinen Schluck genehmigte und die ich zusammen mit einem Glas auf der rückwärtigen Lautsprecherabstellfläche der Schrankwand in meinem Zimmer versteckte. An einem besonders langweiligen Nachmittag trank ich davon in kurzer Zeit ein ganzes Wasserglas leer und wurde langsam betrunken. Um gesehen zu werden, bin dann ein wenig nach draußen gegangen, wodurch die Wirkung des Alkohols sich noch verstärkte. Schwankend und mit stark eingeschränktem Gesichtsfeld ging ich die Glockengießerstraße auf und ab, bis mir jemand, der mich offenbar kannte, den Rat gab, dass es besser wäre, nach Hause zu gehen, was ich dann auch tat. An den weiteren Verlauf des Nachmittags kann ich mich nicht mehr erinnern.
An einem trägen, heißen Sommertag kletterte ich vom Dachboden nach ganz oben auf die Zwischendecke, direkt unter die Dachschräge des Hauses, wo ein kleines Dachfenster sich befand, durch das der Schornsteinfeger immer kletterte, um den Kamin zu fegen. Nachdem ich vorsichtig die gläserne Luke geöffnet hatte, fing ich an, mit der geliehenen Luftpistole eines Freundes, auf die gegenüberliegenden Fenster der Häuser zu schießen. Mir war bewusst, dass die kleinen, Eierbecher genannten Bleikugeln nur an die Scheiben klopfen würden, ohne sie zu beschädigen, aber ich war auch nicht darauf aus, etwas zu zerstören. Gelegentlich erschreckte ich mit der Pistole in den folgenden Tagen noch die Tauben, die auf dem Dachgarten meiner Oma nach Futter suchten und habe die Pistole irgendwann zurückgegeben, da ich bald keinen Gefallen mehr an diesen Aktionen fand.
Disney in Kopenhagen
Seit geraumer Zeit schon war unser Interesse an Walt-Disney-Trickfilmen im Super-8-Fomat sehr groß. Nur waren sie in Lübeck gar nicht und auch sonst nur schwer erhältlich. Mein Freund Heinz Hermann hatte allerdings Informationen erhalten, wonach die Chancen in Dänemark größer wären als in Deutschland. Daraufhin organisierte er eine mehrtägige Fahrt nach Kopenhagen inklusive Hotelaufenthalt. Meine Oma regte sich zwar sehr darüber auf, dass ich als Arbeitsloser mit geringem Budget die Fahrt überhaupt unternehmen wollte, was mir aber egal war, denn sie hatte seit jeher die Angewohnheit, sich in alles einzumischen, auch wenn es sie nichts anging.
Schließlich fuhren wir an einem Freitagmorgen mit dem Schiff von Travemünde ab und blieben bis zum Sonntag in Kopenhagen. Auf unserem Programm standen die Sehenswürdigkeiten der Stadt, der Tivoli, der Zoo und nebenher wollten wir ein Geschäft finden, das diese Filme verkaufte.
Den Freitag ließen wir ruhig angehen und besuchten am Abend den Tivoli. Am Samstag absolvierten wir dann ein Riesenprogramm und streiften von einem Ende der Stadt zum anderen. Am Hafen wunderte ich mich darüber, wie klein das Kopenhagener Wahrzeichen, die „Kleine Meerjungfrau“, im Original ist. Während des Stadtbummels bestiegen wir die Wendeltreppe eines Kirchturms, die an seiner Außenseite nach oben führte. Für mich eine Zitterpartie!
Durch Zufall entdeckten wir dann in einer Nebenstraße tatsächlich einen kleinen Laden, dessen Schaufenster mit Disney-Filmen dekoriert war. Der Film, den ich mir kaufte, trug den Titel „Donald in the High Andes“ und war eine Art geographischer Lehrfilm über Südamerika und die Anden mit Donald Duck und seinen drei Neffen in den Hauptrollen. Heinz‘ Film, dessen Titel ich nicht mehr erinnere, hatte nicht diesen typisch anarchischen Witz, den die Figur des Donald Duck für gewöhnlich versprühte, weshalb er später in Lübeck nach dem Betrachten des Films dementsprechend enttäuscht war.
Nach dem Zoobesuch, der länger dauerte als geplant, war ich in sehr schlechter Stimmung, weil ich den Anblick eingesperrter Tiere noch nie gut ertragen konnte. Von einem Besuch des Hamburger Tierparks Hagenbeck in meiner Kindheit sind mir deshalb außer ein paar verblichenen Fotografien auch nicht viele schöne Erinnerungen geblieben. Das einzige Bild, das vor meinem inneren Auge auftaucht und nicht von der Kamera meiner Mutter festgehalten wurde, ist der Schimpanse, der mir beim Besuch des Affenhauses unendlich leidtat, weil er am Gesäß ein enormes Geschwür mit sich herumtrug. Als wäre die Gefangenschaft nicht schon schlimm genug, schlug ihn das Schicksal auch noch auf diese Weise.
Genauso erging es mir mit den hin- und herschaukelnden Häuptern der Elefanten, die ich zu Anfang noch lustig fand. Als mir aber in den folgenden Jahren klar wurde, dass es sich bei dieser Bewegung um eine Verhaltensstörung handelt, die mit der Gefangenschaft zu tun hat, tat mir ihr Anblick genauso weh, wie die eleganten Großkatzen verzweifelt an den Gitterstäben ihrer Käfige vorüberziehen zu sehen.
Vielleicht, weil in den großen Wasserbecken eines öffentlichen Aquariums das Leben und die Bewegung der Tiere wie in Zeitlupe sich zeigte, hatte ich hier nicht dieses Gefühl einer Gefangenschaft der Geschöpfe, wie es in den Außengehegen der Fall war. Ein Besuch in einem Meerwasser-Aquarium übt selbst heute noch einen ungeheuren Reiz auf mich aus, was möglicherweise auch am Lebensraum Wasser im Allgemeinen liegen mag, der von meinem eigenen sich so grundlegend unterscheidet. Obgleich mich besonders beim Eintauchen in Süßwassergewässer oft ein Gefühl von Vertrautheit und Wiedererkennen überkommt, das mir eine ungeahnte Sicherheit entgegenbringt. Vielleicht ist dieses Empfinden eine Erinnerung an das Urelement, aus dem alles entstanden sein mag.
In der Dämmerung schleppte ich mich mit schmerzenden Füßen zurück ins Hotel, weil ich für den ganztägigen Fußmarsch durch Kopenhagen nicht das richtige Schuhwerk trug. Heinz filmte Teile der Reise mit seiner Super-8-Kamera und schnitt im Nachhinein daraus einen Film, den er ab und zu vorführte.
Auch wenn Disney-Filme zu dieser Zeit scheinbar schwer zu beschaffen waren, erschien mir rückblickend der Aufwand der Reise zu groß. Eventuell hätten wir in Hamburg genauso viel Glück gehabt.
Eine Tür
Es gab einen Song der Band „Ton Steine Scherben“, den ich immer wieder hörte und der die Stimmung, in der ich mich momentan befand, sehr treffend wiedergab. Das Stück heißt „Samstagnachmittag“, in dem besonders die Zeile: „Mama backt ‘nen Kuchen, Papa kippt ein Bier. Und ich sitz auf der Straße und hab die Welt vor mir“, den Nagel auf den Kopf traf.
Durch den Einfluss der progressiven Rockmusik in den ausgehenden 1960ger Jahren, war 1971 für mich genau die richtige Zeit, um mir dir Haare wachsen zu lassen, was in den letzten beiden Hauptschuljahren besonders bei den Mädchen meiner Schulklasse gut ankam. Zwar schnitt mir meine Mutter, die ausgebildete Friseuse war, regelmäßig die Haare, da aber jeder Millimeter zählte, achtete ich sorgfältig darauf, dass sie nicht zu kurz wurden. So begann ich 1973 gekonnt frisiert meine Lehrzeit. Als ich dann 1977 meine Lehre beendete, waren meine Haare auf eine ansehnliche Länge gewachsen, was einmal zu einer amüsanten Verwechselung führte, als ich an einem Schalter bei den Lübecker Stadtwerken um eine Bus-Monatskarte anstand, und mich der Beamte mit den Worten ansprach: „Was kann ich für Sie tun, junges Fräulein?“, weil er mich in dem Moment, als er es sagte, nur von hinten sah.
Mit meinen Haaren wuchs auch das Interesse an einer unangepassten Lebensweise, wie ich sie bei einigen Menschen in meinem näheren Umfeld zu erkennen glaubte. Dass sich hinter manchen Äußerlichkeiten, die auf mich revolutionär wirkten, nicht mehr als heiße Luft befand, hatte ich wegen meines jugendlichen Alters zu der Zeit noch nicht vollständig durchschaut. Für mich galt in erster Linie der Anspruch, niemals wie die eigenen Eltern zu werden. Den Anstoß, dieses Lebensgefühl nicht allein auf das Tragen langer Haare zu beschränken, gab mir bereits in Kindertagen mein Englisch-Nachhilfelehrer Hans-Jürgen mit auf den Weg.
In dieser Zeit lernte ich Ingo kennen, der in den „Capitol -Lichtspielen“ am Süßigkeitenstand arbeitete. Hier ging auch ich ein und aus, da ich mit dem Filmvorführer befreundet war und einmal in der Woche für die Dekoration der Schaufenster und Werbeflächen zuständig war. Ingo war sehr schlank, trug lange lockige Haare und Plateauschuhe mit Sohlen von acht bis zehn Zentimetern Höhe, die gerade am Ende der 1970ger Jahre en vogue waren. Beeinflusst durch Fernsehauftritte von Rockgruppen wie „The Sweet“ oder „Slade“ trug ich ebenfalls schon seit geraumer Zeit diese Schuhe, die allerdings wie plumpe Fremdkörper an meinen Füßen hingen. Für jemanden wie Ingo waren diese Schuhe jedoch wie geschaffen, da er die nötige Androgynität besaß, die den meisten jungen Männern fehlte, so wie auch mir. Ingos Erscheinung entsprach auch nicht dem schmuddelig freakigen Habitus, den die Patchouli ausdünstende Räucherstäbchenszene mit sich führte, die mich zwar eine Zeit lang anzog, zu der ich aber nie einen Zugang fand. Ich träumte eigentlich von nichts anderem, als zu einer Gruppe von Menschen zu gehören, die komplett anders waren, als die, die ich bisher kannte, egal wie sie dufteten. Ich stellte mir vor, aus so einer Gemeinschaft und dem Gefühl „dazuzugehören“, Kraft schöpfen zu können oder zumindest die Gewissheit zu haben, unter Gleichgesinnten mich zu befinden. Dass so ein Gemeinschaftsgefühl oft mit einer ideologischen Kraftmeierei einhergeht, habe ich erst später zu spüren bekommen. Die Enttäuschung darüber führte dazu, dass ich mich in den folgenden Jahren mehr und mehr in mich zurückzog und zu einem Einzelgänger wurde.
Zunächst aber wurde durch Ingo das Leben interessanter für mich. Ab jetzt bewegte ich mich in zwei Welten. Einerseits pflegte ich den Kontakt zu Thomas, genannt „Whity“, Frank L. und seinem Freund Stephan, die ich noch aus meiner Lehrzeit bei Paul Schulze & Co. kannte, die aber vermehrt Tabletten und Alkohol konsumierten, wodurch die Freundschaft immer mehr in Disharmonie geriet.
Andererseits wurde durch die Bekanntschaft zu Ingo, seiner Freundin „Patti“, Ingos Schwester und André P. eine weitere Tür geöffnet. Sie wohnten mit Ausnahme von Ingos Schwester in einer WG in der Hundestraße. André war mir allerdings von Anfang an nicht sehr sympathisch und auch Ingos Freundin Patti erwies sich als sehr egozentrische Person, deren großes Vorbild anscheinend Renate Knaup-Krötenschwanz war, die Sängerin der Rockgruppe „Amon Düül II“, was auf mich ein bisschen albern wirkte. Sie schwärmte oft in den höchsten Tönen von Ingo und war wohl auch schwer verliebt in ihn. Sie betonte dabei, was für ein schöner Mann und wie intelligent er sei. Um dies zu bekräftigen, nannte sie mir einmal sogar seinen IQ. Eines Tages erzählte sie mir von einer Musikkassette, die sie mit Ingo und André zusammen aufgenommen hatten. Sie nannten ihre „Band“ nach der antiken türkischen Stadt „Çatalhöyük“, was für mich allein durch den Klang des Namens schon aufregend war, obwohl ich noch keinen Ton der Musik gehört hatte. Das Instrumentarium bestand aus Gitarre, Blockflöte, Keyboard und allerlei Schlagwerk, dazu diverse gesungene und gesprochene Stimmen. Scheinbar konnte keiner der Beteiligten eines der Instrumente spielen und es gab auch kein erkennbares rhythmisches Metrum. Völlig freies, totales Chaos! Es war wunderbar! Dieses Tonband spielte ich sogleich Frank und Whity vor, denen ich erzählte, ich hätte bei dem einen oder anderen Track mitgespielt, um damit anzugeben. Durch Ingos erlesene Plattensammlung lernte ich Bands kennen, die mir bis dahin völlig fremd waren und, wie mir schien, nur auf mich gewartet hatten. Das Spektrum reichte von Amon Düül II, Kraan, Velvet Underground, Ton Steine Scherben, Chick Coreas „Return To Forever“, bis zu Eberhard Webers wunderbarer Platte „The Colors of Chloë“. Seine Sammlung war ein reichhaltiger Schatz und ich besorgte mir einen Stapel neuer Tonbänder, um diese Platten „unterzubringen“.
Außerdem teilten Ingo und ich die gleiche Bewunderung für die Malerei Salvador Dalis. Mindestens jeden zweiten Tag ließ ich mich in der Hundestraße blicken. Darunter gab es Tage, an denen ich dort nur seine Schwester antraf, mit der ich dann die Sommernachmittage auf dem Balkon verbrachte.
Mit der Zeit bemerkte ich aber, wie das gegenseitige Interesse nachließ. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich würde Ingo langweilen. Er nannte mich einmal „Dicker“, denn durch die Mästung meiner Oma, die mich täglich mit Süßigkeiten und Limonade versorgte, was ich nicht ablehnte, hatte ich mittlerweile schwer zugenommen. Besonders nach der Episode mit meiner türkischen Liebe Yadigar, deren Ex-Mann mich eines Tages verprügelte, wodurch die Beziehung zu ihr in die Brüche ging, ließ ich mich gehen, fühlte mich aber trotzdem unfair behandelt. Und auch einige Äußerungen von André trafen mich empfindlich. Also zog ich mich zurück.
Vielleicht ein halbes Jahr später, Ingo war inzwischen nicht mehr mit Patti zusammen und wohnte wieder bei seinen Eltern, besuchte ich ihn und schenkte ihm eine Kunstpostkarte, die ich in einer Dali-Ausstellung im Lübecker Möbelhaus „Reese“ im Töpferweg gekauft hatte. Zwölf Jahre danach, als ich inzwischen als Taxifahrer in Lübeck arbeitete, sah ich Ingo ein paar Mal in der Stadt, wie er mit Frau und Kindern spazieren ging. Die Kinder waren noch klein. Ein anderes Mal schob er eines seiner Kinder in einem Buggy an meinem Taxi vorbei, als ich gerade auf einem Taxistand in der Königstraße auf Fahrgäste wartete. Ich sah ihm dabei zu, wie er die Karre in den Kofferraum seines Autos lud und davonfuhr. Heute arbeitet Ingo als angesehener Architekt mit eigener GmbH.
Pappnasen und Plastikbecher
Herbst 1977: Die vergangenen sechs Monate hatte ich in den Tag hineingelebt, und mittlerweile war mir klar, dass eine Fortführung meines erlernten Berufes mit der von mir erreichten Abschlussnote schwierig sein würde. Ich hatte bei Bewerbungsgesprächen bei der Firma MINIMAX in Bad Oldesloe und einer weiteren Firma, die sich in Travemünde befand, das Gefühl gehabt, den Anforderungen, die an mich gestellt wurden, nicht gewachsen zu sein, und war ganz froh darüber, keine Zusagen zu bekommen. Um so eine Situation nicht noch einmal erleben zu müssen, bewarb ich mich auf die nächstbeste Stelle, die mir das Arbeitsamt anbot. Es war eine Tätigkeit als Lagerarbeiter im Kunststoffwerk RODER in der Schwartauer Allee. Ich vereinbarte mit Herrn Sauter, dem Leiter der Versandabteilung, einen Termin zu einem Vorstellungsgespräch, und obwohl ihm meine Haarlänge missfiel, bekam ich den Job.
Meinen Arbeitsplatz teilte ich mit zwei Frauen, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Die jüngere von beiden war sportlich und attraktiv und hieß Brigitte. Sie passte nicht hierher und ich fragte mich immer, durch welche Umstände sie wohl zu dieser Arbeit gekommen war. Die andere stand rein äußerlich kurz vor dem Eintritt in das Rentenalter und war unfreundlich und grantig. Diese garstige Person entgratete von früh bis spät mit einem Messer kleine rote Plastikmundstücke, die RODER für die Alkohol-Teströhrchen des Drägerwerks herstellte. Sie umstellte den Platz, an dem sie arbeitete, mit einem Bollwerk aus großen auseinandergefalteten Pappkartons, die sie am Fußboden mit Klebestreifen befestigte, um so die neugierigen Blicke der Sekretärin des benachbarten Hauptbüros der Abteilung abzuwehren, das mit einem Panoramafenster ausgestattet war, durch das man unseren gesamten Tätigkeitsbereich im Blickfeld hatte. Dieser Arbeitsbereich befand sich am Ende eines langen Rollenlaufbandes, das die gesamte Fertigungshalle durchmaß und von dort aus mit Kartons bestückt wurde, die mit den unterschiedlichsten Artikeln gefüllt waren. Die Kartons kamen nach und nach am Ende des Laufbandes an, wurden dann von uns gewogen, zugeklebt und mit entsprechenden Aufklebern versehen, auf denen Artikelbezeichnung, enthaltende Stückzahl und der Bestimmungsort verzeichnet waren. Die versandfertigen Kartons, die europaweit verschickt wurden, stapelten wir dann auf Euro-Paletten. Wir verschnürten die Chargen und transportierten die Palettenpakete mit Hilfe von Hubwagen in das Warendepot, wo der Lagerverwalter Herr Krause das Zepter schwang. Er war herzkrank und von einer hektischen Unruhe erfüllt, die sich auf das Arbeitsklima und besonders für ihn selbst ungesund auswirkte. Während der fünfzehn Monate, in denen ich bei RODER beschäftigt war, fand man ihn einige Male nach Luft ringend auf Kartons liegend vor, wo es ihm manchmal so schlecht ging, dass er mit dem Notarztwagen in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zudem war er ein starker Raucher, was die Sache für ihn nicht besser machte. 1986, als ich mit meiner Freundin Gisela in Sereetz wohnte, erfuhr ich, dass er bis zur Rente im Kunststoffwerk gearbeitet hatte und kurz darauf an einem Herzinfarkt gestorben war.
Wie schon angedeutet war das Dumme an unserem Arbeitsplatz die Panoramascheibe des Leitungsbüros, durch die wir wie Tiere im Zoo ständig unter Beobachtung standen und das Verlassen unseres Arbeitsbereiches sofort registriert wurde. In diesem Büro residierte Herr Sauter in seiner Funktion als Abteilungsleiter mit seiner Sekretärin, einer spindeldürren Person um die fünfzig, die sich in ihrem Sekretärinnenstatus für etwas Höhergestelltes hielt, was sie täglich mit ätzender Arroganz und gestelzter Höflichkeit auskostete.
Ich hatte es mit meiner Tätigkeit als Lagerarbeiter noch gut getroffen, da ich mich in allen Bereichen der Firma frei bewegen konnte, ohne dass es auffiel. Deshalb unternahm ich manchmal kurze Ausflüge zu einem türkischen Arbeitskollegen, der ganz allein in einem separaten Raum Schrumpfschläuche in die vorgesehene Form brachte, um mit ihm ein Gläschen Raki zu trinken. Er war ein feinfühliger, friedlicher Mensch und lebte mit einer gewaltig übergewichtigen Frau zusammen, die sein eigenes Körpergewicht um ein Vielfaches übertraf. Sie arbeitete in einer Firma, die sich in der unmittelbaren Nachbarschaft von RODER befand. Ich sah die beiden nach Feierabend oft an der Bushaltestelle gemeinsam streiten, wobei seine Freundin nicht selten handgreiflich wurde und er grundsätzlich der Unterlegene war. Die Pein dieser Zwistigkeiten waren ihm gerade als türkischem Mann deutlich ins Gesicht geschrieben, und oft tat er mir deswegen ein bisschen leid. Mit dieser Frau war offenbar kein Glück zu finden.
Ein anderer Mitarbeiter, dessen handwerkliche Fähigkeiten ich hin und wieder in Anspruch nahm, verwaltete das Materiallager, das gegenüber der Stechuhr in der Nähe des Arbeitereingangs seine Räume hatte. Er lötete nach meinen Anweisungen die kleinen stählernen Einzelteile für eine winzige Haschpfeifen-Kreation zusammen, die ich zu der Zeit gern an Freunde weiterverschenkte. Er fand die Idee originell, der Konsum reizte ihn aber nicht. Von Herrn Krause war allerdings kein Sinn für Originalität zu erwarten und auch Humor war für ihn ein Fremdwort. Ihm ging es vor allem darum, seine Aufgaben unterwürfig und gründlich zu erfüllen, wodurch zwischen mir und ihm kaum persönliche Anknüpfungspunkte entstanden. Ich war für ihn eher ein Ärgernis, weil ich die Ernsthaftigkeit, mit der er zu Werke ging, nicht anerkannte. Es verging keine Woche, in der er mich nicht mehrfach von der Toilette holte, wohin ich mich häufig mit einem Buch zurückgezogen hatte, und es waren viele Bücher, die ich in dieser Zeit las wie „Der kleine Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“, bei dem ich allerdings nicht über das zweite Buch hinauskam, weil mir die Entwicklung der Geschichte zu langatmig war.
Zu den Artikeln, die die Firma RODER herstellte, gehörten unter anderem auch Joghurtbecher, die einmal wöchentlich von einem 38t-LKW abgeholt wurden, der die Ware dann nach Holland transportierte. Im Allgemeinen wurden die meisten Artikel von Speditionen abgeholt. Beschränkte sich die Lieferung aber auf das Lübecker Stadtgebiet, überbrachten wir die Erzeugnisse mit dem firmeneigenen LKW selbst. Der Fahrer des Wagens hieß Herr Schmidt und hatte große Ähnlichkeit mit Manfred Krug. Manchmal fuhr ich als Begleitung und Entladehilfe mit, was immer eine willkommene Abwechslung war, auch wenn Herr Schmidt nicht gerade eine Stimmungskanone gewesen ist. Eine unserer Standardtouren führte uns zu den Schwartauer Werken, für die RODER diverse Artikel herstellte, vom Kunsstoffbecher bis zum Drehverschluss für Fruchtsoßen- oder Nougatcremegläser. Diese weißen Deckel wurden in unserem Betrieb sogar mit dem Logo der Schwartauer-Werke bedruckt, einer roten Lübeck-Silhouette. Ein schöner Nebeneffekt der Touren zu den Schwartauer Werken war die Bruchware von Marzipan und Schokoladenleckereien, die sich im dortigen Lager in großen Gitterboxen befand, aus denen wir uns oft bedienten. Allein der betäubend süße Duft in diesem Lagerraum war ein Genuß für die Sinne.
Zu der Zeit war ich ein großer Fan der britischen Rockband „Genesis“, deren Liedtexte häufig skurile und geheimnisvolle Geschichten erzählten. Irgendwann fing ich an, sie auswendig zu lernen, und sie begleiteten mich durch die eintönig, identischen Arbeitstage. Während der acht Stunden sang ich mir viele der Songs im Geiste immer wieder vor. Diese Strategie half mir dabei, dass das Arbeitseinerlei mir nicht zu sehr auf das Gemüt drückte und machte es erträglicher. Besonders das Doppelalbum „The Lamb Lies Down On Broadway“ faszinierte mich von allen LPs dieser Band am meisten, sodass ich mich irgendwann daran machte, ein Drehbuch zu den Texten zu schreiben, das ich mit Heinz Hermanns Hilfe verfilmen wollte. Glücklicherweise wurde aus diesem Projekt nichts, denn durch den haschumwölkten Überschwang der Ideen, aus dem das Projekt geboren wurde, wäre am Ende sicher nichts anderes als ein unfreiwillig komisches Machwerk entstanden. Überhaupt war der regelmäßige, exzessive Konsum des Pfeifenkrauts in keinster Weise von Vorteil. Zu dieser Erkenntnis kam ich allerdings erst einige Jahre später, als ich merkte, dass es zu einer schal gewordenen Gewohnheit geworden war. Als ich nach fünf Jahren feststellte, dass ich nachts nicht mehr träumte, hörte ich von einem auf den anderen Tag damit auf. Doch bis dahin verging noch viel Zeit, und manch ein Rausch katapultierte mich an den Rand einer handfesten Psychose.
Spiegel
Zunächst jedoch beschäftigten mich andere Dinge, die mit Drogen nichts zu tun hatten. Durch meine Anstellung bei RODER, die damit verbundene Neustrukturierung meines Alltags und die körperlich anstrengende Arbeit verlor ich rasch meine überschüssigen Pfunde, die ich durch die Fütterung meiner Oma mir angefressen hatte, sah mittlerweile wieder ganz passabel aus und fühlte mich bedeutend wohler in meiner Haut als vorher. Allerdings war mein sehnlicher Wunsch nach einer festen Beziehung zu einer Frau noch nicht in Erfüllung gegangen. Dabei trennte ich zwei Dinge voneinander. Zum Einen die gemeinsame Gestaltung des Alltags neben der Arbeit, andererseits der gemeinsame Sex, der in meiner Vorstellung nichts mit Liebe zu tun haben musste. Allerdings fehlte mir der Mut und die Kühnheit für eine ausschließlich auf Sex ausgerichtete Beziehung, die ich mir problemloser vorstellte als das allgemein in den Himmel gehobene „durch Dick und Dünn gehen“ einer gewöhnlichen Zweierbeziehung.
Es muss im Sommer gewesen sein, denn an besagtem Tag trug ich neben einem weißen Hemd lediglich Jeans und Sandalen. Ich war in den Tremskamp gefahren, um Frank zu besuchen, zu dem ich nach wie vor regelmäßig Kontakt hatte. Bei diesen Besuchen traf ich meistens auch Stephan an, denn beide waren eng befreundet. Als ich klingelte, öffnete mir Franks Freundin die Tür. Wie sich herausstellte, waren er und Stephan nicht anwesend, dafür aber die Freundin von Stephan. Ich wurde hereingebeten und wir warteten dann gemeinsam auf die baldige Rückkehr der „Jungs“. Die beiden jungen Frauen, an deren Namen ich mich nicht mehr erinnere, waren sehr zarte, feingliedrige Wesen und sehr süß. Während wir in der sommerlich aufgeheizten Wohnung herumsaßen, fingen beide an, sich sehr zwanglos über ihren jeweiligen Freund zu beklagen. Sie beschwerten sich darüber, dass sowohl Frank als auch Stephan dem Sex in ihren Beziehungen den größten Stellenwert zukommen ließen, was den beiden Mädchen bei Weitem nicht genügte und ihnen inzwischen gehörig auf die Nerven ging. Sie waren sich einig, dass sie nicht die „Fick-Maschinen“ ihrer Freunde seien, wie sie sagten und wie es derzeit auch in einem angesagten Hit von Nina Hagen hieß. Erstaunt hörte ich mir ihre Klagen an und wunderte mich über ihre Offenheit, mit der sie gerade mir dieses Problem schilderten, wenngleich ich mich nicht gern dazu äußern wollte, denn genau davon träumte ich ja zur Zeit. Aber durch die Schilderung ihrer Perspektive hinterfragte ich meine eigene Einstellung und erfuhr auf diesem Wege, dass ich eigentlich genau wie meine Freunde tickte. Irgendwann tauchten dann die „Männer“ auf, und die beiden jungen Frauen machten ihrem Frust mit spitzen Bemerkungen Luft, während die Jungs wie immer herumalberten.
Dies war für längere Zeit die letzte Begegnung mit Frank, Stephan und den Mädchen. Im folgenden Jahr begegnete ich Frank noch zweimal in der Lübecker Innenstadt, wobei ich jedesmal einen eigenartig stechenden Geruch an ihm wahrnahm, bei dem ich wegen seiner Fremdartigkeit nicht sicher war, ob es sich um ein mir unbekanntes Parfüm oder das Resultat ungenügender Körperpflege handelte. Die kurzen Gespräche, die wir führten, waren oberflächlich und lediglich bei der letzten Begegnung erzählte er mir, dass er gerade vom Arzt käme. Offenbar hatte er ein Problem mit seinen Hoden, was ich mir aus seiner dahingenuschelten Begründug aber eher zusammenreimte, als dass er es tatsächlich erläuterte, denn er sagte etwas von „dicken Eiern“ und „zu vielem Ficken“. Anscheinend hatte sich in der Zwischenzeit bei ihm nicht allzuviel verändert. Erst kurz vor der Fertigstellung dieses Buches erfuhr ich, dass sich Frank damals mehrere Jahre dem Alkohol zuwandte, irgendwann von der Krankheit loskam, doch aufgrund einer gescheiterten Beziehung zu einer Frau derart in Verzweiflung geriet, dass er sich das Leben nahm. Er wurde keine dreißig Jahre alt.
Zwei Jahre nach der Episode im Tremskamp traf ich Stephan eines Abends im „Kaisersaal“, einer bekannten Lübecker Szene-Diskothek in der Eschenburgstraße. Nachdem ich ihm vom Wurf meiner Katze Anne erzählt hatte, verabredeten wir uns bei mir im Langen Lohberg, wohin ich inzwischen gezogen war, weil er gern ein Katzenbaby wollte, für sich und seine Freundin. Als sie dann in meinem Zimmer saßen, erzählte er mir, dass er inzwischen regelmäßig Gitarre spielen würde. Er bemerkte, dass meine alte Gitarre immer noch an der Wand hing und fragte mich, ob er mir etwas vorpielen dürfe. Ich war überrascht, wie gut er das Instrument zu spielen wusste. “Alice’s Restaurant Massacree“ von Arlo Guthrie jedenfalls ging ihm mit allen Finessen, die dieses Stück zu bieten hatte, perfekt von der Hand. Es war umwerfend! Noch während er spielte, bekam ich ein schlechtes Gewissen, denn mir fiel eine Episode aus der Vergangenheit ein, die mit Stephan und dieser Gitarre zu tun hatte, die schon damals an genau derselben Stelle an der Wand hing; zur Zierde allerdings, denn ich konnte keine drei sauberen Akkorde darauf spielen. Ich war vollkommen untalentiert und entwickelte auch kein Gefühl für dieses Instrument. Diese Unfähigkeit wollte ich mir und anderen jedoch nicht eingestehen. Deshalb blieb das Ding immer unberührt an der Wand hängen und wenn ich nicht darauf spielte, sollte es auch kein anderer tun. Aus diesem Grund verweigerte ich Stephan damals seinen Wunsch, einmal darauf spielen zu dürfen.
An diesem Nachmittag aber ließ ich mich von der Freude, die es ihm bereitete, anstecken. Obwohl ich in den vergangenen Jahren durch die Inspiration meiner Freunde Jimmy und Speedy ein ungezwungeneres Verhältnis zu selbstgemachter Musik bekommen hatte und ich manchmal in Gesellschaft durchaus auch die Gitarre zur Hand nahm, scheute ich mich aufgrund Stephans Glanzleistung im Gegenzug, auch ihm etwas vorzuspielen. Als an diesem Nachmittag Stephan und seine Freundin mitsamt einem Katzenbaby gegangen waren und ich dann allein in meinem Zimmer saß, erinnerte ich mich daran, dass ich am Tag von Whitys Einzug in den Langen Lohberg, worauf ich noch im Einzelnen zu sprechen komme, meiner Eitelkeit Futter gab, indem ich die Gitarre unter dem Vorwand in sein Zimmer trug, um hören zu wollen, wie das Instrument in diesem Raum klänge und dann doch nur unbeholfen irgendwelche Töne darauf zupfte.
Genauso ließ ich Whity seinem Bekunden nach halb wahnsinnig werden, als ich im Ausklang eines LSD-Trips in meinem Zimmer eine Ewigkeit damit zubrachte, meine Gitarre zu stimmen und mich dabei in den Intervallschwingungen verlor. Einfach lächerlich, aber in dieser Zeit waren meine Sinne ausschließlich auf mich selbst gerichtet und für alles und alle anderen verschlossen.
Beatrix
Die Maschine, an der die Schraubdeckel für die Nougatcreme mit dem Firmenzeichen der Schwartauer Werke bedruckt wurden, stand abseits in einem separaten Nebenraum. Dort arbeiteten zwei junge Frauen, die in den Ferien ihren Geldbeutel ein wenig auffüllen wollten. Eine von beiden trug eine aparte Pagenkopffrisur und weckte sofort mein Interesse. Weil sie mir nicht mehr aus dem Sinn ging, erfand ich in den folgenden Tagen wiederholt irgendeinen Vorwand, um den Raum betreten zu können. Hierbei ergaben sich einige Gelegenheiten zu einer Kontaktaufnahme. Es waren nur kurze Wortwechsel die Arbeit betreffend und somit nichts Besonderes, aber ich war froh darüber, dasss sie überhaupt stattfanden. Ihre Arbeitskollegin - schulterlange, dunkle Haare und sehr attraktiv - fragte mich eines Tages, ob ich eventuell ein günstig zu mietendes Zimmer wüsste, was ich aber lustlos verneinte. Im weiteren Gespräch stellte sich jedoch heraus, dass sie im Auftrag ihrer Kollegin fragte, die Beatrix hieß. Das änderte selbstverständlich alles und meine grauen Zellen fingen augenblicklich an zu arbeiten. Schon am nächsten Tag präsentierte ich den beiden die Idee, dass im Hause meiner Oma möglicherweise ein Zimmer frei wäre. Darin sah ich für mich die Großchance, Beatrix näher kennenzulernen und mobilisierte meine ganze Energie, meiner Oma die Idee schmackhaft zu machen, ein Zimmer zu vermieten. Beatrix befand sich in der Ausbildung zur Erzieherin an der Lübecker Dorothea-Schlözer-Schule, wie sie mir erzählte, und wünschte sich bereits seit geraumer Zeit nichts sehnlicher, als mit dem Erreichen der Volljährigkeit, bei ihren Pflegeeltern in Stockelsdorf auszuziehen.
Meine Oma für die Idee zu gewinnen war einfacher als ich erwartet hatte, und nach einem kurzen Treffen zu dritt bei Kaffee und Kuchen verabredeten wir, dass Beatrix in mein altes Dachzimmer ziehen würde, das genau über meinem Zimmer im „Flügel“ genannten zweigeschossigen Anbau des Hauses lag. Ich weiß noch, wie glücklich ich war, dass meine Oma ihre Einwilligung gab und ich Beatrix auf dem Treppenabsatz liebevoll umarmte, als ich sie hinunter in das Erdgeschoß begleitete. Sie wunderte sich entsprechend über meine Geste, denn so miteinander vertraut waren wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Eine gegenseitige Zuneigung entwickelte sich erst ein paar Wochen vor ihrem Umzug.
Nach dem Gespräch mit meiner Oma verabredeten wir uns ein paar Mal im Haus ihrer Pflegeeltern in Stockelsdorf, wo wir uns näher kamen. Bei diesen Besuchen lud sie mich in ihr Zimmer ein, das sie sonst mit ihrem Stiefbruder teilen musste. Wir lagen dann auf ihrem Bett und tauschten Zärtlichkeiten aus. Es war wundervoll!
Die größte Hürde bei unserem Vorhaben waren Beatrix‘ Pflegeeltern und hier besonders die Mutter. Sie stellte unseren Umzugsplänen einen ganzen Katalog von Argumenten entgegen und war nicht so einfach zu überzeugen. Als wir nach zermürbenden Stunden mit ihr unseren Plan schon „in trockenen Tüchern“ wähnten, spielte sie unverhofft eine letzte Trumpfkarte aus, indem sie behauptete, Beatrix wäre mit 18 Jahren lediglich halbmündig, weil sie ein Pflegekind sei, und wenn sie vorhabe umzuziehen, bedurfte es nicht nur einer Zustimmung der Pflegeeltern, sondern auch der des Jugendamtes. Danach war unsere Verzweiflung so groß, dass wir uns in ihrem Zimmer weinend in den Armen lagen.
Ich weiß nicht mehr, weshalb Beatrix Pflegemutter einige Tage später unsere Pläne schließlich doch akzeptierte, jedenfalls stand dem Umzug in den Tünkenhagen plötzlich nichts mehr im Wege und die Probleme, die sie uns bereitet hatte, lösten sich in Luft auf.
Intimer wurde es zwischen Beatrix und mir erst, als sie schon eine Weile im Tünkenhagen wohnte und es dauerte dann nicht mehr lange, dass wir die Nächte mitunter gemeinsam in meinem Bett verbrachten. Um ungestört zu sein, mussten wir allerdings gewisse Vorbereitungen treffen, denn meine Oma war neugierig und übergriffig wie eh und je. Sie nahm wohl an, dass sie mit uns genauso verfahren könnte, wie sie es in der Vergangenheit mit meinen Eltern getan hatte, die von 1958 bis 1970 ebenfalls im Tünkenhagen wohnten und in deren Räumen ich jetzt mit Beatrix lebte. Als meine Oma zum wiederholten Mal unter irgendeinem Vorwand und ohne angeklopft zu haben, mein Zimmer betrat, schob ich einmal das Schränkchen, in dem ich meine Schallplatten aufbewahrte, vor die Tür, um sie am Eintreten zu hindern. Sie war über die Barrikade sehr verärgert und zog sich verständnislos fluchend wieder in die oberen Wohnräume des Hauses zurück, nachdem ich ihr lautstark erklärt hatte, dass sie unsere Privatsphäre zu respektieren habe.
Es dauerte nicht lange und unser Alltag hatte etwas von einer echten Lebensgemeinschaft. Dieses Gefühl war für uns beide neu und wir genossen es in jedem Moment. Allein, dass mich Beatrix jeden Morgen zur Haustür begleitete, um sich dort von mir zu verabschieden, bevor ich zur Arbeit und sie in die Schule fuhr, erfüllte mich mit Stolz und Freude. Da ich Beatrix mit meiner Filmleidenschaft infiziert hatte, gingen wir an den Abenden oft ins Kino. Einmal sahen wir uns in den „Hoffnung-Lichtspielen“ Roman Polanskis Film „Der Mieter“ an, der uns zutiefst verstörte. Als wir an diesem Abend nach Haus zurückkehrten, stellten wir fest, dass bei uns eingebrochen worden war. Der Dieb war durch das Fenster im hinteren Teil unseres Zimmers eingedrungen, hatte ein paar Dinge umgeworfen, die herumstanden, und auch ein paar Schubladen durchsucht, aber nichts gestohlen. Ich erinnere noch, ein ungewohntes Geräusch im ersten Stockwerk gehört zu haben, als wir nach Hause kamen. Offenbar überraschten wir den Dieb, woraufhin er schnell das Weite suchte. Nachdem wir Kurt und meine Oma alarmiert hatten, verdächtigte meine Oma den seltsamen Jungen aus der Nachbarschaft, der in einem der Häuser im Bäckergang lebte. Sie erzählte, sie hätte ihn in der Vergangenheit einige Male dabei beobachtet, wie er auf den benachbarten Dächern umherkletterte. Während ihrer Schilderung erinnerte ich mich daran, dass mir dieser Junge ungefähr eine Woche zuvor begegnet war, als er auf dem Flachdach des Nachbarhauses stand, während ich mich gerade in meinem Schlafzimmer aufhielt. Er stand einfach nur da und starrte mit unbeweglicher Miene zum Fenster hinein, was mich sehr erschreckte. Als ich dann nach Kurt rief, verschwand er wieder. Der Junge bot eine unheimliche Erscheinung. Er war sehr hager und die Gesichtszüge ließen keine genaue Schätzung seines Alters zu. Die ganze Situation erinnerte mich im Nachhinein an eine Szene aus John Boormans Film „Beim Sterben ist jeder der Erste“, in der eine Gruppe von Kanufahrern unter einer Brücke hindurchfährt und dort von einem seltsamen Jugendlichen von dieser Brücke herab angestarrt wird. Kurz nach dem Einbruch montierte Kurt ein Metallgitter vor das Fenster, aber das Gefühl, selbst in privater Umgebung nicht sicher zu sein, erschütterte mein inneres Gleichgewicht so sehr, dass ich wochenlang nicht richtig schlief. Diese Angst behielt ich für mich und sprach auch nicht mit Beatrix darüber. Den unheimlichen Nachbarjungen bekam ich nicht wieder zu Gesicht.
Gespenster
Die Episode mit dem unheimlichen Jungen war nur der Auftakt zu erneuten unerklärlichen Ereignissen im Zusammenhang mit meinem Geburtshaus, denn im Tünkenhagen 22 gab es nach eigener Erfahrung über einen Zeitraum von 17 Jahren hinweg eine Kette von Begebenheiten, für die ich keine rationale Erklärung finde. Sicher bin ich mir hingegen, dass diese Phänomene für mich nur deshalb wahrnehmbar waren, weil sie direkt mit unserer Familie und dem Haus verknüpft waren, das sich bereits seit vier Generationen in unserem Besitz befand, und sich meines Wissens auch immer ausschließlich auf ein und dasselbe Zimmer beschränkten.
Angefangen hatte es mit äußerst aggressiven Zuständen, die ich an mir zum ersten Mal bemerkte, als ich neun Jahre alt war. Ich wohnte zu dieser Zeit in der unteren Etage des Flügels gemeinsam mit meinem Bruder und meinen Eltern, die den hinteren Teil als Schlafzimmer nutzten, das durch einen Vorhang vom vorderen Teil abgetrennt war, in dem mein Bruder und ich unsere Betten hatten. Während ich dort an meinem Schreibtisch saß, einer furnierten Holzplatte, die mit einem Klappmechanismus an der Wand befestigt war, und mich mit meinen Hausaufgaben beschäftigte, hatte ich plötzlich das Gefühl, als würde etwas Unbekanntes von außen auf mich einwirken, das in mir eine unerklärliche Wut auf alles um mich herum auslöste. Diese Wut steigerte sich so sehr, dass ich mit einem harten Gegenstand auf den metallenen Schirm meiner Schreibtischlampe einschlug, der dabei eine tiefe Delle davontrug. Kurz darauf legte sich mein Zorn wieder. Auch erinnere ich mich an heftige Albträume, von denen mir einer besonders in Erinnerung geblieben ist: Ich hatte eine Grippe und musste mit Fieber das Bett hüten, als ich träumte, dass ich aus dem Schlaf erwachte und durch den geöffneten Vorhang in das Schlafzimmer meiner Eltern sah. Dort lag meine Mutter schlafend auf ihrer Seite des Bettes. An der Stelle, wo eigentlich mein Vater hätte liegen sollen, erkannte ich den Umriss einer dunklen Gestalt, die im Bett sich aufrichtete und mich über den Körper meiner Mutter hinweg ansah. Die Erscheinung war von einer tiefschwarzen Farbe, die jegliches Licht absorbierte und in der Punkte schwammen, dass es schien, als blickte man in einen nächtlichen Sternenhimmel. Über der ganzen Szene lag ein dröhnendes Schweigen und vor Angst hörte ich das Blut in meinen Ohren rauschen. Vor Schreck erwachte ich und erbrach mich in den von meiner Mutter bereitgestellten Eimer.
Einige Jahre später entdeckte ich in einer alten „Hit-Comic“- Ausgabe eine ganz ähnliche Darstellung eines mysteriösen Wesens, was mir einen kalten Schauer über den Rücken jagte, weil es mich an meinen Traum erinnerte.
Und auch nun, da ich zusammen mit Beatrix dieses Zimmer bewohnte, war es mir wochenlang nicht möglich, nachts ruhig zu schlafen, weil vom Dachgarten und den Räumen, die sich genau über unserem Zimmern befanden, immer wieder Geräusche zu hören waren, die wie Schritte klangen. Ich stand jede Nacht auf, streifte durch das Haus und spähte durch das Fenster zum Dachgarten, konnte aber nie jemanden entdecken. Irgendwann hörte es so plötzlich auf wie es gekommen war. Was aber einige Wochen später sich ereignete, war weitaus verstörender als die unerklärlichen Geräusche: Als Beatrix und ich eines Abends ein kleines Stückchen Haschisch geraucht hatten, verschluckte sie sich am Rauch der Pfeife und musste stark husten. Sie bekam kaum Luft und hatte Angst zu ersticken, wodurch sie in Panik geriet und sich nur schwer beruhigen ließ. In der Hoffnung, dass frische Luft ihr gut täte, machte ich den Vorschlag, ein wenig spazieren zu gehen, sie aber wollte sich lieber hinlegen. Nachdem ich sie zu Bett gebracht hatte, ließ ich sie ein paar Minuten im Zimmer allein, um auf die Toilette zu gehen, die im Erdgeschoss in einem engen Anbau installiert worden war. Um dorthin zu gelangen, musste ich über den schmalen Hof gehen, der sich zwischen der Eingangsdiele des Hauses und dem Toilettenanbau befand. Im Falle, dass Beatrix nach mir rufen sollte, ließ ich Hof- und Toilettentür offenstehen. Ich war noch nicht lange auf der Toilette, als ich die Stimme meiner Oma meinen Namen sagen hörte, als würde sie direkt vor mir stehen. Einen Wimpernschlag später schrie Beatrix um Hilfe. Ich lief nach oben und fand sie weinend und starr vor Schreck im Bett vor. Sie war völlig in Tränen aufgelöst und erzählte mir, sie hätte eine Frau gesehen, die im Zimmer stand und in ihren Händen ein großes Kissen trug, auf dem ein nacktes Baby lag. Dieser Bericht erschreckte mich so sehr, dass ich mich augenblicklich zu ihr ins Bett legte. Auf diese Weise hoffte ich, sie zu beruhigen und auch die Angst unter Kontrolle zu bringen, die mich inzwischen ergriffen hatte. Wir lagen dann mit klammem Gefühl in unserem Bett und müssen irgendwann eingeschlafen sein. Nach diesem Erlebnis wohnten wir noch ein paar Monate im Tünkenhagen, ohne dass es irgendwelche ungewöhnlichen Vorkommnisse gab und zogen dann um in den Langen Lohberg.
1983, nach dem Tod meiner Oma, begann mein Vater mit Hilfe meines Bruders, das Haus von Grund auf zu renovieren. Nach der Modernisierung zog mein Bruder in die erste Etage des Hauses und mit Ausnahme des Flügels, der meinem Vater als Lagerraum diente, erschien das Haus in neuem Gewand. Irgendwann machte mein Vater sich daran, auch diesen Raum zu sanieren und entfernte die abgehängte Zimmerdecke, die irgendwann dreißig Zentimeter unter der ursprünglichen Decke eingezogen worden war, um Heizkosten zu sparen. Da das Haus seit jeher von Ratten bevölkert war, die in den Hohlräumen der Fußböden und Zwischendecken herumhuschten, wunderte ihn der trockene Kot und die kleinen Knochenstücke wenig, die ans Tageslicht kamen. Irgendwann jedoch zog er aus dem Hohlraum der Decke zwei skelettierte menschliche Schädel hervor.
Dieser Fund sorgte in unserer Familie für große Aufregung und überraschende Reaktionen. Als Martina, die Halbschwester meiner Mutter davon hörte, alarmierte sie die Polizei, ohne uns darüber zu informieren, woraufhin plötzlich zwei Beamte vor unserer Tür standen. Wir übergaben den beiden Männern die Schädel, die dann den Fund zur näheren Untersuchung an das Hamburger „Institut für Humanbiologie“ weiterreichten. Nachdem wir die Schädel zusammen mit einem medizinischen Gutachten unversehrt wieder zurückbekamen, beerdigten wir sie ein paar Jahre später in Reinfeld am Stamm eines Gingkobaumes im Garten meiner Mutter. Nachdem die Schädel geborgen waren, gab es nach meinen Informationen keine unerklärlichen Geräusche oder Erscheinungen mehr im Tünkenhagen.
Abenteuer in der Silvesternacht / 1
Beatrix und ich waren von einem jungen Paar zu einer Silvesterparty nach Stockelsdorf eingeladen worden, dessen weibliche Hälfte Beatrix von der Erzieherschule her kannte. Am frühen Abend standen wir mit unserem Beitrag zum Buffett vor ihrer Tür und wurden freudig empfangen. Wir hatten auch ein Stückchen Haschisch mitgebracht, von dem Beatrix und ich im Laufe des Abends auf der Toilette ein Pfeifchen rauchten. Nach dem Essen spielten wir irgendwelche Spiele, bis es, beeinflusst durch den Alkohol, zu einem Streit zwischen den Gastgebern kam, in dessen Verlauf er seiner Freundin gegenüber handgreiflich wurde und sie sich vor Angst im Badezimmer einschloss. Alle Versuche, ihn zu beruhigen, verpufften wirkungslos. Er lief wütend aus der Wohnung, schlug von außen mit der Faust das Badezimmerfenster ein und verletzte sich dabei an der Hand. Während ich ihm half, die Hand zu verbinden, kümmerte sich Beatrix um die weinende Freundin. Als unsere Gastgeber sich wieder beruhigt hatten, beschlossen wir, nach Haus zu fahren. Es war noch vor Mitternacht, als wir wieder im Tünkenhagen ankamen. Um dem missglückten Silvesterabend doch noch eine gewisse Symbolkraft abzuringen, begaben wir uns nach draußen auf den Dachgarten und ließen dort die einzige Rakete in den Himmel steigen, die ich für diesen Zweck zu Haus gelassen hatte. Das übrige Feuerwerk befand sich noch in Stockelsdorf - wir hatten es in der fremden Wohnung vergessen. Nach diesem Abend gab es kein gemeinsames Treffen mit den beiden Namenlosen mehr.
1978
Risse
Im Frühjahr wurde meine Oma mit einer Lungenentzündung in ein Lübecker Krankenhaus eingeliefert. Möglicherweise hatte sie sich auf dem kalten, unbeheizten Dachboden erkältet, als sie dort Wäsche zum Trocknen aufhängte. In einem Telefongespräch, dass ich daraufhin mit meiner Mutter führte, machte sie allein Beatrix dafür verantwortlich und behauptete: „Wenn dieses dumme Mädchen nicht im Tünkenhagen wohnen würde, hätte Oma deutlich weniger Wäsche zu waschen gehabt“ und somit weniger Zeit zum Aufhängen benötigt. Am Tag darauf erschien meine Mutter, um im Tünkenhagen nach dem Rechten zu sehen. Bekleidet mit einem grünen Staubkittel, wie meine Oma ihn zu tragen pflegte, fuhrwerkte sie mit dem Staubsauger feldwebelgleich durch das Haus und versuchte, uns gleichzeitig mit ihren Blicken zu töten.
Nach dieser Performance beschlossen Beatrix und ich, uns nach einer eigenen Wohnung umzusehen und aus dem Tünkenhagen auszuziehen. Schon kurz darauf bot sich eine Gelegenheit, denn Ralf S., der mit seiner Freundin Lisa seit einiger Zeit im Langen Lohberg wohnte, war überraschend aus der Stadt verschwunden und hatte sie mitsamt der Wohnung sitzengelassen. Da Lisa die Wohnung allein nicht behalten wollte, nutzten wir diese Chance und brachten alles Nötige auf den Weg, um sie uns als Nachmieter zu sichern. Die Formalitäten waren schnell erledigt, und schon bald waren wir im Besitz des ersten eigenen Wohnungsschlüssels. Nach der Unterzeichnung des Mietvertrages waren Beatrix und ich in aufgekratzter Stimmung, sodass wir mit drei Matratzen unter den Armen in unsere neue Wohnung einzogen, um uns endlich einmal ungestört lieben zu können. Angeheizt von der eigenen Fantasie wurde Sex in den folgenden Monaten zu einer ungeheuer starken Triebfeder in unserer Beziehung und zu einem weiten Experimentierfeld, mal süß mal salzig. So verbrachten wir auch in den folgenden Tagen nach unserem Umzug die meiste Zeit im Bett. Als meine Oma nach ihrer Genesung wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, waren wir bereits ausgezogen.
Für Beatrix und mich brach jetzt eine Zeit an, die wir zu hundertzwanzig Prozent auskosteten. Wir gingen nach wie vor häufig ins Kino, fuhren zum Baden an die Wakenitz oder zum Spazierengehen in den Wald und trafen uns mit Whity, um zu rauchen.
Unsere Wäsche brachten wir trotz allem weiterhin zu meiner Oma und kamen damit einem Angebot nach, das sie uns gemacht hatte. Wir konnten uns ohnehin von dem wenigen Geld, das uns zur Verfügung stand, keine großen Sprünge erlauben. Allein die Miete für die Wohnung verschlang schon 320.- DM im Monat, sodass die Anschaffung einer Waschmaschine völlig ausgeschlossen war, und auf die Idee, mit unserer Wäsche ein Waschcenter aufzusuchen, kamen wir nicht.
Die im Erdgeschoss gelegene Drei-Zimmer-Wohnung im Langen Lohberg erwies sich als überteuerte Bruchbude. Die zweite Küchentür, die zum Hinterhof führte, ließ sich während der vier Jahre, die ich dort wohnte, nicht richtig schließen und war lediglich mit einem Metallhaken verriegelt. Mit der Zeit verzog sie sich immer mehr, sodass im Winter unentwegt eiskalte Zugluft durch die undichte Tür eindrang. Auch die Küche selbst war ein Ärgernis. Sie befand sich in einem kleinen Anbau, dessen Teerpappendach mit den Jahren mürbe geworden war und Wasser hindurchließ. Zu Anfang bildete sich an der Küchendecke ein kleiner gelbbrauner Wasserfleck, der rasch an Größe zunahm. Es entstanden Risse im Putz, von dem Stück um Stück hinunterbröselte, bis am Ende ein handtellergroßes Loch in der Decke entstanden war, durch das man die Strohdämmung sehen konnte und die Feuchtigkeit ungehindert eindrang.
Ursprünglich war die Wohnung einmal größer gewesen, aber von den Besitzern in zwei ungleiche Hälften geteilt worden, um die Mieteinnahmen zu steigern. Die Eingangstür der neu entstandenen Zwei-Zimmer-Wohnung führte genau wie die meine hinaus auf den Durchgangsflur, über den man sowohl die Straße als auch das Hinterhaus erreichen konnte. In diesem Hausflur befand sich gegenüber meiner Eingangstür das Treppenhaus in das erste Stockwerk, wo Frau Schepke wohnte, eine verhutzelte Dame, die geschätzte achtzig Jahre alt war.
Ebenfalls im Flur war drei Stufen in der Tiefe unter der Treppe eine Toilette installiert worden, die zu meiner Wohnung gehörte, deren Tür sich aber nicht abschließen ließ, sodass man immer damit rechnen musste, dass jemand unverhofft die Tür öffnete, wenn man einmal dort unten saß. Im Winter 1978 / 79 war es so kalt, dass in der Toilette ein Rohr brach und der Raum sich einen Meter hoch mit Wasser füllte, das dann gefror. Der Anblick der unter der Eisdecke eingeschlossenen Toilettenschüssel war reine Poesie und strahlte eine angenehm stille Friedlichkeit aus. Nur leider habe ich es versäumt, davon ein Foto zu machen.
Aber die Wohnung hatte noch mehr zu bieten. So war die Trennwand zwischen dem der Küche vorgelagerten Durchgangszimmer und dem angrenzenden Wohnraum der Nebenwohnung nur aus einer einfachen Bretterlage ohne Dämmung errichtet und von meiner Wohnungsseite her zusätzlich mit einer groben Markisenstoffbahn bespannt worden, die außerdem mit einer Tapetenschicht beklebt war. Diese Stoffbahn war nicht, wie man es hätte erwarten können, direkt auf dem Holzuntergrund befestigt worden, sondern sozusagen freihängend mit einem Zentimeter Luft dazwischen an eine zusätzliche Holzleiste genagelt, die sowohl direkt unter der Zimmerdecke als auch in Bodennähe an den Holzbrettern befestigt war. Berührte man diese Wandfläche, schwang sie leicht hin und her und rief so ein diffuses Schwindelgefühl hervor. Diese Maßnahme der Besitzer erwies sich nicht nur durch ihre Flexibilität als albtraumhaft, sondern auch, weil durch die geringe Wandstärke aus der Nebenwohnung jegliches laute Geräusch und selbst Gespräche deutlich hörbar und zu verstehen waren. Die Fenster waren allesamt einfach verglast, was im Winter zwar für die schönsten Eisblumen an den Scheiben sorgte, die Räume aber nicht besonders warm werden ließ.
Wie ein schlechtes Omen ergoss sich eine Woche nach unserem Einzug ein Wasserschwall durch das Fenster des Durchgangszimmers, weil die Regenrinne verstopft war und ein kräftiger Regenschauer niederging. Dieser Wassereinbruch sorgte für einen weiteren großen Fleck an einer der Zimmerdecken und begleitete unser Leben in der Wohnhöhle noch lange Zeit. Erst viel später, Beatrix wohnte schon nicht mehr mit mir zusammen, versuchte ich die Spuren des Desasters mehr recht als schlecht mit Farbe zu übertünchen.
Die Missstände waren frappierend, aber offenbar entwickelten wir mit steigendem Haschischkonsum eine innere Faultiermentalität, sodass keiner von uns je etwas unternahm, die Verhältnisse grundlegend zu ändern. So marode, wie sich unsere Wohnung präsentierte, so offenkundig zeigte unsere Lebensgemeinschaft durch vermehrte Streitigkeiten über mein Verhältnis zu meinen Eltern bald erste Entfremdungserscheinungen. Ich hatte den Eindruck, dass Beatrix mir die eigenen Eltern neidete, da sie weder ihre leibliche Mutter noch ihren Vater je kennengelernt hatte. Auch besaß sie keine wirklichen Freunde, abgesehen von ein paar Bekanntschaften aus der Erzieherschule, von denen sie aber nur hin und wieder etwas erzählte und die ich auch nie kennenlernte. Ihr Bekanntenkreis war noch kleiner als meiner, was dazu führte, dass sie irgendwann selbst meine Freundschaft zu Whity misstrauisch beäugte, begleitet von heftigen Auseinandersetzungen.
Summer in the City
Der Sommer kam mit großer Hitze, und in der Stadt machte sich eine als gute Laune getarnte Hysterie breit. Scharenweise zogen Menschen aller Altersgruppen an den Fenstern unserer Wohnung vorbei, um im nah gelegenen Stadtpark sich auf den Wiesen zu räkeln oder an die Ostsee zu fahren. „Summer in the City“ – ein für mich seit jeher fremdes Empfinden, dem ich auch jetzt nichts abgewinnen konnte. Deshalb glaube ich auch, dass unsere Idee, nach Travemünde zu fahren, eher dem allgemeinen Herdentrieb als dem freien Willen entsprang. Als wir in den Bus stiegen, der uns an die See bringen sollte, wurde mir klar, dass die ausgewaschene Cord-Kapuzenjacke, die ich trug, für diese Jahreszeit viel zu warm war. Dass der Reißverschluss nur bis auf Brusthöhe sich öffnen ließ, machte die Sache nicht besser.
Diese Jacke hatte einmal Ralf S. gehört und wurde von ihm genau wie eine alte Holzbank, die ich heute noch besitze, bei seinem Auszug in der Wohnung im Langen Lohberg zurückgelassen; zusammen mit einigen seiner Bleistiftskizzen an den Zimmerwänden. Die Bilder zierten noch ein Jahr lang die Wände unserer Wohnung, bevor ich sie übermalte. Ralf S., der auch ReRei genannt wurde, war eine ambivalente Gestalt in meinem Leben. Zum ersten Mal hatte ich ihn zwei Jahre zuvor beim Lübecker Straßenmusik-Festival wahrgenommen, wo mein Freund Wolli an einem kleinen Stand in der Fußgängerzone Müsli mit Milch an die Besucher verkaufte.