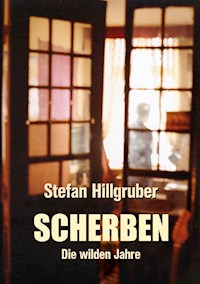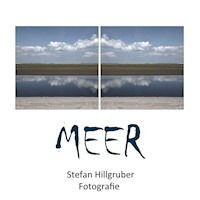Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Erinnerungen an meine Kindheit und Jugend in einem Haus auf der Altstadt-Insel Lübecks umfassen den Zeitraum von 1958, dem Jahr meiner Geburt, bis 1977, als ich meine Lehrzeit beendete. Sie sind ein Versuch, das Leben der 1960er und 1970er Jahre in Lübeck und zwischenzeitlichen Lebensstationen in Itzehoe, Hamberge und Reinfeld durch die Augen eines Kindes und Heranwachsenden zu betrachten und mit den Gedanken eines Erwachsenen aus heutiger Sicht zu verbinden. Dabei spielen die anfänglichen Lebensumstände in einem Mehrgenerationenhaus und den Straßen Lübecks sowie meine persönlichen Gedanken zu dem täglichen Familien-Theater eine tragende Rolle und ich hoffe, dass nicht nur Menschen meiner Generation sich in ihnen wiederfinden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Ehefrau Gisela und unsere Kinder
Was nicht vergessen wird, lebt.
Frances McDormand (Nomadland)
Inhaltsverzeichnis
Kapitel Eins
Erste Erinnerungen
Mein Geburtshaus
Geschichte und Geschichten
Tante Anni
Bilder und Bücher
Fassaden
Onkel Kurt
Unser Garten
Menschen im Tünkenhagen
Blut und Seife
Kuscheltiere
Kinderspiele
Das grüne Leuchten
Neue Welten
Die Zone
Weihnachtsgedichte
Feuerwerk
Kapitel Zwei
Das Aufnahmegespräch
Schulalltag
Mitschüler
13!
Modellbau
Achtung Aufnahme!
Cliquenwirtschaft
Im Kino gewesen
Martin, bitte den Mantel!
Kapitel Drei
Die Sonne geht auf
Kapitel Vier
Das Dachzimmer
Himmel und Hölle
Die Internationale
Hans-Jürgen
Warten ist schwer
Kapitel Fünf
Neue Heimat
Wir leben modern
Staubige Aussichten
Die Kiesgruben
Schlangenjagd
Ein Fahrradwettrennen
Das Blockhaus
Ein totes Eichhörnchen
Ferienbesuch
Die Alte Meierei
Jens
Telke
Schule schwänzen
Seegang
Ortswechsel
Kapitel Sechs
Hamberge
Rückzugsorte
Schulwechsel
Konfirmation
Kapitel Sieben
Ungewisse Zukunft
Umzug in die "Freiheit"
Reinfelder Nächte
Im Schneckentempo
Meister, Gesellen, Lehrlinge
Feilen, feilen, feilen
Mach mal Pause
Klassenkrampf
Herr Schmidt
Yadigar
Ayşe
Freak Out
I
Erste Erinnerungen
Im Alter von drei oder vier Jahren ging ich an einem warmen Sommertag an der Hand meiner Oma einen breiten Sandweg entlang. Beide Seiten des Weges waren von Gärten gesäumt. Ich musste nötig "pullern". So sagten die Erwachsenen damals zu uns Kindern, wenn man pinkeln musste. Irgendwo muss ich mich dann auch erleichtert haben, aber ein paar Tropfen gingen wohl in die Hose. Daraufhin stopfte mir meine Oma einige Tempo-Taschentücher in die Hose, und wir gingen weiter. Die Taschentücher drückten unangenehm und störten mich beim Laufen.
Im Winter bin ich mit meiner Mutter im Park in der Nähe der Rehderbrücke gewesen. Hier verbindet der Düker-Entwässerungskanal die Wakenitz mit dem Elbe-Lübeck-Kanal. Wir fütterten dort Enten, Schwäne und Zappies* mit trockenem Brot. Ein großer, heller Vogel flog dicht über meinem Kopf vorüber. Ich erkannte deutlich sein Gefieder. Es war weiß und hatte braune Flecke. Meine Mutter erklärte mir, dass es eine Eule gewesen war, deren Gefieder mit Öl verschmutzt sei.
* Zappies – Blässhühner
Mein Geburtshaus
Man sagt, dass es ein kalter, grauer Tag war, als ich am 10. November 1958, um 6.00 Uhr in Lübeck als Kind des Ehepaares Hannelore und Manfred Mielenz geboren wurde. Es ist eine, für die damalige Zeit übliche Hausgeburt gewesen. Praktischerweise wohnte die zuständige Hebamme, Frau Metha Meier, drei Häuser weiter in der Nachbarschaft.
Mein Geburtshaus im Tünkenhagen 22 war zu diesem Zeitpunkt bereits vierhundert Jahre alt. Im Jahre 1597 erwarb es eine sogenannte Schmiedegerechtigkeit, was bedeutet, dass dem jeweiligen Haus- und Grundstücksbesitzer das Recht, bzw. Vorrecht, eingeräumt wird, auf seinem Grund und Boden eine Schmiede zu betreiben. Über das 17. und 18. Jahrhundert ist bekannt, dass hier 1766 Johann Daniel Bruder wohnte. Er war von Beruf Schlosser und gab das Haus 1797 an seinen Sohn Herman Gottfried Bruder weiter, der ebenfalls Schlosser war und im Jahr 1828 starb. Die Lübecker Adressbücher der Jahre 1797, 1798 und 1801 verzeichnen allerdings keine Personen mit dem Namen Bruder, die in dieser Zeit im Tünkenhagen 22 gewohnt haben. Der mögliche Grund dafür ist, dass in den Adressbüchern zwar die Namen der Mieter, aber nicht die der Eigentümer standen.
Das Haus war, wenn man den Dachboden mitrechnet, zweigeschossig, zu dem im hinteren Teil des Gebäudes ein zweigeschossiger Anbau hinzukam, dessen Entstehungszeit unbekannt ist, und der auf halber Höhe zwischen Erdgeschoss und erster Etage, sowie zwischen erster Etage und Dachgeschoss jeweils ein Zwischengeschoss bildete, das je zwei Zimmer besaß. Dieser Anbau, von allen Familienmitgliedern "Flügel" genannt, war auf den sich im Hof befindenden, bereits bestehenden Keller gebaut worden, der nach oben hin ungefähr. einen Meter über das Bodenniveau des Erdgeschosses hinausreichte.
Betrat man das Haus, gelangte man über einen Flur in eine Diele. Von hier, gleich links durch die Tür, kam man in das Wohnzimmer meiner Eltern. Gleich daneben, ebenfalls von der Diele aus zu erreichen, befand sich eine kleine Küche, die in erster Linie von ihnen genutzt wurde. Der Raum besaß eine Schiebetür, die der Tischler Fred Hengelhaupt in den 1950ger Jahren einbaute, nachdem die alte, historische, zweiflügelige Tür, die sich vormals an der Stelle befand, aus Modernisierungsgründen entfernt wurde. Eine möglicherweise jahrhundertealte Tür in einem denkmalgeschützten Gebäude gegen eine räudige Schiebetür auszutauschen, an der man sich nach Aussage meiner Mutter, des Öfteren Splitter in die Finger riss, ist aus heutiger Sicht ein nicht wiedergutzumachender Frevel. Aber damals war modern eben schick und der Wert eines solchen Gegenstandes, im Bewusstsein meiner Oma, die das Haus besaß, offenbar nicht verankert. Neben der Küche führte eine massive Holztreppe in den "Flügel" und weiter in das erste Stockwerk, in dem meine Oma und Kurt Wien, ein Zimmermann und mittlerweile enger Freund der Familie, der seit 1936 in diesem Haus wohnte, ihre Küche bewirtschafteten. Dort befanden sich drei Türen, wovon eine in das winzige Zimmer führte, in dem Kurt bis zum Tod meiner Oma in Jahr 1983 wohnte. Sein Zimmerfenster zeigte auf den Hinterhof mit Blick über die verwinkelten Lübecker Altstadtdächer. Die andere Tür führte in zwei Zimmer, die meine Oma bewohnte und deren Fenster in Richtung Straße blickten. Durch die dritte Tür gelangte man über zwei aufwärtsführende Stufen in den oberen Teil des Flügelanbaus, der dort, außer zwei Zimmern, noch einen Zugang zum Dachgarten aufwies. Diese Zimmer hatten zu unserer Hofseite hin eine Dachschräge. Ferner führte neben der Tür zum Flügel eine schmale, schiefe Stiege zum Dachboden hinauf, der im Krieg und auch noch Jahre danach von verschiedenen Mietern bewohnt wurde. Einer von ihnen war Herr Meier, in meiner Erinnerung stets schwarz gekleidet, mit Hut und Zigarre. Der Dachboden selbst ließ sich mit einer Bodenluke verschließen, die von der Treppenseite aus nach oben hin aufgedrückt wurde, von der Bodenseite aber mit einem Seilzug geöffnet werden musste, der über einen Block geführt wurde, wie man ihn von Segelschiffen her kennt, und an dessen Ende zwei miteinander verknotete Metallhanteln als Gegengewicht hingen. Auf dem Dachboden, den ich später ausgiebig erkundete, als dort niemand mehr wohnte, gab es einen separaten, in der Nachkriegszeit eingebauten Raum, der sowohl zur Straße als auch zum Dachboden hin Fenster besaß. Mit einer Leiter konnte man von außen auf die Zimmerdecke hinaufsteigen, über der sich eine Dachluke befand, die der Schornsteinfeger benutzte, um auf das Dach zu klettern, wenn er den Kamin kehrte. Außerdem lagerte auf dem Dachboden das Zimmermannswerkzeug von Kurt, den alle Familienmitglieder Onkel Kurt nannten. Manche der Gerätschaften waren bereits von einer zimtbraunen Rostschicht überzogen und lagen vermutlich schon lange unangetastet in den Regalen.
Im Erdgeschoss, rechts neben der Treppe, öffnete sich die Hoftür zu einem schmalen Hinterhof von vielleicht zehn Meter Länge und ca.2,00 Meter Breite, an dessen Ende sich ein weiterer Anbau befand, in dem ein Abstellraum für Fahrräder und ein Plumpsklo untergebracht waren, das später, ich muss vier oder fünf Jahre alt gewesen sein, einem Wasserklosett Platz machte. Diese unbeheizte Toilette mit einem kleinen Waschbecken, einem Spiegel an der Wand und einem Handtuchhalter war die einzige im ganzen Haus und wurde von allen Bewohnern gleichermaßen benutzt. Hinter den Fahrrädern, die dort standen, existierte eine Luke, hinter der sich ein Hohlraum befand, der unter dem hinteren Teil des Flügels lag und vom Keller durch eine Mauer getrennt war. Ich leuchtete einmal mit einer Taschenlampe dort hinein, als die Fahrräder in Gebrauch waren, aber außer einem Haufen Bauschutt und einem alten hölzernen Wagenrad war dort nichts zu sehen, noch ließ sich wegen des Gerümpels die Größe des Raumes abschätzen.
Ich erinnere mich, dass der Hof im Winter so zuschneite, dass sich die Toilettentür sowie auch die Hoftür selbst nur mit Mühe öffnen ließen und der Hof erst einmal vom Schnee geräumt werden musste, bevor die Toilette benutzt werden konnte. Genauso lebhaft wie an den verschneiten Hof erinnere ich mich an die kalte Angst, die mich überkam, wenn meine Oma mich in diese kalte Toilette zerrte und darin einsperrte, hatte ich wieder einmal etwas getan, dass ihrem Sinn für gutes Benehmen widersprach. Protest von Seiten meiner Mutter wurde nicht geduldet. Sie musste dabei zusehen und hören, wie ich verzweifelt mit Händen und Füßen gegen die Tür trommelte.
An der Wand zum Toilettenanbau war eine Traufe befestigt, unter deren Ende eine Wassertonne stand, die das Regenwasser auffing. Der übrige Regen floss durch ein kleines Rost in die Kanalisation, aus dem wir im Sommer die Ratten quieken hörten.
Festtagsabhängig tummelten sich in unserer Diele oder auf dem Hof aber auch Tiere, die früher oder später geschlachtet und verspeist wurden. Kurz vor Weihnachten waren es Karpfen, die dann eine Zeit lang in einer großen Zinkwanne schwammen. Aber auch an Aale und einen Hecht erinnere ich mich. Der war aber schon tot und brauchte keine Wanne mehr. Für den größten Nervenkitzel sorgten allerdings die Hasen, die meine Oma manchmal mitbrachte und die dann tot an der Teppichstange hingen, an der mein Bruder und ich später Klimmzüge übten.
Die Hasen band man dort an, bevor man ihnen buchstäblich das Fell über die Ohren zog. Dazu machte man zunächst zwei Schnitte an den Hinterbeinen und zog ihnen, von dort aus beginnend, den Balg ab. Mit Grausen und Interesse verfolgte ich jedes Mal dieses Schauspiel und wünschte mir dabei, dass die Prozedur so unblutig wie möglich vonstattenging. Ich erinnere mich an die dünne, bläulich schimmernde Haut, die nach dem Abziehen des Fells zutage trat, und stellte mir die Eingeweide vor, die sich darunter befanden, in der Hoffnung, dass sie nicht beschädigt werden.
Geschichte und Geschichten
Als meine Mutter am Montag, dem 8. Mai 1933 geboren wurde, konnte noch keiner vorhersehen, dass dieser Tag in der Zukunft weltgeschichtlich bedeutsam werden sollte. Genausowenig wie nur wenige an diesem Tag wohl ahnten, was ein paar Jahre später geschehen würde, obwohl der Plan zu diesem kommenden Weltenbrand vermutlich im Kopf eines verhinderten Kunstmalers und Gefreiten des sogenannten Ersten Weltkrieges bereits heranreifte und in der Folge seiner Ereignisse die ganze Welt mit grauer Asche überziehen sollte.
Der Vater meiner Mutter, Martin Friedrich Hammer, war nach russischer Zeitrechnung am 12. September 1906 in Rosengarten, einer deutschen Siedlung im Kreis Jekaterinoslaw, heute Dnepopetrowsk, in der Ukraine zur Welt gekommen. Nach westlicher Zeitrechnung wäre dies der 25. September 1906 gewesen. Seine Eltern zählten zu den sogenannten Schwarzmeerdeutschen, womit die Bewohner deutscher Ansiedlungen am Nordufer des Schwarzen Meeres und der angrenzenden Dnepr-Region gemeint sind. Sein Vater, Johann Petrowitsch Hammer, wurde im Jahre 1876 geboren, seine Mutter, Elisabeth Hammer, geb. Weiss, im Jahre 1881. In den Akten des Melderegisters werden beide, wie es wohl damals üblich gewesen ist, als preußische Untertanen geführt. Die Trauung der Eltern, vollzogen von Pastor Waldemar Kaufmann, fand am 30. Oktober 1904 in Josifowka statt. Elisabeth litt an einer Sonnenlichtallergie und starb bereits mit 54 Jahren. Martin hatte fünf Geschwister: Fritz, Johann, Helene, Mariechen und Lisa. Im Laufe der Jahre 1917 oder 1918 musste die Familie aus der Ukraine fliehen. Der Grund dafür war die Abdankung des letzten russischen Zaren Nikolaus II. am 15. März 1917. Der Zar war den Deutschen gegenüber immer freundlich gesonnen und betrieb viele Jahre eine rege Ansiedlungspolitik in der Schwarzmeer-Region, bis die Februarrevolution seine Pläne für null und nichtig erklärte. Die Reise der Familie Hammer ging über Ostpreußen nach Alsen, das zu diesem Zeitpunkt noch zu Holstein gehörte. Als Alsen allerdings im Jahre 1920 Dänemark zugesprochen wurde, wanderte die Familie südwärts und ließ sich in Kastorf, in der Nähe von Krummesse nieder, wo Martin von 1922 - 1924 in Kost und Logis auf dem Gut Kastorf beschäftigt war. Während dieser Zeit arbeitete sein Vater als Landbriefträger und lieferte tagein tagaus mit dem Fahrrad die Post aus. Bereits in der Zeit auf Alsen zog sich Martin bei einem Sturz von einer Leiter eine schwere Beinverletzung zu. Der Tierarzt der Gemeinde versorgte die Wunde nur notdürftig und es gab Komplikationen, die dazu führten, dass Martin im Laufe seines Lebens immer wieder am Bein operiert werden musste und so gut wie nie beschwerdefrei gewesen ist. Ich kann mich an die tiefen Narben an seinem Bein erinnern, die so gar nicht zu der sonst stattlichen Erscheinung meines Opas passen wollten. So musste er auch im Jahre 1924 zehn Wochen in das Ratzeburger Krankenhaus. Nach diesem Krankenhausaufenthalt fing Martin am 1. Oktober 1924 eine Lehre im Friseur-Salon Hehl in der Lübecker Fleischhauerstraße an, wo er auch nach der Ausbildung weiterhin als Friseur tätig blieb. In dieser Zeit lernte er Anna Wilhelmine Kollien kennen, die er am 29. Juni 1929 in Lübeck heiratete.
Anna Wilhelmine Hammer, geb. Kollien, wurde am 21. August 1907 in Lübeck, im Tünkenhagen 22 geboren. Ihre Großeltern hießen Jochim Hinrich Friedrich Schmöde aus Offendorf und Maria Dororthea Friederika Schmöde, geb. Wisser. Dorothea war die Besitzerin des Hauses Tünkenhagen 22, das sie am 24. September 1925 an ihre Tochter Charlotte für die Summe von 4000 Reichsmark verkaufte. Zu diesem Zeitpunkt war Anna achtzehn Jahre alt. Annas Eltern waren Charlotte Christine Friederike Kollien, geb. Schmöde, geboren am 17. Februar 1876 in Offendorf, Kreis Eutin und Karl Rudolf Kollien, geboren am 18. Dezember 1865 in Mitzelden, Preiloven. Karl Rudolf war von Beruf Zimmermann und starb überraschend am 6. Dezember 1934, während er in seinem Lübecker Altstadthaus die Treppe reinigte. Charlotte starb am 1.Juli 1949 um zehn Uhr morgens im Tünkenhagen 22. Neben Anna hatten sie noch vier Kinder: Adolf, genannt "Adi", Karl, der Künstler war, Thea und Marie Luise die "Ische" genannt wurde. Anna besuchte von Ostern 1914 bis Ostern 1922 die St.Getrud-Mädchenschule in Lübeck. Danach absolvierte sie eine Hauswirtschaftslehre in der Waldschule nahe Wesloe, bevor sie, wie es in dieser Zeit hieß, in "Stellung" bei einer Familie am Hüxterdamm ging, um dort als Unterstützung der Familie in Haushaltsführung und Säuglingspflege tätig zu sein. Dort erlernte sie auch das Handwerk der Weißnäherei.
Nach ihrer Hochzeit lebten Anna und Martin, gemeinsam mit Annas Eltern, im Haus Tünkenhagen 22. In den Jahren 1931 - 1932 war Martin vorwiegend arbeitslos. Der Grund dafür sind höchstwahrscheinlich die Krankenhausbesuche wegen seiner Beinverletzung gewesen. 1933, kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Hannelore, zog das Paar nach Einhaus am Westufer des Ratzeburger Sees, wo sie laufen lernte. Dort blieben sie jedoch nicht lange und zogen wieder zurück in den Tünkenhagen. 1937 musste Martin wegen der Beschwerden im Bein wiederum für zwanzig Wochen in ein Krankenhaus. Im Jahre 1938 zog die kleine Familie dann nach Schlutup, weil Martin die Gelegenheit bekam, in der Ludendorffstraße, der späteren Mecklenburger Straße, einen Friseursalon zu übernehmen.
1939 wurde Hannelore in Schlutup in die Grundschule "Hintern Höfen" eingeschult. Nicht lange nach der Einschulung wechselte sie in die Schule "Am Meilenstein". Anna, ihre Mutter, half in dieser Zeit ihrem Ehemann im Friseursalon, wusch den Kunden die Haare, bevor er mit der Schere kam, oder putzte, zum Missfallen ihres Mannes, bis tief in die Nacht den Salon.
1942, mitten im Krieg, ließen sich Anna und Martin scheiden und Anna zog mit der 9 Jahre alten Hannelore zurück zu ihrer Mutter Charlotte in den Tünkenhagen. Charlotte verkaufte nun das Haus am 22. April 1942 an ihre Tochter Anna für die gleiche Summe, die sie damals ihrer Mutter gezahlt hatte. Die geforderte Summe in Höhe von 4000 RM zahlte Martin an Anna als Abfindung für die Scheidung.
Nach der Trennung heiratete Martin erneut und führte mit Hilfe seiner neuen Frau Gerda, einer ausgebildeten Friseuse, in Schlutup sein Geschäft weiter. Kennengelernt hatten sie sich bereits im Salon Hehl in der Fleischhauerstraße, wo beide beschäftigt waren. Mit Gerda hatte Martin zwei Töchter, wovon die ältere den Namen Dorle bekam und die jüngere Martina heißt. Gerdas Mädchenname lautete Gloy. Ihre Mutter Ida wohnte in der Sereetzer Dorfstraße. Ihren Vater lernte Gerda nie kennen, da er noch vor ihrer Geburt verstarb. Ida Gloy, die in unserer Familie allseits nur Oma Gloy hieß, haben wir in Sereetz einige Male besucht, was Fotos bezeugen. Überhaupt ist es erstaunlich, dass das Familiengefüge trotz der Scheidung offenbar nicht sehr in Erschütterung geriet, was wohl an der gemeinsamen Tochter gelegen hat, die der Familie eine große Stabilität verlieh und damit ein Auseinanderfallen verhinderte.
Weil durch den Krieg ein normaler Schulalltag unmöglich geworden war, musste Hannelore, gemeinsam mit ihren Freundinnen, in die weit entfernte Roeckstraße laufen, wo in den Kellerräumen der St.Gertrud-Kirche noch so etwas wie Schule stattfand. Es gab kaum ausgebildete Lehrer und wenn doch, waren sie sehr alt, denn die jungen waren alle an der Front. Dann, am 8. Mai 1945, Hannelore feierte ihren 12. Geburtstag, machte in Lübeck die Nachricht vom Kriegsende die Runde. Das Gerücht, dass die "Tommys", also die Engländer, schon am Mühlentor standen, ging um, und tatsächlich wurde das Dröhnen der Kettenfahrzeuge immer lauter, bis irgendwann an diesem Tag Soldaten mit Panzern, Geländewagen und zu Fuß durch die St.Annen-Straße, den Balauerfohr bis zum Tünkenhagen und weiter in die Altstadt vordrangen. Die Straßen waren mit Menschen gesäumt, die den Engländern zuwinkten und jubelten, froh über das Ende des Krieges und sicher auch voller Sorge um die Zukunft.
In den folgenden zwei Jahren besuchte Hannelore die Geibel-Mittelschule in der Glockengießer-Straße und daran anschließend das Lyceum am Falkenplatz, worauf sie wegen des Ansehens, das diese Schule genoss, sehr stolz gewesen ist, obgleich der Schulwechsel nur deshalb zustande kam, weil die Geibel-Mittelschule wegen der Neuordnung der Dinge nach dem Krieg anderweitig benötigt wurde und die Schüler woanders untergebracht werden mussten. In der Zeit am Lyceum sammelten sie und ihre Freundinnen Gerda Schlomann und Ingrid Nelsen auf Weisung der Schulleitung außerhalb des Unterrichts wilde Kräuter wie Huflattich, Gundermann und Spitzwegerich, die dann auf dem Dachboden der Schule getrocknet wurden und später der Versorgung der örtlichen Lazarette dienten.
Weil sie für eine Lehre noch zu jung war, besuchte sie nach der regulären Schulzeit zwei Jahre lang die Haushaltsschule in der Hüxstraße, bevor sie am 1. April 1949 eine Lehrestelle zur Friseuse im väterlichen Salon in Schlutup antrat. Sie wäre lieber Krankenschwester geworden, aber das elterliche Wort wog mehr als die eigenen Wünsche.
Im Jahre 1950, ein Jahr nach Beginn ihrer Lehre, trat Hannelore dem Kirchenchor St. Aegidien bei. Sie blieb ihm 7 Jahre treu und ließ nie eine Probe ausfallen. Der Chorleiter hieß Kurt B., dessen Sohn Martin, ein hochgewachsener, junger Bratschist, ihr ausnehmend gut gefiel. Besonders, wenn er mit seinem Instrumentenkoffer im Korb seines grünen Fahrrades zur Chorprobe erschien, um die Sänger mit seinem Instrument zu unterstützen, bekam Hannelores Stimme Flügel. Gemeinsam unternahmen die beiden Fahrradtouren in der Lübecker Umgebung, und mit der Zeit verliebte sie sich in ihn. Aus dieser Zeit stammen auch einige ihrer Gedichte, von denen sie eines noch an Ort und Stelle schrieb, als sie einmal vergeblich im strömenden Regen am Waldrand in der Nähe des Phoenix Fußballplatzes in der Travemünder Allee auf ihn wartete.
Er kam nicht an diesem Tag, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass sie bei diesem Wetter die Verabredung einhalten würde, und er sie, da sie kein Telefon besaß, auch nicht zu erreichen wusste.
Doch noch bevor die gemeinsame Zuneigung entflammte, wurde das Feuer von Martins Mutter im Keim erstickt, die Hannelore, als sie Martin, der einmal krank zu Bett lag, einen Besuch abstatten wollte, schroff auf den Kopf zusagte, dass sie sich doch bitte keine Hoffnungen machen solle, da es für eine engere Beziehung ihres Sohnes mit der Tochter einer geschiedenen Putzfrau keine Zukunft gäbe. Diese Sätze trafen sie tief ins Herz, und man kann sich vorstellen, dass danach die Begegnungen mit Martin anders verliefen als zuvor. Nicht lange nach dieser Begebenheit ging Martin in die USA, um Architektur zu studieren, wo er seine erste Ehefrau kennenlernte, mit der er später zwei gemeinsame Kinder haben sollte.
Hannelores Ausbildung zur Friseuse dauerte drei Jahre, von 1949 bis 1952. Danach blieb sie noch drei weitere Jahre im Salon ihres Vaters. Da sich aber in Schlutup, wegen der unmittelbaren Nähe zur Trave und deren Mündung, diverse fischverarbeitende Betriebe befanden und sich die Kundschaft im Friseursalon zu einem Großteil aus deren Mitarbeitern zusammensetzte, hatte Hannelore nach nunmehr sechs Jahren Arbeit als Friseuse in Schlutup buchstäblich die Nase voll. Der Zufall wollte es, dass sich an ihrer Situation etwas änderte, als Hannelores Vater eine Busreise ins Kleinwalsertal buchte, die der Sportverein organisierte, in dem er Mitglied war. Krankheitsbedingt trat er die Reise jedoch nicht an. Hannelore sprang in die Bresche und fuhr an seiner Stelle. Der Tag der Abfahrt war der 10. Februar 1955 und der Aufenthalt im Kleinwalsertal dauerte zehn Tage. Dort wohnte sie bei einer Familie Fritz in der Nähe von Mittelberg.
Das Gastehepaar hatte vier Kinder: Mathilde, Laura, Joseph, genannt Sepp, und sein Bruder. Sepp ist es gewesen, der Hannelore am Ende des Urlaubs beim Abschied auf dem Busbahnhof auf die Idee brachte, im Kleinwalsertal nicht nur Urlaub zu machen, sondern dort zu arbeiten, was ihr auf der langen Heimfahrt nicht mehr aus dem Kopf ging und in den folgenden Wochen konkret Gestalt annahm.
Kurz nach ihrer Rückkehr gab sie in einer überregionalen Friseurfachzeitschrift, ohne ihre Eltern in Kenntnis zu setzen, folgenden Text auf: "Meistertochter, 22 Jahre alt, 6 Berufsjahre, sucht Stellung Nähe Obersdorf, Kleinwalsertal". Auf ihre Anzeige bekam sie eine überraschend große Anzahl von Angeboten und ihr Vater wunderte sich über die viele Post, die nicht nur aus der Alpenregion, sondern auch aus Stuttgart, der Schweiz und sogar aus Italien kam. Den Brief aus Iskia in Italien hatte eine Frau Klein geschrieben, die gemeinsam mit ihrem Mann Otto, der sich selbst, "Öttchen mit dem Schnörzchen" nannte, den Friseursalon "Klein" in Riezlern, Kleinwalsertal betrieb, und gerade in Italien Urlaub machte. Hannelore nahm die Stelle an, und fuhr bereits im Mai wieder in das Kleinwalsertal. Die Eltern nahmen die Nachricht mit gemischten Gefühlen auf, wobei sich ihr Vater toleranter zeigte.
Wie heute noch in meist dörflich gelegenen Friseursalons üblich, war auch dieser in einen Damen- und einen Herrensalon unterteilt. Im Damensalon taten Hannelore und Frau Klein sowie Anni Stöckler und Gertrud ihren Dienst. Im Herrensalon ließen außer "Öttchen" noch Paul Mussack aus Obersdorf und Rudi die Schere klappern. Hannelore blieb eine Sommersaison, vom 15. Mai bis Mitte Oktober 1955, in Riezlern, bis der Gedanke, Weihnachten in der "Fremde" zu verbringen, für sie so unerträglich wurde, dass sie den Entschluss fasste, wieder nach Lübeck zurückzukehren. Ein zur gleichen Zeit eintreffender Brief ihres Vaters, in dem er ihr deutlich machte, dass er sie im Geschäft bräuchte, bestärkte sie nur noch in ihrem Entschluss, Österreich wieder zu verlassen.
Wieder in Norddeutschland lernte sie durch eine Arbeitskollegin aus dem Schlutuper Salon, mit der sie regelmäßig in Lübeck zu Fußballspielen ging, den fünfzehn Jahre älteren Schneidermeister Max Zimmermann aus Travemünde kennen, der ursprünglich aus Eggesin in Mecklenburg stammte. Im Februar 1956 heirateten die beiden in der zu der Jahreszeit stark unterkühlten Aegidienkirche. Der Pastor der Gemeinde, Herr Richter, der Hannelore bereits aus ihrer aktiven Zeit im Kirchenchor kannte, versuchte sanft mit dem Einwand auf sie einzuwirken, sie möge sich doch den großen Altersunterschied zwischen ihrem zukünftigen Ehemann und sich vergegenwärtigen, was aber die Hochzeit nicht verhinderte. Der Pfarrer handelte sicher aus Erfahrung und hatte mit den Jahren ein Gespür dafür entwickelt, ob Menschen zueinander passen oder nicht, und so hielt die Ehe auch nur eineinhalb Jahre. Während dieser Zeit lebte sie mit Max im Steenkamp in Travemünde, wo er seine Wohnung hatte, die gleichzeitig Schneiderwerkstatt und Atelier war. Ob nun der Altersunterschied der Grund für die Trennung war oder es andere Gründe gab, ist nicht genau zu sagen. Ich erinnere mich, dass einmal von Max' Homosexualität die Rede gewesen ist, die zur Scheidung geführt hätte. Sicher ist, dass Hannelore danach einen Selbstmord mit Schlaftabletten versuchte, von dem sie mir in meiner Jugend berichtete, wobei sie besonders das abweisende Verhalten der Krankenschwestern einer Selbstmörderin gegenüber erwähnte.
Nach der Scheidung wollte sie wieder im Tünkenhagen wohnen, was aber nicht möglich war, da ihre Mutter alle verfügbaren Räume vermietet hatte. Sie ist dann zu ihrer Freundin Ursula Färber, genannt "Uschi", in die Breite Straße 13 gezogen, wo sich auch die "Capitol-Lichtspiele" befanden. Uschi lebte in der zweiten Etage mit ihrem Vater und ihrem Ehemann Goy. Der Vater war von Beruf Fotograf und hatte dort sein Atelier, während Goy an einer Lübecker Förderschule als Lehrer tätig war. Uschis Mutter war vor nicht langer Zeit gestorben und nun bot die Wohnung viel Platz für vier Personen.
Kennengelernt hatten sich Hannelore und Uschi am 1. April 1949 an der Straßenbahnhaltestelle am Koberg. Sie warteten dort gemeinsam auf die Tram, die sie nach Schlutup bringen sollte, denn Uschis Vater führte dort in der Mecklenburger Straße sein Geschäft, in dem sie eine Ausbildung zur Fotografin machte. Auf diesem täglichen gemeinsamen Weg zur Arbeit entstand aus der Zufallsbekanntschaft eine lebenslange Freundschaft. Uschi lebte in der Breiten Straße in einfachsten Verhältnissen, aber trotzdem gingen sie und Hannelore des öfteren zum Tanzen oder ins Stadttheater in der Beckergrube, für das sie ein Abonnement hatten.
Zu ihren gemeinsamen Freunden gehörten Maria Schürmann aus der Hüxstraße und Inge Ivens aus der Hundestraße. Inge hatte vier oder fünf Geschwister, was aber niemand so genau wusste, die alle, vermutlich erblich bedingt, schwer geistig und körperlich behindert waren, was allerdings auch nur auf Vermutungen beruhte, da diese Kinder, bis auf eines namens Evi, nie irgendjemand erblickte. Nur hin und wieder hörte man durch die Fenster der Wohnung Laute nach draußen dringen, die auch von Tieren hätten herrühren können.
Später zogen Uschi und Goy in die Ratzeburger Landstraße nach Groß Grönau in ein kleines Siedlungshaus direkt an der Straße. Ich bin einmal gemeinsam mit meiner Mutter in diesem Haus gewesen und das einzige Detail, an das ich mich erinnere, ist eine Schlange aus Holzsegmenten, die mit einem Lederband verbunden waren, damit die Schlange eine schlängelnde Bewegung machte, wenn man sie bewegte. Aus mir unbekannten Gründen trennten sich Uschi und Goy irgendwann. Danach ist Uschi viel gereist, und neben Schweden war die Insel Capri eines ihrer Lieblingsreiseziele. Oft hat sie von diesem traumhaften Ort erzählt. Als ich später in Lübeck als Taxifahrer arbeitete, traf ich Uschi zufällig wieder. Ich transportierte hin und wieder eilige Päckchen für die Firma Paul Peter Schula, die mit Goldschmiedebedarf handelte und Goldschmieden und Juweliere mit Edelmetall, Perlen und Rohlingen für Ketten und Ringe belieferte. In diesem Betrieb arbeitete Uschi als Chefsekretärin.
Meine Mutter und ich besuchten Uschi in ihrer großen Wohnung in der Lübecker Edward-Munch-Straße, kurz bevor sie an Demenz erkrankte. Sie machten, wie immer, wenn sie sich begegneten, Witze und lachten viel an diesem Nachmittag. Nach dem Ausbruch der Krankheit lebte sie in einem Pflegeheim in Ahrensburg, wo sie im Jahr 2017 verstarb.
Nach der Trennung von Max besuchte Hannelore mit Uschi auch wieder Fußballspiele auf dem nahe gelegenen Phoenix-Platz, wo sie Manfred Mielenz wieder begegnete, der früher ein Mitarbeiter in der Travemünder Schneiderwerkstatt war und gemeinsam mit Hannelore und Max am Küchentisch sein Mittagessen einnahm. Nachdem sie sich näher kennenlernten, besuchte er sie häufig in der Breiten Straße und erklärte ihr intensiv die Abseitsregel im Fußball, woraufhin ich neun Monate später zur Welt kam. Als sie im Frühjahr 1958 meine Oma mit der Schwangerschaft überraschten, zogen sie gemeinsam in den Tünkenhagener "Flügel", in dem inzwischen niemand mehr zur Untermiete wohnte. Am 11. Juli 1958 heirateten meine Eltern im Standesamt in der Mühlenstraße.
Martin Hammer, Hannelore, Manfred, Waldemar Mielenz
Mein Vater wurde am 4. März 1935 als viertes von fünf Kindern in der Praustdorfer Siedlung des Stadtteils Praust geboren, der damals noch zu Danzig gehörte. Dass er erst vier Jahre alt war, als der sogenannte Zweite Weltkrieg begann, war für ihn ein Segen. Selbst Waldemar, sein nächstälterer Bruder, war davon nicht betroffen, obwohl er und seine Brüder Heinz und Arno sich nach Hitlers Besuch in Danzig am 19. September 1939, an dem sie als Schaulustige teilhatten, nichts sehnlicher wünschten, Soldat zu werden. Heinz und Arno hatten nicht so viel Glück. Heinz, das älteste der fünf Kinder, kam erst in Gefangenschaft nach England, später dann nach Amerika. Arno verschlug es mit seiner Panzerbesatzung in Ostpreussen direkt in die Arme der Roten Armee, der er mit drei anderen Kameraden nur knapp entfliehen konnte, nachdem ihr Gefährt unter Beschuss geriet. Er schlug sich dann im Frühjahr 1945 in einem langen Fußmarsch bis nach Lübeck durch, wo er sich den Engländern ergab, die ihn in ein Gefangenenlager nach Neumünster überführten.
Nachdem Heinz 1948 und Arno bereits einige Zeit vorher aus der Gefangenschaft entlassen wurden, machten sie sich auf den Weg nach Lübeck, wo sie ihre Mutter Emma und ihre drei Geschwister wiederfanden, die im Februar 1945 mit dem Zug aus Praust geflüchtet waren und in Lübeck-Rangenberg Quartier bei Emmas Schwester Johanna Fiebrandt und ihrem Ehemann, dem "Dicken Emil", gefunden hatten.
Emma Maria Mielenz, geborene Brausewetter, die Mutter meines Vaters, wurde am 7. Januar 1907 in Dargau (Kreis Preußisch-Holland) geboren. Emma hatte sechs Geschwister: Arthur, Adolf, Ferdinand, der nach dem Krieg in Eckernförde lebte, Johanna, Bertha und ein Bruder, der nach Amerika auswanderte, dessen Name aber nicht mehr zu ermitteln ist. In Dargau befand sich ein Landgut, auf dem Emmas Vater, Julius Brausewetter, als Gärtner arbeitete, während seine Ehefrau, Auguste Brausewetter, geb. Festag, als Hausangestellte dort ihren Dienst tat. Obwohl sich Emmas Vater nach Kriegsende weigerte, in den Westen zu gehen, wurde er umgesiedelt. Er wollte am Entstehen des Sozialismus im Osten Deutschlands teilhaben und starb später in Leipzig. Emma lernte ihren zukünftigen Ehemann Franz Josef Mielenz in Woyanow kennen, wo er als Gutsinspektor arbeitete. Dort kam am 18. Januar 1926 ihr erstes Kind Heinz Lothar zur Welt. Kurz darauf, am 25. Januar 1926, heirateten Franz und Emma. Zu dritt zogen sie kurz darauf nach Praust in die Ul. Boleslawa Prusa Nr. 31, wie die Straße seit dem Ende des Krieges heißt, in eine Wohnung, die sich in der ersten Etage des Hauses befand, das einem gewissen Herrn Grahl gehörte. Dort kamen noch vier weitere Kinder zur Welt. Arno am 30. März 1927, Waldemar am 7. Oktober 1930, Manfred am 4. März 1935 und schließlich Gisela, die am 6. Juli 1938 dort geboren wurde.
Über Franz Mielenz ist bekannt, dass er am 5. April 1903 in Pletzendorf geboren wurde, gelernter Landwirt war und nach dem Umzug nach Praust in der dortigen Zuckerfabrik Arbeit fand. Meiner Internetrecherche zur Folge schloss er sich der SS an und wurde in verschiedenen Konzentrationslagern eingesetzt, unter anderem in Landsberg, Dachau und den dortigen Außenlagern Kaufering 3, 4 und 7. Eine bei meiner Recherche gefundene Anklageschrift eines amerikanischen Militärgerichtes belegt, dass er im August 1947 in Dachau der Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und zum Tode verurteilt wurde. Vor Vollzug der Strafe verstarb er jedoch am
9. Oktober 1947 im Lazarett Landsberg am Lech an Tuberkulose. Seine Frau besuchte ihn einmal in Begleitung des gemeinsamen Sohnes Arno im Lazarett. Franz Mielenz hatte einen Bruder mit Namen Willi, der mit seiner Frau Käthe auf der Nordseeinsel Norderney lebte. Willi wurde am 24. Juni 1912 geboren und starb am 1. Oktober 1977. Seine Frau Käthe Mielenz, geb. Loepp, geboren am 29. März 1912, starb am 8. April 1993.
Nach Kriegsende fanden Emma, ihre Tochter Gisela und Ellen, Heinz‘ Ehefrau, in der Lübecker Marzipanfabrik Erasmi & Carstens GmbH und Co. KG eine Arbeit, bei der sie vorgeformte Marzipanleckereien mit Lebensmittelfarben bemalen mussten. Heinz, der bereits eine Lehre als Schiffsbauer in der Danziger Schmiechen-Werft abgeschlossen hatte, fand schnell eine Arbeit auf der Flender-Werft im Lübecker Stadtteil Siems. In seiner Freizeit spielte er Fußball im Verein TSV Siems. Er hatte mit seiner Frau Ellen fünf Kinder: Volker, Thomas, Bettina, Christine und Sabine.
Auch sein Bruder Arno legte in Danzig bereits eine Berufsausbildung in der Danziger Verwaltung ab und fuhr nun in Lübeck das Essen für die Schulspeisung aus, die die englischen Besatzungstruppen seit März 1946 initiierten. Später arbeitete er für die Firma Karstadt als Fahrer und lieferte Ware an die Kunden. Ich sah ihn als Kind und noch als Jugendlicher häufig mit dem Karstadt-LKW durch Lübeck fahren. Während seiner langjährigen Tätigkeit bei Karstadt stieg er die Karriereleiter empor und wurde später persönlicher Fahrer des Firmenchefs. Er heiratete Gisela Kreutzfeldt, die alle immer nur "Die Gräfin" nannten. Ihre beiden Söhne hießen Jörg und Bernd, der tragischerweise bereits mit 3 Jahren an Leukämie starb. Gisela war auch bei Karstadt beschäftigt. Sie war anfangs als Kassiererin angestellt und leitete später die Hauptkasse des Kaufhauses.
Waldemar Mielenz beendete nach dem Krieg eine Lehre als Schweizer in den Dörfern Böbs und Groß Sarau. Schweizer sind Personen, die Viehzucht und Molkerei nach Schweizerart betreiben – also Hirten und Stallknechte sowie Melker und Sennen – man nannte sie Schweizer, auch wenn sie nicht aus der Schweiz stammten. Bei seiner späteren Tätigkeit tauschte er das "z" in der Bezeichnung seines erlernten Berufs gegen ein "ß" ein und wurde Schweißer auf der Flender-Werft, wo auch schon sein Bruder Heinz arbeitete. Waldemar und seine Ehefrau Mona Lisa heirateten am 15. Dezember 1956. Aus ihrer Ehe gingen keine Kinder hervor.
Manfred, der nächste in der Geschwisterfolge, erlernte schon als Zwölfjähriger die Fertigkeiten eines Artisten. Die Familie wohnte seit 1947 in Kücknitz, Am Wallberg 27. Schräg gegenüber, im Haus Nummer 38, lebte Herr Reinert, der gemeinsam mit der siebzehnjährigen Elfriede Pfeiffer eine jugendliche männliche Person suchte, die in einer Artistengruppe mitwirken sollte. Manfred ergriff die Chance, fing an zu trainieren und lernte jonglieren. Sie nannten sich die "Original Oris" und spezialisierten sich auf Perche-Artistik und Jonglage. Das Wort Perche kommt aus dem Französischen und bedeutet Stange, wobei die Artisten an einer elastischen Bambusstange sogenannte Perche-Akte, Balance und andere Kunststücke vorführen. Angefangen im seinerzeit bekannten Lübecker Varieté-Theater "Atlantic" in der Travemünder Allee, hatten die "Oris" in den folgenden zwei Jahren Engagements in Kiel, Hamburg und Bremerhaven, bis hin nach Köln und Regensburg.
Als Manfred vierzehn Jahre alt war, wurde er allmählich zu schwer für diese Arbeit, denn die Perche wurde am Boden von dem weiblichen Mitglied der Gruppe gehalten und geführt, woraufhin er die Gruppe verlassen musste.
Um sich weiterhin sportlich zu betätigen und vielleicht auch dem Vorbild seines Bruders zu folgen, trat Manfred dem Siemser Fußball-Verein "TSV Siems" bei, wo man schnell auf sein Talent als Fußballer aufmerksam wurde. Nach einiger Zeit wechselte er zum bekannten "LBV- Phoenix", dem Lübecker Phoenix-Fußball-Verein, dessen Herrenmannschaft in den 1920ger Jahren zu den erfolgreichsten in Norddeutschland gehörte und deren größter Erfolg der dritte Platz bei der norddeutschen Meisterschaft 1927 war. Auch nach dem Krieg gehörte der LBV-Phönix mehrere Jahre der erstklassigen Oberliga Nord an, in der Manfred ab 1958 aktiv als Verteidiger spielte. Unter den vielen Pressefotos aus dieser Zeit gibt es auch eines, das Manfred mit Uwe Seeler bei einem Spiel gegen den HSV zeigt, auf dem Manfred allerdings nur von hinten zu sehen ist.
Bevor ihn eine Meniskusverletzung zwang, mit dem aktiven Sport aufzuhören, brach er sich bei Spielen mehrmals das Nasenbein, weshalb er auf dem Platz häufig unter Atemproblemen litt. Er gewöhnte sich deshalb an, in der Tasche seiner Sporthose immer eine Zitronenscheibe zu haben, von der er abbiss, falls ihm die Luft knapp wurde. Für diesen Extra-Service hatte meine Mutter zu sorgen, und wehe, sie vergaß es einmal, dann hing an dem betreffenden Sonntag der Haussegen schief, und es passierte nicht nur einmal, dass sie am Sonntag-morgen bei Tante Gerdas Laden klingeln musste, weil sie versäumt hatte, am Samstag Zitronen zu kaufen.
Von Beruf wäre Manfred viel lieber Tischler oder Gärtner geworden, fing aber im Jahr 1952 eine Lehre als Schneider in der Schneiderei Kielbassa in Kücknitz an. Nach abgeschlossener Lehrzeit bekam Manfred eine Stelle bei dem Travemünder Schneidermeister Max Zimmermann, dem damaligen Ehemann meiner zukünftigen Mutter.
Ihrem jüngsten Kind gaben Emma und Franz den Namen Gisela. Sie ging nach Beendigung ihrer Schulzeit 1953 noch ein weiteres Jahr zum Jugendaufbauwerk, bevor sie im Betrieb von Frau Frieda Carsten in der Lübecker Fleischhauerstraße eine Lehre als Modistin und Putzmacherin antrat. Später lernte sie Günter Plath kennen, den sie heiratete, der aber tragischerweise schon früh verstarb. Sie begegnete wenig später dem Geschäftsmann Willy Zimmermann, der in Travemünde einen Zigaretten- und Zeitschriftenladen besaß. Sie heirateten, und am 28. Mai 1979 kam ihre Tochter Anja zur Welt. Gisela lebt heute in einem Seniorenheim in Kücknitz. Anja lernte ich erst 2018 während der Trauerfeier von Waldemars Ehefrau Mona Lisa kennen.
Tante Anni
Als meine Oma, die alle immer Tante Anni nannten, nach der Scheidung von Martin im Jahre 1942 wieder in den Tünkenhagen zog und eine Arbeit suchte, verhalf ihre Schwester Marie Luise (Ische) ihr zu einer Stelle als Reinmachefrau bei OPEL-Bruhns, einem Autohandel mit angeschlossener Kfz-Werkstatt in der Dorotheenstraße, wo sie bis zum Erreichen des Rentenalters blieb. Selbst meine Mutter war von 1965 – 1968 in dieser Firma als Raumpflegerin tätig, wobei ihr mein Vater zur Hand ging, bevor er selbst zur Arbeit musste, weil die Arbeit für eine Person kaum zu schaffen war. Drei Stunden lang wischten und bohnerten sie den mit schwarzem Linoleum ausgelegten Verkaufsraum, in dem sechs Fahrzeuge Platz fanden. In dieser Zeit achteten meine Oma und Kurt auf mich und meinen Bruder, bis unsere Mutter von der Arbeit zurückkam. Sie kündigte die Stelle wieder, nachdem sie mit der Chefin aneinandergeraten war, die sich nie zufrieden zeigte.
Aber das Autohaus war nicht die einzige Arbeitsstelle meiner Großmutter. Bei Dr. Diederichs, einem praktischen Arzt, der seine Praxis in einem dunkelgrauen Gebäude an der Hüxtertorbrücke hatte, reinigte sie die Praxisräume. Laut Aussage meiner Mutter war meine Oma regelrecht vernarrt in diesen Mann. Sie lud ihn und seine Frau regelmäßig zu ihrem Geburtstag ein, und beide wurden dann, zur Feier des Tages, durch das ganze Haus geführt, das sie vorher natürlich ausgiebig "in Schuss" gebracht hatte. In aller Regelmäßigkeit frequentierte sie auch den „Dorne-Senioren-Stift“ in der Schlumacher Straße. Dort kannte sie einige der alten Damen, für die sie regelmäßig die Zimmer in Ordnung hielt und sauber machte. Manchmal nahm sie mich mit dorthin, und sicherlich haben sich die Damen immer sehr über den kleinen Enkelsohn gefreut. Eine Zeit lang putzte sie auch das Haus eines Herrn Hannemann, der in der Wahmstraße ein Fachgeschäft für Rasierapparate führte, im Nebenberuf Opernsänger war und in Groß Grönau wohnte. Meine Oma schwärmte von ihm und seinem Haus in den höchsten Tönen. Ich weiß nicht, wie es zustande kam, aber eines Tages fuhren wir gemeinsam mit ihr und meiner Mutter sein Haus zu besichtigen. Wahrscheinlich wollte uns meine Oma zeigen, worin sich ein Opernsänger und Geschäftsmann vom gemeinen Volk unterschied, zu dem sie uns und sich selbst zählte. Die Führung fand statt, während er in seinem Geschäft war. Das Haus war in seiner ganzen Art und Einrichtung vollkommen normal und konventionell, kein bisschen ungewöhnlich oder extravagant. Ich habe den ganzen Wirbel, den sie darum machte, überhaupt nicht verstanden, aber vermeintliche Standesunterschiede waren für meine Oma eine unveränderliche Tatsache. Die Menschen, "die es zu etwas gebracht hatten", wurden von ihr unterwürfig bewundert und der Unterschied zwischen diesen und den "einfachen Leuten" nie in Frage gestellt.
Sie und meine Mutter waren es auch, die mir aufgrund dieser Ansicht, die Fähigkeit mit Messer und Gabel zu essen, gründlich aus-trieben, weshalb ich es bis heute nicht einwandfrei beherrsche. Wir waren damals bei irgendwelchen Bekannten meiner Oma, deren Namen ich längst vergessen habe, an einem Sonntag zum Essen eingeladen worden. Schon Tage vor diesem Termin lagen sie mir damit in den Ohren, dass ich mich bei Tisch anständig zu benehmen hätte und bläuten mir unentwegt ein, wie die Gabel zum Mund zu führen und das Messer zu halten sei; mit dem Resultat, dass ich völlig verkrampft am Tisch der fremden Familie saß und nur mit Mühe das Essen genießen konnte. Diese Unfähigkeit, "vernünftig" zu essen, und die damit einhergehende Scham beschäftigten mich im Laufe meines Lebens immer wieder, selbst wenn ich bei Freunden und Bekannten zu Gast war.
Eigentlich putzte meine Oma bei jeder Gelegenheit und nicht nur in Anstellung bei Fremden und Bekannten. Auch im Tünkenhagen füllte sie die verbleibende Tageszeit mit dieser Tätigkeit aus, wenn sie nicht mit anderen Hausarbeiten beschäftigt war. Dabei waren mit unterschiedlichen Motiven bedruckte Staubkittel ihre Arbeitskleidung. Im normalen Alltag und wenn sie nur mal eben zwei Häuser weiter im Geschäft von Tante Gerda einkaufte, zog sie den Kittel nicht aus. Es verging kein Tag, an dem nicht irgendwo ein Wischei-mer klapperte oder ein Staubsauger heulte. Der Geruch von Putzmitteln aller Art wehte beständig durch die Räume und „Ajax - Der weiße Wirbelwind“, „Meister Proper“ und „Clementine“ gehörten zu unseren ständigen Hausgenossen. Weil ich manche davon sogar gern roch, wurden sie zum festen Bestandteil meiner Erinnerungen, wie zum Beispiel der Duft von Bohnerwachs für die Dielenbretter und Treppenstufen. Zum Bohnern nahm meine Oma den sogenannten Bohnerbesen zur Hand, der aus einem stabilen Stiel bestand, an dessen unterem Ende sich ein Kugelgelenk befand, woran ein, für mich unsäglich schwerer, mit blauem Hammerschlaglack überzogener Metallklotz befestigt war, der beim Bohnern mit erheblichem Kraftaufwand hin- und herbewegt werden musste. An seiner Unterseite befand sich eine harte Bürste oder ein Fließ, mit denen man das Bohnerwachs auf der Holzoberfläche verteilte und einarbeitete. Es war eine sehr rhythmische Arbeit und im Haus weithin hör- und sogar spürbar, weil das kiloschwere Gewicht des Bohnerbesens des Öfteren gegen die Laibungen der Treppe und die Fußleisten der Zimmer stieß. Ein anderes oft benutztes Utensil war ein aus Röhricht geflochtener Teppichklopfer, der sich in den 1960ger Jahren in vielen Haushalten befand. Meine Oma und auch meine Mutter zweckentfremdeten diesen Gegenstand bei Gelegenheit, um uns Kindern als erzieherische Maßnahme damit "den Hintern zu versohlen". Wenn die Frechheiten, die mein Bruder Karsten und ich uns leisteten, das Maß der Erträglichkeit mal wieder überschritten, gab es "Dresche" mit dem Ding, egal ob die Hosen kurz oder lang waren. Ich schrie immer aus vollem Hals, obwohl es fast nie wirklich weh tat, auch wenn ich mich an ein paar hartnäckige Striemen an Armen und Beinen erinnere. In der Regel hielt sich der Schmerz aber in Grenzen, weil so ein Teppichklopfer im Vergleich zu einem einfachen schlanken Stock, wie er damals noch an den Schulen zur Bestrafung benutzt wurde, eine zu große Gesamtfläche hatte, um damit wirklich Schmerzen zu bereiten. Abgesehen von der Bestrafung mit dem Teppichklopfer drohte meine Oma uns wiederholt mit dem Heim. Es hieß dann immer: „Du kommst nach Vorwerk, ins Heim!“ Darüber, was „Das Heim“ oder was „Vorwerk“ war, ließ sie uns allerdings immer im Dunkeln. In erster Linie benutzten wir den Teppichklopfer natürlich, um die Teppiche auszuklopfen, von denen im Haus nicht wenige herumlagen. Als ich groß genug war und die nötige Kraft hatte, übernahm ich sehr gern diese Arbeit, denn ich liebte es, die feinen Staubpartikel im Sonnenlicht tanzen zu sehen.
Bilder und Bücher
Ein Bruder meiner Oma war Künstler. Sein Name war Karl Heinrich Kollien. Er wurde am 25. März 1895 in Lübeck geboren und am 5. Mai desselben Jahres in St. Marien getauft. Am 28. August 1918 heiratete er in Dresden Getrud Frida Rosenau, geboren am 13. März 1893. Die beiden hatten zwei gemeinsame Kinder mit Namen Lotte und Karl-Heinz (Heinzi). Später lebte Karl mit seiner Familie in Lübeck, wo ihn 1932 offenbar eine Frau aus Eifersucht vergiftete. Seine Frau starb am
27. April 1970 in Lübeck. Von ihm gab es eine großformatige Portraitfotografie im Erdgeschoss unseres Hauses neben einem Spiegel in der Nähe der Eingangstür. Im Treppenhaus, gleich neben der Hoftür, hing eine Kohlezeichnung von ihm mit dem Titel „Die Not“. Dieses Bild machte immer sehr großen Eindruck auf mich. Es zeigt seine Mutter Charlotte in der Pose einer weinenden Frau, die Haare nach hinten gebunden, das Gesicht in den Händen verborgen.
Stilistisch erinnert das Bild an Arbeiten der Künstlerin Käthe Kollwitz. Zwei kleinere in Öl gemalte Blumenbilder schmückten das Wohnzimmer meiner Oma. Rosen in einem geflochtenen Korb. Das vierte Bild hing in der Diele und zeigt einen Wanderer, ruhend auf einer Bank. Er sitzt unter dem Blätterdach eines großen Baumes mit Blick in eine weite Landschaft. Bis zur Sanierung des Hauses Anfang der 1980ger Jahre hing das Bild an diesem Platz. Angeblich hatte es Karl nach einer alten Postkarte gemalt. Es muss mir als Kind sehr gefallen haben, denn ich habe oft staunend davorgestanden und mir mit den Jahren viele Details eingeprägt; zum Bespiel die verwachsene Narbe am Stamm, wo dem Baum ein dicker Ast abgesägt worden war, oder den kleinen Landschaftsausschnitt in der Bildmitte, der für den Künstler beim Malen offenbar ein technisches Problem dargestellt hatte und im Vergleich zum übrigen Bild fehlerhaft wirkt. Abgesehen von diesen Bildern hing im unteren Treppenaufgang eine Kopie der „Saskia“ von Rembrandt, das Thea Sievers, eine gute Bekannte meiner Mutter, gemalt hatte. Die Malerin war eine Jugendfreundin meines Opas und lebte in Mölln. Ihr Vater war Lehrer gewesen und mein Opa sein Schüler. Ich bin ein einziges Mal mit meiner Mutter bei ihr zu Besuch gewesen. Die Wohnung war mit Antiquitäten vollgestellt, und ich kann mich noch an einen alten Sessel erinnern. An seinem dunkelroten Samt-Sitzpolster baumelten kleine runde Troddelchen, mit denen ich an dem betreffenden Tag spielte.
Weil es für meine Mutter bequemer war, verbrachte ich Krankentage tagsüber mit meiner Bettdecke auf dem Sofa im Wohnzimmer meiner Eltern. So war ich in ihrer Nähe und wenn ich etwas benötigte, musste sie nicht ständig die Treppe zum "Flügel" hinauf- und hinabsteigen, in dem mein Bett stand. Hatte ich einmal eine Erkältung mit Halsschmerzen oder Husten, braute meine Mutter einen Hustensaft aus braunem Kandis, kleingeschnittenen Zwiebeln und dünnen Möhrenscheiben, der nicht nur die Beschwerden linderte, sondern auch köstlich schmeckte. Wenn ich aber fieberte, bekam ich häufig ein als "Pulver" bezeichnetes Mittel, aufgelöst in einem Glas Wasser. Es war in kleine gefaltete Papiertütchen eingepackt und wurde von den Erwachsenen auch bei Kopf- und Zahnschmerzen verabreicht. Die Verpackung der Arznei zierte die Zeichnung eines Mannes, der sichtlich von Schmerz gepeinigt war. Seine Stirn war in Falten gelegt, und den Kopf stützte er in eine seiner Hände. Das Pulver schmeckte bitter und half bei Zahnschmerz überhaupt nicht. Um festzustellen, ob ich erhöhte Temperatur hatte, schob man mir ein Fieberthermometer in die Achselhöhle, was mir überhaupt nicht gefiel, denn je länger es dort eingeklemmt war, desto sicherer blieb es an der empfindlichen Haut kleben und ziepte beim Herausnehmen sehr unangenehm. Gerade meine Oma ging da nicht unbedingt rücksichtsvoll vor. Ich hatte jedes Mal Angst vor dieser Prozedur, traute mich aber auch nicht, es selbst zu entfernen, bevor es jemand anderes tat. Außerdem waren diese Thermometer noch aus Glas mit einer Quecksilbersäule darin und ich befürchtete immer während des Messens einzuschlafen, um es dann durch eine falsche Bewegung zu zerbrechen.
Ein Phänomen meiner Kindheit waren die Fieberphantasien. Alles, was sich dann in meiner unmittelbaren Nähe bewegte, nahm an Tempo zu, und wirkte, als sähe man einen Zeitrafferfilm. Nicht einmal die Sprache meiner Mutter, die mich trösten wollte, wurde davon verschont. Sofort verfiel ich in Panik und rief: "Nicht so schnell, nicht so schnell!" Es war beängstigend.
Fehlte mir die Kraft, Zeit mit dem Lesen meiner Comics zu verbringen, schaute ich mir die wenigen Bilder im Wohnzimmer genauer an, bis manche Details ein Eigenleben bekamen und sich von dem, was sie darstellten, weit entfernten, wie zum Beispiel bei dem Bild einer mediterranen Straßenszene an einem Hafen, das in einem weißen Holzrahmen an der Wand hing. Im Vordergrund befindet sich nach meiner Erinnerung eine Palme. Links im Bild liegt ein Segelboot im Wasser. Das Segel ist gesetzt und die Rahe führt schräg ins Bild. Auf der rechten Seite steht ein Haus mit einer rot-weiß gestreiften Markise, das dem Ganzen ein südländisches Flair verleiht. Vielleicht ist es Italien. In meiner Fantasie verwandelte sich die gestreifte Markise in das Gesicht einer dicken älteren Dame, die mit einem pelzigen Hut, auf ihren Krückstock gestützt, am Hafen spazieren geht. Wenn mir die Stunden zu lang wurden, schaute ich manchmal im Liegen unter den großen Schirm der Stehlampe, die an der Seite der Couch stand, und entdeckte dabei eine neue Perspektive. Ich sah die glasklare, glatte Kunststofffolie, die zum Schutz gegen die Wärme der beiden Glühbirnen an der Innenseite des Stofflampenschirms angebracht war. Ich liebte das zarte Gefühl an meinen Fingern, wenn ich den Quast berührte, der an einer dünnen Kordel zwischen Lampenschirm und Standfuß hinunterbaumelte und mit dessen Hilfe sich das Licht an- und ausschalten ließ. Der Quast wurde bei näherem Betrachten zu einem Bergsteiger, der im Inneren des Lampenschirms wie in einer unterirdischen Höhle emporkletterte.
Auch vertrieb ich mir die Zeit mit "Sterne sehen". Dazu übte ich bei geschlossenen Augen mit meinen Fingern leichten Druck auf meine Augäpfel aus. Die Schwärze, die ich wahrnahm, füllte sich allmählich mit geometrischen Formen, die jedes Mal wieder in ein und derselben Reihenfolge erschienen. Zuerst flimmerten schwarz-weiße Schachbrettmuster an meinem Gesichtsfeld vorbei, deren quadratische Grundformen immer gleichblieben, sich aber in ihrer Gesamtheit wie eine gemusterte Tischdecke an einer Wäscheleine hin und herbewegten. Nach einer Weile folgte dann ein Zwischenstadium uniformer Farbflächen, aus denen in langsamer gleichmäßiger Abfolge farbige Ellipsen aus einem weit entfernten Mittelpunkt auftauchten, die immer größer werdend auf mich zuflossen, während im Hintergrund schon die nächste Ellipse entstand. Gerade diese letzte Phase des optischen Phänomens empfand ich immer als sehr beruhigend. Öffnete ich meine Augen nach einer Weile wieder, sah ich beim Blinzeln noch lange Zeit ein Nachbild der zuletzt gesehenen Ellipse.
Aber auch Bilder meiner Mutter, die eine talentierte Hand für künstlerische Dinge besaß, dekorierten die Wände unseres Hauses. In den Jahren in Lübeck und auch später in Itzehoe, Hamberge oder Reinfeld zeigte sich immer wieder ihre kreative Begabung. Obwohl ich persönlich nie ein großes Faible für Bauernmalerei gehabt habe, gefielen mir ihre unterschiedlich großen, mit Blumenmotiven ornamental bemalten Holzbretter immer sehr. Besonders durch den Einsatz von abschließendem Firnis erzielte sie bei den Malereien einen homogenen Effekt, der die Bretter alt erschienen ließ, und gerade das machte diese Arbeiten so besonders. Wunderschöne, ruhige Bilder fertigte sie mit hauchdünnem, unterschiedlich gefärbtem Balsaholz-Furnier, aus dem sie Stadtsilhouetten von Lübeck und Segelboote ausschnitt, die sie dann auf mit Stoff bespannten Holzhintergründen arrangierte. Außerdem schrieb sie in sehr jungen Jahren und auch nach dem Tod meines Vaters im Jahre 1995, als sie mit ihrem Lebensgefährten Holger Sellmer aus Reinfeld zusammenlebte, einige Gedichte, die mir immer sehr gefielen.
Da meine Mutter gelernte Friseuse war, arbeitete sie hin und wieder im Schlutuper Friseursalon ihres Vaters. Aus diesem Grund verbrachte ich dort als Kind viel Zeit und liebte die speziellen Düfte des Salons. Um mir die Zeit zu vertreiben, sah ich mir oft die gefärbten Haarmuster an, die auf Pappunterlagen befestigt waren, und versuchte, da ich schon früh zu lesen begonnen hatte, zu entschlüsseln, was die Begriffe bedeuteten, mit denen diese Haarproben bezeichnet waren. Neben den nuancenreichen Braun- und Blondtönen gab es auch ganz spezielle Färbungen wie silbergrau, violett und sogar hellblau, die ich ganz besonders mochte. In der Anordnung der Farben erkannte ich ein wiederkehrendes Schema, das allen Ansichtstafeln für Haarfarben gemein war. Die Farbenanordnung folgte exakt derselben Reihenfolge, und am Ende standen immer die besonders ausgefallenen Färbungen. Ähnliche Einteilungen erkannte ich auch in den großen Tapetenbüchern, die sich unsere Eltern in der Drogerie Prien in der Glockengießer Straße ausliehen, wenn sie einen Tapetenwechsel planten. Am Ende des überdimensional großen Buches kamen immer die Brokattapeten oder Tapeten mit sehr ausgefallenen Mustern und Bildmotiven. An diesen Büchern konnte ich mich nicht sattsehen. Sie waren für mich spannender als manche Lektüre, die meine Mutter oder meine Oma mir zu lesen gaben.
Verbrachte ich meine Zeit nicht im Salon, spielte ich manchmal auf der Straße vor dem Haus mit dem Sohn des Drogisten, dessen Vater sein Geschäft direkt neben dem Haus meines Opas hatte. An seinen