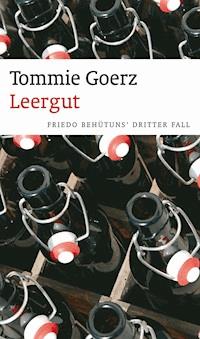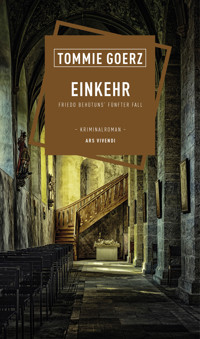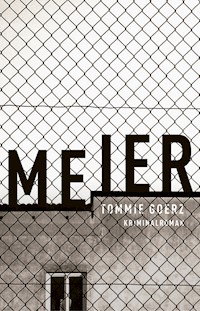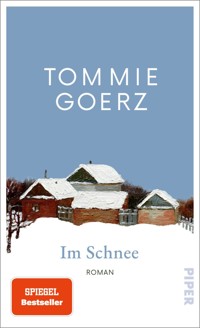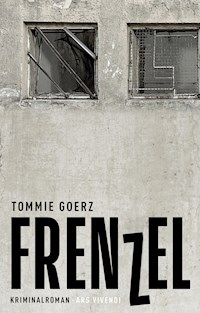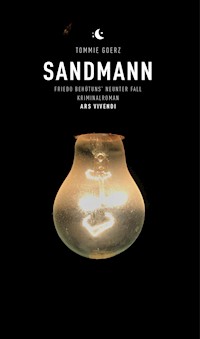Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi
- Kategorie: Krimi
- Serie: Friedo Behütuns
- Sprache: Deutsch
Auf einem Bauernhof in Franken wird eine Sau geschlachtet, zerlegt und verwurstet, es gibt Schlachtschüssel und Bier: Schlachttag. Aber auch sonst geht es blutig zur Sache. So buddelt in der Fränkischen Schweiz ein Hund Körperteile einer Frau aus. Dann stößt ein Wanderer auf einen fürchterlich zugerichteten Leichnam, das Opfer wurde offenbar regelrecht abgeschlachtet. Bis jedoch die Polizei am Tatort erscheint, ist der Leichnam verschwunden. Währenddessen befasst sich Kommissar Friedo Behütuns mit einem über 20 Jahre zurückliegenden Vermisstenfall. War es Mord? Die Suche nach den Familienmitgliedern der Verschwundenen führt ihn durchs fränkische Land und bis auf die Kanareninsel La Gomera. Als sich dann der Enkel einer alten Frau meldet, zieht sich die Schlinge immer enger um die Familie. Der sechste Fall des beliebten Nürnberger Ermittlers Friedo Behütuns. Ein Frankenkrimi vom Feinsten: hintersinnig, erfrischend humorvoll und spannend
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tommie Goerz
Schlachttag
Kriminalroman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Februar 2016)
© 2016 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © plainpicture/Andreas Koschate
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-611-0
Die Handlung dieses Buches ist frei erfunden. Etwaige Übereinstimmungen mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig. Trotzdem wurden natürlich einzelne Charaktere von realen Personen inspiriert.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Großer Dank
Der Autor
Für »Lupus« Hermann Jakobus Wolf, ermordet bei Monterey, Kalifornien
»In Deutschland wurden im letzten Jahr
fünfundachtzigmillionensiebenhundertfünfunddreißigtausend
Schweine geschlachtet (in Zahlen: 85.735.000).«
SZ Magazin 21.4.2015
»Leider nur die falschen.«
Spontaner Kommentar eines Lesers
…
Als sie in den Hof einbogen, war die Sau schon tot. Ihre Befürchtungen hatten sich bewahrheitet. Der Transportanhänger stand mit heruntergelassener Rampe im Hof, die Ladefläche war leer, und sie hörten keine Sau mehr quieken. Eine Sau quiekt, wenn sie Todesangst hat. Immer. Kein Schwein geht freiwillig in den Tod. Tiefe Männerstimmen drangen aus der offen stehenden Stahltür des Schlachthauses, das Klappern einer schweren Kette war zu hören. Sie waren zu spät, weil Peter Dicks Frau sich verspätet hatte; die hatte sich verspätet, weil eine Telefonkonferenz bei ihr im Büro zu lange gedauert hatte; die hatte so lange gedauert, weil ein amerikanischer Kollege so schwer von Begriff war; der war so schwer von Begriff, weil … – es macht wenig Sinn, immer weiter nach Gründen zu suchen, auch wenn der Ami ein Dummdödel war. Wirklich. Gründe für Dinge sind letztlich immer banal, meistens beliebig, und damit muss man sich abfinden und zufriedengeben. Fakt war: Dick hatte seine Kinder nicht allein lassen können, deshalb hatten sie auf seine Frau warten müssen, deshalb hatten sie sich verspätet, und jetzt war die Sau schon tot. Schade, sie wären gerne dabei gewesen.
»Ah, servus, da seid ihr ja endlich.« Zwei Männer blickten auf und nickten Dick und Behütuns kurz zu.
…
»Sehr gut ausgeblutetes Tier brühen, Borsten abkratzen, ausnehmen, sehr gut waschen, dabei besonders auf Ohren und Rüssel achten, Augen entfernen […]«
Spanferkel gebraten
1
Josepha Regenfuß war eine gottesfürchtige Frau. Schon immer gewesen, nicht erst seit dem Tod ihres Hubertus vor inzwischen neun Jahren. Da hatte Gott ihn zu sich geholt eines Nachts. Hubert hatte sich urplötzlich aufgerichtet, hatte sich an den Hals gefasst, an die Brust, auf den Bauch, hatte gehustet, dass es einen grausen konnte, dann geröchelt und plötzlich Blut gespuckt, einen Schwall nach dem anderen. Dann war er in sich zusammengesunken. Blutsturz hatte der Doktor gesagt, als er nach über drei Stunden endlich kam. Früh um vier und mit einer Fahne – na ja, die Männer sind überall gleich. Dann hatte er sich noch einen Schnaps geben lassen, einen doppelten wie immer, den guten Birn vom Langguth, ihr ein wenig zu lange die Hand gedrückt, ihr glasig in die Augen gesehen, war an der Türschwelle noch über den alten Flickenteppich gestolpert, der dort schon seit Jahren Falten warf, es hätte ihn fast der Länge nach hingehauen, und schließlich war er weggefahren. Nur den Totenschein hatte er noch auf den Tisch gelegt.
86 Jahre war Josepha jetzt, da ging schon alles ein bisschen schwerer. Mühsamer halt, das Alter. Eine riesige Sauerei war das damals gewesen mit dem Hubertus. Sie hatte das Bett frisch bezogen, das alte Bettzeug gleich eingeweicht und es nachher doch wegwerfen müssen, denn das Blut ging nicht mehr heraus. Sie hatte den Boden gewischt, Hubertus von oben bis unten gewaschen, da war er sogar noch ein bisschen warm gewesen, hatte ihm sein gutes Hemd übergezogen, ihn in seinen Sonntagsanzug gesteckt, die Krawatte, die Gott sei Dank immer gebunden war, umgehängt, seine Schuhe noch mal geputzt, bevor sie sie ihm anzog, und ihm schließlich seine Hände auf dem Bauch gefaltet, so wie sie es immer gesehen hatte. Löchrige Socken hatte er in seinen Schuhen, dafür hatte sie sich einen Moment geschämt. Aber die guten wollte sie nicht mit ihm begraben lassen, die konnte sie ja noch tragen, und die Löcher sah ja keiner, dachte sie sich, er hat ja die Schuhe drüber, und ausziehen tut ihm die keiner mehr. Außerdem würde den Sarg eh niemand mehr aufmachen, wenn der Hubertus erst einmal drin lag und der Deckel zu war. Dann hatte er auf dem Bett gelegen, längs ausgestreckt, das Gesicht zur Decke, ganz friedlich und als ob er überhaupt nie jemandem etwas zuleide getan hätte, der alte Sack, auch ihr nicht, und draußen hatten sich die Vögel lauthals in den frühen Morgen gesungen, dass es eine wahre Freude war. So schön! Josepha hatte sich gewundert, dass sie nicht traurig war, ganz im Gegenteil, sie fühlte sich leicht und befreit, fast beschwingt. Mit 77 damals. Das wär’s dann also gewesen mit meinem Hubertus, hatte sie nur gedacht, hatte auf dem Stuhl neben seinem Bett gesessen und ihn betrachtet. Wie komisch doch das Leben ist, selbst wenn es dann endlich vorbei ist, wie friedvoll der Tod. Und wie verlogen, wenn man sich’s recht überlegt, denn auch das größte Schwein strahlt plötzlich Friedlichkeit aus. Liegt einfach so harmlos und wehrlos da. Doch so ein großes Schwein war er dann doch nicht gewesen, ihr Hubertus.
»Gott liebt mich«, hatte sie dann gedacht, »denn er lässt mich nicht traurig sein«, und hatte ein langes Dankgebet gesprochen.
Zur Beerdigung waren dann alle gekommen, das ganze Dorf. Beim Heid waren sie gewesen, da hatten sogar noch ein paar geweint, vor allem die alten Frauen. Damit man weiß, dass man ihn gekannt hatte und er einer der Ihren gewesen war. Dann aber, nach dem Schweinebraten, der Pfarrer hatte seine drei Bier schon getrunken und war längst wieder gegangen, hatte der Hinterers Loisl die Quetsche rausgeholt, so wie er es immer tat, der Ludgers Hansi hatte die Klampfe gestimmt, die beim Heid, seit sie denken konnte, hinten an der Wand hing, und dann hatten sie erst ein paar traurige Lieder gespielt, das gehörte dazu. Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss, danach Ich seh’ den weißen Wolken nach und so, auch etwas Christliches, Jesus, meine Zuversicht, dann aber hatten alle endlich genug getrunken, man fing an, richtig zu singen, und am Ende hatten fast alle getanzt, so wie es sich gehörte. Ja, das war eine schöne Leich’ gewesen beim Hubertus, so etwas gab es heute gar nicht mehr. Das hätte ihm sicher gefallen. Und gerauft hatten auch wieder ein paar zum Schluss, immer dieselben, der Manes Fredl und Maurers Ferdl, die mussten immer raufen, das gehörte einfach dazu. Kein Mensch wusste, warum sie das jedes Mal taten, aber man wartete fast schon darauf. Das war dann auch immer das Ende der Feiern, und die Leute gingen heim, sangen noch auf der Straße, nur der Manes Fredl und der Maurers Ferdl standen dann immer noch zusammen und tranken Schnaps, bis einer nicht mehr konnte oder der Wirt sie rausschmiss. Dann brachte der eine den anderen heim, und am nächsten Tag war wieder alles gut. So wie vorher. Jetzt aber waren die auch schon alle tot, und Josepha kümmerte sich um den Grabschmuck. Machte ja sonst keiner. Ohne sie wäre der Friedhof wahrscheinlich schon ganz überwuchert, denn um die Toten kümmerte man sich ja immer weniger, nur um das Erbe, wenn es da etwas zu holen gab. Von der Gemeinde hatte sie schon eine Urkunde bekommen dafür, als sie 80 wurde. Weil sie den Friedhof machte. Da war extra der Bürgermeister bei ihr, zusammen mit Pfarrer Hinz, und sie hatte Kuchen gebacken und Kaffee gekocht. Es mussten aber beide ganz schnell wieder weg, sie hatten Termine. Das war dann doch etwas schade gewesen. Aber immerhin waren sie dageblieben, bis der Fotograf gekommen war, und am nächsten Tag waren sie dann alle drei in der Zeitung. In ihrem Wohnzimmer. Das hatte sie sehr gefreut, auch wenn es ein bisschen komisch war, so im Mittelpunkt zu stehen beziehungsweise zu sitzen, denn sie hatte gesessen und der Bürgermeister und der Pfarrer hatten gestanden – also jetzt keine Untat oder Sünde oder so, sie waren halt einfach stehen geblieben, sie mussten ja auch gleich wieder weg, wie gesagt. Trotzdem: Den Artikel hatte sie sich ausgeschnitten, der hing jetzt an der Wand und war schon ganz gelb. Das ging ja so schnell, dass das Zeug vergilbte.
Ihr Hubertus hatte dann auch ein schönes Grab bekommen, gleich drüben an der Mauer, wo jetzt der Efeu wächst. Der war damals, als sie ihn begraben hatten, noch nicht da gewesen. Josepha wusste auch nicht, wer ihn angepflanzt hatte, aber er gefiel ihr. So war es auch im Winter immer ein bisschen grün.
Jetzt muss ich aber langsam mal los, dachte sie, es ist ja schon Mittag, und bis zur Kapelle brauche ich meine Zeit. Gut, dass es nicht mehr August ist, sondern schon Oktober, da wird es nimmer so heiß. Auf dem Weg hinüber ist ja nur wenig Schatten, und das strengt schon an. Früher hat mir die Hitze ja nichts ausgemacht, da konnte ich auch auf dem Acker sein und arbeiten, wenn die Sonne am Mittag ganz hoch stand, aber jetzt wird mir da manchmal schwindelig, und einmal hat es mich schon hingehauen draußen, erst im letzten Jahr. Da war ich drüben bei der Resl und habe mit der das Sofa rausgetragen, dass sie es ausklopfen kann, da war es heiß, und erst war mir so komisch schummerig, dass ich gedacht hab, was ist denn jetzt, und dann war ich auf einmal weg. Blaue Flecken habe ich dann gehabt, ganz große, das hat lange gedauert, bis die wieder weg waren, aber sonst war nichts passiert. Die Resl war ja da, die hat gleich den Doktor geholt. Wie der dann gekommen ist, später, da war ich schon wieder auf den Beinen, und wir haben zusammen einen Schnaps getrunken, jeder einen, nur der Doktor seinen großen. So wie immer.
Josepha Regenfuß packte ihren Besen, stopfte einen Lappen und ihren Staubwedel in den Eimer, die Blumen dazu, die sie beim Wimmelbacher kaufte, der einmal in der Woche mit seinem Wagen vorbeikam und der immer alles hatte, na ja, fast alles, man musste sich schon einschränken, im Sommer holte sie die Blumen ja immer aus dem Garten … wo hatte sie angefangen zu erzählen, also zu denken, so für sich? Ist wurscht, es hört ja eh keiner zu. Sie machte sich auf den Weg. Den Besen nahm sie als Stock, um sich darauf zu stützen, denn ein Stock kam nicht infrage, und so war das Gehen doch leichter, es war ja auch ein ganzes Stück Weg. Sie ging gleich hinten raus, an den letzten Häusern vorbei, auf der Straße im Dorf war heute tagsüber sowieso niemand mehr, mit dem man hätte ein Schwätzchen halten können. Die paar Kinder wurden jetzt mit dem Schulbus abgeholt und kamen erst am Nachmittag wieder, die Erwachsenen waren alle in der Stadt zum Arbeiten, und die Alten, für die die Jungen keine Zeit mehr hatten, hatten sie alle ins Altersheim gesteckt. Nur der Riemeisls Hans, der letzte Bauer im Dorf, fuhr noch manchmal vorbei mit seinem großen Bulldog, dass die Fensterscheiben klirrten. Die anderen hatten ihre Höfe alle schon aufgegeben, das brachte ja nichts mehr. Und die Willa, die Rudls Wilhelma, hatte ihren Laden schon vor Jahren zugemacht, da haben die Leute zuletzt nur noch gekauft, wenn sie etwas vergessen hatten, alles andere holten sie mit dem Auto in den Supermärkten aus der Stadt. Kofferraumladungsweise, um dann doch wieder die Hälfte wegzuschmeißen.
»Douderfoh konnsd doch nemmer lehm vo dem bisserla«, hatte die Willa gesagt und ihren Laden eines Tages einfach zugesperrt. »Sollsd immer alles dohohm, aber dann kummd kahner und kahfds, blohs wenns was vergessn ham, massdns nadürli nachds, do holns di dann raus, ohmds und am Wochnend, da kenner die niggs und machn auf freindli und Nachberschafd. Naa, do hobbi ka Lusd mehr drauf. Leggd mi doch alle am Arsch!«
Harte Worte für die alte Willa, hatte Josepha gefunden, aber sie hatte ja recht. Nur für Josepha Regenfuß war es nachher schwerer geworden mit den Lebensmitteln. Sie hatte ja kein Auto und keinen Führerschein, und Fahrrad fuhr sie schon lange nicht mehr, das ging ihr inzwischen viel zu schnell. Na ja, jetzt kam Gott sei Dank der Wimmelbacher einmal in der Woche. Und für den Rest schrieb sie den Heiners, denen sie damals die alte Wiese verkauft hatte und die dort ihr Haus hingebaut hatten, immer einen Zettel, damit sie ihr das, was sie brauchte, mitbrachten.
Danach, also nachdem die Willa ihren Laden zugemacht hatte, fanden sie es alle schade, dass es das »Lädla« von der Willa nicht mehr gab, »und keinen Punkt mehr im Ort, wo man sich trifft und wo man sich das Neueste erzählt, wo man einmal miteinander reden kann und man weiß, was im Ort los ist«, sagten sie dann alle und schauten traurig. Aber das war alles gelogen, denn hingegangen war von denen ja schon lange keiner mehr, genauso wenig wie ins Wirtshaus. Da hockten auch immer bloß dieselben drin und sagten nichts. Ein Treffpunkt war das schon lange nicht mehr. Die Leute fuhren nach der Arbeit heim und gingen nicht mehr, so wie früher, erst ins Wirtshaus. Na ja.
Ob es auch wirklich nicht zu warm würde heut? Gestern waren es noch über 20 Grad gewesen, hatte das Thermometer hinten gezeigt. In der Sonne. Ich hätte mir vielleicht doch meinen Hut mitnehmen sollen, dachte sie sich, der würde mich dann ein wenig vor der Sonne schützen. Und auf dem Weg wird es ja meistens noch wärmer, dachte sie, weil die den Feldweg entfernt und dafür einen Teerweg hingebaut haben. Für die schweren Maschinen vom Riemeisls Hans. Der machte ja alles nur noch mit großen Maschinen, und alles ganz allein, der brauchte keinen Knecht mehr und der Hof auch keine Magd. Sie war ja einmal Magd gewesen, kurz nach dem Krieg damals, und das war gut gewesen, eine schöne Zeit, denn da hatte sie immer gut zu essen gehabt, besser als die anderen. Aber es war auch eine harte Zeit. Gearbeitet hatten sie da, fünf Mägde waren sie gewesen und drei Knechte, so etwas gab es heute gar nicht mehr, von früh bis Nacht und sechs Tage die Woche, oft sogar sieben, wenn es sein musste. Da war das hier noch ein Feldweg gewesen mit drei Spuren, nicht mit zweien wie dann später. Zwei von den Rädern der Karren und in der Mitte eine vom Ochsen oder vom Pferd. Seitdem man alles mit den Bulldogs machte, haben die Feldwege nur noch zwei Spuren, das weiß ja kaum mehr einer. Aber jetzt ist der Feldweg fast wie eine Straße und geteert, auch deshalb wird es da auch schnell warm. Josepha ging bis zu der Baumgruppe, wo das alte Marterl stand mit der Bank und setzte sich einen Moment. Drüben, auf der anderen Seite der Senke, jagte der Hans über den Acker und eggte, das Korn hatte der schon drin und die Halme schon längst wieder untergepflügt. Mit einer Geschwindigkeit ging das heute mit den Maschinen! Und wie das hinter dem staubte, so schnell, wie der fuhr – manchmal wurde der Josepha richtig angst. Die Maschine hörte man bis hierher, die klang fast wie ein Flugzeug. Kein Wunder, dass der immer Kopfhörer aufhatte.
Josepha Regenfuß pflegte die kleine Walpurga-Kapelle drüben am Waldrand schon seit über 50 Jahren. Obwohl es eine katholische Kapelle war mit Maria und so, aber das konnte ja nicht schaden. Der Herrgott wird es mir auch so vielleicht anrechnen, dachte sie oft, der ist doch für alle der Gleiche, oder nicht? Ein-, zweimal pro Woche ging sie hinüber, fegte die Blätter hinaus, wechselte das Wasser und die Blumen, wischte den Staub und die Spinnen vom Jesus am Kreuz, vom Betbänkchen und den Fenstern und tat halt, was getan werden musste. Es kümmerte sich ja sonst keiner drum.
Gebaut hatte die Kapelle der Friedhammers Loner, der Leonard hinten aus Gräfenberg, der war katholisch gewesen. Gleich nach dem Krieg, noch 46. Wahrscheinlich, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Ganz sicher aber, weil er zeigen wollte, wie gut er ist. Oder im Grunde ist. Und weil er Bürgermeister werden wollte. Da machte es sich gut, wenn man christlich was tat. Und er ist ja auch Bürgermeister geworden dann, die Leute sind ja so vergesslich. Aber der Pfarrer hatte damals ja auch immer gepredigt, dass er es werden sollte. Dabei war der Loner immer ganz vorne dabei gewesen und einer der Ersten, als es um die Juden ging. Josepha war ja noch ganz klein zu der Zeit, erst zehn oder elf, aber das hatte sie nicht verstanden, dass man die Familien aus ihren Häusern jagt, ihre Möbel auf die Straße schmeißt und die Leute dann noch verprügelt, auch die Frauen. Das waren doch alles Nachbarn gewesen und Leute, mit denen man zusammensaß. Bei diesen Sachen war der Friedhammers Loner immer ganz vorne dabei gewesen. Auch wie sie die dann alle zusammengetrieben und nach Nürnberg gefahren hatten. Keiner von denen ist je wieder zurückgekommen, auch nach dem Krieg nicht.
Damals hatte sie ja noch in Ermreuth gewohnt, erst als sie ihren Hubertus geheiratet hatte, war sie heraus nach Wohlmannsgesees gezogen. Beim Tanzen hatte sie ihn kennengelernt, er hatte ihr den Hof gemacht, und sie hatte erst nicht gewollt, dann hatte sie aber doch Ja gesagt. War ja auch eine harte Zeit gewesen damals, und der Hubertus war eine gute Partie. Der Friedhammers Loner war dann tatsächlich Bürgermeister geworden drunten in Streitberg. Aus Gräfenberg war er weggezogen, da hatten ihn ja alle gekannt aus der Nazizeit und gewusst, wie er da mit dringesteckt hatte. Den Kohlenhandel von dem Juden hatte er lange noch, damit verdiente er sein Geld. Den hatte er dem Juden damals abgekauft und seinen Viehhandel gleich mit dazu. Eigentlich hatte er den Juden damals mit seinen Freunden zusammen einfach fortgejagt und dann seinen eigenen Namen übers Geschäft gehängt. Und keinen Pfennig bezahlt. »Die werrn alle umbrachd«, hatte die Maiers Betty einmal gemunkelt, aber die Mutter hatte nur »Pssst!« gemacht, und dann wurde nicht mehr darüber geredet, das tat man nicht.
Das war überhaupt alles komisch gewesen damals. Sie hatte gar nicht gewusst, was Juden waren. Für sie waren das immer die Händler gewesen, die nannte man so. Wenn einer handelte, mit Körben, Kohlen, Vieh oder so, dann war das ein Jude. A Juhd. Es gab ja auch die christlichen Juden damals, also die Händler, die in die Kirche gingen. Mit denen aber machte man nicht so gern Geschäfte, weil die betrogen einen immer. Die echten Händler, die guten, also die, die man Juden nannte, die waren immer ehrlich, »auf die kannst du dich verlassen«, hatte ihr Vater gesagt, »vor den anderen aber nimm dich in Acht.« Die waren ja auch die Schmuser, so etwas gab es heute gar nicht mehr. Zu denen ging man, wenn man etwas brauchte oder verkaufen wollte, und die vermittelten das dann. Denn die kamen ja weit herum, bis nach Forchheim und noch weiter, sogar bis Bamberg. Die wussten dann schon, wenn irgendwo einer etwas brauchte oder loswerden wollte.
Sie hatte das lange nicht kapiert, auch das mit den Katholischen nicht. In Ermreuth waren sie ja alle evangelisch gewesen, aber auf der anderen Seite, hinterm Berg, dem Hetzles, die in Hetzles, die waren alle katholisch. Andere Menschen irgendwie, mit Hörnern oder so hatte sie sich das als Kind immer vorgestellt. Und dann, als sie einmal welche gesehen hatte, hat sie sich die ganz genau angeguckt, aber die hatten keine Hörner und keinen Schwanz, die waren eigentlich ganz normal. Trotzdem. Mit denen hatte man nichts zu tun, da führte auch nur der Judenweg hinüber, der Weg, den die Händler gingen. Den gab es heute auch nicht mehr, diesen Judenweg, da hatten sie einen Flugplatz drübergebaut. Auf jeden Fall hatte der Friedhammers Loner, der Leonard hinten aus Gräfenberg, der mit dem Kohlenhandel später in Streitberg, hier heroben die kleine Kapelle gebaut. Verlogen hatte sie das gefunden, aber sie hatte nichts gesagt. Das Reden brachte ja nichts außer Ärger, besser man hielt seinen Mund.
In der kleinen Kapelle hatte schon lange keiner mehr gebetet, da ging niemand hin. Nur Wanderer setzten sich manchmal auf die Bank davor oder im Sommer, wenn es heiß war, hinein. Die machten da sogar Brotzeit, und dann ließen sie ihren Müll da, die Leute hatten keine Manieren mehr. Sie gingen auch nicht mehr in die Kirche. Früher ist man am Sonntag bis runter nach Muggendorf gelaufen, um in die Kirche zu gehen, manchmal sogar bis rüber nach Moggast, und manchmal kam der Pfarrer sogar vorbei. Einfach fragen, wie es einem geht, und einen Schnaps trinken. Jetzt aber hatte sie schon seit Jahren keinen mehr gesehen. Bis hierherauf kamen die nicht mehr, nicht einmal mit dem Auto, da hatte heute ja jeder eins. So dachte die alte Josepha hin und her, setzte ab und zu den Eimer ab, stützte sich auf ihren Besen und verschnaufte einen Moment. Es ist ja auch alles nicht mehr so leicht, wenn man alt ist.
Hustete da jemand?
Josepha hielt inne und lauschte.
Ja, aus der Kapelle war eindeutig ein Husten gekommen. Oder ein Räuspern. Und dann, je genauer sie hinlauschte, Gemurmel oder Gerede, monoton. Ob da tatsächlich mal jemand betete? Das hatte es ja schon lange nicht mehr gegeben. Sie stellte ihren Eimer mit dem Wasser, dem Lappen und den Blumen ab und lugte vorsichtig ums Eck. Ja, da kniete einer! Er hatte die Hände vorm Gesicht und wiegte den Oberkörper vor und zurück. Und hustete wieder, dass seine Haare wackelten.
Das war ein Katholischer, das sah sie sofort. Ein Evangelischer kniet sich nicht hin, der betet auch anders. Und auch nicht zur Jungfrau Maria, denn das murmelte der immer, der Mann, das verstand sie zwischendurch: »Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria …« und so was, und dann wieder Zeug, das sie nicht verstand. Und dann hustete er wieder. Der war ganz schön erkältet. Sie hatte den gar nicht hineingehen sehen in die Kapelle, das wäre ihr doch aufgefallen. Dann betete der also schon länger. Josepha verhielt sich leise und wartete. Der Mann hatte sie nicht bemerkt, er war ganz in sein Gebet versunken. Der war wirklich schon älter, das sah sie, mit einer dünnen Stelle hinten am Kopf, wo die Glatze durchschien. Aber einen Ohrring hatte er – einen Ohrring, in diesem Alter! Das war doch lächerlich, oder? Aber beten konnte der! So etwas hatte sie noch nie gesehen. Mit einer Inbrunst, sagte man das so? Sie glaubte schon. Allein deshalb konnte der nur ein Katholischer sein.
Josepha setzte sich aufs Bänkchen neben der Kapelle und wartete ab. Beim Beten stört man einen nicht, das macht man nicht, das bringt am Ende noch Unglück. Nein, abergläubisch war sie eigentlich nicht, aber sicher ist sicher. Man kann nie wissen, was einem daraus erwächst, und wie das bei den Katholischen war, das wusste sie nicht. Also besser abwarten.
Der Alte aber – warum denke ich eigentlich immer »der Alte«? Ich bin doch selber schon alt, sogar schon viel älter als der!, dachte sie sich – betete und betete und betete. Ob der Hilfe brauchte? Aber sie konnte ja nicht fragen, denn dazu müsste sie ihn ja unterbrechen und stören, und das ging nicht. Also wartete die Josepha. Faltete ihre Hände, sah auf deren verschrumpelte Haut, sah zum Wald hinüber und wieder auf ihre Hände – und irgendwann nickte sie ein.
Als sie wieder erwachte – wie lange hatte sie geschlafen? Sie wusste es nicht – war der Betende fort. Ja, »der Betende« klang viel besser als »der Alte«.
…
»Wir mussten schon anfangen, weil die Sau schreit ja, und die kannst du ja nicht halten.«
Sie nickten. Jeder wehrt sich gegen seinen Tod. Und hat doch keine Chance. Ist so. Blöd, aber nichts zu machen. So ist das Leben. Und der Tod.
Die Sau lag in einer Blechwanne auf dem Boden und dampfte im heißen Wasserbad. Der eine der beiden, Sepp, der Metzger, zog gerade mit brachialer Gewalt eine dicke Kette unter dem massigen Körper des Schweins hindurch, der andere, Hans Weisel, der Bauer des Hofes, dessen Sau es war und für den sie geschlachtet wurde, stand gebeugt über dem noch warmen Tierkörper und schabte mit einer Schabglocke Borsten ab. Beide in einer bis über die Gummistiefel reichenden, blutverschmierten, ehemals weißen Gummischürze. Dann wuchteten sie die Sau auf den Rücken, und Ströme von Wasser ergossen sich über den Wannenrand. Am Boden des Schlachthauses überall Blut. Die Brühe staute sich über dem in den Betonboden eingelassenen Abfluss, der sichtlich mit langen Schweineborsten verstopft war. Die zwei Männer, Hans Weisel und Sepp, der Ältere, wirkten wie ein eingespieltes Team.
…
»Frisch geschlachtetes Fleisch bleibt infolge der Totenstarre auch bei sorgsamer Zubereitung zäh.«
Fleischreife
2
»In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.«
Pfarrer Franziskus Aloisius Heiselbetz stand mit dem Rücken zum Altar, seiner Gemeinde zugewandt, und schlug dreimal das Kreuz. Dann breitete er seine Arme weit aus und segnete das, was »seine Gemeinde«, für die er die Messe las, war: fünf alte vertrocknete Mütterchen, deren dünn krächzenden Stimmchen beim Singen der Lieder man das Quietschen einer alten Kellertüre gerne vorgezogen hätte, und ein gebeugter weißhaariger Alter, der sich gerne noch »Herr« würde nennen lassen und sich entsprechend steif hielt. Kernig sollte das wirken und stramm. Militärisch-deutsche Erziehung hielt ein Leben lang, auch wenn das, was Stolz ausdrücken sollte und Kraft, irgendwann nur noch jämmerlich war, ja sogar peinlich.
»Gehet hin in Frieden!«
Es war nicht einmal Heiselbetz’ Gemeinde. Der Priester war seit Jahren im Ruhestand, lebte im Heim drüben in Ebermannstadt und sprang nur hin und wieder für Messen ein, wenn Not am Priester war – oder dort, wo sonst keine mehr gehalten wurden, weil die Gemeinde zu klein war, der Sprengel zu unbedeutend, so wie hier in der Kapelle St. Konrad in Rüssenbach. Früher war er einmal ein paar Jahre in Ebermannstadt gewesen und hatte in den umliegenden kleinen Gemeinden die Messen gelesen und die Beichte abgenommen, ja, aber das war lange her. Und von daher kannte er auch noch die eine oder andere der Frauen hier, die sich jetzt als alte Hutzelweiblein verschämt und krumm in die harten Bankreihen buckelten. Ob die sich noch an ihn erinnerten? Es würde ihn wundern, wenn nicht. Er hatte manch eine dieser Sünderinnen damals ins Gebet genommen, wenn sie bei ihm beichteten.
Die Glocken begannen zu läuten, der Weihrauch stank in der kalten Kirchenluft, und die Kerzen auf dem Altar rußten. Man müsste einmal den Docht etwas kürzen, aber heute hatte er keine Zeit, er musste gleich anschließend noch weiter. Hatte er »Glocken« gedacht, vorhin? Ein schwingungsunfähiger Eiseneimer musste das sein, der droben im kleinen hölzernen Dachaufsatz kopfüber hing und auf den gerade – bimmbimmbimmbimmbimmbimmbimm – erbarmungslos und viel zu schnell ein Hammer eindrosch. Jämmerliches Geläute all dieser verlorenen Dorfkirchlein. Genauso verloren wie die vertrockneten Weiblein hier. Frisches kam überhaupt nicht mehr nach, früher war das noch anders gewesen, da gingen noch junge Mädels in die Kirche und man konnte Beine sehen, ihre prall geschnürten Brüste, und ihnen Ehrfurcht beibringen vor dem Herrn. Und die Frauen mittleren Alters, die Reiferen, die Volleren, die Erfahreneren, an denen er eigentlich mehr Freude hatte. Optisch natürlich nur! Und vielleicht noch ein bisschen in der Phantasie. Aber heute? Zum Gottserbarmen war das, und zum Unchristlichwerden. Das Alter ist schon etwas Gnadenloses und Unästhetisches. Man mochte sich diesen Frauen nicht einmal mehr auf Atemnähe nähern, und hast du ihnen die Hand gegeben, verspürst du den unstillbaren Drang, dir schnellstens die Hände zu waschen. Das trockene Gebimmel klang wie ein Totenglöckchen. Er faltete seine Hände über dem kleinen Kugelbauch, der seine Soutane wölbte, neigte sein Haupt betont demütig und schob sich, so wie er es immer tat – und wie er es inzwischen schon wieder fast jede zweite oder dritte Woche tat, es heute schon in zwei anderen Gemeinden getan hatte – gemessenen Schrittes den Mittelgang entlang dem Ausgang zu. Dort setzte er das mildeste Lächeln auf, das er im Repertoire hatte, nahm gleich neben Opferstock und Weihwasserbecken – ja, sah er recht? Da schwamm, verkrümmte Beine nach oben, doch tatsächlich groß eine tote Spinne drin! War das ein Zeichen Gottes? Aber wofür? – Position ein, um die Handvoll Gemeindemitglieder einzeln und per Handschlag zu verabschieden und ihnen das Gefühl zu geben, genau zu sehen, wie viel sie für das Wohl von Kirche und Gemeinde spendeten. Na, für zwei, drei Bier würde es schon reichen, ohne dass es gleich auffiel. Seit Priester Heiselbetz es sich angewöhnt hatte, sich hier zu platzieren, war das Spendenaufkommen der Gläubigen spürbar gestiegen. Er würde es nachher in St. Marien in Wohlmuthshüll wieder genauso tun. Durch dieses Händeschütteln fühlten sich die Gottesdienstbesucher beachtet und geehrt, die eine oder andere der Alten auch eingeschüchtert, und spendeten gleich noch einmal mehr. Nur deine Hände musst du dir hinterher waschen, natürlich nur aus Hygienegründen, log er seinen Gott an. Aber so funktioniert halt der Mensch. Gibst du ihm das Gefühl, dass du ihn achtest, gibt er dir alles, und du kannst ihn für dich nutzen. Ganze Unternehmen lebten heute davon. Und lügst du dich selber an, so, dass du am Ende selber daran glaubst, dann lügst du am besten und glaubhaftesten. Vor allem: Diese Lügen fliegen fast nie auf, denn dazu müsstest du dich ja selbst als Lügner sehen. Das aber lässt niemand zu. So entstehen die seltsamsten Wahrheiten, und jeder glaubt fest daran.
Zehn Minuten später, er hatte seine Soutane schon abgelegt, sie in seine Tasche gestopft, die Spinne aus dem Weihwasserbecken gefischt und die Kollekte gezählt – zwölf Euro siebenundvierzig waren zusammengekommen, nicht gerade viel, aber vier Euro konnte er davon schon abzweigen, also fast zwei Bier –, schloss er die kleine Kapelle ab und ging hinüber zu seinem Wagen. In zwanzig Minuten wollte er drüben in Wohlmuthshüll sein für noch so einen jämmerlichen Gottesdienst für die paar verbliebenen alten Weiblein, dann würde er zurückkönnen nach Ebermannstadt und endlich ein Bier trinken. Oder vielleicht doch einen Wein? Er startete seinen Wagen und fuhr los.
*
In der Kapelle St. Marien in Wohlmuthshüll saßen die vier alten Weiblein und warteten, zwischendurch sah die eine oder andere auf die Uhr. Nur die Niersbergers Tanni kam nie, wenn der Heiselbetz angekündigt war. Hatte immer irgendeine Ausrede. Die war schon früher nie gekommen, wenn der Heiselbetz die Messe machte. Irgendwann hatte das angefangen, aber dann war der Heiselbetz ja versetzt worden. Ab da, erinnerte sich die Willermanns Norma, war die Tanni wieder regelmäßig gekommen. Nur heute – natürlich! – nicht. Wo der Priester nur blieb? Vereinzelt begann man zu tuscheln, störte die Kirchenruhe. Immer wieder wanderten die Blicke zur Tür hinüber oder lugten zum Eingang der Sakristei, ob sich da etwas tat. Aber es tat sich nichts, der Pfarrer kam nicht. Um 19:00 Uhr sollte die Messe beginnen, und jetzt war es schon eine halbe Stunde drüber. Zehn nach konnte es ja schon mal werden, auch einmal Viertel, daran hatten sie sich längst gewöhnt, sie waren ja dankbar und froh, dass es überhaupt eine Messe gab, aber halb? Das hatte es noch nicht gegeben, so spät war der Heiselbetz noch nie gekommen. 17:30 Uhr war Messe in Rüssenbach gewesen, das wussten sie, drüben auf der anderen Seite der Wiesent. Aber die war schon um halb sieben aus, und mit dem Wagen brauchte man zwanzig Minuten.
Vier Paar alte Frauenohren lauschten hinaus auf die Straße. Kam da endlich das Auto?
Ja, es kam eins, aber es fuhr nur vorbei.
»Also ihch geh edds«, sagte die Willermanns Norma irgendwann, »wall der kummd haid nemmer.« Sie klappte ihr Gebetbüchlein zu, schlug kurz das Kreuz in Richtung des über den Altar genagelten Jesus samt Jungfrau Maria zu seinen Füßen und trat zwischen den Holzbänken hinaus auf den Gang. Dort deutete sie einen Knicks an, aber es knackste nur hörbar im Knie, schließlich schlurfte sie betont langsam hinaus. Man sollte ja auch sehen, wie schwer sie sich mit dem Gehen tat. Böse, ja verächtliche Blicke verfolgten sie. Die schwere Holztüre der Kapelle fiel ins Schloss. Für den Moment, als sie geöffnet war, hatte man draußen die Amsel gehört, obwohl es schon langsam wieder Richtung Herbst ging. Aber die Amseln sangen manchmal abends trotzdem, oft kurz bevor ein Regen kam.
»Des machdmer ned!«, zischte die Veiths Erna, »die hädd scho nu aweng waddn könner, der Bfarrer kummd scho nu.« Die Bauers Anni nickte und zog nur verächtlich hoch, die Alte vom Kugler in der Reihe dahinter war schon längst eingenickt und schnarchte leise vor sich hin. Filme könnte man drehen in fränkischen Kirchen und Verhaltensstudien anstellen über Nächstenliebe, Freundschaft und Nachbarschaft.
»Ihch muss zu die Hänner, die müssn eds nai, sunnsd hulldsmer der Hachd.« Auch die Kuglers Mari, wieder aufgewacht, bemühte zehn Minuten später eine windige Ausrede, doch da sollte erst einmal einer etwas dagegen sagen. Sie schlug ihr Kreuz und quietschte zur Tür hinaus, die letzten beiden warfen ihr böse Blicke hinterher. Sie hatten den Absprung verpasst. Draußen war es noch dämmerig und zu warm für die Jahreszeit, in dem Kirchlein aber war es dunkel und kalt. Man konnte sogar den eigenen Atem sehen. Nein, konnte man nicht, aber die alten Weiblein fühlten sich so, da geht die Kälte schnell in die Knochen.
Auch die zwei Verbliebenen, die Veiths Erna und die Bauers Anni, verließen irgendwann später die Kapelle, denn der Pfarrer kam wirklich nicht. Aber das war dann etwas anderes als bei den anderen, das sahen sie so. Und sie hatten bis dahin auch schon etliche Gebete gesprochen. Zumindest hatten sie den Mund bewegt und so getan.
In St. Konrad in Rüssenbach hatte Franziskus Aloisius Heiselbetz, Pfarrer im Ruhestand und wohnhaft im kirchlichen Heim Ebermannstadt, seine letzte Messe gehalten. Gelesen, sagte man auch. In St. Marien in Wohlmuthshüll auf der anderen Seite der Wiesent kam er an diesem Abend nicht mehr an. Das bemerkten aber nur die Veiths Erna und die Bauers Anni. Sie machten darüber aber kein großes Aufheben oder sich auch nur überhaupt Gedanken, denn der Heiselbetz, das wusste man ja, blieb manchmal in dem einen oder anderen Wirtshaus hängen, und hin und wieder mussten ihn die Betreuer aus dem Wohnheim in Ebermannstadt dann auch, verständigt vom jeweiligen Wirt – aber nie, bevor er fünf Brände hatte und entsprechend viele Seidla, man wollte ja auch leben –, abholen und nach Hause fahren. »Auslösen«, wie die das dann nannten. Also gingen die Veiths Erna und die Bauers Anni irgendwann heim und wurden dabei richtig nass, denn es schüttete wie aus Eimern. Ein Wolkenbruch hatte sich über der Fränkischen Schweiz ergossen, der sich gewaschen hatte.
Mehrere Tage fiel es niemandem auf, dass der Pfarrer verschwunden war. Nur im Wohnheim wurde sein Ausbleiben registriert, doch machte man sich hier keine weiteren Gedanken darüber, denn Heiselbetz war ein freier Mann und blieb immer wieder einmal eine Weile aus. Erst drei Tage später, als sein Auto in der Nähe von Streitberg gefunden wurde, auf einem Feldweg stehend und nicht verschlossen, sogar mit steckendem Schlüssel, aber mit leerem Tank, da fragte man sich doch, wo denn der Pfarrer sei. Er aber war verschwunden.
Die Spuren, die man im Auto gefunden hatte, führten wiederum mehrere Tage später zu zwei Halbwüchsigen aus Berlin, die mit ihren Eltern in Ebermannstadt Urlaub machen mussten. Sie hatten, frustriert wie sie waren und wie man sein muss, wenn man aus der Großstadt kommt, gerade pubertiert und dann in so einer gottverlassenen Gegend wie der Fränkischen Schweiz – und auch noch mit seinen Eltern! – Urlaub machen muss, den Wagen auf einem Feldweg an der Straße nach Kanndorf gefunden, kurz hinter dem Wald, offen und mit Schlüssel im Zündschloss, hatten ihn genommen, nachdem sich eine halbe Stunde niemand darum gekümmert hatte, und waren damit über die Äcker geheizt, bis sie einen Platten hatten. Von einem Pfarrer wussten sie nichts.
…
Kommissar Behütuns sah die Stichwunde am Hals des massigen Körpers, der jetzt auf dem Rücken lag, das Blut war offensichtlich schon abgelassen. Die Füße der Sau waren abgeknickt, sie wirkte fast genüsslich entspannt, so wie sie da im heißen Wasserbad lag. Wachen Auges beobachtete er den als »Sepp« Vorgestellten, wie er mit dem Schweinekörper umging.
Peter Dick, Schwager des Hofbesitzers Hans Weisel, hatte dieses »Event« organisiert. Schlachttag auf dem Land wie anno dunnemal mit anschließendem Wursten, mit Blut- und Leberwürsten, Schlachtschüssel und Kesselfleisch, Metzelsuppe, Schnaps und Bier. Er kannte seinen Chef und dessen Vorliebe für Schweinernes, und die Kollegen suchten nach dessen zurückliegenden Erlebnissen immer wieder nach Dingen, die ihn abzulenken in der Lage waren und ihn auf andere Gedanken brachten. Also hatte Peter Dick seinen Schwager gefragt und der hatte sofort zugestimmt.
»Dann muss er aber auch aweng mit anpacken«, hatte der gegrinst, »und unblutig wird das nicht!« Die Geschichte von Behütuns kannte er nicht, Dick hatte sie ihm nicht erzählt. Vielleicht würde er ihn heute irgendwann noch beiseitenehmen und ihn informieren, vielleicht aber auch nicht. Es hing ganz davon ab, wie dieser Tag verlief.
Sie waren aber auch dienstlich bei dieser Hausschlachtung. Doch das wusste außer den Polizisten niemand.
…
»Ganz frisch geschlachtetes Fleisch ist ›unreif‹ und deshalb zäh, es muß abhängen und dadurch Reife erreichen.«
Fleischspeisen
3
Gaststätte Grüner Hans stand auf dem Schild. Behütuns stieg die drei, vier Stufen zum Eingang hinauf und probierte die Türklinke. Die Tür war nicht verschlossen. Alter Ölofengeruch hing in der Luft, sofort war es ihm heimelig.
»Hallo?«
Er lauschte.
Keine Antwort.
Die Tür zur Gaststube nach rechts war angelehnt.
»Hallo?«
Noch immer keine Antwort.
»’S kahns derhamm!«, tönte es von irgendwo aus der Tiefe des Hauses. Trotzdem trat er ein. Die Gaststube war ein kleiner Raum, darinnen gleich rechts der Tresen, links ein Ofen mit lang durch die Stube gezogenem Ofenrohr, vier Tische, mehr nicht. Altdunkles Holz und Dämmerlicht, links hinten an der Stirnwand eine Tür zu einem Nebenraum.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!