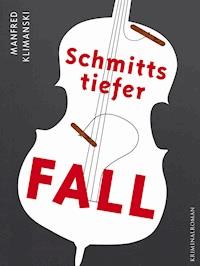
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Streichquartettfestival in Ostratal. Und der Hauptsponsor ist verschwunden. Der etwas heruntergekommene Privatdetektiv Schmitt soll herausfinden, was passiert ist. Merkwürdig, dass der Auftrag nicht von der Ehefrau, sondern von einem jungen Geiger aus Odessa erteilt wird. Und noch merkwürdiger ist, dass niemand aus der feinen Gesellschaft der fiktiven Stadt Ostratal sich um den Verschwundenen, einem Vermögensmakler und Geschäftsführer diverser "Amüsierbetriebe", sorgt. Und auch als dessen Leiche auftaucht, scheint das niemanden wirklich zu berühren. Klimanski schildert mit viel Sachkenntnis die heterogene Bildungsbürgerschicht einer kleinen Großstadt, den Musikbetrieb und auf liebenswerte und humorvolle Art die streichende Zunft der Musiker ohne die Spannung zu vernachlässigen. Besonders bemerkenswert ist ein Ausflug nach Odessa, wo alles anfing....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schmitts tiefer Fall
Buch und AutorSchmitts tiefer FallPrologODESSA, Juni 1993OSTRATAL, Spätherbst 1993OSTRATAL, Montag, 12. Mai 2014Dienstag, 13. Mai 2014Mittwoch, 14. Mai 2015Donnerstag, 15. Mai 2014Freitag, 16. Mai 2014Samstag, 17. Mai 2014Sonntag, 18. Mai 2014Montag, 19. Mai 2014Dienstag, 20. Mai 2014Mittwoch, 21. Mai 2014Meisterkurse OstratalWettbewerb OstratalDankeschönSchmitt zum Dritten ... (und letzten)ImpressumBuch und Autor
Streichquartettfestival in Ostratal. Und einer der Hauptsponsoren wird vermisst. Der etwas heruntergekommene und unglückliche Privatdetektiv Schmitt wird gleich von drei Personen mit der Suche beauftragt. Merkwürdigerweise nicht von der Ehefrau des Verschwundenen. Und ebenso merkwürdig ist, dass sich die Suche als gar nicht so kompliziert erweist. Denn der Sponsor, ein Vermögensmakler und Geschäftsführer eines Amüsierkonzerns, ist schlicht und einfach abgehauen. Wenn er auch nicht sehr weit kam ... Schmitt findet einen Toten, bleibt aber im Geschäft, beauftragt mit der Suche nach ebenfalls verschwundenen Unterlagen über die Geschäftspraktiken des Maklers. Dabei schliddert er ebenso durch das Rotlichtmilieu als auch in die gut- und bildungsbürgerliche Gesellschaft seiner Heimatstadt Ostratal, der fiktiven 300.000-Einwohner Metropole irgendwo in Süddeutschland. Wird Zeuge eines Mordanschlags, findet eine weitere Leiche und kommt selbst in höchste Gefahr.
Der Autor schildert mit großer Sach- und Fachkenntnis ein musikalisches Großereignis, die Finanzierung, Macher und Mitmacher sowie das verehrte Publikum. Dabei führt ein Zweig der Geschichte in die wilden Jahre der wunderschönen Stadt Odessa ins Jahr 1993.
Manfred Klimanski, Jahrgang 1947, war insgesamt 42 Jahre in der Verwaltung von Musikhochschulen tätig, zunächst in Stuttgart, dann seit 1979 bis zu seiner Pensionierung 2011 als Kanzler der Hochschule für Musik Freiburg. Kein Wunder, dass er es auf Musiker abgesehen hat.
Der erste Roman einer Trilogie mit dem Privatermittler Schmitt, seiner Ex Mälis und dem Kriminalhauptkommissar Ringwald erschien im Juni 2014 bei Amazon („Schmitts Fall“ ISBN 978-3-00-045970-2). Der abschließende Teil wird voraussichtlich im Sommer 2016 erscheinen.
Schmitts tiefer Fall
Für Maxim, Natalie, Paul, Svenja, Lea, Joscha, Jannik (damit sie wenigstens etwas haben)
Eine Ähnlichkeit der Figuren dieses Romans mit lebenden oder toten Personen ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig. Soweit Personen der Zeitgeschichte in diesem Roman namentlich genannt werden, können deren Hintergründe wahr oder erfunden sein ...
Für Maxim, Natalie, Paul, Svenja, Lea, Joscha, Jannik (damit sie wenigstens etwas haben)
Prolog
Sie waren hinter ihm her. Das war eindeutig. Kein Zweifel. Zwei Typen im Russensmoking, Mitte zwanzig, kurzgeschorene Haare mit einrasierten Mustern, olivfarbene Haut, schwarzer verdreckter 5er-BMW, tiefer gelegt. Seit Tagen tauchten sie immer wieder auf, fuhren langsam durch seine Straße an seinem Haus vorbei. Folgten ihm zu Fuß auf seinen innerstädtischen Wegen durch die autofreie Zone Ostratals: Büro, Restaurant, Bank, Büro ... Überall bemerkte er die geschmacklosen Adidashosen kombiniert mit unverschnürten Footlocker-Modellen an - wie er bösartig unterstellte – ungewaschenen Füßen. Gesichtsausdruck dreckig wie die Füße. Er hätte das große Rad mit dem Geld seiner Geschäftspartner doch nicht drehen sollen. Es war für ihn in Ordnung gewesen, die Millioneneinnahmen der letzten Jahre aus den Bordellen, den Stripteaseschuppen und dem Mädchenhandel bis Ende 2012 regelmäßig in Zypern bei der Cyprusbank und der Laikabank zu deponieren.
Er hatte bei diversen Kurzurlaubsreisen die schwarze Kohle bar im Koffer nach Zypern gebracht. Und er nutzte die dortige Bankenkrise als einmalige Chance, mehr als eine Million Euro mit der Behauptung abzuzwacken, sie als Schmiergelder zu benötigen. Die seien nötig, um trotz des Einfrierens der Vermögen und der strengen Kapitalverkehrskontrollen im Februar 2013 der drohenden Enteignung zu entgehen. Immerhin sollten zunächst mehr als ein Drittel, dann im Juli 2013 sogar rund die Hälfte der Bankguthaben über 100.000 Euro vom Staate Zypern weggesteuert werden. Schließlich hatte er seinen Geschäftspartnern glaubhaft versichern können, dass sie, statt rund 4 Millionen Euro zu verlieren, nur auf 1,3 Millionen für Bestechungen verzichten mussten. Tatsächlich hatte er mit seinem zypriotischen Kompagnon Kostanopoulos die Gelder schon vorher in Sicherheit gebracht, ihm 100.000 Euro für diese Dienste abgegeben und
den Rest umgehend auf die Britischen Jungferninseln weiter überwiesen. Und ihn dann dermaßen oft von Bank zu Bank in die weiteren altbekannten und -bewährten Steuerparadiese hin- und hergeschoben, dass niemand den Weg dieser Gelder zurückverfolgen konnte.
Die Idee, die Bankenkrise Zyperns zu nutzen, um sich ein gehöriges Stück vom Kuchen abzuschneiden, war für seine Geschäftspartner natürlich nicht akzeptabel. Er hingegen fand sie genial. Zumal er die Bestechungen mit entsprechenden Bescheinigungen von Kostanopoulos nachweisen konnte sowie durch ebenso hervorragend gefertigte wie falsche Urkunden. Seine Geschäftspartner aber fanden das trotz der vermeintlichen Rettung von immerhin mehr als 2,7 Millionen Euro offensichtlich dennoch grenzwertig und beobachteten seine Aktivitäten der Geldwäsche und Anlage misstrauischer als bisher. Was wiederum ihn dazu bewogen hatte, mit weiteren Hunderttausenden weggeschwindelten Euros seine Zukunft abzusichern, für den Fall, dass es ihm in Ostratal zu heiß wurde. Auch diese Gelder waren mittlerweile in Übersee gebunkert. Und nun war der Zeitpunkt gekommen, seine Zelte abzubrechen. Nur seine Geschäftspartner konnten ihm die beiden Killertypen auf den Hals gehetzt haben.
Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, mehr und mehr kroch ihm die Angst den Nacken hoch. Er kannte seine Pappenheimer nur zu gut. Schließlich war er vom selben Schlag und wusste genau, wozu er fähig war. Für seine Partner spielte es keine Rolle, ob er die Gelder unterschlagen oder in den Sand gesetzt hatte. Gingen sie von einer Unterschlagung aus, drohten ihm zuerst Folter, um Informationen über den Verbleib des Geldes aus ihm herauszupressen, und dann das Ende. Nahmen sie nur einen Verlust an, würden sie ihm verzeihen wie letztes Jahr. Das hatte er wenigstens bislang geglaubt. Offensichtlich lag er damit jedoch falsch. Vielleicht gaben sie sich in diesem Fall gnädiger Weise mit seinem schnellen Tod zufrieden. So oder so: Ihm war klar, dass er verschwinden musste. Es tat ihm zwar unendlich leid, seine mühsam aufgebaute Fassade bürgerlicher Existenz in Ostratal aufzugeben, seine attraktive Frau, seine Villa, die Freunde aus dem kulturellen Milieu. Das alles im Tausch gegen sein Leben.
Aber er war seit langem auf diesen Tag vorbereitet. Seit dem Aufkommen der Steuer-CDs und vor allem wegen seiner Anlagebetrügereien. Auch aus Furcht vor staatsanwaltlicher Entdeckung und nicht nur aus Angst vor seinen Kumpanen, aber egal. Er verließ wie jeden Morgen nach einem üppigen Frühstück das Haus, nachdem er sich von seiner Frau verabschiedet hatte, stieg in seine Mercedes-S-Klasse und fuhr in die Randlage der Innenstadt von Ostratal, wo er in einem hypermodernen Bürohochhaus seine Finanzagentur betrieb. Allerdings nahm er heute nicht den Aufzug zu seinem Büro, sondern verließ die Tiefgarage durch einen Seitenausgang, marschierte geradewegs zu seiner Bank und entnahm seinem dortigen Schließfach einiges an Bargeld, die notwendigen Unterlagen für die Auslandskonten, Reisepass und Führerschein, beide echter als echt gefälscht, sowie zwei auf seinen neuen Namen ausgestellte Kreditkarten, bezogen auf ein Schattenkonto bei der Barclays Bank.
Anschließend fuhr er mit der Straßenbahn zu einem Autoverleih, mietete sich dort einen unauffälligen VW Passat-Variant und verließ Ostratal ohne jedes Gepäck und zwar im doppelten Wortsinne. Seine Simcard schmiss er in eine Abfalltonne auf dem Parkplatz der Autovermietung. Sein Smartphone hingegen behielt er. Das war neu und ein Geschenk seiner Frau. In einer kleinen Stadt, von der aus er Frankfurt bequem mit der S-Bahn erreichen konnte, nahm er in einem unscheinbaren Gasthof ein Zimmer und legte sich den genaueren Plan für sein zukünftiges Leben zurecht. Geld hatte er genug. Wo er in Zukunft leben würde, war ihm eigentlich egal. Nur zivilisiert musste es sein. Und kultiviert. Schließlich hatte er sich mittlerweile an einen gewissen Standard gewöhnt.
Er verließ das einfache, aber gemütliche Etablissement, um einige Hygieneartikel nebst Kulturbeutel zu besorgen. Morgen würde er mit der Bahn nach Frankfurt fahren, sich dort mit dem Nötigsten an Wäsche und Kleidung eindecken und mit dem nächstmöglichen Flug verschwinden. Erst einmal weg. Am besten auf Nimmerwiedersehen. So wie er schon einmal vor rund zwanzig Jahren aus den Resten der damaligen Sowjetunion verschwunden war.
Als er in sein Zimmer zurückkehrte, befahl ihm ein instinktiver Fluchtreflex, es umgehend wieder zu verlassen. Was aber nicht möglich war. Die Zimmertür fiel wie von selbst ins Schloss. Mitten im Raum stand ein grinsender Kerl, der ihm irgendwie bekannt vorkam. Eindeutig typengleich mit seinen Verfolgern. Bevor er irgendwie reagieren, auch nur den geringsten Laut herausbringen konnte, legte sich eine Drahtschlinge um seinen Hals. Das muss der andere Drecksrusse hinter mir sein, dachte er. Er versuchte, mit den Fingern zwischen Schlinge und Hals zu kommen, gab aber schnell wieder auf. Ihm dämmerte, dass er hier in diesem Zimmer, in diesem Kaff sterben würde. Eine Erinnerung schoss ihm durch den Kopf. Eine Erinnerung daran, wie er vor langer Zeit schon einmal auf der Flucht vor solchen Typen gewesen war. Typen wie denen, die ihm jetzt das Leben nahmen. Gawno, dachte er. Scheiße. Dann verlor er das Bewusstsein.
ODESSA, Juni 1993
Michail Radenko schloss sein Geschäft wie jeden Tag pünktlich um achtzehn Uhr. Es war nicht viel los gewesen. Das Durcheinander in der Sowjetunion, der Zerfall des riesigen kommunistischen Reiches, das Chaos in der 1991 gegründeten Ukraine nutzten viele clevere Typen in Odessa zu ihrem Vorteil. Michail zählte sich durchaus dazu. Aber irgendwie klappte es bei ihm nicht richtig. Obwohl die Idee mit den Reifen gut war, wie ihm selbst sein Schwiegervater bestätigte. Und der nahm Michail sonst vor allem übel, dass er nicht bei der Musik geblieben war. Immerhin hatte er Domra und Balaleika im Staatskonservatorium Odessa studiert. Aber Michail war weitsichtig genug, um zu wissen, dass er damit weder sich noch seine Frau und ihre zwei kleinen Kinder über Wasser halten konnte. Deshalb lieh er sich schon im August 1991, kaum war die Unabhängigkeitserklärung verkündet, Geld bei einem Bekannten seines Schwiegervaters, einem undurchsichtigen Geschäftemacher schon zu geordneten Sowjetzeiten. In der alten Hafenstadt Odessa waren Geschäfte aller Art nie ein Problem. Im Hinterhof der Buninastraße siebzehn, nahe der Innenstadt, mietete er ein ziemlich baufälliges einstöckiges Gebäude an, besorgte sich Werkzeuge zum Vulkanisieren gebrauchter Reifen und legte unbeschwert und optimistisch los. Es gab mittlerweile genug Autos aus russischer und osteuropäischer Produktion, außerdem zunehmend immer mehr alte und neuere westliche Wagen. Letztere manchmal legal, meistens jedoch geklaut, was aber in diesen Zeiten keine Rolle spielte. Michail bezog sein Reifenmaterial überwiegend aus geschmuggelten Altreifen westlicher Herkunft, teils über LKW- und Busfahrer, eingesammelt auf den Schrottplätzen Westeuropas, vornehmlich Deutschlands. Einen anderen Teil bekam er mit ähnlicher Herkunft über Schiffskapitäne, die im Hafen von Odessa anlegten.
Zwei ehemalige Freunde aus seiner Militärzeit, die einschlägige Erfahrungen aus den Werkstätten der ruhmreichen Sowjetarmee mitbrachten, halfen im handwerklichen Bereich. Eine Freundin seiner Frau unterstützte ihn im Büro.
Alles lief gut an. Dann kamen im Frühjahr 1993 die dubiosen Gestalten, die ihm eine Versicherung gegen Vandalismus verkaufen wollten. Und dies zu einer Prämie, die hanebüchen war. Michail wandte sich hilfesuchend an den alten Freund seines Schwiegervaters. Der riet ihm zu zahlen. Michail entschied sich dagegen und stellte zwei brutal wirkende Wachmänner ein, Angehörige einer berüchtigten Polizeisondereinheit, die abwechselnd für seine Sicherheit sorgen sollten. Das schien ihm billiger und langfristig sinnvoller zu sein. Eines Tages jedoch blieben beide weg. Seine Bürokraft wurde brutal vergewaltigt. Ihm wurde unmissverständlich klar gemacht, dass dasselbe seiner Frau blühen würde. Man könne weder für seine noch für die Sicherheit seiner Familie garantieren, wenn nicht monatlich eine beträchtliche Summe an Schutzgeldern gezahlt würde, hieß es.
Kulanterweise in Karbowanez, der gerade eingeführten ukrainischen Währung, nicht in Dollar. Michail gab seinen Widerstand auf und zahlte. Ihm selbst und seiner Familie blieb kaum noch etwas zum Leben übrig. Seine Gläubiger konnte er gar nicht mehr bedienen.
Und gestern kam dann dieser schicke schwarze BMW in den Hof gefahren, aus dem ein junger Kerl stieg, in der Uniform der neuen ukrainischen Mafia, bestehend aus Adidas-Hosen, Nike-Laufschuhen und schwarzer Lederjacke. Der teilte ihm mit, dass er, Michail die restlichen Schulden nebst den in den letzten zwei Jahren aufgelaufenen Zinsen, alles in allem 12.000 Dollar zurückzahlen müsse und zwar innerhalb der nächsten sieben Tage und wie er sich dies vorstelle. Michail hatte keine 12.000 Dollar. Er verfügte gerade mal über 12.000 Karbowanzen, die entsprachen in etwa 1.200 Dollar.
Gut, war die unfreundliche Antwort, man könne ihm sein Geschäft auch abkaufen. Dann müsse er nur noch 5.000 Dollar zahlen, die restlichen 7.000 würden ihm erlassen. Wenn er das nicht akzeptieren wolle, habe er leider mit Problemen an seinen Kniescheiben, später auch an seinem Rücken zu rechnen. Und noch später ... Er habe eine Woche Zeit, sich zu entscheiden und zu zahlen. Michail wandte sich an seinen Schwiegervater und musste erfahren, dass dessen Bekannter inzwischen in die USA emigriert war und sämtliche Geschäfte und Außenstände verkauft hatte. Der Schwiegervater nahm an, dass er ebenfalls vor einer Mafiabande kapituliert hatte.
Michail Petrowitsch Radenko lief die Buninastraße, benannt nach einem russischen Literaturnobelpreisträger, vormals Rosa-Luxemburg-Straße, deren Namensgeberin bekanntlich nie einen Nobelpreis erhalten hatte, Richtung Zentrum über die Brücke, unter der die Devolanstraße lag. In uralten Zeiten war das die Kanava gewesen, eine Räuber- und Hurenstraße, die direkt vom Hafen in die Oberstadt führte. Hier konnte man alles, was illegal war, kaufen und verkaufen, weit über die Zarenzeit hinaus. Er bog rechts in die Garibaldistraße, folgte ihr bis zur Einmündung in die Deribasovskaya, in deren Verlauf er nach wenigen Metern auf die Kreuzung Pushkinstraße stieß. Dort hielt er kurz inne und entschied sich dann für einen kleinen Umweg rechts in die Pushkin, vorbei am archäologischen Museum und dem „Original der Laokoon-Gruppe“, letzteres in guter Gesellschaft mit weiteren rund fünfzig Exemplaren in ganz Europa. Linkerhand befand sich im Hintergrund das wunderschöne, ehrwürdige Opernhaus, etwas verdeckt durch eine riesige, uralte Eiche. Leicht versetzt auf der linken Seite der Pushkinstraße das eindrucksvolle Marinemuseum. Radenko lief wie in Trance am prunkvollen Gebäude des Stadtparlaments vorbei, das schon seit Gründung Odessas den Stadtrat beherbergte, und weiter auf die Promenade oberhalb des Hafens.
Er blickte - vielleicht ein letztes Mal - auf das Schwarze Meer, auf den alten Getreidehafen hinunter und musste dabei an seinen Vater denken, den er nur aus Erzählungen seiner Mutter kannte. Als neunzehnjähriger Soldat der Roten Armee hatte er „Berlin erobert“, wie seine Mutter es ausdrückte, und war danach bis 1950 in der Nähe von Magdeburg stationiert. Dort lernte er fleißig Deutsch und hatte zuletzt als Unteroffizier vor allem im Büro mit Übersetzungen zu tun und damit bei offiziellen Anlässen auch Kontakt zu ostdeutschen Stellen. Über diese Kontakte machte er die Bekanntschaft mit einigen Deutschen und freundete sich sogar ein wenig an. Zurück in Charkov bekam er eine Stelle als Zugbegleiter bei der staatlichen Eisenbahn und lernte auf einer der Fahrten nach Odessa eine Chorsängerin des dortigen Opernhauses kennen. Sie heirateten 1953 im schmucken Rathaus Odessas und bezogen ein Zimmer in einer ehemals hochnoblen Bürgerwohnung im Zentrum. Küche und Bad teilten sie sich mit vier anderen Familien. Die Wohnungsnot war groß damals in Odessa. 1956 wurde er erneut zum Militär eingezogen, um mit den sowjetischen Truppen in Ungarn den Volksaufstand niederzuschlagen. Als Besatzungssoldat in Budapest knüpfte er Verbindungen zur Unterwelt. Und als er, zurück in Odessa, wieder bei der Bahn anfing, nutzte er im Sommer 1957 eine der regelmäßigen Fahrten Odessa - Shmerinka – Budapest zum Untertauchen und gelangte über Wien nach Deutschland. Seinen 1956 geborenen Sohn Michail hatte er nur wenige Male gesehen. Seine Familie hörte nie wieder von ihm, erfuhr nur gerüchteweise und über Umwege, dass er sich wohl in den Westen abgesetzt hatte.
Radenko schlenderte noch ein paar Meter auf dem Primorskiyboulevard bis zum Hotel Londonskaya, einem der Prachthotels aus zaristischer Zeit, immer noch im alten Glanz die Häuserreihe beherrschend, die auch nicht von schlechten Eltern war. Wehmut drohte sein Herz zu überschwemmen. Er gab sich einen Ruck, kehrte auf der Pushkinstraße zurück bis zur Deribasovskaya, die nach etwa vierhundert Metern zur berühmten Prachtavenue wurde. Geistesabwesend lief er geradeaus bis zum Soborkaplatz, auf dem in früheren Zeiten die große Russisch-Orthodoxe Hauptkathedrale Odessas gestanden hatte, die 1936 auf Befehl Stalins gesprengt worden war. Dort ließ er sich auf einer der Bänke nieder und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Nach und nach nahm er den betörenden Duft der blühenden Weißen Akazien an den Straßenrändern und auf dem Platz wahr, der sich in den Frühlings- und Frühsommermonaten über Odessa legte. Er ging in Gedanken die verschiedenen Möglichkeiten durch, die ihm geblieben waren. Dabei stand für ihn der Schutz seiner Familie, seiner Frau Galina, seiner Tochter Dina und seines Sohnes Alexander an erster Stelle. Aber auch sein eigenes Leben, seine körperliche Unversehrtheit und seine wirtschaftliche Zukunft waren ihm wichtig. Ihm war klar, dass er weder 12.000 noch 5.000 Dollar auftreiben konnte. Ebenso wenig kam es in Frage, in Odessa unterzutauchen. Die Mafia würde ihn auf jeden Fall erwischen und sei es mittels Gewaltandrohung gegen seine Familie. Und es würde nicht bei leeren Drohungen bleiben. Er sah nur einen einzigen Ausweg: Er musste sterben.
Radenko stand auf und ging die Tolstoistraße entlang und dann rechts in die Ostrovidovastraße in Richtung des halblegalen Neuen Marktes. Dabei kam er zur Kreuzung Ostrovidovo und Petra Velikogo. Dort stand das Staatskonservatorium, seine alte Wirkungsstätte, an der er von 1979 bis 1984 studiert hatte. Schräg gegenüber befand sich noch immer die alte deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche St. Paul, eine markante Ruine. Aufgrund ihres vermeintlich durch Kriegseinwirkung zerschossenen Äußeren hatte sie häufig als eindrückliche Kulisse für diverse sowjetische Kriegsfilme gedient. Tatsächlich wurde sie aber durch einen Brand am neunten Mai 1976 zerstört, dem Tag der Siegesfeier über Nazideutschland. Vermutlich wurde vorsätzlich Feuer gelegt. Hier wirkte der Vater des berühmten Pianisten Svatoslav Richter, Teofilus Richter als Organist und Chorleiter, bis er von Stalins Schergen im Keller des KGB in Odessa erschossen wurde. Für all das hatte Radenko heute allerdings weder Augen noch Gedanken.
Zielstrebig bog er nach einigen hundert Metern rechts in die Torgovayastraße ein und landete nach kurzer Zeit vor der imposanten Front der ehemaligen großen Halle des Neuen Marktes, ein Bauwerk noch aus zaristischer Zeit, mittlerweile zur Hälfte Ruine. Er durchquerte den früher in sich geschlossenen, nun nach drei Seiten offenen Lebensmittelmarkt mit seinen Fleischständen, auf denen ganze Schweine- und Rinderhälften nebst allen anderen Teilen dieser Tiere angeboten wurden, ungekühlt und auf Wunsch zerlegt. Er kam an den Kartoffelkisten vorbei mit den uralten Babuschkas und ihren schönen Gesichtern: Gesichter, in die ganze Lebensgeschichten voller Entbehrungen, aber auch voller Freuden gezeichnet waren. Weiter entlang an den Theken mit Milch, Butter, Joghurt und Smetana, einem festen Sauerrahm, wesentlicher Bestandteil des Smetanik, einer herrlichen Schichttorte mit tausend wundersamen Aromen. Sauerkraut direkt aus dem Fass mit x-verschiedenen Zutaten, eingelegte Paprika und Pfefferschoten, Tomaten und Zwiebeln, Obst in zig Variationen, Formen und Mengen.
All das nahm Radenko heute kaum wahr. Ebenso wenig die vielen alten Menschen, die staunend über die Buntheit und Vielfältigkeit durch das Treiben gingen, das sich in den letzten zwei Jahren nach Jahrzehnten der Mangelwirtschaft entwickelt hatte. Dieses Staunen wurde allerdings zumeist schnell von Traurigkeit und Resignation abgelöst, weil sich die meisten der Alten wenig bis gar nichts von dem leisten konnten, was hier so massenhaft angeboten wurde.
Radenko war, so abwesend und in Gedanken versunken er auch schien, andererseits hellwach und vorsichtig, denn nirgendwo in Odessa wimmelte es von Taschendieben so wie hier. Er zog weiter durch die Nonfood-Angebote aller Arten, von Hochzeitskleidern bis hin zu Waschpulver und Gartengeräten. Und genau hier fand er, weswegen er den weiten Fußweg von der Deribasovskaya unternommen hatte. Er kaufte einen stabilen Spaten, zahlte einen wahrscheinlich überhöhten Preis dafür und machte sich auf den Heimweg die lange Torgovayastraße zurück in seinen Stadtteil, die berühmt-berüchtigte Moldawanka, den er nach Überquerung der ehemaligen Zollstraße, der heutigen Komsomolskaya, zwischen dem alten Stadtgebiet Odessa mit Freihafen und diesem Gauner- und Bordellviertel erreichte. Zwei Minuten später bog er in die Mikojanstraße ein. Im Hinterhof der Nummer sechs war er mit seiner Mutter in einem winzigen Haus aufgewachsen, nachdem sein Vater sie beide verlassen hatte. Nach dem Tod seiner Mutter 1983 blieb er in den zwei kleinen Kammern mit Wohnküche und Plumpsklo und auch noch nach seiner Heirat, inzwischen mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern.
Heute war Freitag und Radenko wusste genau, was er am Wochenende und für die Zeit danach zu tun hatte. Zunächst rief er seinen Freund Dimitrij Wolkoff an, den er seit seiner Kindheit kannte. Aufgrund ihrer ähnlichen Statur, der gleichen Haar- und Augenfarbe und einer bei flüchtigem Hinsehen verwechselbaren Physiognomie gingen sie bei vielen als Zwillinge durch. Das setzte sich auch beim Militär fort. Einen großen Teil der vierjährigen Militärzeit hatten sie gemeinsam in der Nähe von Dresden verbracht, Wolkoff als einfacher Rekrut und Radenko zuletzt als Unteroffizier. Völlig unbewusst hatte er einen ähnlichen Weg beschritten wie sein Vater und war wegen seiner hervorragenden Deutschkenntnisse als Verbindungsoffizier regelmäßig mit ostdeutschen Behörden und Einrichtungen in Kontakt. Wolkoff wohnte seit einiger Zeit nicht mehr in der Moldawanka, sondern hatte eine Einzimmerwohnung in einer Trabantenstadt direkt vor den Toren des Stadtgebietes Odessa. Er lebte allein und das war der Grund, warum immer wieder das Gerücht aufkam, dass er schwul sei. Und das konnte in der Ukraine wie früher schon in der gesamten Sowjetunion lebensgefährlich sein. Radenko wusste es besser, aber es hätte ihn auch nicht gestört, wenn an den Gerüchten etwas dran gewesen wäre. Seine Frau Galina mochte Wolkoff nicht und versuchte mit Erfolg, ihn von ihren Kindern fernzuhalten. Das tat ihrer Männerfreundschaft jedoch keinen Abbruch.
„Hallo Mitja, altes Haus, was hast du am Wochenende vor?“
„Grüß‘ dich. Nix, was ich nicht sausen lassen könnte“, antwortete Wolkoff.
„Prima. Mir hängt nämlich im Moment alles zum Hals raus. Besonders meine Arbeit. Und außerdem die Aasgeier, die ständig Geld von mir wollen. Ich muss mal ein Wochenende weg von allem. Wie früher einfach zwei Tage angeln gehen. Hast du Lust? Weg von den Sorgen und von den Gangstern, die mir im Nacken sitzen. Bis Sonntag einfach den Kopf leer kriegen. Wir fahren an den kleinen versteckten See an der Grenze zu Moldawien. Ich nehme das Zelt mit und wir besaufen uns mal wieder ordentlich.“
„Klingt gut. Aber ich wäre auch ohne dein Geschwafel mitgekommen!“
Wolkoff klang begeistert wie immer, wenn sich eine Sauftour mit alten Kumpels ankündigte. Sie verabredeten die Einzelheiten. Wer besorgt was? Wann geht’s los? Was muss alles mitgenommen werden? Mit wessen Auto wird gefahren?
„In Ordnung. Diesmal nimmst du deinen alten Lada. Und vergiss deinen Pass nicht. Im Grenzgebiet ist es ziemlich unruhig. Man weiß nie! Dann also bis morgen um zwölf. Ich warte vor meiner Bude“, verabschiedete Radenko sich.
Am Samstag bog Wolkoff fast pünktlich um Viertel nach zwölf in die schlaglochübersäte Mikojanstraße ein, wo Radenko schon am Straßenrand wartete mit Wodka, Sprotten, eingelegten Gurken und sonstigen deftigen Köstlichkeiten, Weißbrot, dem Zelt, dem neuen Spaten und seinem Angelzeug. Seine Frau und die Kinder ließen sich nicht blicken.
„Was willst du denn mit dem Spaten?“ fragte Wolkoff erstaunt.
„Wie lange warst du nicht mehr angeln? Wir brauchen doch Regenwürmer!“
„Dafür einen funkelnagelneuen Spaten? Da hätte es doch der alte noch lange getan. Du musst ja gut bei Kasse sein …“, brummelte Wolkoff vor sich hin. „Na komm, verstau das Zeug und steig endlich ein!“
Obwohl der alte Lada von Wolkoff mindestens fünfundzwanzig Jahre auf dem Buckel hatte und so verschrammt und verbeult war wie ein Uraltbraunbär in den Karpaten, schnurrte der Motor zuverlässig und ohne Mucken und brachte sie in weniger als drei Stunden in ein weitgehend unberührtes Stück Natur südwestlich von Odessa zu dem kleinen See. Nur ein fast nicht befahrbarer Knüppelweg führte bis etwa zweihundert Meter ans Ufer heran. Dort war eine kleine circa vier Meter breite Stelle vom ansonsten wuchernden Schilf ausgespart. Auf dieser Fläche wollten sie ihr Zelt aufschlagen, ein Feuer anzünden und es sich behaglich machen. Wie in den vergangenen Jahren das eine oder andere Mal.
Aber diesmal kam es anders. Radenko war schon auf der Fahrt einsilbig und in sich versunken, ganz gegen seine sonstige Art. Wolkoff spürte, dass irgendetwas seinen Freund ganz außerordentlich bedrückte und vermutete zu Recht, dass das mit der Erpressung durch die Mafia-Bande zu tun hatte, die Radenko seiner Existenzgrundlage berauben wollte. Zum Teil jedenfalls. Hätte Wolkoff die daraus resultierenden Konsequenzen auch nur geahnt, er hätte auf der Stelle kehrtgemacht. Wolkoff parkte seinen Lada, sie stiegen aus, und Radenko holte als erstes den Spaten aus dem Kofferraum. Ohne Vorwarnung, ohne ein einziges Wort schlug er damit solange auf Wolkoff ein, bis der tot war. Das ganze kam dermaßen plötzlich und überraschend, dass keinerlei Chance zur Abwehr bestand. Nicht ein einziger Laut kam über Wolkoffs Lippen. Nur sein Blick, mit dem er den Freund ansah, bevor seine Augen brachen, war völlig verständnislos und zugleich unendlich traurig. Radenko zog seine Jacke aus und begann, etwa dreihundert Meter vom Auto weg in Richtung Wald ein Grab zu schaufeln. Nach ungefähr einer Stunde hatte er ein rund zwei Meter langes, 70 cm breites und 50 cm tiefes Loch ausgehoben, schleifte Wolkoffs Leiche dorthin, nahm ihm den Pass und alle weiteren persönlichen Dinge ab, steckte ihm stattdessen seinen eigenen Pass und seine persönlichen Dinge bis auf sein Bargeld in Jacke und Hose, zerschlug ihm sodann das Gesicht, quetschte ihm die Fingerkuppen und wälzte ihn hinein. Danach schaufelte er das Loch wieder zu, stampfte die Erde fest und verstreute den Rest in der Umgebung. Im See wusch er sich das Blut von Händen und Gesicht, entnahm seiner Tasche neue Kleidung, zog sich um und verstaute in ihr stattdessen die blutverschmierten, dreckigen Klamotten. Dann stieg er in den Lada, wendete und fuhr nach Odessa zurück.
Unterwegs hielt er mehrmals an menschenleeren Stellen und entledigte sich nach und nach der Ausrüstung und des Proviants, der Tasche mit den blutbefleckten Kleidern und seiner Schuhe. Er warf die Sachen teils in Gewässer, teils auf Müllhalden. Proviant und Wodka deponierte er auch in dunklen Ecken von kleinen Plätzen in unscheinbaren Dörfern. Die würden sicher schnell ihre Abnehmer finden. In Odessa wartete er die Dunkelheit ab, parkte den Lada weit vom Wohnhaus Wolkoffs entfernt und verschaffte sich gegen elf Uhr nachts Zutritt zu dessen kleiner Wohnung mit dem Schlüssel, den er seinem Freund abgenommen hatte. Er suchte alle persönlichen Unterlagen zusammen. Geburtsurkunde, Militärpapiere, Schul- und Hochschulzeugnisse sowie Diplome, steckte die Dokumente in eine Ledermappe, die er in der Wohnung fand und verließ leise die Räume. Fast wäre die Sache noch schief gegangen, weil Radenko im Hauseingang einen Besoffenen dabei störte, seine Notdurft zu verrichten. Der pöbelte sofort los, aber Radenko suchte ohne ein Wort das Weite und der Säufer war durch seinen offenen Hosenstall, seinen urinierenden Schwanz und sein vernebeltes Gehirn zu gehandicapt, um ihn zu verprügeln. Klar, es war Samstagnacht, da ist die eine Hälfte der Odessiten volltrunken und die andere hat sich verbarrikadiert, wusste Radenko. Er ging zum Lada, vorsichtig darauf bedacht, nicht wieder einem Betrunkenen oder, schlimmer noch, einer ganzen Gruppe von Betrunkenen zu begegnen. Er stieg ein und verließ Odessa noch in dieser Nacht, um nie wieder zurückzukehren.
OSTRATAL, Spätherbst 1993
In einem Café in der Innenstadt saßen sich zwei Männer gegenüber. Ein sonniger Nachmittag gestattete es, sich draußen aufzuhalten. Beide rauchten. Der Ältere hatte einen Kaffee und einen Cognac vor sich, der Jüngere nur einen Kaffee. Sie sahen sich ähnlich, beide waren schlank, der Ältere allerdings mit Bauchansatz. Er war Mitte sechzig, sein Gegenüber Mitte Dreißig. Beide hatten eher rundliche Gesichter und dichtes Kopfhaar. Der Ältere war wohlfrisiert mit grauem Einschlag, der Jüngere noch dunkel, dafür weniger gepflegt. Auch ihre Kleidung und Schuhe unterschieden sich. Der Ältere bevorzugte offensichtlich eine dezente Eleganz, wenn auch nicht übermäßig teuer. Der Jüngere besaß eindeutig weder Geschmack noch ausreichend Geld. Billige schlechtsitzende Klamotten, billige Treter an den Füßen. Die zwei sprachen russisch.
„Du nennst dich jetzt also Dimitri Wolkoff“, stellte der Ältere fest.
„Ja. Und du bist in eine Person namens Nikolai Dogrenitsch geschlüpft, statt wie früher Pjotr Iwanowitsch Radenko“, erwiderte der Jüngere.
„Wie soll ich dich nennen, Michail oder Dimitri?“
„Dimitri. Michail ist tot.“
Michail Radenko sprach völlig sachlich. Ohne jede Emotion. Er hatte seine vormalige Existenz in Odessa offenbar hinter sich gelassen.
„Wie hast du mich gefunden?“, wollte Dogrenitsch wissen. „Du warst doch noch ein Säugling, als ich ...“, er machte eine kleine Pause. „ ... fortging.“
„Ganz einfach. Mein Freund Wolkoff war Jude. Ich nahm seine Identität an, um über das jüdische Kontingent, das Deutschland mit Russland und der Ukraine ausgehandelt hatte, auszureisen. Das war wesentlich einfacher, wenn man bereits Verwandte in Deutschland hatte. Also erfand ich einen Onkel, einen vermeintlichen Bruder meines nichtjüdischen Vaters, nämlich dich. Zunächst natürlich unter deinem richtigen Namen, Pjotr Radenko. Unter diesem Namen war in Deutschland allerdings niemand registriert. Und da fiel mir ein, dass du Unteroffizier der Roten Armee warst und was meine Mama mir alles erzählt hat. Dass du zuletzt auch in Ungarn 1956 dabei warst. Also schlug ich dem deutschen Konsularbeamten vor, über den Geheimdienst nach einem Radenko Pjotr Iwanowitsch suchen zu lassen, der vielleicht als Teil irgendeines Deals eine neue Identität bekommen hatte. Möglicherweise hatte er sein Wissen über die Sowjetarmee und die Lage in Ungarn preisgegeben und im Gegenzug einen deutschen Pass erhalten. Und so ähnlich muss es wohl gewesen sein. Denn nach sechs Wochen bekam ich vom Konsulat in Kiew ein Visum mit Daueraufenthaltserlaubnis, deinen Namen und die aktuelle Adresse hier in dem Vorort von Ostratal. Davor hatte ich schon die Ausreisegenehmigung durch die ukrainischen Behörden bekommen.“
„Alle Achtung. Und was erwartest du jetzt von mir?“
„Deine Hilfe beim Start, Onkelchen.“
Wolkoff schaute seinen Vater Hilfe suchend an, wobei er einen leicht spöttischen Ausdruck um die Augen nicht verbergen konnte. Dogrenitsch blickte lange in sein Cognacglas. Endlich schien er eine Entscheidung getroffen zu haben.
„Hör zu. Ich habe genau wie du mit meinem Leben in Odessa abgeschlossen. Und zwar schon 1957. Ich habe dort keine Familie mehr, keine Freunde, keine Kontakte. Ich habe auch nicht die geringste Lust, hier in Ostratal plötzlich einen Sohn an der Backe zu haben und möglicherweise noch dessen ganze Bagage. Ich hege keine väterlichen Gefühle.“
Dogrenitsch wechselte jetzt ins Deutsche.
„Ich helfe dir so, wie ein Onkel einem Neffen helfen würde. Ich helfe dir bei der Abfassung eines Lebenslaufes, bei der Anerkennung deiner Papiere, bei der Beschaffung eines Zimmers oder einer kleinen Wohnung. Ich leihe dir etwas Geld, damit du erstmal über die Runden kommst. Wohlgemerkt leihen, nicht schenken“, betonte Dogrenitsch nachdrücklich. „Wenn du willst, greife ich dir beruflich unter die Arme. Zum Beispiel könntest du mir bei meinen Geschäften behilflich sein. Eventuell kannst du dich mit einem Abendstudium zum Betriebswirt qualifizieren. Aber geh mir bitte nicht auf den Sack.“
Wolkoff schaute verständnislos.
„Nerv mich nicht, meine ich damit. Und häng nicht an meinen Rockschößen, wie man hier zu sagen pflegt. Ponjemaisch?“
„Ja, ich hab‘s verstanden“, nickte Wolkoff. „Was machst du denn beruflich?“
„Ich bin ein Verbrecher.“
So selbstverständlich Dogrenitsch das aussprach, hätte er auch jeden anderen Beruf meinen können. Wolkoff war im ersten Augenblick schockiert über die ungeschminkte Offenheit und die Beiläufigkeit, mit der sein Vater ihm dies eröffnete. Auch im zweiten Moment war er noch perplex und sprachlos. Dogrenitsch sah seinen Sohn kalt an.
„Ich bin einer der Köpfe des Rotlichtmilieus der Region in und um Ostratal. Schau nicht so blöde, so sagt man hier nun mal. Ich hatte kurz vor meiner Flucht 1957 bereits entsprechende Kontakte in Budapest und nach Wien. Die Polizei schleuste mich hier in die einschlägigen Kreise ein. Als Spitzel. Aber nach und nach löste ich mich aus dieser Abhängigkeit. Hin und wieder lasse ich dem Verfassungsschutz einen Tipp zukommen. So heißt der hiesige Inlandsgeheimdienst. Aber nur in politischen Dingen. Das ist alles.“
Die letzten Sätze hatte Dogrenitsch wieder russisch gesprochen.
„Und? Bist du interessiert?“
Wolkoff dachte nach. In Odessa ausgenommen und gejagt von üblen Kriminellen sollte er jetzt selber einer werden?
„Ich glaube, ich kann das nicht. Brutal Menschen zusammenschlagen, möglicherweise sogar töten. Nein danke, lieber nicht.“
Sein Vater lachte spöttisch auf.
„Du glaubst gar nicht, wie schnell man sich daran gewöhnt. Das ist wie mit jedem anderen Beruf. Irgendwann wird alles zur Routine. Aber wenn du nicht willst, musst du dir nicht selbst die Hände schmutzig machen. Dafür haben wir unsere Spezialisten.“
Jaja, dachte Wolkoff, die habe ich in Odessa kennengelernt.
„Du könntest mir auch erst mal bei den Büroarbeiten helfen“, fuhr Dogrenitsch fort. „Beim Geldschleusen, bei der Buchhaltung, beim Kontakthalten zu den Behörden und zur Polizei. Natürlich musst du dazu den Betrieb, sage ich mal, von der Pieke auf, von allen Seiten kennenlernen. Ebenfalls die Leute auf der bürgerlichen Seite, unsere Kunden, die hinter ihrer Fassade oft alles andere als moralisch sauber sind.“
Wolkoff dachte an seine Zeit als Verbindungsoffizier zu den deutschen Stellen in der DDR zurück.
„Ich kann’s mir ja mal anschauen“, sagte er auf Deutsch.
„So ist es recht, Neffe“, erwiderte Dogrenitsch strahlend und jetzt doch mit so etwas wie väterlichem Stolz. Auch wenn er das niemals zugeben würde.
„Aber eine Frage hätte ich noch“, bohrte Wolkoff nach. „Warum habt ihr euren Betrieb, wie du ihn nennst, nicht in einer der großen Städte wie Hamburg oder München angesiedelt sondern in dieser Provinzstadt?“
„Guter Einstieg. Aber du kannst dir nicht vorstellen, welche enormen Vorteile das hat: Kurze Wege, hervorragende Verbindungen zu den staatlichen Stellen, man kennt sich. Und daneben haben wir überall unsere Strohmänner und - natürlich unter verschleierten Eigentumsverhältnissen - diverse Filialen. Du wirst sehen …“
OSTRATAL, Montag, 12. Mai 2014
„Schmitt!“
Endlich. Nach Tagen ohne Kundenkontakt der erste Anruf.
„Mälis hier. Hallo Schmitt“, erklang die muntere Stimme seiner Exfrau am anderen Ende.
„Ach, du bist es“, war Schmitts mürrische und enttäuschte Antwort. „Was gibt’s?“
„Jetzt sei doch nicht gleich wieder so negativ. Ich habe immerhin einen Klienten für dich aufgetan.“
„Dann sollten wir uns unbedingt treffen!“
Schmitt klang sofort wesentlich lebendiger.
„Bei dir oder bei mir im Büro?“
Schmitt hatte aufgrund der geringen Einnahmen in den vergangenen Monaten, vor allem aber wegen seiner angehäuften Schulden, die von seinem letzten Fall herrührten, das angemietete Büro aufgegeben. Stattdessen wurde das Schlafzimmer in seiner Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung in einen Büroraum umfunktioniert. Hätten ihm seine Eltern nicht die abbezahlte Eigentumswohnung in der Falkensteinstraße vermacht, sähe es übel für Schmitt aus. „Bei mir im Büro“ hieß allerdings für Susanne Mälis übersetzt, sich mit ihm in der Kneipe schräg gegenüber seiner Wohnung zu treffen, seinem bevorzugten Aufenthaltsort, soweit er nicht in seinen vier Wänden langsam vergammelte.
Mälis und er verabredeten sich auf neunzehn Uhr „bei ihm im Büro“. Und dort erschien er auch pünktlich. Gewaschener Hals, frisch rasiert, sauberes Hemd, leichte Sommerjacke - es war immerhin Frühling - eine um die Hüfte leicht Wellen schlagende Jeans und bequeme Schuhe. Er wirkte mit seinen stets von ihm selbst geschorenen, schon überwiegend grauen Haaren und den schlaffen, resignierten Gesichtszügen wesentlich älter, als er mit seinen vierundfünfzig Jahren war. Abitur, Zivildienst, Jurastudium, zweimal durch das erste Staatsexamen gerasselt, vielversprechende Ehe mit der angehenden Karrieremusikwissenschaftlerin Susanne Mälis, frustrierender Job als Schadenssachbearbeiter bei einer Versicherung. So weit, so, naja, noch gerade eben gut. Eines Tages jedoch kam es knüppeldick: Erst die Entlassung wegen manipulierter Vorwürfe, dann die Scheidung wegen unerträglichem Selbstmitleid, schließlich der Absturz. Später doch noch eine halbwegs einträgliche Existenz als Privatschnüffler. Bis ihn vor etwa einem Jahr ein völlig verkorkster Fall fast endgültig aus der Bahn warf. Er kündigte seinen Büroraum in der Langgasse zwei und benannte seine Privatdetektei „Schulzenrieder“ um; eine Figur, die gar nicht existierte. Diese vermeintlich geniale Idee erlaubte ihm, sich im Zweifel hinter einem stets abwesenden Chef zu verstecken. Sie bewährte sich aber letztlich genauso wenig wie alles andere in seinem bisherigen Leben. Und seitdem also „Schmitt. Private Ermittlungen“, wie es auf dem Briefkasten, neben der Klingel und auf dem Schild an seiner Wohnungstür zu lesen war.
Schmitt setzte sich in seine gewohnte Ecke hinten im Gastraum. Hier oder vorne an der Theke war sein Domizil. Zehn Minuten später erschien seine Exfrau Susanne Mälis. Genauer: Professor Dr. Susanne Mälis, promovierte Musikwissenschaftlerin mit Spezialgebiet Biografieforschung, Honorarprofessorin an der Universität Aarhus in Dänemark. Klein, kompakt, auf eine freche Art hübsch, ein Lausemädchengesicht mit blondiertem Pagenkopf und modisch schwarzer Hornbrille, wirkte sie mit ihrem nur ein Jahr jüngeren Leben sichtlich und rundum zufrieden. Den Kontakt zu Schmitt hielt sie immer noch aufrecht. Sie wusste selbst nicht, warum. Anhänglichkeit? Mitleid? Schlechtes Gewissen? Vielleicht handelte es sich auch nur um ein ganz normales Verhalten gegenüber einem guten Bekannten. Um sexuellen Notstand ging es jedenfalls nicht. Sie war seit zwei Jahren in jeder Hinsicht befriedigend mit einem Banker liiert. Sehr zum Missfallen von Schmitt. Ausgerechnet ein Banker!
„Hallo Schmitt“, sagte sie leichthin, setzte sich, bestellte einen Weißburgunder und erkundigte sich nach dem Befinden ihres Verflossenen. Ein Fehler. Hätte sie wissen müssen. Sein Gesicht bekam einen zitronensauren Ausdruck um die schmalen Lippen und um die Augen, und er war drauf und dran, die übliche Liste seiner Leiden und die ihm widerfahrenen Ungerechtigkeiten herunterzuleiern und allem und jedem ...
... da wurde ihm Gott sei Dank sein Pils serviert. Er nahm einen Schluck und Mälis fuhr ihm in die Parade.
„Es geht um einen Vermissten“, sagte sie.
Schmitt setzte sein Glas ab.
„Im Ernst? Kein Scheidungsfall? Oder Eierdiebstahl?“
Sein Gesicht vergaß sein ganzes Unglück und nahm wieder menschliche Züge an, zeigte gar echtes Interesse.
„Nein. Es scheint eine einigermaßen komplizierte Geschichte zu sein. Du weißt ja sicherlich, dass gestern das Streichquartett-Festival eröffnet worden ist.“
Dem Gesichtsausdruck ihres vormaligen Mannes entnahm sie, dass er keine Ahnung hatte.
„Mein Gott, Schmitt, bist du seit unserer Scheidung so desinteressiert? Seit sechs Jahren, seit der Schließung unseres Theaters, findet regelmäßig alle drei Jahre das immerhin auch international renommierte Streichquartett-Festival Ostratal statt samt Streichquartett-Wettbewerb. Und du kriegst nicht mit, dass dieser Superevent nun zum dritten Mal über die Bühne geht!“
Schmitt schwieg und schämte sich, wenn auch nur ein bisschen. Seit der Trennung von Mälis hatte er sich tatsächlich wenig, eigentlich gar nicht und uneigentlich noch weniger als gar nicht um die ernste Musik geschert. Und davor auch nur seiner Frau zuliebe. Allerdings musste er einräumen, dass ihn weniger die - zugegebenermaßen hehre - Kunst als die blasierte Gesellschaft der Kunstliebhaber störte. In dieser Ansicht war er erneut durch seinen letzten und bei Lichte betrachtet auch ersten und bisher einzigen großen Fall bestärkt worden.
„Dafür habe ich ja dich. Du warst also beim Festival ...“
Mälis war immer noch konsterniert. Obwohl sie Schmitt lange genug kannte.
„Für das Programmheft des Festivals habe ich wie in den Jahren davor einen Beitrag über die Entstehung dieses Musikgenres, die bedeutenderen Komponisten der verschiedenen Epochen, die schönsten Stücke, wie zum Beispiel Bergs kaum noch aufgeführte ‚Lyrische Suite‘ ...“
Irritiert hielt sie inne und starrte in Schmitts erkennbar desinteressiertes Gesicht. Er gab keinen Ton von sich.
„Offensichtlich kann ich mir die Vorgeschichte sparen?“
Schmitt schwieg beredt. Mälis war zwar nicht eingeschnappt, fuhr aber deutlich kühler fort.
„Gut. Aufgrund dessen war ich jedenfalls gestern Abend zur Eröffnung eingeladen. Die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker“ (Ärsche und Ärschinnen, lästerte Schmitt insgeheim) „waren natürlich anwesend, ebenso die Leiterinnen und Leiter der Meisterkurse“ (die Tische und die Tischinnen, ergänzte Schmitt in Gedanken und unterdrückte ein Gähnen) „die Mitglieder der Jury. Deine Freunde von der Presse, die Sponsoren und Honoratioren ...“
„Susanne, ich bitte dich“, unterbrach Schmitt sie gequält.
„Die beiden Streichquartette aus Nowosibirsk und aus Odessa waren besonders umlagert. Als sich ein deutschsprechender Cellist aus Russland als Befürworter der Krim-Annexion outete, war das russische Streichquartett sofort non grata und alle wendeten sich dem ukrainischen zu. Einem hervorragend Deutsch sprechenden Geiger dieses Quartetts gefiel das Getue um ihren Heldenmut und ihre Opferrolle im Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit und gegen den ‚neuen Stalin‘ Putin offensichtlich immer weniger. Ja, Schmitt, ich komme schon noch zum Punkt. Und ich nahm mich dieses Jungen an.“
„Junge? Wie alt ist er denn?“ fragte Schmitt.
„Fünfundzwanzig.“
„Junge? Mein Gott, das ist ein Mann! Und du hast dich seiner angenommen? Und auf welche Art? Ich meine ...“
„Schmitt, du bist ja eifersüchtig.“
Mälis lächelte spöttisch.
„Quatsch. Ich meine bloß, inwiefern hast du dich seiner angenommen?“
„Naja, zuerst habe ich ihn in eine dunkle Ecke abgedrängt und dann ….“
Schmitt verdrehte die Augen.
„Du, ich habe ihn einfach von der Menge weggelotst. Wir kamen ins Gespräch über alles Mögliche, nur nicht über die Ukraine und die Krim, Putin ...“
„Jetzt komm bitte zum Punkt, Susanne“, verlangte Schmitt ungeduldig.
„Der junge Geiger heißt Alexander Radenko und wollte seinen Vater oder Onkel besuchen. Der lebt hier in Ostratal. Und ist seit rund vierzehn Tagen spurlos verschwunden.“
„Und die Polizei?“
„Seine jetzige Frau hat wohl eine Vermisstenanzeige erstattet. Aber du weißt ja, in solchen Fällen von abgängigen Erwachsenen wird eine Akte angelegt und das ist erstmal alles.“
„Und da dachtest du, dass ich ...“
„Ja. Du hast doch sowieso nichts zu tun im Moment. Oder täusche ich mich?“
„Ja“, rutschte es Schmitt spontan heraus.
„Nein“, gestand er nach einer Weile zerknirscht ein. „Du täuscht dich nicht. Aber ich habe mit sowas doch keinerlei Erfahrung.“
„Nun stell‘ dein Licht mal nicht unter den Scheffel. Mit deinem letzten Fall hast du ganz schön Furore gemacht. Erpressung, Mord, Sodom und Gomorra …“
„Darüber will ich jetzt nicht reden. Sag mir lieber, wie der Junge mich zu bezahlen gedenkt. Sehr flüssig wird er ja wohl nicht sein.“
„Das ist der Clou an der Sache!“
Mälis war richtig in Fahrt und kippte fast ins Selbstgefällige.
„Nach einiger Zeit gesellte sich ein Geigenbauer, einer der Förderer des Festivals, zu uns. Er hat die Nöte des jungen Geigers mitbekommen und erbot sich, innerhalb eines bestimmten Rahmens dein Honorar zu übernehmen. Er hält es allerdings für besser, nicht selbst als dein Klient in Erscheinung zu treten. Der Geigenbauer heißt Wendrich, Meinrad Wendrich. Ich schätze ihn auf etwas über siebzig. Er ist weit über Ostratal hinaus als Restaurateur und als für dieses Milieu relativ seriöser Instrumentenhändler und Gutachter bekannt. Wendrich sponsert den Wettbewerb zum dritten Mal damit, dass er den ersten Preis zur Verfügung stellt. Der besteht aus einem von ihm gebauten Instrumentarium für ein Streichquartett. Die zwei Violinen, die Viola und das Violoncello stellt er ganz individuell auf die Spieler ein. Natürlich macht er das nicht völlig unentgeltlich. Der vermisste Wolkoff gibt ihm ebenfalls zum wiederholten Mal 50.000 Euro dazu, jedoch unter der Hand. Und diese Summe hat Wendrich bis heute noch nicht erhalten. Daher sein Interesse an dem Fall.“
Schmitt war erschlagen.
„50.000 Euro reichen nicht aus für zwei Fideln, eine Bratsche und ein Cello?“
„Mein Lieber, ich gehe davon aus, dass Wendrich mit seinem Renommé nicht weniger als 20.000 Euro pro Geige, 30.000 Euro für eine Viola und 40.000 Euro für ein Cello verlangen kann. Das wären für ein Quartett satte 100.000 Euro. Er legt also für das Festival ordentlich drauf.“
„Das lässt er sich aber wahrscheinlich steuerlich gutschreiben“, kommentierte Schmitt sauertöpfisch.
Mälis seufzte und blickte hilfesuchend im Raum umher.
„Jetzt nimm doch einfach mal eine gute Tat als solche an. Und übrigens übernähme er auch dein Honorar, als gute Tat dem Jungen aus Odessa gegenüber.“
„Ist ja in Ordnung“, beschwichtigte Schmitt sie, „Du weißt doch, wie ich’s meine.“
Das wusste Mälis in der Tat nur allzu gut.
„Ich kann ja mal mit dem jungen Mann reden“, fuhr Schmitt fort. „Ganz unverbindlich. Aber eines sage ich dir vorweg: Verheben werde ich mich nicht nochmal.“
Mälis wusste genau, worauf er anspielte. Bei dem von ihr erwähnten Fall war er nicht nur fast zu Tode gekommen, nicht nur beinahe im Gefängnis gelandet, sondern hatte zu guter Letzt auch noch auf sein Honorar verzichten und den kompletten Vorschuss zurückzahlen müssen. Bloß, weil er diesen von einem Betrag abgezwackt hatte, den er als „herrenlos“ betrachtete.
Mälis klatschte vor Vergnügen innerlich in die Hände.
„Ich rufe den Alexander gleich mal an, um zu hören, wann er sich mit dir treffen kann. Die müssen ja viel proben und üben, haben ihre Lectures ...“
„Ihre was?“
„Ach, du weißt doch ganz genau ...“ Mälis hatte mittlerweile eine Nummer in ihr Handy eingetippt. „Hallo? Hören Sie, ich habe mit dem Privatdetektiv gesprochen. Er ist bereit, sich Ihre Geschichte anzuhören und wird dann entscheiden, ob er die Sache übernehmen kann. Wann haben Sie denn Zeit? Gleich morgen früh um acht ?“
Schmitt wedelte wie verrückt abwehrend mit seinen Händen.
„In Ordnung. Acht Uhr. Falkensteinstraße achtundzwanzig, zweites Obergeschoss. ‚Private Ermittlungen Schmitt‘. Er wird Sie erwarten. Keine Ursache. Gute Nacht. Ja, kein Problem.“
Mälis legte auf und strahlte ihren Ex an.
„Darauf sollten wir noch was trinken. Ich zahle.“
„Bist du verrückt? Acht Uhr!“
Schmitt presste die ohnehin schon schmalen Lippen zusammen und schüttelte den Kopf.
„Da hat dir der ‚Junge‘ aber mächtig imponiert, dass du dich dermaßen ins Zeug legst. Wann hast du mir das letzte Mal was gezahlt?“
Mälis lächelte spitzbübisch.
„Tja, mein Lieber, Geige spielen müsste man können.“
Dienstag, 13. Mai 2014
Um sieben klingelte der Wecker und Schmitt quälte sich wie jeden Morgen aus dem Bett, wenn auch heute außerordentlich früh für seine Verhältnisse. Er schlurfte ins Bad, betrachtete sich im Spiegel über dem Waschbecken und beschloss, sich nicht zu rasieren. Er duschte, trocknete sich flüchtig ab und zog seine Klamotten von gestern Abend an. Da es nicht besonders spät geworden und bei drei Bieren geblieben war, fühlte er sich zwar unausgeschlafen, aber dennoch einigermaßen aufgeräumt. Das Frühstück fiel wie üblich eher karg aus. Zwei Tassen Kaffee, eine Scheibe Brot mit irgendwas drauf (heute war es Salami) und das Verlangen nach einer Zigarette. Eine Art Phantomschmerz, der ihn begleitete, seit er vor zehn Jahren mit dem Rauchen aufgehört hatte. In zwanzig Minuten sollte Alexander Radenko da sein. Schmitt blieb also noch etwas Zeit und er blätterte im Lexikon nach, was er auf die Schnelle über Odessa in Erfahrung bringen konnte.
Was dem einen Zar sein St. Petersburg, war der anderen Zarin ihr Odessa. Muss mal eine prachtvolle Stadt gewesen sein, vermutete Schmitt nach der Lektüre. Vielleicht führte ihn sein Vermisstenfall ja dorthin. Auf Spesenbasis natürlich, verstand sich. Wäre doch mal was. Bevor er jedoch Gefahr lief, sich in Träumereien zu verlieren, versicherte er sich, dass in seinem „Büro“ einigermaßen Ordnung herrschte.
Seiner Meinung nach hatte er nur zweimal in seinem Leben Glück gehabt. Das erste Mal, als er Susanne Mälis ehelichen durfte, die aus der Schar ihrer Verehrer seltsamerweise ihn gewählt hatte. Gut, zugegeben, dieses Glück wurde durch das Pech ihrer Scheidung vor rund zehn Jahren wieder ausgeglichen. Das zweite glückliche Ereignis bestand in der Erbschaft infolge des Unfalltodes seiner Eltern. So zynisch es auch klingen und so sehr Schmitt auch den grausamen und viel zu frühen Tod seiner Eltern betrauern mochte (und das tat er wirklich), kam die Erbschaft doch gerade zum richtigen Zeitpunkt. Weder zu früh, denn dann wäre er noch verheiratet gewesen. Mälis und er hätten die Wohnung sicherlich verkauft und sich davon etwas Schönes





























