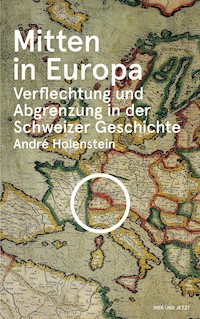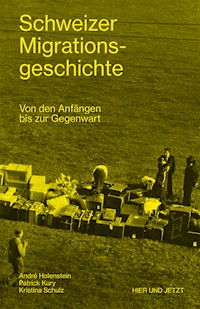
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hier und Jetzt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Migration ist eine historische Normalität. Schon die frühen Besiedlungen der Schweiz am Ende der letzten Eiszeit waren das Ergebnis von Wanderungen. Die eidgenössischen Söldner der Frühen Neuzeit machten Migration zu einem Massenphänomen. Menschen unterwegs haben das Land seit Jahrtausenden mit dem Rest der Welt vernetzt. Die erste Überblicksdarstellung zur Schweizer Migrationsgeschichte geht von den Protagonisten aus: den Frauen und Männern, die sich auf den Weg machten, um Chancen durch Arbeit, Handel oder Bildung wahrzunehmen, um Perspektivlosigkeit und Verfolgung hinter sich zu lassen, um ein besseres Leben zu beginnen. Autorin und Autoren erzählen von der Suche der Eidgenossen nach Arbeit in der Ferne, vom Aufstieg der Schweiz zu einem Zentrum des europäischen Arbeitsmarktes Ende des 19. Jahrhunderts und vom Umgang mit Flüchtlingen und Arbeitsmigranten im 20. und 21. Jahrhundert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SchweizerMigrations-geschichte
Von den Anfängenbis zur Gegenwart
André HolensteinPatrick KuryKristina Schulz
HIER UND JETZT
Einleitung
1 Am Anfang waren Einwanderer
Migration und eidgenössischer Gründungsmythos
Migrationsbewegungen der Frühzeit
Wanderungen im römischen Vielvölkerreich
Spuren in Orts-, Gewässer- und Gebirgsnamen
2 Stadtgründungen und Landesausbau im Hoch- und Spätmittelalter
Brennpunkt Stadt
Bürgerrecht und Bürgergeld als Instrumente der Regulierung
Migrationsräume und Zielorte
Die Migrations- und Integrationspolitik der Stadt Zürich
Der Migrationshintergrund der städtischen Machtelite
Der Landesausbau der Walser in den Hochalpen
Ursachen und Motive der Walserwanderung
Migration in der Wirtschaft der Walser
3 Die militärische Arbeitsmigration ab dem 15. Jahrhundert
Phasen der militärischen Arbeitsmigration
Das Sozialprofil der Militärunternehmer
Das Sozialprofil der Soldaten und Unteroffiziere
Die Allianzen mit den europäischen Mächten als Faktor der Migration
4 Die zivile Arbeitsmigration in der frühen Neuzeit
Handwerksgesellen, Hausierer, Kaufleute
Die Bündner Zuckerbäcker
Handwerker und Gewerbetreibende aus den südalpinen Tälern
Baumeister, Freskomaler, Stuckateure und Maurer
Künstler und Kunsthandwerker
Studenten, Geistliche und Reformatoren
Gelehrte und Wissenschaftler
Hauslehrer, Erzieher und Erzieherinnen, Gouvernanten
Alpwirtschaft, Küherwesen und Schwabengängerei
5 Flucht- und Zwangsmigration im 16. bis 18. Jahrhundert 97
Kriegsflüchtlinge
Glaubensflüchtlinge im 16. Jahrhundert
Glaubensflüchtlinge im 17. und frühen 18. Jahrhundert
Politische Flüchtlinge
Französische Revolutionsflüchtlinge
Flucht- und Zwangsmigration innerhalb der Eidgenossenschaft
6 Die permanente Auswanderung ab Ende des Dreissigjährigen Krieges
Beweggründe der Auswanderer
Das Sozialprofil der Emigranten
Massnahmen zur Minimierung der Auswanderungsrisiken
7 Unterwegs in der Eidgenossenschaft der frühen Neuzeit
Wirtschaftliche und lebenszyklische Faktoren der Binnenmigration
Regional- und geschlechterspezifische Muster
Bürgerrechts- und Arbeitsmarktpolitik als Faktoren der Migration
Einschränkungen des Bürgerrechts auf dem Land
Nichtsesshaftigkeit als Marginalisierungsfaktor
8 Inländer und Ausländer im modernen Staat des 19. Jahrhunderts
Inländergleichstellung in der Helvetik und im neuen Bundesstaat
Eingeschränkte und unerwünschte Mobilität
Der Status der Ausländer
Urbanisierung und Land-Stadt-Migration
Soziale und konfessionelle Segregation
9 Freiheit und Bildung im jungen Bundesstaat
Asylland zwischen freiheitlichen Idealen und aussen-politischen Realitäten
Ausländischer Druck auf Liberale und Republikaner
Umgang mit Sozialisten und Anarchisten
Massenmigration aus Osteuropa
Die Rolle der jüdischen Gemeinden
Bildungsmigration in die Schweiz
10 Im «wilden» Westen und Osten: Auswanderung als Massenphänomen
Migration nach Übersee
Migration nach Afrika, Asien und Ozeanien
Siedlungsprojekte als Massnahmen gegen Pauperismus
Mehr Rechtssicherheit für Auswandernde
Koloniale Verstrickungen
Ethnozid an den Native Americans
Auswanderung in europäische Länder
Die Russische Revolution und ihre Folgen
11 1888 – Die Schweiz wird zum Einwanderungsland
Der Beginn des «Jahrhunderts der Italiener»
Manchesterkapitalismus am Gotthard
Zielorte und Aufstiegschancen italienischer Migranten
Herkunft und soziale Zusammensetzung der Migrantengruppen
Wohlhabende Gäste
Migrationspolitische Vorstösse um 1900
Massnahmen zur stärkeren Kontrolle transnationaler Migration
12 Wendepunkt Erster Weltkrieg: Das Fremde wird zur Bedrohung
Rückgang der Arbeitsmigration und Zuzug neuer Migrantengruppen
Humanitäre Hilfe und Betreuung von Kriegsgefangenen
Krise, Not und Stimmungswandel
Umfassende Kontrollen: Das bundesstaatliche Migrationsregime
Von der Kontrolle zur Abwehr
«Überfremdung» wird zum beherrschenden Schlagwort
13 Asylland im Zeitalter der Weltkriege
Vom Flüchtlingsregime des Völkerbunds zum «wilden Kontinent»
Zwischenkriegszeit: Die Schweiz als Durchgangsland
Zwischen den Fronten: Die Rettungsinsel schliesst ihre Pforten
Formen und Bedingungen des Aufenthalts
Hilfe und Selbsthilfe
Die Ära der Flüchtlinge: Vorgeschichte der Nachkriegszeit
14 Neutralität und humanitäre Sendung: Neufindung in der Nachkriegszeit
Flüchtlingsregime im Schatten der Gewalt
Zum Umdenken aufgefordert
Neutralität und Solidarität
Flüchtlingspolitische Massnahmen
15 «Freie Welt» im Kalten Krieg
Postkoloniale Schweiz
Von Budapest in die Schweiz
Vom Alpenland im Kalten Krieg
… zum Kalten Krieg im Alpenland
Ost-West-Migrationen: Europa und die Schweiz
Offene Arme und Missverständnisse
Günstiger Arbeitsmarkt und politischer Wille
Existenz im Schatten des Bruchs
16 «Trente Glorieuses»? Hochkonjunktur und Überfremdungsängste
Die Süd-Nord-Migrationen der Wirtschaftswunderjahre
Man hat Arbeitskräfte gerufen
… und es kamen Menschen
Deutungen in Wissenschaft und Populärkultur
Überfremdungsängste
Selbstorganisation
«Integration» als «Assimilation»
«Trente Glorieuses»?
17 Die Schweiz und die Globalisierung der Arbeitskraft
Vom liberalen zum restriktiven Asylgesetz
«Die offene, die solidarische Schweiz»
Die Schweiz im Zeichen der europäischen Integration
Globalisierung der Arbeitskraft
Fördern und Fordern: Neue Wege in der Integrationspolitik
Später Triumph der Überfremdungsgegner
Migration – eine historische Normalität: Einsichten und Ausblicke
Anhang
Literaturnachweise zu den einzelnen Kapiteln
Bibliografie
Anmerkungen
Abbildungsnachweis
Verwendete Abkürzungen
Autorin und Autoren
Dank
Einleitung
Migration betrifft unzählige Menschen weltweit. Noch nie waren so viele Frauen, Männer und Kinder unterwegs wie heute. Kein Land ist von Wanderungsbewegungen ausgenommen, ob sie nun grenzüberschreitend stattfinden oder im Landesinneren. Die Bewegungen gehen aus von Menschen, die ihre Familien zusammenführen möchten, von hoch ebenso wie von niedrig qualifizierten Arbeitsmigranten, von Menschen, die Asyl suchen, und anderen Flüchtlingen.
Auch die Schweiz zeichnet sich durch ein hohes Migrationsgeschehen aus: Ein Drittel der gegenwärtig in der Schweiz lebenden Bevölkerung ist in den letzten fünfzig Jahren eingewandert oder besitzt einen eingewanderten Elternteil, ein Viertel ist im Ausland geboren. Entsprechend weist die Schweiz heute – ähnlich wie vor dem Ersten Weltkrieg – nach Luxemburg den höchsten Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung in Europa auf. Dass die Schweiz seit Beginn des 21. Jahrhunderts sowohl demografisch als auch wirtschaftlich zu den Ländern mit hohen Wachstumsraten in Europa zählt, steht in engem Zusammenhang mit der Migrationsentwicklung.1 Eine wichtige Rolle spielte dabei das Abkommen über die Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und den Staaten der Europäischen Union (EU), das im Sommer 2002 in Kraft trat und eine wirtschaftliche und demografische Wachstumsphase begünstigte.
Historisch betrachtet sind solche Zusammenhänge alles andere als ein Novum. Der Blick in die Geschichte der modernen Schweiz zeigt, dass auch frühere Phasen hoher wirtschaftlicher Dynamik jeweils Epochen mit intensivem Migrationsgeschehen waren – so etwa das Zeitalter der Hochkonjunktur von den 1950er-Jahren bis Mitte der 1970er-Jahre, das sich vor allem durch eine starke Zuwanderung auszeichnete, oder die äusserst dynamische Wachstumsphase der Städte vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, die von einer starken Zuwanderung und zugleich von einer intensiven Auswanderung geprägt war.
Auch der Blick in die Zeit vor der Bundesstaatsgründung von 1848 macht ersichtlich, dass Migration schon immer historische Normalität war. Die Gesellschaften der Frühen Neuzeit und des Mittelalters waren weitaus mobiler, als wir uns dies gemeinhin vorstellen. Reisläufer und Söldner stellten bis zur Französischen Revolution ein Massenphänomen dar. Gelehrte und Hauslehrer suchten ihre Arbeit meist ausserhalb des Gebiets der heutigen Schweiz, an Höfen von Königen und Zaren, bei Adeligen oder wohlhabenden Bürgern. Für Gesellen zählte die Wanderschaft, die manche für immer in ferne Länder führte, zur Ausbildungszeit. Gewerbetreibende, Hausierer, Kaufleute, Landarbeiter, Sennen und viele andere mehr machten die Mobilität zur Grundlage einer Wirtschafts- und Lebensweise, die ihnen die Subsistenz und das Fortkommen ihrer Haushalte sicherte und sie für Jahrhunderte in einen generationenübergreifenden Zyklus von Auswanderung und Rückwanderung einband.
Nochmals Jahrhunderte früher wanderten nacheinander Kelten, Römer und Germanen in jenes Gebiet, das wir heute als Schweiz bezeichnen. Ihre Kulturen prägten auf je eigene Weise die Verhältnisse in diesem Raum. Dabei lösten sich diese Kulturen nicht einfach ab, sondern überlagerten und durchmischten sich auf vielfältige Weise. Auch die Mythen über die Anfänge der Eidgenossenschaft und die Ursprünge der Schweiz sind mit Migrationsgeschichten gespickt. Die keltischen Helvetier etwa, die im 1. Jahrhundert vor unserer Zeit im Raum zwischen Boden- und Genfersee gelebt hatten, gaben ihre Siedlungen auf, zerstörten sie, um ihren Wanderungsabsichten Nachdruck zu verleihen und sich südwestlich, das heisst in Gallien, niederzulassen. Nachdem sie bei Bibracte von Cäsars Truppen vernichtend geschlagen worden waren, kehrten sie zurück und errichteten ihre Siedlungen wieder neu. Es waren die Gründerväter der modernen Schweiz, die sich dieser Erzählung im 19. Jahrhundert bedienten, um daraus den offiziellen Staatsnamen Confoederatio Helvetica abzuleiten.
Bereits diese wenigen Beispiele zeigen: Schweizer Geschichte ist Migrationsgeschichte, und ohne Migrationsgeschichte ist eine Geschichte der Schweiz nicht denkbar. Aktuell allerdings ist Migration zu einem gesellschaftspolitischen Reizthema geworden. Wie nur wenige andere Themen beschäftigt es die Menschen. Debatten über die Aufnahme von Flüchtlingen, die Gewährung von Asyl, die Steuerung der Zuwanderung, die rechtliche und gesellschaftliche Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie Fragen des nationalen Selbstverständnisses in einer sich rasch verändernden Welt werden auch in der Schweiz hoch emotional geführt. Dabei stehen sich zwei mehr oder weniger unverrückbare Positionen gegenüber. Die einen sehen in den aktuellen grenzüberschreitenden Wanderungsbewegungen von Flüchtenden und Arbeitsemigranten eine grosse Gefahr für die Nation, vor der einzig der Nationalstaat mit seinen Grenzen schützen könne. Nationalstaaten werden dabei als mehr oder weniger statische Einheiten begriffen, als eigentliche Refugien von Dauer- und Sesshaftigkeit. Dem gegenüber begreifen andere die Staaten als dynamische Gebilde, die fortwährendem sozialem Wandel unterworfen sind. Aus dieser Position heraus wird Migration als Faktor und Produkt hoch mobiler Gesellschaften gesehen. Dazu gehört das Recht, sich möglichst frei zu bewegen. Als Bestandteil der persönlichen Freiheit und als Grundlage für ökonomische Prosperität gelte es, dieses Gut zu wahren. Dazu gehört auch, dass Menschen in Not ein Recht auf Migration besitzen und Unterstützung verdienen.2
Die historische Dimension von Migration bleibt in den aktuellen migrationspolitischen Debatten meistens aussen vor. Vergessen geht insbesondere, dass Menschen aus aller Welt zum Erfolg des Landes und zu dessen wirtschaftlicher und kultureller Ausgestaltung beigetragen haben.
Migration bedeutet, bestehende Grenzen zu überschreiten. Sie ist heute häufig transnational ausgerichtet. Entsprechend lässt sich fragen, ob eine Migrationsgeschichte mit dem Fokus auf die Nation Schweiz nicht per se einen Widerspruch darstellt. Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass die historische Forschung Nationen als verhältnismässig junge Gebilde staatlicher Organisation heute nicht mehr isoliert, sondern verstärkt in ihren gegenseitigen Abhängigkeiten, Verbindungen und Verknüpfungen untersucht. So hat André Holenstein darauf hingewiesen, dass die «Existenz einer souveränen Nation Schweiz […] nur mit Rücksicht auf deren Verflechtungen» verständlich gemacht werden kann, die die politische, kulturelle und soziale Dimension von Mobilität und Migration umfassen.3 Das Überschreiten von Grenzen, das Entstehen persönlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Beziehungen zwischen Menschen, Regionen und Institutionen ist das, was Migration kennzeichnet. Mit genau dieser Rekonstruktion von Verflechtungen, mit den individuellen und kollektiven Erzählungen im Kontext von Weggehen und Ankommen beschäftigt sich die historische Migrationsforschung seit Langem. In den historischen Meistererzählungen der Schweizer Geschichte hingegen haben migrationshistorische Aspekte trotz ihrer grossen Bedeutung bisher erst wenig Platz gefunden. Erst neuere Überblicksdarstellungen wie Thomas Maissens «Geschichte der Schweiz», André Holensteins Verflechtungsgeschichte «Mitten in Europa» oder Jakob Tanners «Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert» haben migrationshistorischen Fragen mehr Platz eingeräumt.4
Der vorliegende Band setzt hier an. Er will seiner Leserschaft einen vertieften Einblick in die Geschichte der Schweiz und deren Bevölkerung mit ihrem reichen und vielfältigen Wanderungsgeschehen gewähren. Das Buch spannt einen Bogen von den Anfängen bis in die Gegenwart und erzählt in 17 chronologisch gegliederten Kapiteln von migrationshistorischen Gründungsmythen, der Suche der Eidgenossen nach Arbeit und Auskommen fern von der Heimat, vom Aufstieg zu einem wichtigen Zentrum des europäischen Arbeitsmarkts gegen Ende des 19. Jahrhunderts und vom Umgang mit Flüchtlingen und Arbeitsmigrantinnen und -migranten im 20. und 21. Jahrhundert.
Das Buch orientiert sich am aktuellen Forschungsstand und versteht den Begriff der Migration als eine längerfristig angelegte, räumliche Verlagerung des Lebensmittelpunktes von Menschen.5 Im Mittelpunkt stehen Individuen, Familien, Gemeindeangehörige oder auch grössere, heterogene Bevölkerungsgruppen, die aus privaten, familiären, wirtschaftlichen, politischen, religiösen oder ethnischen Gründen ihre angestammte Heimat verlassen haben, um an einem neuen Ort vorübergehend oder auf Dauer eine neue Existenz aufzubauen. Auch wenn ihre Motive zum Weggehen ganz unterschiedlich waren und sind und der Aufbruch teilweise aus freien Stücken, teilweise unter Zwang erfolgte – wobei es zahllose Mischformen gibt –, ist ihnen eines gemein: die Hoffnung, am neuen Ort bessere Perspektiven für die Zukunft vorzufinden. Bemerkenswert dabei ist, dass in der Vergangenheit wie in der Gegenwart Menschen nicht einfach aufs Geratewohl aufgebrochen sind. In aller Regel haben sie Zielorte ins Auge gefasst, wo bereits Familienangehörige, Freunde oder Bekannte von Bekannten lebten, die ihnen notwendige Informationen über den Zielort und die Reise zukommen liessen.
Die Orte der Ankunft wie auch diejenigen der Herkunft bildeten keine leeren, rechtsfreien Räume. Vielmehr war das Leben hier wie dort durch ein System von Gesetzen und Regeln sowie von unausgesprochenen Normen geprägt und zeichnete sich durch eine Vielzahl von Gewohnheiten und Gepflogenheiten aus. Diese Tatsache führt neben dem Begriff der Migration zum zweiten zentralen Begriff der Forschung, von dem sich die Autorin und die Autoren des vorliegenden Buchs leiten liessen: Migrationsregime. Damit ist ein Ensemble von «formellen und informellen gesellschaftlichen Regeln, Normen und Wertesystemen» gemeint, die den Umgang einer Gesellschaft mit geografischer Mobilität prägen.6 Der Band nimmt somit auch das Spannungsfeld in den Blick, das zwischen den rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, die Migration regeln, und den Erfahrungen, die Menschen damit machen, besteht. Im Anschluss an die individuellen und kollektiven Motive der Migrantinnen und Migranten stellen sich so zwei umfassende Fragenkomplexe: Wie sind Akteure der Vergangenheit und Gegenwart mit den rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen der Auswanderung, Zuwanderung, Binnenmobilität und Einbürgerung umgegangen? Mit welchen Massnahmen haben Obrigkeit, Regierungen und Behördenvertreter sowie Experten und die Bevölkerung auf Veränderungen im Wanderungsgeschehen reagiert?
Die Migrationsregime der einzelnen Staaten und diejenigen von Staatengemeinschaften sind Reaktionen auf länderübergreifende Migrationsentwicklungen und das internationale Migrationsgeschehen. Um die Aufmerksamkeit zu bündeln, greift das Buch auf einen weiteren in der Forschung diskutierten Begriff zurück: Wanderungssysteme. Ein Wanderungssystem zeichnet sich aus «durch empirisch verifizierbare Abwanderungen vieler Individuen aus einer nach geografischen und wirtschaftlichen Kriterien definierten Region, die über einen längeren Zeitraum hinweg in einen durch steten Informationsfluss bekannten Zielraum führen».7 Die Schweiz vor und nach der Gründung des Bundesstaats war primär in interregionale und europäische Wanderungssysteme eingebettet, seit 1848 darüber hinaus verstärkt auch in transkontinentale Wanderungssysteme der Armuts-, Arbeits- sowie Fluchtmigration.
Das Konzept der Wanderungssysteme ermöglicht es, individuelle Migrationsgeschichten in grösseren Zusammenhängen zu verorten. Es sensibilisiert für die Wahrnehmung von Migration als Prozess, der geografische Räume dauerhaft verändert und miteinander verbindet und neue Informationsflüsse zwischen Ziel- und Herkunftsland produziert. Erst eine solche Einbindung in internationale Zusammenhänge ermöglicht es, die Besonderheiten des schweizerischen Migrationsgeschehens und der schweizerischen Migrationsregime hervorzuheben. Der Fokus auf Migrationsregime erlaubt es zugleich, Kontinuitäten und Wandel im Umgang mit Migration aufzuzeigen, um entsprechende Perioden benennen zu können. So zeigt sich etwa für die Schweiz, dass die traditionellen kantonalen Migrationsregime auch nach der Bundesstaatsgründung 1848 lange weiterwirkten. Bis zum Ersten Weltkrieg waren es die Kantone, die politisches Asyl gewährten sowie die Zulassung von Arbeitsmigrierenden entscheidend prägten.
Das Buch stützt sich zum einem auf eigene Forschungen der Autorin und der beiden Autoren auf dem Gebiet der historischen Migrationsforschung und der Schweizer Geschichte, die hier syntheseartig in eine Überblicksdarstellung Eingang gefunden haben. Zum anderen bildeten eine Vielzahl neuerer und älterer Einzelstudien, die unterschiedliche Aspekte der schweizerischen Migrationsgeschichte vertieft beleuchten, sowie wenige ältere Darstellungen mit Überblickscharakter die Grundlage der vorliegenden Migrationsgeschichte der Schweiz.8 Einen für eine vertiefte Beschäftigung weiterhin unerlässlichen Forschungsüberblick bietet Silvia Arlettaz mit «Immigration et présence étrangère en Suisse» aus dem Jahr 2011.9 Insgesamt hat sich der Forschungsstand als ergiebiger erwiesen, als in der Vergangenheit verschiedentlich bemängelt. Eine 2016 am Historischen Institut der Universität Bern erarbeitete Bibliografie der Forschungsliteratur zur Migrationsgeschichte seit 1848 hat, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, mehr als 600 Titel zu vielfältigen Themen und Zeiträumen zutage gefördert. Auffällig ist dabei, dass das Interesse der Migrationsgeschichte lange Zeit der Auswanderung als herausragendem Wanderungstypus der Moderne galt. Kristina Schulz hat kürzlich an anderer Stelle die Migrationsgeschichte der Schweiz in drei grobe Bereiche gegliedert.10 Bei aller Heterogenität von Zeiträumen, Akteurinnen und Akteuren und geografischen Räumen lassen sich die Forschungsbeiträge in die Themenfelder Migrationsregime, Wanderungssysteme und Überfremdungspolitik und -ängste unterteilen.11
Für das vorliegende Buch besonders hilfreich waren die in den vergangenen Jahren entstandenen Studien, die die Verstrickungen der Schweiz ins weltweite Kolonialsystem untersucht haben. Diese Forschungen haben dazu beigetragen, die Migrationsgeschichte der Schweiz in globaler Perspektive neu zu denken.12 Fruchtbar war auch die vertiefte Beschäftigung mit biografisch angelegten Studien, die die erfahrungsgeschichtliche Dimension von Migrantinnen und Migranten beleuchteten, jedoch selten die eigentliche Fallgeschichte übergreifende Überlegungen aufweisen.
1 Am Anfang waren Einwanderer
Migration und eidgenössischer Gründungsmythos
Migrationsbewegungen der Frühzeit
Wanderungen im römischen Vielvölkerreich
Spuren in Orts-, Gewässer- und Gebirgsnamen
«Der Anfang und das gar ehrenhafte Herkommen der drei Länder Uri, Schwyz und Unterwalden. / Uri hat als erstes Land vom Römischen Reich die Freiheit erhalten, dort zu roden und zu wohnen. / Nachher sind Römer nach Unterwalden gekommen, denen hat das Römische Reich auch bewilligt, dort zu roden und zu wohnen. / Später sind Leute aus Schweden nach Schwyz gekommen, da ihrer daheim zu viele waren. Auch diese empfingen vom Römischen Reich die Freiheit, da zu roden und zu wohnen.»13 (Das Weisse Buch von Sarnen)
Migration und eidgenössischer Gründungsmythos
In den Meistererzählungen der Schweizer Geschichte hat Migration bislang kaum Platz gefunden. Dies überrascht, spielt sie doch eine wichtige Rolle in der mythischen Erzählung von den Anfängen der Eidgenossenschaft im «Weissen Buch von Sarnen» (um 1470). Diese erste zusammenhängende Darstellung der eidgenössischen Gründungsgeschichte setzt nicht etwa mit dem Widerstand gegen die bösen adeligen Vögte ein, sondern mit einer Herkunftssage. Noch bevor die Chronik vom Freiheitskampf der Waldstätte, von Wilhelm Tell und dem Schwur der ersten Eidgenossen auf dem Rütli berichtet, erzählt sie von Einwanderern, denen das Römische Reich erlaubt habe, in den Tälern um den Vierwaldstättersee zu roden und dort zu bleiben. Zuerst seien Siedler nach Uri gekommen, dann hätten Römer Unterwalden bevölkert, und schliesslich seien Leute aus Schweden nach Schwyz gelangt.
In den 1480er-Jahren fügte der Geistliche Heinrich von Gundelfingen (1440/1450–1490) dieser Sage weitere Einzelheiten hinzu.14 Demnach habe in unvordenklicher Zeit in Skandinavien eine Hungersnot geherrscht, die den König von Schweden und den Grafen von Ostfriesland gezwungen habe, die Bevölkerung ihrer Länder zu verkleinern. Mit dem Los seien jene Einwohner ausgewählt worden, die übers Meer hätten auswandern müssen. In ihrer Verzweiflung hätten sich die Vertriebenen zusammengeschlossen und seien raubend südwärts bis an den Rhein gezogen. Dort hätten sich ihnen die Franken unter König Priamus in grosser Überzahl in den Weg gestellt. Unter ihrem Hauptmann Swicerus hätten die Schweden und Friesen die Franken aber in die Flucht geschlagen. Auf ihrer Wanderung seien sie schliesslich in die Gegend am Vierwaldstättersee gelangt, die sie an ihre Heimat erinnert habe. Der Graf von Habsburg habe ihnen als Landesherr erlaubt, dort zu siedeln. Darauf hätten sich die Schweden zwischen Pilatus und Gotthard und die Friesen jenseits des Brünigs im Haslital niedergelassen. Jahre später sei die Christenheit in arge Bedrängnis geraten, als der Heidenfürst Eugenius Papst Zosimus und die Kaiser Honorius und Theodosius aus Rom verjagt habe. Da sei der Gotenkönig Alarich diesen zu Hilfe geeilt, wobei ihn die Schwyzer und Haslitaler als standhafte Christen und treue Diener von Papst und Reich unterstützt hätten. Mit ihrem Heldenmut hätten die Schwyzer und Haslitaler in Rom massgeblich zum Sieg der Christen über die Heiden beigetragen. Als Belohnung hätten die Schwyzer auf ihren Wunsch eine rote Fahne mit den Marterzeichen Jesu Christi und die Haslitaler die Fahne des Kaisers, allerdings nur mit dem einköpfigen Adler, erhalten. Reich beschenkt und im Besitz ihrer urkundlich verbrieften Reichsfreiheit seien die Schwyzer und Haslitaler in ihre Täler zurückgekehrt.
Die Herkunftssagen entsprangen nicht der Fantasie ihrer Verfasser, sondern waren um 1500 in den Waldstätten allgemein bekannt. So forderte ein Schwyzer Sittenmandat Ende der 1520er-Jahre die Landleute auf, jeweils beim Mittag- und Betläuten im Andenken an die Vorfahren aus Schweden fünf Vaterunser und fünf Ave-Maria sowie das apostolische Glaubensbekenntnis zu beten. 1531 bekräftigte die Schwyzer Landsgemeinde diese Anweisung: Die Menschen in Schwyz sollten jeden Tag zu Gott beten, so wie dies schon die frommen Vorfahren aus Schweden getan hätten; Gott habe es ihnen mit viel Gnade und Glück vergolten.15 Das Andenken an die Wanderung der Vorfahren gehörte, so zeigen die Beschlüsse, noch im frühen 16. Jahrhundert zur ehrenhaften Identitätsrepräsentation der Schwyzer. Wie ihre frommen und tapferen Ahnen aus Schweden wollten auch die Schwyzer eigenständig bleiben, nur Gott als ihren Herrn anerkennen und an ihrem alten, wahren Glauben festhalten – ein Bekenntnis, das nicht zufällig im Frühjahr 1531 formuliert wurde, als die reformationspolitische Krise in der Eidgenossenschaft auf ihren Höhepunkt im zweiten Kappelerkrieg zusteuerte.
Die fremde Abstammung und die durch Not erzwungene Auswanderung der Vorfahren aus dem hohen Norden haben sich im Gegensatz zu den tyrannischen Vögten, Tells Apfelschuss und dem Rütlischwur kaum ins kollektive Gedächtnis der Waldstätte eingeschrieben. Durch die Brille des Migrationshistorikers gelesen, erhalten diese Herkunftsgeschichten jedoch paradigmatischen Charakter. In ihnen lebt die Erinnerung daran fort, dass Einwanderinnen und Einwanderer den Raum bevölkert und kultiviert haben, wo in den letzten Jahrhunderten die Schweiz entstanden ist.
Migrationsbewegungen der Frühzeit
Das Ende der letzten Eiszeit bietet sich als Anfangspunkt für eine Geschichte der Migration im schweizerischen Raum an. Nach dem Rückzug der Gletscher und mit der Bildung einer stabilen Pflanzendecke konnten Tiere und Menschen aus verschiedenen Richtungen in die Räume zwischen Léman und Bodensee sowie zwischen Rhein und Tessin einwandern, denn in den Jahrtausenden davor waren nur ein Teil des Jurabogens und wenige Gebiete des Mittellandes nicht von Eis bedeckt gewesen. Um 15 000 v. Chr. gelangten Tiere und Menschen zuerst ins Mittelland und nach zirka 12 700 v. Chr. in die inneralpinen Gebiete. Fortan ernährten sich kleinere Gruppen nomadisierender Wildbeuter für viele Jahrtausende von der Jagd, dem Fischfang und der Sammelwirtschaft.
Ab etwa 6500 v. Chr. breiteten sich Ackerbau und Viehzucht – ausgehend vom Gebiet des so genannten Fruchtbaren Halbmonds zwischen der Levante und dem heutigen Iran – in Europa aus (so genannte neolithische Revolution), indem Bauernvölker einwanderten oder die Wildbeuter die bäuerliche Lebensweise von Nachbarn übernahmen. Im schweizerischen Raum sollen der Ackerbau ab etwa 6500 v. Chr., die Viehzucht ab etwa 5400 v. Chr. betrieben worden sein, wobei Jagen und Sammeln noch für lange Zeit wichtig blieben. Sesshaftigkeit kennzeichnete die neue Kultur, die in der Schweiz mit frühesten archäologischen Spuren von bäuerlichen Siedlungen am Ende des 6. Jahrtausends v. Chr. in der Nordschweiz (Schaffhausen, Basel-Landschaft), im Wallis und im Tessin fassbar wird. Die Sesshaften betrachteten fortan die nomadisierende Lebensweise der Wildbeuter als räuberisch und zerstörerisch. Nomaden und Bauern kamen sich bei der Beschaffung der Nahrung und bei der Kontrolle über die Ressourcen in die Quere. Die Bauernkulturen entwickelten ihre «notorische Aversion gegen alles Fremde».16
Spätestens in der Eisenzeit (8.–1. Jahrhundert v. Chr.) bewohnten keltische Stämme den Raum der heutigen Schweiz. Umstritten ist allerdings, wann diese sich im grössten Teil des schweizerischen Raums – mit Ausnahme bestimmter Täler in Graubünden (Räter) – niedergelassen haben. Ihre Namen (Helvetier, Allobroger, Rauriker, Lepontiner, Uberer, Seduner, Veragrer, Nantuaten) sind nur indirekt in Beschreibungen griechischer und römischer Autoren der Antike überliefert. Unter ihnen waren die Helvetier im 1. Jahrhundert v. Chr. der grösste Stamm. Sie lebten in weiten Teilen des Mittellandes mit Aventicum (Avenches) als Zentrum.17
Die «keltische Frage» hat ihre besondere Bedeutung für die Schweizer Geschichte, weil humanistische Geschichtsschreiber im frühen 16. Jahrhundert in den Helvetiern das nationale «Urvolk» der Schweiz erkannt haben wollten. Die Helvetier gingen fortan in die schweizerische Nationalideologie ein, und ihr Name diente in der Neuzeit dazu, das nationale Band zu beschwören, welches das Konglomerat partikularer Orte trotz aller inneren Gegensätze zusammenzuhalten schien. So wurden bereits im 17. Jahrhundert die Gesamtheit der 13 Orte und ihrer Zugewandten als «Corpus Helveticum» bezeichnet, und «Helvetia» entwickelte sich zur personifizierten weiblichen Repräsentationsfigur der Schweiz. 1798 löste die «Helvetische Republik» die alte Eidgenossenschaft ab, und nach der Gründung des Bundesstaats 1848 wurde, um keine der Landessprachen zu bevorzugen, «Confoederatio Helvetica» offizieller lateinischer Staatsname.
Es entbehrt allerdings nicht der Ironie, dass ausgerechnet der Name jenes Stammes zum Synonym für die Schweiz werden konnte, der sich möglicherweise nur kurze Zeit in diesem Raum aufhielt und diesen aus freien Stücken wieder verliess. Wahrscheinlich wanderten die Helvetier erst kurz vor 100 v. Chr. aus dem süddeutschen Raum ins schweizerische Mittelland ein. Doch schon 58 v. Chr. zerstörten sie hier ihre Wohnstätten und zogen aus ungeklärten Gründen unter ihrem Führer Divico weiter, um sich zwischen Bordeaux und Toulouse niederzulassen. Dort hatten sie sich bereits 107 v. Chr. aufgehalten und bei Agen gemeinsam mit den germanischen Kimbern ein römisches Heer geschlagen. Der römische Feldherr Julius Caesar aber setzte der Auswanderung der Helvetier in der Schlacht bei Bibracte 58 v. Chr. ein Ende. Die geschlagenen Helvetier gelangten nicht ins Land ihrer Träume, sondern wurden in stark dezimierter Zahl ins schweizerische Mittelland zurückgeschickt, wo sie – nunmehr unter römischer Herrschaft – das Land gegen Einfälle der Germanen beschützen sollten.
Wanderungen im römischen Vielvölkerreich
War das Südtessin schon 194 v. Chr. von den Römern erobert worden, so gehörte nach der Unterwerfung der Helvetier 58 v. Chr. der grösste Teil des schweizerischen Raums bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. zum Römischen Reich, ohne darin allerdings eine ethnische oder administrative Einheit zu bilden. Im Zuge dieser Eingliederung vermischten sich die einheimischen Kulturen der Kelten und Räter mit jener der Römer. Wenn auch diese Akkulturation als «Romanisierung» bezeichnet wird, darf man sie sich nicht als Übermächtigung der unterworfenen Völker durch die Römer vorstellen. Vielmehr eigneten sich Kelten und Räter die römische Kultur an. Nicht zuletzt durch die Eingliederung der indigenen Eliten in die römische Herrschaftsordnung entstand so die besondere Kultur der Galloromanen. Da sich die römische Einwanderung auf ein paar Tausend Veteranen und Soldaten, einige Hundert Beamte, Ingenieure, Gewerbetreibende und Geschäftsleute beschränkte, blieb das keltische Substrat in der gallorömischen Kultur stark.18 «Der Einfluss der Römer auf die Völker der Kelten und Räter bedeutete für diese nicht nur Fremdherrschaft, sondern auch die Integration in eine grössere Welt und die Einbettung in eine sehr reiche und vielfältige Kultur, die den Nährboden für die Entwicklung Europas bildete.»19
Die Zugehörigkeit zum Römischen Reich brachte den schweizerischen Raum erstmals mit einer urbanen Kultur in Berührung. Die Bevölkerung genoss Schutz und eine lange Friedenszeit. Die Römer legten ein überregionales Strassennetz an und prägten damit langfristig die Raumbildung und Siedlungsentwicklung. Im 4. Jahrhundert führten sie das Christentum ein. In der Westschweiz hatten auch die im Jahr 443 von den Römern angesiedelten Burgunder massgeblichen Anteil am Aufbau kirchlicher Strukturen. Um 450 erfolgte mit Romainmôtier die erste Klostergründung auf heutigem Schweizer Boden, um 515 folgte das Kloster St. Maurice. Im selben Zeitraum, zwischen dem späten 4. und dem 6. Jahrhundert, entstanden an den römischen Zentralorten auch die Bischofssitze Martigny (später verlegt nach Sitten), Augst (später verlegt nach Basel), Windisch, Genf, Chur und Lausanne.
Die Romanisierung erfolgte regional unterschiedlich rasch und intensiv. Sie prägte das Genferseegebiet und das Unterwallis deutlich stärker als das nordwestliche Mittelland, die Nordostschweiz oder die Alpentäler. In der Westschweiz, in Rätien und im Tessin bildeten die Galloromanen über viele Jahrhunderte die Mehrheit der Bevölkerung und legten auf lange Sicht betrachtet das Fundament für die Entstehung der romanischen Schweiz.
Anders verhielt es sich in der Nordschweiz. Seitdem die Grenze des Römischen Reichs an den Rhein verlegt worden war (260 n. Chr.), waren das schweizerische Mittelland und die Bündner Alpenpässe dem Einfluss germanischer Völker ausgesetzt. In der Spätantike schwankte das Verhältnis der Römer zu den Germanen lange «zwischen Konfrontation und Kooperation».20 Im 5. und 6. Jahrhundert gelangten mehrere germanische Völker in den schweizerischen Raum. Im Südwesten siedelten die Römer Reste der Burgunder an (443 n. Chr.), die fortan als ihre Verbündeten gegen die Hunnen und Germanen kämpften und sich rasch in die gallorömische Kultur integrierten. In der zweiten Hälfte des 6. und im 7. Jahrhundert gelangten die Alemannen, die Ende des 5. Jahrhunderts unter die Herrschaft der Franken gefallen waren, über den Hochrhein ins Mittelland. Rätien kam Ende des 5. und im frühen 6. Jahrhundert kurzzeitig unter die Herrschaft der Ostgoten, während die Südschweiz seit Ende des 6. Jahrhunderts zum Reich der Langobarden in Italien gehörte.
Die Einwanderung der Alemannen aus Süddeutschland betrachtet man heute nicht mehr als systematische Landnahme, sondern als eine sich über Jahrzehnte erstreckende, meist friedliche Infiltration, in deren Folge als Erstes die für die agrarische Nutzung günstigen Lagen besiedelt wurden. Mit dem Einsickern der Alemannen wurde die romanische Bevölkerung langsam assimiliert, das Althochdeutsche breitete sich am Hochrhein sowie in grossen Teilen des Jura, des Mittellandes und der Voralpen aus.
Spuren in Orts-, Gewässer- und Gebirgsnamen
Die mit dem Landesausbau verbundenen Migrationsbewegungen der Frühzeit sind abgesehen von archäologischen Spuren vor allem über die Ortsnamen fassbar. Diese lassen sich verschiedenen Namenschichten und Zeiträumen zuordnen und ermöglichen so näherungsweise Aussagen darüber, wann und durch wen ein Raum besiedelt wurde.21 Für die Schweiz unterscheidet man drei Namenschichten. In Gewässer- und Gebirgsnamen (Aare, Birs, Emme, Rhein; Albis, Alpen) fasst man die älteste Namenschicht, die seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. von keltisch-helvetischen, lepontinischen beziehungsweise rätischen Namen überformt wurde. Die Benennungen von Räumen (Helvetier → Helvetia; Räter → Raetia; Lepontiner → Leventina) und von Siedlungen (Avenches, Biel, Brig, Chur, Moudon, Olten, Solothurn, Thun, Winterthur, Yverdon) sind Ausdruck davon.
Mit der Eingliederung des schweizerischen Raums ins Römische Reich wurde diese älteste Namenschicht seit der Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. mit romanischen Namen überlagert und ergänzt. Verbreitet sind Siedlungsnamen, die auf die lateinischen Ausdrücke «campus» (Feld) oder «curtis» (Hof) zurückgehen (Campo TI, Champagne VD, Gempen SO, Gampelen BE, Gampel VS, Court JU, Gurzelen BE, FR und SO, Corcelles BE, NE, VD, Bassecourt JU, Courtelary BE). Auch Gutsnamen, die einen Personennamen mit dem besitzanzeigenden Suffix «-acum» verbinden, verweisen auf römische Besiedlung (Brissago TI, Dornach SO, Erlach BE, Martigny/dt. Martinach VS usw.).
Die alemannische Besiedlung macht sich in einer dritten Phase bemerkbar durch Ortsnamen mit der Endung «-ingen» (ältester alemannischer Siedlungsraum, 6./7. Jahrhundert: Itingen BL, Seftigen BE), mit der Endung «-i(n)ghofen»/«-ikofen» (erster Ausbauraum, 7./8. Jahrhundert: Zollikofen BE, Zollikon ZH, Etziken SO, Etzgen AG) sowie mit der Endung «-wil», «-wiler» (zweiter Ausbauraum, 8.–11. Jahrhundert: Bärschwil SO, Hergiswil NW, Rapperswil BE, SG usw.). Die Verbreitung der Ortsnamen lässt auf ein Wachstum der Bevölkerung und die Gründung neuer Siedlungen ab dem 7. Jahrhundert schliessen. Um 700 waren in der Nordost- und Nordwestschweiz diejenigen Räume wieder besiedelt, die es schon in römischer Zeit gewesen waren; zuvor nicht oder kaum besiedelte Zonen wurden neu erschlossen.22 Die deutsch-romanische Sprachgrenze blieb über die längste Zeit beweglich, wie die Verteilung von Ortsnamen mit dem Kompositum «Walen», «Walchen», «Welsch» zeigt (Walensee beziehungsweise Walenstadt SG, Walchwil ZG, Wahlen BL, Wahlern BE, Wahlendorf BE, Welschenrohr SO), die auf eine Kontaktzone zum romanischen Sprach- und Kulturraum verweisen. Erst in der frühen Neuzeit stabilisierte sich die Sprachgrenze, bis im 19. und 20. Jahrhundert die starke Zuwanderung in die Städte das Gewicht der einzelnen Sprachgruppen besonders entlang der Sprachgrenze (Biel, Freiburg, Sitten) wieder veränderte.
2 Stadtgründungen und Landesausbau im Hoch- und Spätmittelalter
Brennpunkt Stadt
Bürgerrecht und Bürgergeld als Instrumente der Regulierung
Migrationsräume und Zielorte
Die Migrations- und Integrationspolitik der Stadt Zürich
Der Migrationshintergrund der städtischen Machtelite
Der Landesausbau der Walser in den Hochalpen
Ursachen und Motive der Walserwanderung
Migration in der Wirtschaft der Walser
Zwei zentrale Entwicklungen prägten die Schweizer Migrationsgeschichte des Hoch- und Spätmittelalters: die Erschliessung neuer ländlicher Siedlungsräume, der so genannte Landesausbau, und die Gründung zahlreicher Städte. Beide Vorgänge setzten eine säkulare Tradition kolonisatorischer Migration fort. Sie spiegeln das Bevölkerungswachstum und den gesellschaftlichen Wandel, die nicht zuletzt dank eines günstigen Klimas Mittel- und Westeuropa am Übergang vom Hoch- zum Spätmittelalter erfassten. Man schätzt, dass die Bevölkerung im Raum der heutigen Schweiz von knapp 500 000 im Jahr 1000 auf 700 000–850 000 Einwohnerinnen und Einwohner im Jahr 1300 zunahm, wobei das Wachstum bis gegen Mitte des 13. Jahrhunderts besonders ausgeprägt war.23
Da die Landwirtschaft im Mittelalter die Flächenerträge nur unwesentlich steigern konnte, führte das Wachstum der Bevölkerung zwangsläufig zur Erweiterung der agrarischen Anbaufläche, zur Erschliessung neuer Siedlungsräume und zu Migration. Landesausbau und Stadtgründungen veränderten die Natur- und Kulturlandschaft erheblich. Undurchdringliche, öde und dschungelartige Waldgebiete wurden erschlossen, die Siedlungs- und Nutzfläche dehnte sich aus. Um 1400 stiess die Binnenkolonisation jedoch an ihre Grenzen. Die Landreserven waren erschöpft. Als Folge der Agrarkrise, des Bevölkerungsrückgangs nach der Pest und der Verschlechterung des Klimas wurde kolonisiertes Land schon bald wieder aufgegeben und fielen Siedlungen auf marginalen Böden wüst. Neue Städte wurden kaum mehr gegründet, und manche Neugründung entwickelte sich nicht mehr über ein kümmerliches Stadium hinaus.
Brennpunkt Stadt
Die mittelalterlichen Städte Europas mit ihren spezifischen Rechten und Freiheiten unterschieden sich deutlich von den Städten früherer Jahrhunderte. Sie waren nicht nur Sitz herrschaftlicher und kirchlicher Instanzen, sondern trieben als Zentren des Handels auch die Geldwirtschaft voran. Als zentrale Orte mit hoher Arbeitsteilung hatten die Städte einen hohen Bedarf an administrativen, medizinischen, baulichen, kulturellen und künstlerisch-kunsthandwerklichen Dienstleistungen. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner hatten höhere Konsumansprüche als die Menschen auf dem Land.
Im Hoch- und Spätmittelalter vervielfachte sich die Zahl der Städte im Raum zwischen Brügge im Westen und Brest-Litowsk im Osten sowie zwischen Falsterbo (Südschweden) im Norden und Genf im Süden von etwa 200 auf etwa 4000. Zwischen 1240 und 1300 wurden in jedem Jahrzehnt etwa 300 Städte gegründet, zwischen 1300 und 1330 etwa 200 pro Jahrzehnt.24 Besonders dicht war das Städtenetz in dem Raum, der sich von Flandern über Südwestdeutschland und die Schweiz nach Oberitalien erstreckte. Auch im Gebiet der heutigen Schweiz gründeten weltliche und geistliche Herren zwischen 1200 und 1300 zahlreiche Städte. Vor dem 12. Jahrhundert gab es hier nur die spätantiken Bischofsstädte Basel, Chur, Genf, Lausanne und Sitten sowie einige Marktstädte, darunter Zürich, Schaffhausen oder Solothurn. Nun erhöhte sich ihre Zahl von etwa 35 auf fast 200.25 Ihre Einwohnerzahl blieb jedoch bescheiden. Die meisten Städte zählten im 15. Jahrhundert nur einige 100 Einwohnerinnen und Einwohner, vergleichsweise wenige kamen auf mehr als 1000, und nur Basel und Genf erreichten rund 10 000. Metropolen wie Mailand, das schon damals über 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner zählte, fehlten im Raum der heutigen Schweiz ganz.
Grosse Freiburger Stadtansicht (Ausschnitt) von Martin Martini, 1606. Für die Stadtansicht erhielt der in Graubünden geborene und später in Schweizer Städten und in Italien tätige Kupferstecher 30 Livres und das Bürgerrecht von Freiburg. Vogelschaukarte, Ansicht von Süden, wichtige Bauten durch einen grösseren Massstab hervorgehoben.
Die Städte waren Brennpunkte der Migration und ein wesentlicher Faktor für die räumliche Mobilität in der mittelalterlichen Gesellschaft. Nicht nur für ihre Gründung auf der grünen Wiese, sondern auch für ihr langfristiges Überleben waren sie auf Zuwanderung angewiesen. Weil die Sterblichkeit in der Stadt höher war als die Geburtenrate, konnten sie ihren Bevölkerungsstand nicht aus eigener Kraft halten. Pestzüge wirkten sich in den verdichteten Siedlungen viel verheerender aus als auf dem Land. Da die städtischen Haushalte kleiner waren als auf dem Land, waren sie auch weniger fruchtbar. Zudem wiesen städtische Bevölkerungen eine geringe Kontinuität auf. Viele Familien starben aus oder wanderten wieder ab. Für die Stadt Basel beispielsweise wurde berechnet, dass die Bürgerschaft statistisch gesehen im Spätmittelalter innerhalb von hundert Jahren vollständig ausgewechselt wurde.26
Bürgerrecht und Bürgergeld als Instrumente der Regulierung
Wer im Mittelalter eine Stadt gründete, musste Menschen dazu bewegen, ihre angestammten Lebensräume aufzugeben, um in einer fremden Umgebung ein neues Leben zu beginnen. Die Stadtherren lockten mit der Aussicht auf bessere Lebensumstände, konkret: mit der Aussicht auf das Bürgerrecht in der Stadt. Das Bürgerrecht verhiess dem Zuzügler persönliche Freiheit, wenn er Jahr und Tag in der Stadt gelebt hatte, ohne dass sein früherer Herr ihn zurückforderte – der Ausspruch «Stadtluft macht frei» geht auf diesen mittelalterlichen Rechtsgrundsatz zurück. Das Leben hinter Stadtmauern versprach aber auch Schutz vor Krieg und Fehde. So nahm die Stadt Basel 1444 mehrere Tausend Flüchtlinge aus dem Sundgau auf, die sich vor den Armagnaken in Sicherheit brachten. Für die Stadt stellte dies nicht nur wegen der Verschlechterung der Versorgungslage eine Bedrohung dar, sondern auch wegen der Anwesenheit zahlreicher Untertanen feindlich gesinnter Adeliger.27 Für den Bürger galten zudem das besondere Stadtrecht sowie die städtischen Gerichte. Schliesslich konnte der Bürger als Handwerker, Gewerbetreibender oder Händler von den Konsumbedürfnissen, der Kaufkraft und Prosperität einer arbeitsteiligen städtischen Gesellschaft profitieren. Er gehörte zur Gemeinde, die aus ihren Reihen die Räte und städtischen Ämter besetzte, und war zu Wacht- und Kriegsdienst mit der eigenen Waffe und Ausrüstung verpflichtet. Erhob die Stadt eine Steuer, so hatte jeder Bürger gemäss seinem Vermögen dazu beizutragen. Nur als Bürger war der Bewohner einer Stadt mit allen Rechten und Pflichten integriert. Sein Bürgereid verpflichtete ihn zu Loyalität gegenüber der Stadt. Er unterwarf sich dem Recht und den Gesetzen der Stadt und versprach Gehorsam gegenüber den städtischen Amtsträgern. In vielen Städten erneuerten die Bürger ihren Eid jährlich beim politischen Ritual des so genannten Schwörtags.
Die starke Sogwirkung der Städte führte zwangsläufig zu Konflikten mit den Verlierern der Wanderungsbewegungen. Adelige und Klöster verloren Eigenleute und Hörige, von deren Abgaben und Frondiensten sie lebten. Die Landflucht höhlte das Fundament ihrer Herrschaft aus. Die Grund-, Gerichts- und Leibherren auf dem Land reagierten auf die gefährliche Entwicklung. Sie verschärften die Leibherrschaft über ihre abhängigen Leute und liessen diese schwören, sich nicht aus der Herrschaft zu entfernen und sich nicht ausserhalb des eigenen Leibeigenenverbandes zu verheiraten. Sie riefen den Schutz des Kaisers an, der den Städten die Aufnahme von Bürgern verbieten sollte. Bisweilen wehrten sie sich auch mit Gewalt und überzogen die Städte mit Fehde und Krieg. In diesen Zusammenhang gehört etwa der Sempacher Krieg von 1386 zwischen dem habsburgisch-österreichischen Herzog Leopold III. und der habsburgischen Landstadt Luzern. Diese hatte über Jahre habsburgische Untertanen als Ausbürger in ihr Bürgerrecht aufgenommen, was Leopold als Luzerner Stadtherr nicht unwidersprochen lassen konnte. Der Krieg, den die ältere Schweizer Nationalgeschichte gerne als Freiheitskrieg der Eidgenossen gegen Habsburg dargestellt hat, war letztlich die legitime Strafaktion des rechtmässigen Herrn gegen dessen unbotmässige Stadt. Feudalherren konnten auch mit der Gründung eigener Städte auf Wanderungsverluste reagieren. Grundsätzlich aber war die Wirksamkeit dieser Massnahmen eine Machtfrage, und besonders der niedere Adel war dem Aufstieg der Städte recht hilflos ausgeliefert.
Die Städte steuerten die Zuwanderung über die grosszügige beziehungsweise restriktive Erteilung des Bürgerrechts beziehungsweise über die Höhe des Bürgergelds, das Neubürger bei der Aufnahme in den Bürgerverband zu entrichten hatten. Waren Städte dringend auf Neubürger angewiesen, konnten sie das Bürgerrecht auch unentgeltlich verleihen. Umgekehrt erhöhten sie das Bürgergeld, wenn sie keine Neubürger mehr oder nur noch solche mit hohem Vermögen aufnehmen wollten. Phasen der grosszügigeren Integration und Phasen der Abschottung wechselten sich je nach Situation und Bedürfnissen ab. Im Spätmittelalter und bis ins 16. Jahrhundert waren die Städte grundsätzlich auf Zuwanderung angewiesen, sodass sie eine relativ offene Bürgerrechtspolitik praktizierten. Dies war besonders nach Bevölkerungskrisen der Fall, wenn es galt, die Lücken in der Bürgerschaft zu schliessen, die Pest- und Seuchenzüge, Ernteausfälle und Hungersnöte oder verlustreiche Kriege verursacht hatten.
Weil viele Städte ihre neuen Bürger in besonderen Verzeichnissen, so genannten Bürgerbüchern, registrierten, lässt sich die Zuwanderung in die Städte des Spätmittelalters in manchen Fällen genau untersuchen. Die Bürgerbücher erlauben Aussagen über die Reichweite der städtischen Migrationsräume, über das Sozialprofil der Neubürger und über die Migrations- und Integrationspolitik einer Stadt.
Migrationsräume und Zielorte
Grundsätzlich war die Migration in die Städte des Heiligen Römischen Reichs von der Mitte des 13. bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts ein bedeutsamer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Vorgang.28 Das ganze Reich bildete einen grossen Migrationsraum, aus dem Städte ihre neuen Bürger gewannen. Besonders zahlreich stammten Neubürger aus der dichten Städte- und Siedlungslandschaft im Westen des Reichs, aus Flandern, dem Rheinland, aus Schwaben, dem Elsass und dem Schweizer Mittelland. Schwächer war die Zuwanderung aus dem Norden, aus den Gebieten östlich von Weser und Elbe, aus den deutschen Mittelgebirgen sowie aus grossen Teilen des Alpenraums. Der Osten des Reichs und die Alpen waren im Spätmittelalter noch dünn besiedelt und selber Zielgebiete von Kolonisationswanderungen.
Die Neubürger wanderten innerhalb von Sprachgrenzen, die viel stärker als Gewässer oder Gebirge als Migrationsbarrieren wirkten. So migrierten vergleichsweise wenige Neubürger aus den Reichsgebieten westlich des Juras und der Vogesen sowie aus Frankreich, Böhmen, Mähren, Dänemark, Schweden und Polen in die Städte des Reichs. Attraktive Zielorte waren die Städte im Elsass, im Bodenseeraum und in Oberschwaben, im Rhein-Main-Gebiet, im Kölner Raum inklusive Westfalen, in Flandern und in den Niederlanden. Eine hohe Sogwirkung entfalteten auch die Städte in den welfischen Territorien sowie an der Nord- und Ostseeküste zwischen Bremen, Hamburg, Lübeck und Danzig.
Mehrere Faktoren machten die Attraktivität einer Stadt für Zuwanderer aus.29 An erster Stelle stand die wirtschaftliche Attraktivität, das heisst der Arbeitsmarkt, das ökonomische Profil und die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt. Sodann wies auch die Sprache der Wanderung die Richtung. Verlässliche Informationen über die Verhältnisse am Zielort der Wanderung erleichterten ebenfalls den Wanderungsentscheid. Kaufleute, Marktbesucher und wandernde Handwerksgesellen gaben Auskunft über die lokalen Verhältnisse und über die aktuelle Stellensituation. Schliesslich bestimmten auch politische und herrschaftliche Rahmenbedingungen das Wanderungsverhalten. Seit der Reformation prägte zudem die Konfession die Richtung der Wanderung.
Zuger Marktszene, Bilderchronik des Wettinger Abts Christoph Silberysen, 1576. Die Städte des Mittelalters und der frühen Neuzeit waren nicht nur für die Versorgung mit Lebensmitteln vom Umland abhängig. Nur dank Zuwanderung von Neubürgern und Hintersassen konnten sie ihren Bevölkerungsstand halten und ihren Bedarf an Arbeitskräften decken.
Für einzelne Städtelandschaften sind die Intensität der Zuwanderung und die Reichweite der Migrationsräume bekannt. Die drei mittelgrossen Städte Konstanz, Ravensburg und Zürich mit jeweils bis zu 5000 Einwohnerinnen und Einwohnern waren bei Neubürgern beliebt und wiesen eine bemerkenswerte Integrationsfähigkeit auf: In diesen Kommunen war jeder dritte Einwohner ein Neubürger. Die meisten Neubürger kamen aus dem näheren Umland dieser Städte, das weitgehend mit deren Herrschaftsgebiet identisch war. Doch nahmen alle drei Städte Neubürger auch aus weiter entfernten Migrationsräumen im Norden und Nordosten auf, aus Oberschwaben, der Schwäbischen Alb, dem Ober- und dem Niederrhein. Die eidgenössische Stadt Zürich nahm kaum Neubürger aus der Innerschweiz oder aus dem westlichen Mittelland um Bern und Freiburg auf. Der Zürcher Migrationsraum bestätigt das Selbstverständnis der Limmatstadt als «schwäbische Reichsstadt», das sie bis zu ihrer gewaltsamen Einbindung in die Eidgenossenschaft im Alten Zürichkrieg (1436–1450) charakterisierte.
Die Migrations- und Integrationspolitik der Stadt Zürich
Für Zürich liegt mit Bruno Kochs Studie die zurzeit beste Analyse der Zuwanderungs- und Bürgerrechtspolitik einer Stadt des schweizerischen Raums im Spätmittelalter vor.30 Zürich zählte Mitte des 14. Jahrhunderts etwa 5300 Einwohner (plus etwa 400 Bewohner der Vorstädte). Von 1351 bis 1550 nahm es 5395 Neubürger an, von denen 1700 Ausbürger waren, das heisst Bürger, die auf der Landschaft wohnhaft blieben; somit dürften sich etwa 3700 Neubürger in der Stadt selber niedergelassen haben. Unter der Annahme, dass sechzig bis siebzig Prozent der Neubürger verheiratet waren und zusammen mit Kindern und Hausangestellten eingebürgert wurden, sind insgesamt schätzungsweise 10 000 Personen nach Zürich migriert. Da die Bevölkerung der Stadt in diesem Zeitraum nicht grösser wurde, ist von einem Bevölkerungsverlust in etwa dieser Grössenordnung auszugehen. Die Stadt verlor also jedes Jahr gut fünfzig Einwohner, sodass sich die Stadtbevölkerung ohne Zuwanderung alle 69 Jahre halbiert hätte.31
Die Zuwanderung von Neubürgern verlief nicht gleichmässig, sondern in Wellenbewegungen. Bis um 1430 nahm sie stetig zu, danach war sie bis 1500 rückläufig. Im 16. Jahrhundert wurden zuerst, vor allem als Folge des Glaubenskonflikts, wieder mehr Neubürger aufgenommen. Ab 1540 war die Zahl der Einbürgerungen langfristig stark rückläufig (vgl. Tabelle Seite 143). Besser noch als solche langfristigen Durchschnittswerte lassen die jährlichen Schwankungen bei der Aufnahme von Neubürgern die Überlegungen erkennen, von denen sich der Zürcher Rat bei seiner Migrations- und Integrationspolitik leiten liess.32 Sowohl die Aufnahme von Neubürgern, die sich in der Stadt niederliessen, als auch jene der so genannten Ausbürger, die auf dem Land wohnhaft blieben, unterlagen starken Schwankungen: Gewöhnlich verlieh die Stadt jedes Jahr zwischen zehn und dreissig bis vierzig Zuzüglern und höchstens zehn Ausbürgern das Bürgerrecht. Unter besonderen Umständen nahm die Stadt aber auch über hundert Zuzügler und ebenso viele Ausbürger ins Bürgerrecht auf. Solche Masseneinbürgerungen sollten die hohen Verluste an wehrfähigen Männern kompensieren, die im Alten Zürichkrieg (1436–1450), in den Burgunderkriegen (1474–1477) und in den Mailänderkriegen (1499–1515) zu beklagen waren. Auf diese Weise beschaffte sich Zürich neue Krieger; davon profitierten vor allem Männer, die sich aufseiten Zürichs im Krieg bewährt hatten und mit der Einbürgerung für ihren militärischen Einsatz belohnt wurden. Die unentgeltliche Einbürgerung als Anerkennung für geleistete Kriegsdienste war besonders für Angehörige der Unterschicht interessant, die sich das Bürgergeld nicht hätten leisten können. Indem Zürich von 1475 an das Bürgergeld von drei auf zehn Gulden erhöhte, gab es zu verstehen, dass sein Interesse an der Aufnahme von Neubürgern nachliess. Dies gilt auch für die anderen grossen eidgenössischen Städte, die mit dem Erwerb grosser Untertanengebiete ihre kriegsfähige Mannschaft vergrössert hatten und ihre militärische Schlagkraft nicht mehr durch die Vergabe des Bürgerrechts absichern mussten.
Woher stammten Zürichs Neubürger, und welche Qualifikationen brachten sie an die Limmat mit? Die Ausdehnung des Migrationsraums ist grundsätzlich ein Indikator dafür, wie attraktiv ein Zielort für Migranten war und wie weit der Einfluss und der Wirtschaftsraum einer Stadt reichten. Zwischen 1350 und 1550 wanderte die grosse Mehrheit der Zürcher Neubürger aus einer Entfernung von höchstens dreissig Kilometern in die Stadt. Dieser Kernmigrationsraum umfasste Orte, die schon zum Herrschaftsgebiet der Stadt gehörten oder bald einmal dazugehören sollten. Von hier aus zogen vor allem Landbewohner ohne besondere handwerkliche oder gewerbliche Qualifikation in die Stadt. Mit zunehmender Entfernung zur Stadt ging zwar die Zahl der Zuwanderer zurück, doch erhöhte sich gleichzeitig deren Qualifikationsgrad.33 Die durchschnittliche Wegstrecke der Zürcher Neubürger wurde zwischen den 1390er-Jahren und den 1490er-Jahren deutlich länger. Der Zürcher Migrationsraum dehnte sich in Richtung Thurgau, Rheintal und Sargans sowie ins Elsass, nach Baden, Schwaben und Franken aus. Seine äussersten Eckpunkte waren Danzig im Norden, die flämischen Städte im Westen, Asti und Venedig im Süden sowie Wien und Budapest im Osten.
Aus dem ferneren Migrationsraum (60–180 Kilometer Entfernung) gelangten vor allem qualifizierte Berufsleute aus städtischem Milieu nach Zürich. Als Zentrum der Leder- und Fellverarbeitung bürgerte Zürich bis 1545 234 Schuhmacher, 59 Kürschner, 53 Gerber, 19 Säckelmacher und 13 Sattler ein. Die zahlreichen Zürcher Schuhmacher nutzten die Nähe zu den Viehzuchtgebieten und fertigten Schuhe für einen grösseren Markt an. Zahlreiche Neubürger waren sodann im Textilgewerbe (Schneider, Weber), im Nahrungsmittelsektor (Bäcker, Müller, Metzger), in der Metallverarbeitung und Waffenproduktion (Schmiede, Gürtler, Schlosser, Harnischer, Schwertfeger) und im Baugewerbe (Zimmerleute, Steinmetzen, Bildhauer, Maurer) tätig. Zürich hatte auch Bedarf an medizinischem Fachpersonal (Apotheker, Scherer, Bader). Vergleichbare Migrationsmuster sind auch für andere Städte nachzuweisen. Bern holte sich Apotheker und Ärzte unter anderem aus Pavia, Ulm, Wesel, Braunschweig und Dresden, Bauhandwerker aus Basel, Ulm, Passau und Stadtlohn an der Grenze zu den Niederlanden, Stadtschreiber aus Rottweil, Brugg und Luzern, Schulmeister und Organisten aus Württemberg und Franken sowie die ersten Betreiber von Papiermühlen aus dem Piemont.34
Der Bedarf an Finanzdienstleistungen bewog zahlreiche Städte dazu, Juden nach den Pogromen in den Pestjahren 1348–1350 schon bald wieder gegen die Entrichtung hoher Gebühren und einer jährlichen Judensteuer Aufenthalt zu gewähren. Juden waren als Geld- und Pfandleiher sowie als Ärzte gefragt, blieben aber von den Berufen der Bürger sowie von Ämtern und Zünften ausgeschlossen. Die Aufnahme von Juden als mindere Bürger war auch fiskalisch motiviert, verschafften sie doch verschuldeten und verarmten Städten dringend erwünschte Einnahmen. Kritik am Wucher, die auch fremdenfeindlich motiviert war und sich deswegen ebenfalls gegen die seit dem 13. Jahrhundert im schweizerischen Raum tätigen Pfandleiher und Wechsler aus Oberitalien, so genannte Lombarden, richtete, führte im Verlauf des 15. Jahrhunderts zu neuen Verfolgungen und schliesslich zur definitiven Vertreibung der Juden.35 Die Städte hatten in der Zwischenzeit mit der Einrichtung amtlicher Wechselstuben den Bedürfnissen der sich ausbreitenden Geldwirtschaft Rechnung getragen: Auch ohne Juden konnte man nun Währungen wechseln und zu Krediten kommen.36
Wie kamen die Neubürger am Zielort ihrer Wanderung zurecht, und wie gut integrierten sie sich an ihrem neuen Lebensmittelpunkt? Die Frage der Integration stellt sich umso mehr, als die Neubürger keine marginale Gruppe bildeten: Bei den Schmieden und Zimmerleuten in Zürich war 1443 immerhin jedes dritte Zunftmitglied ein Neubürger.37 Wie rasch und wie erfolgreich sich ein Neubürger in seinem neuen sozialen Umfeld einzugliedern wusste, lässt sich an seinem wirtschaftlichen Erfolg, an seiner Teilhabe an politischer Macht und an seiner Wohnlage in der Stadt ablesen.
Die Vermögen der Zürcher Neubürger streuten innerhalb derselben Bandbreite wie jene der ansässigen Bürger. Die reichsten Neubürger versteuerten ähnlich hohe Vermögen wie die reichsten ansässigen Bürger. Insgesamt aber waren Neubürger in der höchsten Vermögensklasse seltener vertreten als Altbürger. Am anderen Ende des sozialen Spektrums befanden sich jene Neubürger, die wie viele ansässige Bürger so wenig besassen, dass sie keine Steuer zahlten. Insgesamt aber waren die Neubürger vermögender als die ansässigen Bürger, was dadurch bestätigt wird, dass sie in allen Quartieren Zürichs wohnten, jedoch nur selten in den ärmeren Randlagen.38 Auch konnten die meisten Neubürger in den Jahren nach ihrer Niederlassung ihr Vermögen beträchtlich steigern; Zuzügler konnten sich also berechtigte Hoffnung machen, durch die Wanderung nach Zürich wirtschaftlich voranzukommen. Besonders gut gelang dies Krämern beziehungsweise Händlern, Wirten und Apothekern, den Spezialisten im Metallgewerbe sowie Vertretern seltener Berufe (Orgelbauer, Windenmacher, Pergamenter, Siebmacher).39 Wenn sich unter den wirtschaftlich besonders erfolgreichen Zürcher Neubürgern mit einem Vermögen über 1000 Gulden nicht weniger als zwölf Bäcker fanden, dann hatten diese ihren Wohlstand allerdings weniger mit dem Verkauf von Brot als mit dem Getreidehandel erwirtschaftet.
Neubürger, die vor ihrer Aufnahme in Zürich bereits in einer Stadt gelebt hatten, waren im Durchschnitt vermögender als solche, die aus dem ländlichen Raum zuwanderten; sie konnten ihre wirtschaftliche Lage nach ihrer Niederlassung in Zürich deutlich verbessern. Diesbezüglich fallen einige Zuwanderer aus Kleinstädten im nahen Migrationsraum auf, die schon an ihrem Herkunftsort reich geworden waren und mit der Wanderung nach Zürich ihren Lebensmittelpunkt in eine aufsteigende Stadt verlegten, die ihnen mit ihrer politischen und wirtschaftlichen Machtposition einen grösseren Handlungsspielraum eröffnete. Hier sind etwa die Escher zu nennen, die ihren ersten sozialen Aufstieg in der bischöflich-konstanzischen Kleinstadt Kaiserstuhl durch die Abwanderung nach Zürich fortsetzten, wo sie rasch eine führende Rolle spielten.
Mit der baldigen Übernahme politischer Führungspositionen zeigten Neubürger an, dass sich geografische Mobilität auch in soziale Mobilität ummünzen liess. Im 14. und 15. Jahrhundert konnten Neubürger und deren Söhne noch ohne Weiteres in die Zürcher Machtelite aufsteigen. Dies trifft etwa auf Familien aus dem Dienstadel wie die Meyer von Knonau oder die Manesse zu, die Erfahrung in Herrschaftsfunktionen mitbrachten und dank ihrer Einkünfte für die Übernahme eines grundsätzlich nicht entlohnten hohen Amts in der Zürcher Politik infrage kamen. Spektakuläre Karrieren wie die des Hans Waldmann (etwa 1435–1489) aus dem zugerischen Weiler Blickensdorf waren in den Städten des Spätmittelalters ebenfalls noch möglich. Waldmann wurde 1452 in Zürich eingebürgert und nutzte in der Folge wirtschaftlichen Erfolg, eine vorteilhafte Heirat und militärische Erfolge in den Burgunderkriegen, um einer der einflussreichsten Politiker in der Eidgenossenschaft und 1483 zum Zürcher Bürgermeister gewählt zu werden.40 Sein Aufstieg war auch den Zeitumständen geschuldet. In den Burgunderkriegen wurden die grossen Kriegsherren auf den Anführer der Zürcher Truppen aufmerksam; sie machten ihn zu ihrem Klienten und entschädigten ihn reich mit Pensionen. Waldmanns Schicksal ist das eines Karrieristen. Auf seinem Weg nach oben machte er sich mächtige Feinde innerhalb der Zürcher Elite und stürzte schliesslich noch steiler ab, als er davor aufgestiegen war.
Waldmanns Aufstieg war zwar aussergewöhnlich, doch blieb er nicht der einzige Neubürger, der nach seiner Einwanderung in Zürich in hohe Ämter gelangte. Zwischen 1380 und 1545 waren jeweils etwa zehn Prozent der Ratsherren Neubürger, die fünf bis zwanzig Jahre nach ihrer Aufnahme ins Bürgerrecht in den Rat gewählt wurden. Noch mehr Neubürger schafften die Wahl zum Zunftmeister. Eine entscheidende Voraussetzung für solche politischen Karrieren war allerdings ein überdurchschnittlich grosses Vermögen, das diese Neubürger für politische Führungschargen abkömmlich machte.41 Langfristig wurde der Zugang zu Spitzenämtern für Neubürger jedoch enger. Die Angehörigen der Zürcher Machtelite betrachteten ihre Teilhabe an der Macht je länger, je mehr als Privileg der Etablierten, das sie nicht mit Neubürgern teilen wollten.
Der Migrationshintergrund der städtischen Machtelite
Die Migration in die mittelalterliche Stadt bestätigt eine allgemeine Feststellung der Migrationsgeschichte: «Niemand war schon immer da.»42 Auch Samuel Henzi erinnerte die Berner Patrizier an diese Tatsache, als er 1749 zusammen mit anderen Angehörigen der zurückgesetzten Burgerschaft die in Bern regierenden patrizischen Familien gewaltsam von der Macht verdrängen wollte. In seiner Denkschrift wies er darauf hin, dass deren Vorfahren einmal als einfache Maler, Metzger, Gerber, Schuster oder Färber in Bern eingebürgert worden waren.43 Der Migrationshintergrund bekannter Familien aus der frühneuzeitlichen städtischen Machtelite lässt sich in der Tat nicht nur für Bern leicht bestimmen, sondern auch für andere eidgenössische Städte (siehe dazu Tabelle Seiten 38/39).
Der Landesausbau der Walser in den Hochalpen
Zur selben Zeit, als Neubürger die eben gegründeten Städte bevölkerten, kolonisierten deutschsprachige Siedler aus dem Oberwallis die hochalpinen Täler der Zentralalpen. Die Wanderungen der Walser waren Teil jener ausgreifenden Siedlungs- und Kolonisationsprozesse, in deren Verlauf sich die wachsende Bevölkerung im Hoch- und Spätmittelalter neue Lebensräume erschloss. Bekannt ist in diesem Zusammenhang die so genannte Deutsche Ostsiedlung, die Kolonisten aus Flandern, Holland, dem Rheinland, Westfalen, Schwaben und Franken in die noch dünn besiedelten, von Slawen und Balten bewohnten Gebiete östlich des Heiligen Römischen Reichs führte. Weiter südlich besiedelten sie die Gebiete der heutigen österreichischen Bundesländer Niederösterreich, Steiermark und Kärnten. Im dünn besiedelten Osten wollten sie grössere Ackerflächen bewirtschaften. Die Landesherren versprachen ihnen für die Startphase Abgabenfreiheit. Sie sollten ihr Land zu günstigen Besitzrechten erhalten und dieses an ihre Kinder vererben können. Sie sollten zudem auch am neuen Lebensmittelpunkt nach dem vertrauten Recht ihrer alten Heimat leben können.
Familiäre Herkunft der frühneuzeitlichen städtischen Machtelite (Auswahl)
NameHerkunftJahr der Einwanderung / EinbürgerungOrt der EinbürgerungTätigkeit / Beruf zum Zeitpunkt der EinbürgerungBurckhardtBritznach (Schwarzwald)1523BaselTuchhändlerFaeschBreisgau (vermutl.)1409BaselBaumeister, Goldschmiede, KaufleuteForcartRheinland1637BaselTuchhändlerMerianCourroux (JU)1498BaselSchiffer, SägemüllerThurneysenNürnberg1461Basel?SocinBellinzona1560BaselKaufleuteWerthemann (Vertemate)Plurs (Bergell)1586/87BaselSpediteure, TuchhändlerManuelChieri (Piemont)um 1450/1460BernApothekerMayComesee-GegendEnde 14. Jh.BernFernhandel, BankgeschäfteGadyBelfaux (vermutl.)1595FreiburgWirteRaemyZofingen1517Freiburg?Reynoldurspr. Savoyen; ab 1404 Romont1531Freiburg?AmrhynBeromünster1518LuzernGerber, SchuhmacherBalthasarPeccia (Maggiatal)1544/1547Luzern?CysatMailandvor 1544/1547LuzernKaufleuteMeyer (von Schauensee)Mellingen1406 oder 1468LuzernGerberPfyfferRothenburg (Luzern)1483LuzernSchneider, Tuchhändler, KrämerRussLombardeiAb 1381LuzernApotheker, Gewürz- und ViehhändlerSonnenbergAltkirch (Elsass)spät. 1418Luzern?PeyerBayern (vermutl.)2. Hälfte 15. Jh.SchaffhausenHufschmiedeArreggerRuswil1495Solothurn?BesenvalAostatal1629SolothurnSilber-, Korn- und WeinhändlerGrimmZürich1524SolothurnKürschnerSchwallerWasseramt (Solothurn)1480SolothurnMüllerBodmerAlagna Valsesia (Piemont)1543ZürichSteinmetzeGöldliPforzheimAnfang 15. Jh./1405ZürichBankiersHeideggerNürnberg1503ZürichSeidenstickerHirzelPfäffikon (Zürich)1540ZürichTuchhändlerHottingerZollikon1562ZürichBäckerLandoltThalwil1566ZürichSchärer, WirteRahnRorbas1429ZürichWirteUlrichWaltalingen1528, 1535, 1544ZürichRotgerberPestalozziChiavenna1567ZürichKaufleuteQuelle: Historisches Lexikon der Schweiz, Familienartikel.
Der so genannte Landesausbau war ein umfassender Intensivierungsvorgang, der im Hochmittelalter von den kontinentalen Kernländern und vom Altsiedelland ausging und den Siedlungs- und Wirtschaftsraum in periphere Räume ausdehnte. Migration und Rodung erschlossen neue Gebiete und machten sie für die Landwirtschaft nutzbar. Auch im schweizerischen Raum migrierten Kolonisten in bislang unerschlossene Gebiete. Angeworben durch lokale Herrschaftsträger (Klöster, Adelige, Dynasten, Bischöfe), die ihnen Selbstverwaltung, vorteilhafte Besitzrechte und tiefe Abgaben in Aussicht stellten, bevölkerten sie waldreiche Höhenlagen und Seitentäler im Jura sowie in den Voralpen und Alpen, die weder topografisch noch klimatisch begünstigt waren. Diese Binnenkolonisation setzte wohl schon im 7./8. Jahrhundert ein. Sie erreichte ihren Höhepunkt im 12. und 13. Jahrhundert und klang im 14. und 15. Jahrhundert als Folge des pestbedingten Bevölkerungsrückgangs aus.
In diesen Zusammenhang sind auch die Wanderungen der Walser im 13. und 14. Jahrhundert einzuordnen. Diese setzten mit der Kolonisation der Hochtäler im inneralpinen Raum die Wanderungs- und Siedlungstradition ihrer alemannischen Vorfahren fort, die im 7. Jahrhundert die Landnahme im zentralen Alpenraum vorangetrieben hatten. Alemannen hatten im Wallis Dauersiedlungen in Höhenlagen bis 1500 Meter über Meer angelegt. Später gründeten die Walser im Verlauf ihrer Wanderungen zwischen dem 12./13. Jahrhundert und 15. Jahrhundert rund 150 Siedlungen, die verstreut auf einer Länge von rund 300 Kilometern in den Zentralalpen liegen. Ganz oder teilweise walserisch geprägt sind im Norden Teile des Lauterbrunnentals (Mürren) und das bernische Haslital, im Westen das französische Chablais im Tal von Chamonix, jenseits des Alpenkamms die Täler am Südhang des Monte Rosa (Lys, Anzasca, Sesia, Toce) und das Val Formazza (Pomat) im Ossolatal. Vom Pomat aus gründeten die Walser Bosco/Gurin in einem Seitental des Maggiatals. Während gut hundert Jahren zogen sie ab dem 13. Jahrhundert auf verschiedenen Wegen ostwärts ins Urserental, jenseits des Oberalppasses ins Tujetsch sowie nach Obersaxen in der Surselva. Weitere wichtige Walserkolonien in Graubünden sind das Rheinwald im Gebiet des Hinterrheins und die Landschaft Davos, die beide um 1280 besiedelt wurden. Von dort aus griffen die Walser weiter in benachbarte Täler aus: vom Hinterrhein aus nach Vals, Safien, Tschappina und vermutlich ins Aversertal, von Davos aus nach Klosters und Schlappin (oberhalb Klosters), zudem ins Prättigau, wo sie die Höhensiedlungen St. Antönien, Schuders, Furna und Valzeina anlegten oder ausbauten. Von Davos aus gelangten sie auch ins Schanfigg, nach Arosa und Langwies (mit Praden). Kaum geklärt ist die Wanderung der Walser ins Sarganserland, ins Fürstentum Liechtenstein (v. a. Triesenberg, um 1280) und nach Vorarlberg. Seit Beginn des 14. Jahrhunderts sind sie im Laternser- und Kleinwalsertal nachgewiesen. Walserisch sind auch das Grosse Walsertal, Lech am Arlberg, zahlreiche verstreute Orte in den Seitentälern des Walgaus und des Rheintals sowie das tirolische Galtür.
Ursachen und Motive der Walserwanderung
Die ältere Forschung führte die ersten Wanderungen der Walser auf die Kargheit des Bodens sowie auf Übervölkerung, Klimawandel, Krankheit und Not zurück. Sie bediente sich damit eines in der älteren Migrationsforschung beliebten Arguments, das allerdings nicht zu erklären vermag, weshalb gewisse Gesellschaften über Generationen hinweg persistente Migrationsmuster entwickelten, und zwar unabhängig davon, wie gut oder schlecht die Ernten ausfielen, ob Pest und Seuchen grassierten, die Bevölkerung wuchs und die Nahrung knapp wurde. Wer Migration einseitig als Flucht aus der Not betrachtet, erhebt stillschweigend die Sesshaftigkeit und lokale Immobilität zur Norm einer bäuerlichen Lebensweise und bekundet Mühe mit der Vorstellung, dass auch bäuerliche Gesellschaften für ihr Leben und Überleben auf Mobilität und Migration setzen konnten.
Das Klima hat allerdings die Wanderungen der Walser sehr wohl beeinflusst. Seit dem Ende des 9. Jahrhunderts herrschte eine Warmphase vor. Namentlich im 11. und 13. Jahrhundert lagen die Temperaturen im Sommerhalbjahr zeitweise sogar etwas höher als im 20. Jahrhundert. Feigenbäume gediehen damals bis auf die Höhe von Köln, und die Alpengletscher schmolzen so weit zurück wie heute. Die Siedlungstätigkeit und der Landesausbau der Walser in den Höhenlagen über 1500 Meter über Meer profitierten von günstigen klimatischen Bedingungen. Ab 1300 leitete der markante Rückgang der durchschnittlichen Wintertemperaturen eine Phase der Klimaverschlechterung ein, welche die Klimahistoriker als «Kleine Eiszeit» bezeichnen. Die Intensität des hochalpinen Landesausbaus liess in der Folge deutlich nach.
Bei der Wanderung der Walser spielten auch herrschaftliche Kräfte eine wichtige Rolle. Adelige Herren und Klöster siedelten Kolonisten zur Festigung ihrer Raumkontrolle, zur Sicherung ihrer Herrschaft und für die Überwachung der Passübergänge an. Neuerdings ist der Einfluss adeliger und kirchlicher Feudalherren auf die Wanderungen der Walser wieder kontrovers diskutiert worden. Vonseiten der Rechtsgeschichte wurde die These vertreten, die alemannischen Bauern hätten das Wallis im 12. Jahrhundert verlassen und sich in schwer zugängliche Hochtäler zurückgezogen, um der Unterwerfung unter die Gewalt des Feudaladels zu entgehen.44 In der Tat etablierten sich Adelsfamilien aus Oberitalien im späten 12. Jahrhundert im Wallis, wo sie als Dienstleute des Bischofs von Sitten eine herrschaftliche Stellung um die Saaser Pässe und am Simplon aufbauten. Der Auffassung, die freien Walser hätten sich mit ihrer Wanderung der drohenden Unterdrückung durch diese Feudalherren entziehen wollen, widerspricht allerdings die Tatsache, dass diese Adelsfamilien selber frühzeitig die Besiedlung der Walliser Seitentäler durch alemannische Siedler vorantrieben. Als Vögte des Vispertals sowie als Besitzer von Herrschaftsrechten im Simplongebiet, im Goms und in der Valsesia südlich des Monte Rosa hatten sie massgeblich Anteil an der Erschliessung des Simplontals, des Saaser- und Mattertals sowie später des Val Formazza (Pomat).45 Die Zermatter sind im Übrigen ein gutes Beispiel dafür, wie die Besiedlung eines alpinen Hochtals nicht das Ende, sondern nur eine Etappe einer fortgesetzten inneralpinen Migration bilden konnte. Zermatter Familien wanderten im 14. und 15. Jahrhundert über hohe Pässe ins Val d’Hérens weiter, von wo aus einige Anfang des 15. Jahrhunderts ins Tal zogen und Bürger von Sitten wurden, das damals als Folge der Zuwanderung aus dem Oberwallis immer mehr eine deutschsprachige Stadt wurde.46 Auch in Graubünden waren Adel und Kirche massgeblich an der Kolonisierung und Urbarisierung peripherer Täler durch Walser Siedler beteiligt. Die Freiherren von Sax-Misox siedelten Walser um 1265 im Rheinwald (Hinterrhein) an. Die Besiedlung des Landwassertals und die Gründung der Walserkolonie Davos erfolgten unter den einflussreichen Freiherren von Vaz. Bei der Ansiedlung von Walsern im Schanfigg (Arosa, Langwies) ergriffen das Churer Domkapitel und das Kloster St. Luzi die Initiative.
Im Rahmen des Kolonistenrechts räumten die Herren den Walsern das Recht der freien Ammannwahl sowie die niedere Gerichtsbarkeit ein. Die Kolonisten legten also ihre zivilen und strafrechtlichen Konflikte – soweit sie nicht schwere Vergehen berührten – selber bei. Sie waren persönlich frei und genossen Freizügigkeit. Ihre Höfe und Güter besassen sie zu freier Erbleihe und entrichteten dafür einen festen Zins. So konnten sie ihren Besitz an ihre Nachkommen vererben und zahlten ihren Grundherren eine Abgabe, die sie langfristig angesichts der Geldentwertung real immer weniger belastete. In gewissen Fällen schuldeten sie ihren Herren auch Kriegsdienst, weshalb gewisse Walserforscher auch militärische Interessen lokaler Herren als Ursachen der Walserwanderung in den Vordergrund gerückt haben. Als «gefürchtete Hirten-Krieger» hätten die Walser in den zahlreichen Fehden und Kleinkriegen der Bündner Feudalherren im 14. Jahrhundert eine Rolle gespielt.47