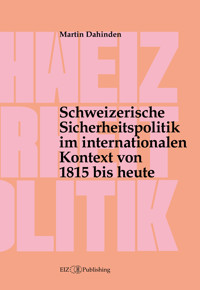
Schweizerische Sicherheitspolitik im internationalen Kontext von 1815 bis heute E-Book
Martin Dahinden
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: buch & netz
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Geopolitische Spannungen und Krieg in Europa, Cyberbedrohungen, wirtschaftliche und energetische Abhängigkeiten, Terrorismus, organisierte Kriminalität, Klimawandel und Naturkatastrophen, Migration und Flüchtlingsströme haben die Sicherheitspolitik ins Zentrum der politischen Debatten gerückt. Eine zukünftige Sicherheitspolitik erfordert ein umfassendes, interdisziplinäres Verständnis, das militärische, diplomatische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Dimensionen miteinander verbindet. Ebenso wichtig ist es, den Weg zu kennen, den die schweizerische Sicherheitspolitik zurückgelegt hat – nicht für das Archiv, sondern für die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft. Diesem Anliegen ist dieser Band verpflichtet. Einst standen der Schutz des Territoriums mit militärischen Mitteln gegen Eingriffe von aussen und die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Innern klar im Vordergrund. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts waren Sicherheitspolitik und Militärpolitik weitgehend identisch. Im 20. Jahrhundert wurde die Kriegsführung und Verteidigung zunehmend zu einer Mobilisierung aller nationalen Ressourcen; immer mehr staatliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche wurden Teil einer umfassend verstandenen Sicherheitspolitik. Heute stehen wir erneut an einem Wendepunkt. Welche Erfahrungen helfen zur Gestaltung einer zukunftstauglichen Sicherheitspolitik?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Dahinden
Schweizerische Sicherheitspolitik im internationalen Kontext von 1815 bis heute
Eine Skizze
Schweizerische Sicherheitspolitik im internationalen Kontext von 1815 bis heute Copyright © by Martin Dahinden is licensed under a Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitung 4.0 International, except where otherwise noted.
© 2025 – CC BY-NC-ND (Werk), CC BY-SA (Text)
Autor: Martin DahindenVerlag: EIZ Publishing (eizpublishing.ch)Produktion, Satz & Vertrieb: buch & netz (buchundnetz.com)ISBN:978-3-03805-762-8 (Print – Softcover)978-3-03805-763-5 (Print – Hardcover)978-3-03805-764-2 (PDF)978-3-03805-765-9 (ePub)DOI:https://doi.org/10.36862/eiz-763Version: 1.01 – 20250310
Das Werk ist als gedrucktes Buch und als Open-Access-Publikation in verschiedenen digitalen Formaten verfügbar: https://eizpublishing.ch/publikationen/schweizerische-sicherheitspolitik-im-internationalen-kontext-von-1815-bis-heute/.
1
Inhalt
Vorwort
Der Ausgangspunkt
Der Wiener Kongress und seine Folgen
Vom Staatenbund zum Bundesstaat 1815–1848
1848 Der moderne Bundesstaat entsteht
Militär und Diplomatie als Instrumente der Sicherheitspolitik im 19. Jahrhundert
Konzeptionelles und Strategisches Denken
Die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg
Erster Weltkrieg
Zwischenkriegszeit
Zweiter Weltkrieg
Kalter Krieg
Von der Truman-Doktrin zur Kubakrise
Konzeptionsstreit: vom Reduit zur totalen Landesverteidigung
Entspannungspolitik
Nach dem Ende des Kalten Krieges
Im neuen Millennium
Ausblick
Literatur und Quellen
Vorwort
Geschichte hat nicht in erster Linie einen archivarischen Zweck. Geschichte studieren wir, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. Diesem Leitgedanken folgt dieser kurze Überblick zur schweizerischen Sicherheitspolitik. Entstanden ist er im Rahmen meiner Vorlesungsreihe Schweizerische Sicherheitspolitik im internationalen Kontext an der Universität Zürich.
Im heutigen Verständnis hat die schweizerische Sicherheitspolitik den Zweck, die Handlungsfähigkeit, Selbstbestimmung und Integrität der Schweiz und ihrer Bevölkerung sowie ihre Lebensgrundlagen gegen direkte und indirekte Bedrohungen und Gefahren zu schützen sowie einen Beitrag zu Stabilität und Frieden jenseits der eigenen Grenzen zu leisten.
Ist es sinnvoll diese zeitgemässe Auffassung von Sicherheitspolitik in die Vergangenheit zu projizieren, um längerfristige Entwicklungen und Strukturen sichtbar zu machen? Ich halte es für legitim, weil der Zweck der Eidgenossenschaft – lange bevor es den Begriff Sicherheitspolitik gab – genau darin bestand, die Selbstbestimmung und Integrität der Schweiz und ihrer Bevölkerung zu sichern.
Der Begriff Sicherheitspolitik ist vielschichtig, die Vorstellungen darüber haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Einst stand der Schutz des Territoriums mit militärischen Mitteln gegen äussere Eingriffe eindeutig im Vordergrund sowie die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Inneren. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts waren in der schweizerischen Wahrnehmung Sicherheitspolitik und Militärpolitik weitgehend identisch. Im 20. Jahrhundert wurde Kriegsführung zunehmend zu einer Mobilisierung aller nationalen Ressourcen. Damit sind immer weitere staatliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche zu Teilen einer inzwischen umfassend verstandenen Sicherheitspolitik geworden.
Nach dem Ende des Kalten Krieges ging es für die schweizerische Sicherheitspolitik zunehmend auch um das Einwirken auf das Sicherheitsumfeld mit den Instrumenten der Diplomatie, Friedenspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, humanitären Hilfe und weiteren Instrumenten. Das führt zur Frage, ob Sicherheitspolitik inzwischen kein thematischer Politikbereich mehr ist, sondern ein transversaler Aspekt, der jegliche Regierungstätigkeit und die schweizerische Gesellschaft insgesamt betrifft.
Wer sich mit der schweizerischen Sicherheitspolitik über den mehr als zweihundertjährigen Zeitabschnitt seit 1815 befasst, entdeckt bald, dass konzeptionelle und strategische Leitdokumente, aber auch strategisches Denken, erstaunlich spät eine Rolle zu spielen begonnen haben. Ein Blick unter die Oberfläche zeigt aber auch, dass durchaus kohärente Vorstellungen zu den sicherheitspolitischen Herausforderungen und den Antworten darauf vorhanden waren, allerdings wenig explizit und zumeist mit geringer schriftlicher Sichtbarkeit. Aus diesem Grund muss vieles mühsam aus Reglementen, politischen Debatten, rechtlichen Erlassen usw. rekonstruiert werden, um sich ein klares Bild über die Entwicklung der Sicherheitspolitik während der letzten zweihundert Jahre zu machen.
Wie in anderen Staaten haben nationale und historische Narrative in der sicherheitspolitischen Diskussion der Schweiz zeitweise ein grosses Gewicht erhalten. Begleitet wurden diese Diskussionen und Debatten oft von einprägsamen Bildern und bisweilen auch von schiefen Wahrnehmungen (Igel, Insel, Reduit usw.). Selbst beim so zentralen Konzept wie der Neutralität sind Begriffsverwirrungen und Fehlwahrnehmungen bis heute häufig, teilweise sind sie auch bewusst gestreut worden, um politische Zwecke zu erreichen.
Die schweizerische Sicherheitspolitik ist – wie viele Bereiche der Bundespolitik – seit jeher eng verknüpft mit den internationalen Verhältnissen und ihren Veränderungen. Deshalb ist es wichtig, die Entwicklung der schweizerischen Sicherheitspolitik nicht auf eine Entwicklung im gesellschaftlichen Kontext der Schweiz zu reduzieren und zu bewerten, sondern in ihren vielfältigen Wechselwirkungen zum internationalen Umfeld.
Solche Feststellungen haben mich zum Schreiben dieses Textes veranlasst. Es geht mir dabei nicht um das Nacherzählen von Begebenheiten aus der Vergangenheit, auch nicht um die Darstellung von einzelnen Instrumenten und Konzepten der schweizerischen Sicherheitspolitik. Dazu gibt es umfangreiche und ausgezeichnete Publikationen (s. Literaturverzeichnis). Es geht mir darum, die grossen Linien sichtbar und nützlich zu machen für die Auseinandersetzung mit gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen.
Sicherheitspolitik und sicherheitspolitische Analysen erfordern in hohem Masse Interdisziplinarität. Das erforderliche Wissen beschränkt sich nicht auf den aussenpolitischen, politikwissenschaftlichen und militärwissenschaftlichen Bereich. Ökonomie, Recht, Technik, Kultur und viele Erkenntnisse vorab aus den Geisteswissenschaften sind unerlässlich, um das Thema zu erschliessen. Das ist auch der Ansatz meiner Vorlesungsreihe Schweizerische Sicherheitspolitik im internationalen Kontext und den in diesem Rahmen geführten Diskussionen mit Zeitzeugen und Entscheidungsträgern der schweizerischen Sicherheitspolitik. Diese Skizze zur Entwicklung der schweizerischen Sicherheitspolitik entstand aus Vortragsnotizen seit dem Beginn meiner Vorlesungen im Jahre 2020.
Der Ausgangspunkt
Welche Epoche ist der zweckmässige Ausgangspunkt für einen Überblick zur schweizerischen Sicherheitspolitik? Sind es die Renaissancekriege in Italien und die Niederlage von Marignano (1515), welche den Expansionsbestrebungen der alten Eidgenossen ein Ende bereiteten? Oder das Wiler Defensional von 1647, die Vereinbarung zwischen den Ständen (Kantonen) zur militärischen Abwehr gemeinsamer Feinde, die als Geburtsstunde der Schweizer Armee gilt? Ist es der Westfälische Friede von 1648, mit dem die europäischen Mächte die Souveränität der Eidgenossenschaft und ihre Neutralität anerkannten, was ihre Unabhängigkeit vor äusseren Einwirkungen festigte? Eignet sich der Untergang der alten Eidgenossenschaft im Jahre 1798 als Ausgangspunkt oder die Gründung des modernen Bundesstaates von 1848?
Ich habe mich für keinen dieser historischen Eckpunkte entschieden, sondern für das Jahr 1815, für den Wiener Kongress und den Bundesvertrag, als die politischen Verhältnisse in Europa nach dem Ende der Napoleonischen Ära neu geordnet wurden und die Eidgenossenschaft nach einer schwierigen Periode als französischer Vasallenstaat ihre Unabhängigkeit wieder erlangte, und zwar in den geografischen Grenzen, die bis heute gelten.
Die Wahl des Jahres 1815 als Ausgangspunkt bedeutet keineswegs, dass die Zeit davor keine dauerhaften Spuren hinterlassen hätte. Im Gegenteil: Die historischen Erfahrungen seit dem Spätmittelalter sind bis heute wichtig als Fundus von Werten und Vorstellungen, die in sicherheitspolitischen Debatten immer wieder an- und abgerufen werden. Dazu gehören die Schlachten der alten Eidgenossen gegen die habsburgische Vorherrschaft, der Rückzug aus der europäischen Machtpolitik während der Renaissancekriege in Norditalien, die Herauslösung aus dem Verbund des Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zwischen 1499 (Schwabenkrieg) und 1648 (Westfälischer Frieden), aber auch die Erfahrung mit der Neutralität während den grossen europäischen Kriegen (Dreissigjähriger Krieg, Spanischer Erbfolgekrieg usw.).
Die schwierige «Franzosenzeit» hat lange nachgewirkt, teilweise bis heute: die Helvetische Republik (1798–1803) mit ihrer unitarischen Staatsform, der einheitlichen Währung und der Überwindung der ungleichen Rechtsstellung von Personen und Gebietskörperschaften sowie die Mediationszeit (1803–1813) mit ihren institutionellen Anpassungen und der Wiederherstellung der Eidgenossenschaft als Staatenbund.
Die Neutralität entwickelte sich über Jahrhunderte zum wichtigsten Grundprinzip der schweizerischen Aussenpolitik. Neutralität war nicht nur ein Konzept für das Verhältnis zu kriegsführenden Staaten. Sie war auch bedeutend für das innere Zusammenleben in der sehr heterogenen Eidgenossenschaft mit den unterschiedlichen Sprachen und ihrer Verbundenheit mit ausländischen Kulturräumen, mit den unterschiedlichen Konfessionen und den sehr verschiedenen Lebens- und Wirtschaftsverhältnissen in den einzelnen Gebieten der Eidgenossenschaft.
Der Wiener Kongress und seine Folgen
Der Wiener Kongress 1814/15 ist von herausragender Bedeutung für die europäische Geschichte und auch für die Geschichte der Schweiz. Nach den Revolutionskriegen und dem Ende der napoleonischen Herrschaft ordneten die vier siegreichen Grossmächte Österreich, Russland, Preussen und Grossbritannien zusammen mit Frankreich die geopolitischen Verhältnisse in Europa neu. Die französischen Eroberungen wurden rückgängig gemacht. Vor allem Russland, Österreich und Preussen gingen territorial gestärkt aus dem Wiener Kongress hervor. Russland wurde Finnland und Polen zugesprochen. Preussen vergrösserte sein Territorium um den nördlichen Teil Sachsens, die Provinz Westfalen und das Grossherzogtum Niederrhein. Österreich trat die österreichischen Niederlande (Belgien) an die Niederlande ab und erhielt dafür Tirol, Kärnten, Salzburg und weite Teile Norditaliens.
Auch die frühere Geschichte Europas kann als Abfolge von Kriegen und Friedenskonferenzen beschrieben werden, aber der Wiener Kongresses war von weit grösserer Tragweite und Wirkung als die vielen früheren europäischen Friedenskonferenzen.
Für die Schweiz bedeutete der Wiener Kongress das Ende der Zeit als französischer Vasallenstaat. Die Zukunft der Eidgenossenschaft und anderer Staaten war am Wiener Kongress zunächst ungewiss. Nicht alle Staatswesen überlebten den grossen historischen Umbruch, darunter die alten Republiken Venedig und Genua.
Für die Eidgenossenschaft war das Ergebnis des Wiener Kongresses insgesamt sehr günstig. Das lag weniger an der Leistung der untereinander zerstrittenen eidgenössischen Unterhändler als an den geopolitischen Interessen der siegreichen Grossmächte, die verhindern wollten, dass das Gebiet der Eidgenossenschaft mit den Alpenübergängen, in den Machtbereich einer der Grossmächte fiel. Im Pariser Frieden vom 11. November 1815 garantierten die Grossmächte die Unverletzlichkeit des Territoriums der Eidgenossenschaft und ihre Neutralität. Die Schweiz erhielt die äusseren Grenzen, die bis heute gültig sind. Der von den Grossmächten garantierte Status erforderte zugleich, dass die Schweiz militärisch in der Lage war, ihre Unabhängigkeit selbst zu sichern. Damit entsprach das Ergebnis des Wiener Kongresses in hohem Masse den Absichten der Eidgenossen, auch wenn deren territorialen Ansprüche (Nordsavoyen, Bündner Südtäler, Konstanz usw.) nicht vollumfänglich befriedigt wurden. Am Wiener Kongress wurde auch die innere Gliederung der Schweiz festgelegt. Dazu wären die Eidgenossen damals selbst kaum in der Lage gewesen. Restaurative Kräfte hätten die Ordnung des Ancien Regime aus der Zeit vor 1798 bedeutend stärker wiederherstellen wollen. Mit den Ausnahmen der Schaffung des Kantons Basel-Land, des Kantonswechsels des Laufentals und der Gründung des Kantons Jura (dessen Gebiet am Wiener Kongress Bern zugeschlagen wurde als Kompensation für den endgültigen Verlust der Waadt) veränderte sich auch die innere Gliederung der Eidgenossenschaft seither nicht mehr.
Am Wiener Kongress wurde der Grundstein gelegt für dauerhafte Formen der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit: das Kongresssystem – das europäische Konzert der Mächte. Es hatte zum Zweck, den am Wiener Kongress geschaffenen Status quo zwischen den Mächten, aber auch innerhalb der einzelnen Staaten zu bewahren. Die fünf Grossmächte Österreich, Frankreich, Preussen, Russland und Grossbritannien (Pentarchie) sahen regelmässige Kongresse vor zur Beilegung von Streitigkeiten, tatsächlich wurden diese Kongresse auf ad-hoc-Basis abgehalten. Sie waren erfolgreich bei der Verhinderung oder Eingrenzung von Konflikten. Das formale Kongressystem fiel in den 1820er Jahren auseinander, doch der Frieden zwischen den europäischen Grossmächten hielt weitgehend an, und in Krisenzeiten wurden weiterhin Treffen durchgeführt, die an die früheren Kongresse erinnerten. Sichtbarste Folge war eine lange Zeit ohne Kriege in Zentraleuropa. Das Kongresssystem war später auch ein Bezugspunkt und Studienobjekt für die Entstehung multilateraler Institutionen (Völkerbund, Vereinte Nationen, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa). Mit der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt wurde am Wiener Kongress auch die erste internationale Organisation gegründet.
Politisch war der Wiener Kongress restaurativ und reaktionär. Russland, Österreich und Preussen (Heilige Allianz) nutzten das System um revolutionäre und liberale Bewegungen zu bekämpften und nationale Strömungen in Europa zu schwächen, sogar ausserhalb des direkten Machtbereichs der Pentarchie. Der österreichische Aussenminister und spätere Staatskanzler Metternich war die herausragende Figur im europäischen Konzert der Mächte und bestimmte die europäische Politik der damaligen Zeit sehr massgeblich. Das Metternichsche System ist Inbegriff der Verfolgung und Unterdrückung von Demokratie, Presse‑, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Mit seinen Spitzeln und Agenten wirkte es in ganz Europa, einschliesslich in der Eidgenossenschaft.
Vom Staatenbund zum Bundesstaat 1815–1848
1815 war die Eidgenossenschaft ein schwacher Staatenbund von 22 Kantonen, die sich als eigenständige Staatswesen verstanden und stark auf ihrer Unabhängigkeit bedacht waren. Konstitutionelle Grundlage war der Bundesvertrag von 1815. Er wurde an der sogenannten langen Tagsatzung von den Vertretern der Stände (Kantone) und unter Einfluss ausländischer Gesandter erarbeitet. Diese Diplomaten haben in der schweizerischen Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur nicht den Stellenwert, der ihrer Bedeutung entspricht. Herausragende Personen waren Ioannis Kapodistrias und Stratford Canning. Kapodistrias war Sondergesandter von Zar Alexander I. am Wiener Kongress. Er verhalf der Schweiz zu ihrer föderalistischen Struktur und zur Anerkennung der Neutralität. Ohne sein Engagement und seine Verbundenheit mit der Eidgenossenschaft sähe die Schweiz heute wohl anders aus. Stratford Canning wurde 1814 britischer Gesandter in der Eidgenossenschaft und wirkte mit anderen Vertretern der Alliierten am Bundesvertrag mit, später war er Mitglied der britischen Delegation am Wiener Kongress und ebenfalls eine Schlüsselfigur für die Wiedererlangung der schweizerischen Souveränität und bei den Verhandlungen über die schweizerische Neutralität.





























