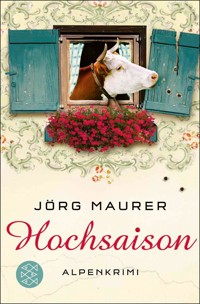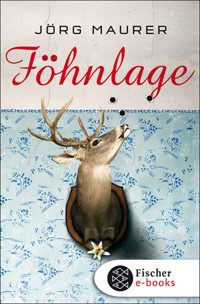8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Jennerwein ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Kult-Kommissar Jennerwein im Höhenflug: der achte Alpenkrimi von Bestseller-Autor Jörg Maurer steigt bis zum Gipfel. Hoch über dem idyllisch gelegenen Kurort schwebt ein wunderschöner Heißluftballon. Doch ganz plötzlich ist er verschwunden. Vom Winde verweht? Abgestürzt? Oder explodiert? Kommissar Jennerwein und sein Team ermitteln auf windigen Gipfeln und bei aufgeblasenen Lokalprominenten. Doch Jennerwein wirkt bei der Spurensuche merkwürdig unkonzentriert, geradezu abgelenkt. Seit langem besucht er heimlich einen mysteriösen Unbekannten im Gefängnis. Was mag der verbrochen haben? Und warum sucht Jennerwein den Rat des Bestatterehepaars a.D. Grasegger? Da taucht der Unbekannte auf einmal im Kurort auf, und Jennerweins gesamte Existenz droht wie ein Ballon zu zerplatzen…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Ähnliche
Jörg Maurer
Schwindelfrei ist nur der Tod
Alpenkrimi
Über dieses Buch
Gerade noch schwebt ein Heißluftballon über dem Werdenfelser Land. Dann ist er verschwunden. Ein Absturz? Ein Unfall? Oder Mord? Kommissar Jennerwein und sein Team ermitteln auf windigen Gipfeln und bei aufgeblasenen Lokalprominenten. Doch Jennerwein ist nicht recht bei der Sache. Seine Gedanken drehen sich um einen Unbekannten, den er regelmäßig im Gefängnis besucht. Ein ehemaliger RAF-Täter? Ein meisterlicher Trickbetrüger? Und warum sucht Jennerwein den Rat des Bestatterehepaars a.D. Grasegger? Da taucht der Unbekannte im Kurort auf und Jennerwein muss sein eigenes Team in die Irre führen – sonst droht ihm selbst der Absturz…
Weitere Titel des Autors:
›Föhnlage‹
›Hochsaison‹
›Niedertracht‹
›Oberwasser‹
›Unterholz‹
›Felsenfest‹
›Der Tod greift nicht daneben‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jörg Maurer stammt aus Garmisch-Partenkirchen. Er studierte Germanistik, Anglistik, Theaterwissenschaften und Philosophie und wurde als Autor und Musikkabarettist mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kabarettpreis der Stadt München (2005), dem Agatha-Christie-Krimi-Preis (2006 und 2007), dem Ernst-Hoferichter-Preis (2012), dem Publikumskrimipreis MIMI (2012 und 2013) und dem Radio-Bremen-Krimipreis 2013. Sein Krimi-Kabarettprogramm ist Kult.
Inhalt
Der Gesundheitstipp
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Greifen und Begreifen – wo das Herz aller Eltern höher schlägt
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Eine literarische Annäherung
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Rippenklau und Apfel-Snack
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Alte Volksweisheit
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Produktinformationen für Steal Deal©
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Ein krimineller Streifzug durch die bayrischen Volksstämme
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Geistiger Diebstahl
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
Die Welt der Oper, die Welt des Theaters –
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
Die Vortäuschung amtlicher Eigenschaft oder einer sonstigen Befugnis
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
Zu guter Letzt: Sieben Tipps, um mit dem Klauen aufzuhören
Die geschilderten Ereignisse basieren [...]
Abspann: In den Hauptrollen …
Der Gesundheitstipp
Die einen brauchen es mindestens einmal am Tag – die anderen sehen nicht ein, warum sie andauernd mit einem Fuß im Gefängnis stehen sollen. Aus gesundheitlicher Sicht gibt es aber durchaus Argumente für den regelmäßigen Griff in fremde Taschen.
Jeder Zehnte verstößt öfter gegen die einschlägigen Diebstahls-paragraphen. Für diese Menschen ist das Klauen so normal wie das tägliche Zähneputzen. »Es werden immer mehr«, sagt Dr. Klaus Stubenrauch, leitender Arzt der Abteilung für Naturheilkunde im Münchner Paul-Heyse-Krankenhaus. »Und es ist ein gesunder Trend.«
Amerikanische Untersuchungen bei Kaufhausdieben haben es ergeben: Schon beim Ausspähen geeigneter Beutestücke steigt die Hauttemperatur auf bis zu 40° an – daher kommt auch die rosige Farbe vieler Diebe, wenn sie in Aktion sind. Die Gefäße weiten sich, der Blutdruck sinkt. Das Herz muss nun volle Arbeit leisten und schlägt schneller, die Atmung steigt.
Kurz vor dem eigentlichen Zugriff ziehen sich die Gefäße schlagartig zusammen, und der Körper schaltet kurzzeitig auf Alarm. Adrenalin und weitere Hormone werden ausgeschüttet und machen den Dieb putzmunter. Geschafft! »Das Gefühl ist unbeschreiblich«, so Dr. Stubenrauch. »Ein- bis zweimal in der Woche sollte man klauen. Erst durch die zyklische Wiederholung profitiert der Körper von den Vorteilen.«
Nach solchen Aktionen empfiehlt es sich, auf einer Liege zu entspannen. Das Herz schlägt jetzt kräftig und langsam, die Haut fühlt sich wohlig und geschmeidig an. Durch die vermehrte Durchblutung werden Schadstoffe schneller abtransportiert. Zudem kann die Haut laut einer Studie mehr Feuchtigkeit speichern, was der Faltenbildung entgegenwirkt. Klauen hält jung!
Die Atemwege profitieren ebenfalls von regelmäßigen Raubzügen – Asthmatiker und Menschen, die unter einer chronischen Bronchitis leiden, können sich dadurch viel Linderung verschaffen. Aber auch zur Infektabwehr werden Eigentumsdelikte angepriesen. »Zehn bis zwölf Diebstähle vor der Erkältungssaison sind optimal«, empfiehlt Dr. Stubenrauch. »Das erhöht die Anzahl weißer Blutkörperchen. Und die sind wichtig im Kampf gegen Krankheitserreger.«
Nur in wenigen Fällen wird vom Klauen abgeraten. Verboten ist es bei einer Erkältung oder nach Alkoholkonsum. Patienten mit Herzrhythmusstörungen und ältere Menschen sollten deswegen sicherheitshalber ihren Hausarzt konsultieren. Schwangere hingegen können klauen, wenn sie es bereits gewohnt sind – doch sie sollten allzu schwere Tragelasten beim Wegschaffen der Beute vermeiden.
(Quelle: World Health Summit 2014)
1
Dieser Augusttag war der klebrigste und heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Eine der Prachtalleen der Landeshauptstadt, die sonst so geschäftige Prinzregentenstraße, lag da wie eine zertretene Spaghettinudel. Von der nahe gelegenen Bierbrauerei wehte fetter, süßlicher Hopfengeruch, und aus einem der offenen Fenster dudelte der Sommerhit Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Eine junge Frau mit schwarzglänzenden langen Haaren stand an der Spüle und wusch Porzellanteller, im Hintergrund prangte das unvermeidliche Che-Guevara-Poster. Sie drehte das Küchenradio lauter, wippte mit den Hüften im Takt und biss in eine trockene Brezel vom Vortag. Irgendetwas lag in der Luft. Irgendetwas musste jetzt passieren.
Die Frau trat ans Fenster und blickte hinunter auf die Straße. Gegenüber der Deutschen Bank hatte sich eine Menschenansammlung in doppelter Schulklassengröße gebildet, und alle starrten gebannt und bewegungslos auf die Eingangstür. Dann ertönten Polizeisirenen, zunächst noch ganz fern und leise, doch als sie sich näherten, kam Unruhe in die gaffende Menge.
»Endlich!«, stieß ein Mann mit Trachtenjanker hervor. »Endlich kommens!«
»Ist ja auch Zeit geworden!«, entgegnete sein Nachbar. Er trug einen viel zu kleinen Hut. Das verlieh seinem ohnehin nicht pfiffigen Gesicht einen dümmlichen Zug. Trotzdem. In diesem Fall hatte er recht. Ein paar Umstehende nickten zustimmend. Väter schulterten ihre quengelnden Kinder zwecks besserer Sicht, einer schoss ein Polaroid-Foto. Doch niemand zückte sein Handy. Niemand zückte sein Handy? Natürlich nicht, es war der 4. August des Jahres 1971.
Das Polizeiauto bog schrill quäkend um die Ecke. Es war überraschend klein, viele stöhnten enttäuscht auf, sie hatten einen geräumigen Bus erwartet, eine imposante Grüne Minna, die die Verbrecher verschlucken und erst im Gefängnishof wieder ausspucken würde. Aber es war lediglich ein VW-Käfer, der hier eine Vollbremsung hinlegte. Ein VW-Käfer? Wie gesagt: 1971. Einige schlugen die Hände vor den Mund und schnappten nach Luft, weil sie befürchteten, dass er umkippte, zwei Reifen hingen bereits in der Luft. Doch dann kam der Wagen endlich zum Stehen. Viele der Zuschauer klatschten und johlten. Das leiernde Martinshorn verstummte, das Blaulicht erlosch flackernd. Einen bösen Gedanken lang geschah nichts. Schließlich sprangen die Türen auf, zwei Uniformierte mit Schirmmützen und in speckigen Lederjacken schossen rechts und links heraus und warfen sich bäuchlings auf den staubigen Asphaltboden. Dort blieben sie in unbequem gekrümmter Haltung liegen, mit einer Hand an der Dienstwaffe, und brüllten sich unverständliche Befehlslaute zu, zerhackte Fetzen polizeilicher Anweisungskürzel – Kauderwelsch, das nach Gefahr, Gewalt und Panik klang. Aber die Menge war zufrieden. Die Polizei war ja da. Das war die Hauptsache.
»Papa, was ist denn das?«
»Ein Bankraub, du Dummerl!«
Der kleine Kasimir starrte auf die Beamten in den speckigen Lederjacken, die ein paar Schritte vor ihm am Boden kauerten. Er war sich unsicher, ob nicht das die Bankräuber waren. Aber er wollte nicht nachfragen und dadurch blöd dastehen. Ein Bankraub, das war was für Erwachsene, da fragte man besser nicht weiter. Auf der anderen Seite der Straße, vor dem Feinkostgeschäft, bauten Pressefotografen ihre Klappstühle und Geräte auf. Kriminalberichterstatter ließen spitze Bleistifte über den Stenoblock rasen und notierten erste Eindrücke: trügerische Stille … lauernde Gefahr … Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Doch dann stießen sich einige der Gaffer aufgeregt an und deuteten hinüber zur Bank. In einem der Erdgeschossfenster des Bankgebäudes Prinzregentenstraße 70 war ein Kopf aufgetaucht, der in eine rötliche, spitze Ku-Klux-Klan-Mütze gehüllt war. Langsam hob der dazugehörige Mensch den Arm. Er hielt einen Stock in der Hand, vielleicht auch ein Gewehr, er schüttelte das gefährlich aussehende Ding und drohte damit, dann war er auch schon wieder verschwunden. Die Menge stöhnte auf. Sie war enttäuscht.
»Papa, wann ist denn der Bankraub zu Ende?«
Einige lachten.
»Da musst du schon die Bankräuber fragen«, antwortete der Papa.
»Aber warum bleiben die so lang da drin?«
»Bis das ganze Geld eingepackt ist, das dauert wahrscheinlich seine Zeit.«
Der Bub war damit zufrieden. Die beiden Speckjacken, die aus dem VW-Käfer gesprungen waren, robbten einige Meter auf dem Boden dahin, die Menge wich vor ihnen zurück. Einer der beiden Beamten, der dickere, richtete seine Waffe aufs Fenster. Doch dann schüttelte er den Kopf und ließ sie wieder sinken. Ein paar der Zuschauer lachten hämisch.
»Schauts, dassts euch schleichts!«, rief der andere Polizist der Masse zu. Doch niemand schlich sich. Niemand fühlte sich angesprochen, niemand ging heim, ganz im Gegenteil. Den neu Hinzukommenden wurde berichtet, was inzwischen geschehen war.
»Ein Bankraub!«
»Was? Ein Bankraub?! Wie gibts denn so was?«
»Ja, die Deutsche Bank haben sie überfallen.«
»Wer denn?«
Ja, wer jetzt? Es wurde spekuliert. Bankräuber halt. Verzweifelte. Ausgestoßene. Oder Politische? Verwegene RAF’ler? Visionäre Anarchisten, die vielleicht sogar die Bayerische Räterepublik wieder einführen wollten? Jedenfalls keine kleinen Bazis und Striezis, sondern große Kaliber. Mit einem Bankraub spielte man, gleich hinter dem Mord, in der kriminellen Bundesliga. Komisch bloß, dass es so was mitten in München gab. In Chicago, ja, da hätte man sich das eingehen lassen. Oder in Frankfurt. Aber in der bocksgemütlichen Landeshauptstadt? Und dann auch noch in der altehrwürdigen Prinzregentenstraße?
»Wahrscheinlich drogensüchtige Ausländer aus dem Hasenbergl!«
»Oder arbeitsscheues, langhaariges Gesindel aus Ramersdorf!«
Die beiden übel beleumundeten Stadtviertel der Landeshauptstadt waren sicher gute Nährböden für bankräuberische Sumpfpflanzen.
Die Kirchturmuhr St. Gabriel schlug sechs, die Geschichte zog sich jetzt schon zwei Stunden hin. Der Mann mit der roten Ku-Klux-Klan-Mütze hatte sich erst ein einziges Mal gezeigt, die Polizei hatte nach Meinung der Zuschauer viel zu wenig unternommen. Trotzdem hatte sich die Straße in den zwei Stunden gut gefüllt, die Veranstaltung geriet langsam in die Nähe eines kleinen Volksfestes. Vorne braute sich ein Fetzenspektakel zusammen, was hinten noch fehlte, waren Würstelbuden und Losverkäufer. Schiffschaukeln, Ochsenbratereien, Karussells, Bierzelte, Blasmusik, Trachtenumzüge … Doch die richtige, kernige Gemütlichkeit kommt selbstverständlich auch ohne das alles aus. Weitere Polizeiautos fuhren vor, peinlich darauf bedacht, keinen der Schaulustigen über den Haufen zu fahren. Ein grüner BMW glitt langsam durch den Auflauf, einige der Zuschauer schlugen zur Gaudi mit der flachen Hand aufs Autodach. So wenig Respekt hatte man in den Siebzigern vor den Bullen. Erste Sympathiekundgebungen mit den Outlaws kamen auf. Die Bankräuber hatten offensichtlich telefonisch nach Verpflegung verlangt, denn jetzt sah man die beiden Polizisten, die als Erste gekommen waren, wie sie eilig aus dem Feinkostladen gegenüber traten, vollbepackt mit prallen, bunten Tüten, aus denen es köstlich dampfte. Sie liefen zur Bank, die beiden Speckigen – eben noch Diener der Staatsmacht, jetzt Laufkellner für Ramersdorfer Ganoven.
»Und was ist mit uns? Kriegen wir nichts?«, rief ein Witzbold mit Hund.
Gelächter. Zustimmender Applaus.
»So ein Bankraub macht hungrig«, rief ein anderer. »Drinnen wie draußen. Für mich zwei Kaviarbrötchen und ein Glas Champagner bitte!«
Erneutes Gelächter. Bravorufe. Man amüsierte sich großartig.
Die Speckjacken legten die Tüten vorsichtig vor der gläsernen Eingangstür der Bank ab und entfernten sich im Rückwärtsgang. Das hatte etwas Höfisches, wie wenn sie Mundschenke des Großherzogs gewesen wären. Eine behaarte Verbrecherhand schob sich tastend durch die Glastür und zog die Feinkostpackerln ins Innere des Gebäudes.
»Ich an seiner Stelle hätte die Tüte nicht mit der Hand, sondern mit der Waffe hineingezogen«, raunte der Mann mit dem zu kleinen Hut seinem Nachbarn zu. Der mit der Trachtenjoppe blinzelte ihn an, schätzte ihn ab. Rechnete sich aus, dass er in dem Alter –
»Minsk, 1941«, wisperte der mit dem zu kleinen Hut weiter. »Neunundzwanzigste motorisierte Infanterie-Division, Durchbruch bei Białystok –«
Bevor er jedoch seine Kriegsgeschichte erzählen konnte, fuhren zwei weitere Polizeiautos vor, wieder sprangen Speckige heraus und brüllten ihren Kollegen etwas zu. Langsam schien sich die Schlinge um die Banditen zuzuziehen.
Der kleine Kasimir gähnte. Kein Wunder, dass er langsam müde wurde, bei dem aufregenden Tag heute. Am Nachmittag im Englischen Garten hatte er das erste Mal in seinem Leben Radieserl gegessen. Sogar einen Schluck Bier hatte er trinken dürfen. Und dann beim Heimweg war er mit seinem Vater mitten in einen Banküberfall hineingerumpelt! Er wusste jetzt schon, dass es nach den Ferien viel zu erzählen gab in der Schule. Und dann der übliche Aufsatz über das schönste Ferienerlebnis. Die Überschrift hatte er sich schon überlegt: Wie ich einmal bei einem Bankraub mitgemacht habe.
Aber jetzt! Wie bei einem Tennisspiel drehten sich alle Köpfe und Fotoapparate synchron und wie von hundert Schnüren der Neugier gezogen auf die andere Seite. Einer der Gangster kam vor die Tür. Die rote Ku-Klux-Klan-Haube trug er immer noch. Einige buhten bei seinem Auftritt, doch die meisten hielten den Atem an und schwiegen ehrfurchtsvoll. Der Bankräuber stieß eine Geisel vor sich her, der er die Waffe an den Kopf hielt.
»Eine alte Schmeisser«, flüsterte der Mann mit dem zu kleinen Hut. »Entweder eine MP 38 oder vielleicht sogar eine 40-er. Meine Augen sind nicht mehr die allerbesten. Aber damals –«
Der mit dem Trachtenjanker glaubte ihm jetzt, dass er in Minsk dabei gewesen war.
Die junge Frau droben am Fenster hatte sich ein Handtuch um die nassen Haare gebunden. Sie öffnete ihren schon von Haus aus spöttisch geschnittenen Mund zu einem breiten Lächeln. Wenn einer raufgeschaut hätte, hätte er unter dem Handtuch die üppigste Lockenpracht vermutet. Er hätte im abendlichen Licht das hervortretende, energische Kinn erkennen können, aber auch die mandelförmigen, fast orientalisch geschwungenen Augen mit dem katzenhaften, sich in der Ferne verlierenden Blick. Es schaute natürlich niemand rauf, weil unten weit mehr los war. Ein Bankraub, mit echten Bankräubern und echten Geiseln. Da spielte die Musik. Aber wenn einer raufgeschaut hätte, dann hätte er den Eindruck gehabt, dass dort oben am Fenster Nofretete stand, die Gemahlin des Pharao und Herrscherin über die sieben östlichen Münchner Stadtviertel einschließlich Ramersdorf.
2
Vierundvierzig Jahre später hob Kriminalhauptkommissar Jennerwein den Kopf und blinzelte in die Sonne. In der Ferne konnte er schon sein Ziel erkennen, einen zweistöckigen Jugendstilbau, den eine abweisende, graue Mauer vollständig umschloss. Er wollte jemanden besuchen, aber seine Vorfreude hielt sich in Grenzen. Hubertus Jennerwein war ein gutaussehender, aber unauffälliger Mann in mittleren Jahren. Sein Blick war wach und klar, sein Gang zielstrebig, die Hände hielt er auf dem Rücken verschränkt. Ein eventuell entgegenkommender Sherlock Holmes hätte aus diesen Kleinigkeiten blitzschnell den absolut integren, sehr erfolgreichen, mit kleinen privaten Geheimnissen ausgestatteten Ermittler im Gehobenen Dienst abgeleitet. »Erfolgsquote hoch, Ruf bestens, Privatleben nicht vorhanden«, hätte Holmes zu Dr. Watson gesagt. Und er hätte wieder einmal vollkommen richtig gelegen.
Jennerwein war schon öfter in diesem mittelgroßen Städtchen gewesen, einem unentschlossenen Ding zwischen Voralpendorf und Flachlandsiedlung, weder Stadt noch Gemeinde, weder schön noch hässlich, weder richtig bedeutend noch gänzlich unwichtig. Die Altstadt war teils mittelalterlich, teils Bausünde – selbst der amerikanische Bombenschütze damals vor siebzig Jahren schien unentschlossen gewesen zu sein. Jennerwein warf einen Blick auf die Uhr: noch zehn Minuten bis zum verabredeten Termin. Er überquerte einen belebten Platz. Die unentschiedene Kulisse färbte anscheinend ab: Alle Menschen, die hier durchströmten, schienen sich zögerlich zu bewegen, stockend war ihr Gang, zerrissen ihre Gespräche, orientierungslos ihr Blick. Kommissar Jennerwein ließ sich mitreißen von dieser wackligen Atmosphäre, langsam geriet er in den gefährlichen Sog des Selbstzweifels, der ihn in letzter Zeit immer häufiger heimsuchte. Hatte er eigentlich den richtigen Beruf gewählt? War er ein guter Kriminaler? War das andauernde Herumstochern in menschlichen Abgründen die angemessene Beschäftigung für ihn? Jennerwein versuchte, sich zu konzentrieren. Natürlich hatte er den richtigen Beruf gewählt. Er hatte niemals eine Alternative in Erwägung gezogen. Er war der geborene Kämpfer für die gerechte Sache. Schon in der Schulzeit hatte er sich für die Polizeiarbeit interessiert. Er hatte ganz sicher seinen Traumberuf ergriffen. Oder etwa doch nicht? Warum quälten ihn manchmal solche Anfechtungen? Jennerwein riss sich von seinen dunkelgrauen Gedanken los.
Er stand am Eingangstor des abweisenden Gebäudes und klingelte. Der Pförtner öffnete, Jennerwein zückte seinen Ausweis, doch der Pförtner schüttelte den Kopf.
»Ich weiß schon, wer Sie sind«, knurrte er und winkte ihn herein. Jennerwein durchschritt einige Gänge, kam an verschlossenen Türen vorbei, stieg abgeschabte Treppen hinauf. Er kannte den Weg. Es war früher Nachmittag, keine Seele schien im Haus zu sein. Endlich betrat er das schmucklose, spartanisch eingerichtete Zimmer.
»Herr Dirschbiegel kommt gleich«, sagte ein blasser Jüngling mit roten Flecken im Gesicht. Das Namensschildchen an seinem Revers war nicht ausgefüllt. Oder der Zettel war herausgefallen und lag jetzt irgendwo im Staub, achtlos zertreten von den Hausbewohnern und deren Besuchern. Jennerwein sah sich um. Kein Bild an der Wand, keine Blumenvase auf dem Tisch, kein Gramm Deko. Er schloss die Augen vor dem gestalterischen Elend. Er als Beobachter, Ermittler und Schnüffler brauchte stets etwas, das seine Phantasie und seine Schlussfolgerungslust entzünden und befriedigen konnte. Und wenn es vertrocknete Blumen auf dem Tisch waren. Der Namenlose stand immer noch da, wie ein Hotelpage, der auf Trinkgeld wartet.
»Ich komme schon allein zurecht«, sagte Jennerwein.
Der blasse Jüngling mit den roten Flecken im Gesicht verschwand. Als Jennerwein aus dem Fenster sah, traf sein Blick auf die Mauer. Seit seinem letzten Besuch war ein Graffito dort hingesprüht worden. Jennerwein interessierte sich sehr für diese Art von Malerei. Kryptische Schriften und geheimnisvolle Botschaften zogen ihn an. Dieser Painter hier war begabt. Ob es ein Hausbewohner war? Jennerwein fiel ein, dass er ganz vergessen hatte, sein Smartphone vorschriftsmäßig beim Pförtner abzugeben. Er holte es heraus, um das Graffito zu fotografieren.
Ja, richtig: ein Smartphone. Jennerwein besaß seit neuestem eines. Sein Ermittlerteam hatte ihm das chromstahlgewordene Symbol der restlos durchnetzten Zeit zum runden Dienstjubiläum geschenkt. Und jeder seiner Mitstreiter hatte mit einer besonderen App oder einem kleinen Zusatzgag eine persönliche Note beigesteuert. Von Hauptkommissar Ludwig Stengele, dem Allgäuer Bergfex, stammte der Peakfinder, der jeden Berggipfel dieser Welt identifizieren und klassifizieren konnte. Die Polizeipsychologin Dr. Maria Schmalfuß wiederum hatte ihm eine Audiodatei installiert, auf der das beruhigende Geräusch des stetigen Umrührens in einer Kaffeetasse zu hören war:
»Besser als jedes Meeresrauschen! Das wird Ihnen beim Nachgrübeln helfen, Hubertus!«
Das selbstgeschnitzte urige Smartphone-Holzkasterl aus Werdenfelser Zirbelholz stammte von Polizeihauptmeister Johann Ostler. Kommissarin Nicole Schwattke hatte ihm die Jammer-GPS-App heruntergeladen, mit der man alle Handys im Umkreis von zehn Metern stilllegen konnte. Sehr praktisch bei längeren Bahnfahrten. Das Geschenk von Polizeiobermeister Franz Hölleisen, dem Metzgerssohn, war schließlich eine Weißwurst-Restaurant-Finder-App, die sogar in Helsinki zwei Ergebnisse lieferte.
Jennerwein schoss ein paar Aufnahmen von der bunten Wandkunst, war ganz in Perspektive, Tiefenschärfe und Farbtemperatur eingetaucht, da vernahm er eine wohlbekannte Stimme in seinem Rücken.
»Pünktlich wie immer?«
Es war Dirschbiegels rauer, spottlustiger Ton. Jennerwein antwortete seufzend.
»Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem gerade auf diese Tugend viel Wert gelegt wurde. Manchmal zu viel.«
»Das lobe ich mir«, setzte Dirschbiegel hinzu. »Nur so funktioniert der Beamtenapparat. Pünktlich zum Dienst, pünktlich am Tatort, pünktlich zum Verhör, pünktlich zur Hinrichtung.«
Jennerwein entgegnete nichts. Gegen Dirschbiegels Sarkasmus anzukommen war zwecklos. Sie setzten sich und blickten sich schweigend an, Dirschbiegel herausfordernd, Jennerwein mit einem skeptisch-prüfenden Gesichtsausdruck. Dirschbiegel war der Ältere. Sein zerfurchtes, markantes Gesicht stand in großem Gegensatz zu der lockeren, unaufdringlichen Eleganz Jennerweins. Dirschbiegel hatte sorgfältig geschnittene, graumelierte Haare, er war glatt rasiert, und in seinen Augen glomm ein unruhiges Feuer. Es war das unruhige Feuer dessen, der noch nicht alle Ziele im Leben erreicht hatte. Er verschränkte die Arme vor der breiten Brust und wartete. Sie hatten telefonisch vereinbart, sich auf ein Stündchen zu treffen, und von diesem Stündchen waren jetzt schon fünf wortlose Minuten verstrichen. Schließlich brach Jennerwein das Schweigen, wie ein Schachspieler, der nach genauer Abwägung aller komplizierten Eröffnungszüge den einfachsten wählt. Bauer e2 auf e4:
»Wie gehts?«
»Geht so«, antwortete Dirschbiegel barsch.
»Gibt es Pläne?«
»Was für Pläne?«
»Pläne für die Zukunft zum Beispiel.«
Dirschbiegel verzog das Gesicht zu einer unentschiedenen Grimasse. Trotz seines Alters war Dirschbiegel ein Mann, zu dem der Ausdruck Bursche gut gepasst hätte, er zeigte etwas Jungenhaft-Verschmitztes.
»Ich mache mir nie große Gedanken über die Zukunft«, sagte er.
»Ich frage ja bloß. Morgen ist dein Entlassungstermin.«
»Wird wohl so sein.«
»Ich kann dich abholen. Natürlich nur, wenn du willst.«
Dirschbiegel schüttelte den Kopf. Wieder verstrichen einige Minuten, ohne dass ein Wort fiel. Das Graffito war aus dieser Perspektive für Jennerwein nicht mehr zu sehen. Und im Zimmer selbst gab es keinen Punkt, auf dem sein Blick hätte ruhen können. Dirschbiegels Gesicht kannte er schon. Seit langem.
»Ich fühle mich hier drin nicht wohl«, sagte Jennerwein plötzlich genervt und stand auf. »Wollen wir ein Stück gehen?«
»Wenn es sein muss.«
So schritten sie durch die unwirtlichen Gänge und Trakte des Gefängnisses: der Häftling, der morgen entlassen werden sollte, und sein Besucher, der Kriminalhauptkommissar. Dahinter marschierte der namenlose Blasse mit den roten Flecken im Gesicht. An seinem Gürtel baumelten ein Achter und ein Schlüsselbund, seine Uniform war tadellos gepflegt, die Schuhe schienen gerade eben erst gewienert zu sein. Diesen Mann anzugreifen hieße, den Staat selbst anzugreifen. Trotz der eintönigen Zellen- und Verwaltungstrakte, an denen sie vorbeikamen, war Jennerwein froh, sich nicht mehr im kahlen Besucherraum aufhalten zu müssen. Dessen absolute Schmucklosigkeit hatte ihm großen Stress bereitet. Eine Gruppe von Gefängnisinsassen, die einen quietschenden Wagen mit klappernden Tellern und Tassen schob, blieb stehen und musterte die ungleiche Dreiergruppe misstrauisch. Ein drahtiger Frankenstein mit vollständigem Gesichtstattoo trat vor.
»Na, Dirschi! Brauchst du jetzt schon zwei Wachtel?«
Jennerwein konnte beim besten Willen nicht erkennen, ob die Brille echt oder tätowiert war.
»Hallo, Dirschi!«, rief ein kleiner, stämmiger Danny-DeVito-Typ mit hochgekrempelten Hosenbeinen. »Ich hab gehört, du kommst morgen raus?«
»Möglicherweise«, gab dieser freundlich lächelnd zurück.
»Gibst du den Kurs heute trotzdem noch?«
»Klar.«
»Du hältst hier im Gefängnis Kurse?«, fragte Jennerwein, als Danny DeVito mit seinen Kumpanen außer Sicht war.
»Ja. Sozusagen ehrenamtlich.«
»Fließt das in die Abschlussbeurteilung mit ein?«
»Möglich.«
»Kann ich da zuschauen?«
»Ich fürchte, ich bin nicht in der Position, das verbieten zu können.«
Als sie den Hof überquerten, bemerkte Jennerwein erneut, dass viele Mitgefangene Dirschbiegel ehrfurchtsvoll grüßten. Einige verbeugten sich sogar. Es war keine Spur von Ironie darin zu finden.
»Du scheinst ja ein großes Renommee in dieser JVA zu besitzen«, sagte Jennerwein anerkennend.
»Das macht allein die Würde des Alters«, entgegnete Dirschbiegel trocken.
Von wegen Würde des Alters, dachte Jennerwein. Er kannte keinen würdeloseren Alten als Dirschbiegel. Dieser Häftling hatte fast sein halbes Leben im Gefängnis verbracht, und man konnte nicht den Eindruck gewinnen, dass er von Verurteilung zu Verurteilung auch nur eine Spur klüger geworden wäre.
»Wann beginnt der Kurs?«
»In einer Stunde.«
Das Büro des Gefängnisdirektors war geräumig, der junge Mann mit den Flecken im Gesicht servierte Erfrischungsgetränke und kleine harte Plätzchen. Jennerwein hatte beschlossen, die Wartestunde zu nutzen und den Direktor zu besuchen, eine graue Riesenmaus mit traurigen Augen.
»Wie lange war der Häftling Insasse Ihrer Anstalt?«, fragte Jennerwein.
»Zwölf Monate hätte er zu verbüßen gehabt. Sieben hat er abgesessen.«
»Wegen guter Führung vorzeitig entlassen?«
»Er hat sich untadelig verhalten. Mehr noch. Er organisiert Veranstaltungen, verwaltet die Gefängnisvideothek und leitet Präventionsgruppen.«
Jennerwein blickte den Direktor skeptisch an.
»Haben Sie den Eindruck, Kommissar, dass unlautere Absichten dahinterstecken?«
»Vielleicht bereitet er etwas vor.«
Der Direktor lächelte riesenmäusisch.
»Sie meinen, dass er sich absichtlich hat einschleusen lassen? Zu welchem Zweck?«
»Keine Ahnung. Vielleicht um Leute anzuwerben, um Kontakte zu knüpfen, um an Informationen zu kommen –«
»Nach einer Rekrutierung sieht mir das nicht aus. Außerdem hat Dirschbiegel bisher immer alleine gearbeitet.«
Trotzdem spürte Jennerwein, dass hier etwas nicht stimmte. Dirschbiegel war anders als sonst gewesen. Irgendwie nervös, angespannt, nicht ganz so locker, wie er ihn kannte. Zwölf Monate Knast hatte er bekommen, und gar nicht einmal wegen erneuter Eigentumsdelikte, sondern wegen Verstößen gegen Bewährungsauflagen, Nichteinhaltung von Platzverweisen – Jennerwein hatte einen kurzen Blick in die Akte im Büro des Direktors geworfen. Er hatte das Gefühl, dass ihm die Riesenmaus nicht weiterhelfen konnte. Er stand auf, um sich zu verabschieden.
»Gibt es denn einen Raum, in dem ich mich noch eine Stunde aufhalten kann?«, fragte er an der Tür.
»Sie können in meinem Vorzimmer warten.«
»Danke, dann will ich lieber im Gefängnishof spazieren gehen.«
»Wie Sie wollen. Mein Assistent bringt Sie zu einem der Bunkerhöfe. Da ist Uli Hoeneß immer entlanggelaufen.«
»Auf den Spuren von Uli Hoeneß? Davon habe ich immer geträumt. Also gut. Dann bleibe ich im Hof, bis der Kurs beginnt.«
Die Riesenmaus zog verwundert die Augenbrauen hoch.
»Wie bitte? Sie wollen an Dirschbiegels Kurs teilnehmen?«
»Ja, warum nicht? Ich bin schon äußerst gespannt auf seine didaktischen Fähigkeiten.«
3
Der Himmel über den Alpen war so blau wie das Briefpapier von Kaiserin Sisi. Eine silberne Boeing stieg hoch und schrieb eine Zeile Fernweh darauf.
Hört man etwas über die Alpen, dann denkt man meist nur an die bayrischen und vergisst, dass diese nur einen kleinen Teil der eigentlichen Alpen bilden, die von Südfrankreich bis nach Slowenien reichen. In Nizza fangen sie an, vor Maribor hören sie auf, oder kurz vor Wien, wie man will. Im Osten verzweigen sie sich nämlich eigensinnig. Sie bilden jedenfalls den größten Steinhaufen, den Europa zu bieten hat, aber sie beginnen zaghaft, als meerumspülte Alpes Maritimes an der Côte d’Azur. Dort schneckeln und rollen sie sich ein, zieren sich praktisch noch ein bisschen, so, als ob sie sich nicht recht trennen könnten von den croissantduftenden Straßencafés. Dann aber plustern sie sich gewaltig auf, türmen sich hoch zum Mont Blanc, bilden das Rückgrat der alpinen Schweiz und des hochgebirgigen Teils von Österreich, um dann, nach zwölfhundert Kilometern, kleinlaut und mau kurz vor Wien zu verbröckeln. Von oben betrachtet, sehen die Alpen ein bisschen aus wie eine dösende Eidechse – Bodensee und Gardasee sind die zwei herausgestreckten Füßchen, Aflenz und Bruck die Äugerl.
Würde die massive Eidechse wie der heidnisch-germanische Steingott Saxnôt Richtung Wiener Becken wegspringen, wäre sie mit einem kleinen Satz und einem großen Platsch im Schwarzen Meer. Es ist wirklich jammerschade, dass sich um diesen europäischen Kalk- und Granitsteinhaufen zu Zeiten Karls des Großen keine eigene Nation gebildet hat – dieses Land würde zu Recht den Namen Alpenrepublik tragen, ein uneinnehmbares Bollwerk gegen alle möglichen Ansinnen von Nord und Süd, reichgefressen durch die Zölle, die erhoben werden könnten, beschwipst von der allgegenwärtigen Höhenluft. Das wäre ein Volk der Bergsteiger und Gipfelstürmer geworden! Mit Wal-Lungen, Pratzen wie Tatzelwürmern und Wadeln wie Mörtelsäcken, unschlagbar beim Fensterln, Jodeln und Skispringen. Wie von selbst hätte sich Rätoromanisch als Landessprache angeboten, eine würzige Mischung aus Französisch, Italienisch, Alemannisch, Bajuwarisch und Slowenisch – ein gejodeltes Latein, eine gejauchzte Berg- und Talfahrt menschlichen Ausdrucksvermögens. So aber teilen sich ein paar umwässerte und vom Flachland degenerierte Nationen die Alpen. Acht Anrainerstaaten melken die steinerne Eidechse. Sofern man Liechtenstein und Monaco mitzählen will.
Marco Zunterer träumte davon, die Alpen vollständig zu umkreisen. Und zwar mit seinem Heißluftballon. Starten wollte er im Kurort, der für ihn den Mittelpunkt, das pochende Herz der Eidechse bildete. Bei Guinness hatte er schon angefragt wegen eines neuen Rekords, und die waren gar nicht so abgeneigt, seine vollständige Alpenumrundung ins Buch aufzunehmen. In Höhen von sechs-, acht- oder sogar zehntausend Meter wollte er aufsteigen bei dieser Eidechsen-Tour. Frühstückskaffee über Nizza, Abendjause mit Blick auf Wien-Simmering, so etwas in der Art. Tragen sollte ihn ein seltener und unregelmäßig auftretender Wind, der die Alpenränder heiß und staubig umstrich, und von dem die Alten sagten, dass auf ihm der Sonnengott mit seinem Wagen führe. Marco fand, dass er genau der Richtige für dieses Abenteuer war, denn er hatte seine Wurzeln in fast jedem der Anrainerstaaten. Die eine Großmutter stammte aus Tirol, die andere aus Graubünden, ein Urgroßonkel aus Bayern, ein entfernterer aus Ligurien und ein paar Ahnen waren sogar aus dem Slowenischen heraufgekommen. Marco fühlte sich als staatenloser Alpländer, er wäre ein idealer Bürger für diese gedachte Republik der Kletterer, Kraxler und Luftikusse gewesen. Nach der Bundeswehrzeit hatte er den Ballonpilotenschein gemacht und zunächst beim süddeutschen Marktführer Schott (»Schott’s Alpenträume«) gearbeitet, dann hatte er sich in die Selbständigkeit gestürzt. Seit Jahren chauffierte er nun schon Geburtstagskinder, Absolventen von Flugangstbewältigungsseminaren und kreischende japanische Touristen durch die Lüfte.
Übermorgen war es wieder so weit. Da sollte die nächste Tour starten, eine Fahrt vom Kurort aus Richtung Spitzingsee, wegen des spektakulären Blicks immer dicht am Alpenrand entlang, natürlich nur bei günstigem Wind. Und der Wind war günstig. Erstens sagte der Wetterbericht das, und zweitens hatte Marco so ein vages meteorologisches Gefühl von seinem slowenischen Urgroßvater geerbt, er spürte einen bevorstehenden Umschwung im großen Zeh. Nach der Landung südlich des Sees sollte sie das Verfolgerteam aufsammeln und wieder zurückbringen. Marco blickte aus dem Fenster seines Arbeitszimmers. Der Abendhimmel war in ein sternengepunktetes Schlafanzugblau getaucht, nur die weißglänzende Alpspitze wehrte sich trotzig gegen die Nacht: Will aufbleiben!Sein Blick blieb an dem Geräteschuppen hängen, der im Garten stand. Dort drinnen lagerte sein gesamtes Betriebsvermögen: die verpackte Ballonhülle, der Korb, der Brenner, die Gaszylinder, die Navigationsgeräte, das ganze restliche Equipment. Er hatte sich beim Kauf für einen großen, rechteckigen Peddigrohr-Korb aus bester philippinischer Korbweide mit einem Fassungsvermögen von zwölf Personen entschieden. Ein Prachtstück! Er löste den Blick von seiner flugtauglichen Geschäftsgrundlage, beugte sich über seinen Computer und schrieb eine Rundmail:
Liebe Alpengucker!
Übermorgen ist es endlich so weit, da packen wir es an. Wir treffen uns Punkt 6 Uhr in der Früh in Grainau am Hammersbacher Hölzl, dann werden wir gemeinsam den Ballon aufrichten und starten. Wenn ich so hinaussehe –
Marco hob den Kopf und blickte erneut aus dem Fenster. Tatsächlich deutete die sternklare Nacht darauf hin, dass das Wetter so blieb und eine Fahrt möglich machte. Er beugte sich wieder über die Tastatur.
– sieht es gut für unsere Fahrt aus. Ich bitte alle Teilnehmer nochmals um eine kurze Bestätigung. Der Wetterbericht sowie mein untrügliches Gefühl im großen Zeh sind gut. Denkt bitte an eine Kopfbedeckung, damit euch die Hitze des Brenners nicht die Haare versengt. Und nochmals: Es gibt keinen Handy-Empfang dort oben. Lasst also eure Tablets, Mobiles und anderen Kram zu Hause, so schwer es auch fällt.
Euer Marco Zunterer
Er schickte die Rundmail ab und lehnte sich zurück. Dass es keinen Handy-Empfang dort oben gab, stimmte zwar nicht, aber er hasste die Dinger und griff deshalb zu dieser Notlüge. Marco erhob sich, verließ das Haus, ging hinüber zum Ballonschuppen und überprüfte noch einmal die wichtigsten sicherheitsrelevanten Teile des Fluggeräts. Er musste an Egon Schott denken, seinen idiotischen Ex-Chef, in dessen Firma er zwei Jahre als Pilot gearbeitet hatte. Schott’s Alpenträume. Von wegen! Eher Schott’s Albträume. Vergiss den Alten! Vergiss den ganzen Ärger mit ihm. Und ein bisschen war er auch selbst dran schuld, dass er aus dessen Firma rausgeflogen war. Doch der alte Schott war imstande, ihm eine Inspektion auf den Hals zu schicken, die dann ausgerechnet im unpassenden Moment kam. Dem alten Schott traute er das zu. Dem war er ein Dorn im Auge. Der tat alles, um ihm seine Kunden abspenstig zu machen. Marco überprüfte den Gasbrenner und die Notzündquelle. Alles in Ordnung, alles tipptopp in Schuss. Seine Gedanken schweiften ab von der routinierten Spitzingseefahrt hin zur wesentlich mystischeren Alpenumrundung. Eine solche Eidechsen-Tour hatten schon viele gemacht. Mit dem Motorrad oder mit dem Mountainbike, zu Fuß oder mit dem Auto. Was noch fehlte, war sein Himmelsritt mit der warmen Umluftströmung des Sonnengotts.
Zuerst musste er allerdings einen Sponsor finden. Das konnte er nicht alleine stemmen. Die aufwändigen Vorbereitungen und Ausrüstungen für diesen Rekordversuch überstiegen seine Mittel total. Als gutes Omen war sicherlich der geheimnisvolle Prominente zu deuten, der sich heute Mittag noch zu der übermorgigen Spitzingsee-Fahrt angemeldet hatte. Natürlich nicht er persönlich. Ein geschniegelter Anzugträger hatte in seinem Auftrag vor Marcos Haustür gestanden, er hatte den Namen seines Chefs nicht genannt, hatte nur von einem ganz hohen Tier geredet. Dieses hohe Tier und eine Begleitperson hätten sich spontan dazu entschlossen, eine Ballonfahrt zu unternehmen. Äußerste Diskretion wäre hier gefragt, die Presse durfte keinen Wind davon bekommen. Man würde noch einen Tausender drauflegen. Einen Schweigetausender. Einen Ohne-Papierkram-Tausender. Marco hatte das Geld genommen.
»Aber wenigstens das Gewicht der beiden muss ich wissen.«
»Warum das denn?«
»Damit ich die Fahrt planen und den Gasvorrat berechnen kann.«
Zehn Grüne steckten nun in Marcos Hosentasche. So eine Geldspritze konnte er momentan gut gebrauchen. Er ging wieder zurück ins Haus, zog das Geld heraus und strich mit dem Zeigefinger vorsichtig über die steuerfreien Scheine. Niemand durfte davon etwas mitbekommen. Er zögerte kurz. Konnte es eine Falle von Egon Schott sein? Er rollte das Schmu-Geld zusammen und deponierte es in seinem Spezialversteck, einem ausgehöhlten Stuhlbein, das man abschrauben konnte. Ein Geräusch hinter ihm ließ ihn erschrocken herumfahren. Ein kurzes, dumpfes Brummen, das bedrohlich im Raum stand. Er entspannte sich wieder. Es war nur sein Computer gewesen. Der erste Passagier hatte auf seine Mail geantwortet. Es war die Frau, die im Voraus bezahlt hatte und die 61 Kilo wog.
Hallo Marco,
danke für die Erinnerung. Werde pünktlich an Ort und Stelle sein. Schön, dass es noch geklappt hat, die Fahrt kommt gerade recht für mich. Wenn der Föhn aufzieht, befallen mich immer üble Migräneanfälle, gegen die anscheinend kein Kraut gewachsen ist. Dann aber hat mir jemand den Tipp gegeben, es einmal mit Höhenluft zu probieren. Mit Ballonfahren zum Beispiel. Dreitausend Meter über dem Boden sind ideal!
Ich freue mich auf übermorgen – Margret
Marco grinste. Ballonfahren als Migränetherapie, mal ganz was anderes. Er sollte vielleicht den Gesundheitsaspekt auf seiner Homepage aufnehmen. Wer aber verbarg sich hinter dem geheimnisvollen Unbekannten? Ein Sportler? Ein Politiker? Einer aus der Showbranche? Irgendeine Skandalnudel, die mal einen Tag Ruhe haben wollte? Oder war es gar einer der milliardenschweren arabischen Scheichs, von denen es hier im Alpenraum nur so wimmelte? Der geschniegelte Mann mit dem Maßanzug hatte etwas durchaus Arabisches an sich gehabt. Obwohl er astrein Hochdeutsch gesprochen hatte. Oder war es am Ende gar ein Guinness-Buch-Scout, der sich ein Bild von seinen Fähigkeiten machen wollte? Ein Plomm unterbrach seine Spekulationen. Die zweite Rückmeldung war eingegangen.
Hallo Marco,
bittaschöön! – hier meldet sich der Luftakrobat Ödön, ehemaliges Mitglied des weltberühmten Staatszirkus Budapest! Vom fliegenden Trapez in der Zirkuskuppel zum fahrenden Ballon in der Himmelskuppel – was für ein Aufschwung! Ich werde dort oben große Eingebungen haben. Wünsche uns allen ein schönes windiges Wetter –
Dein Ödön.
Ein verrückter Typ, dieser Ungar. 76 Kilo. Er hatte einen unaussprechlichen Nachnamen, so etwas wie Seekäschfährdeo. Er wollte sich in der frischen Höhenluft zu neuen Zirkusnummern inspirieren lassen. In Marcos Lehrzeit bei Schott waren immer wieder mal Künstler mitgefahren. Einmal hatte ein Maler eine Staffelei im Ballonkorb aufgestellt, um den Föhn in einem Aquarell einzufangen. Alle waren gespannt, wie denn der eingefangene Föhn wohl aussehen würde. Linsig? Drückend? Dann war dem Künstler aber so schlecht geworden, dass er keinen Pinselstrich auf die Leinwand gebracht hatte. Auch der zwölfköpfige Mittenwalder Bergsteigerchor hatte eine Tagestour gebucht, dabei tausendmal La Montanara rauf und runter geschmettert, es war einfach grauenvoll gewesen. Wenn Marco dieses Lied irgendwo hörte, bekam er einen Schreikrampf. Doch jetzt ging es Schlag auf Schlag. Schon wieder ein Plomm auf dem Computer.
Sehr geehrter Herr Zunterer,
wir werden pünktlich da sein.
Katharina und Christian Trockenschlaf
Prima, das Ehepaar (57 und 93 Kilo) hatte ebenfalls bestätigt. Das waren ruhige, sympathische Leute, die ihren fünften Hochzeitstag auf diese Weise feiern wollten. Sie waren die Inhaber der ortsbekannten Baufirma Trockenschlaf Hoch & Tief. Der Ehemann hatte die Reise schon vor Wochen gebucht. Zuerst sah es so aus, als ob die beiden die einzigen Passagiere bleiben würden. Dann kamen doch noch die anderen dazu, und Marco hatte den Eindruck gehabt, dass Christian Trockenschlaf ein bisschen enttäuscht darüber war. Er hätte es vielleicht lieber einsam-romantisch in einem Pärchen-Ballon gehabt. Das nächste Plomm. Der Dünser Karli? Richtig, der Dünser Karli, ein Einheimischer aus dem Kurort. 107 Kilo. Ein uriger Vogel. Saß immer in der Roten Katz beim Frühschoppen, dort hatte er ihn schon früher ein paarmal gesehen.
Servus Marco,
danke für Deine Mail. Was ich noch vergessen habe: Kann ich was mitnehmen?
Servus Karli,
was denn?
Ein kleines Packerl.
Das kommt drauf an. Wie viel wiegt denn das kleine Packerl?
Keine Ahnung. Ein Tragl Bier tät ich gerne dabeihaben. Weil: Die Fahrt ist doch eine Wette mit meinen Spezln vom Stammtisch, also dem Grimm Loisl, dem Hacklberger Balthasar, dem Apotheker Blaschek und dem Pfarrer. Die werden sich wundern! Die wissen es nämlich noch gar nicht. Ich will ein paar Fotos schießen, damit ich die Fahrt nächsten Donnerstag beweisen kann am Stammtisch. Jetzt hab ich aber ein bisserl Knieschwammerl gekriegt. Und deswegen brauche ich den Kasten Bier. Also geht das jetzt?
Und die Knieschwammerl gehen damit weg?
Auf jeden Fall.
Dann fahren wir halt ein Tragl Bier spazieren. Hab ich auch noch nie gemacht.
Viel wird von dem Tragl unten nicht mehr ankommen. Also dann bis übermorgen.
Alle Passagiere hatten sich nun gemeldet. Marco zückte den Kugelschreiber und schrieb eine Liste auf die Rückseite der Pralinenschachtel, die neben dem Computer lag. Das waren ja illustre Teilnehmer diesmal: die Migränefrau. Der Zirkusartist. Das Ehepaar Hoch & Tief. Der Biertraglträger. Er ließ den Stift sinken. Einer der angemeldeten Teilnehmer fehlte doch. Der wird doch nicht – Knieschwammerl bekommen haben? Es war ein Mann namens Klaus Jakobshagen, 82 Kilo, der ebenfalls im Voraus bezahlt, sich aber nicht mehr auf seine Mails gemeldet hatte. Egal. Dafür gab es ja jetzt den Prominenten ohne Namen samt Begleitperson. Vielleicht verbarg sich ja etwas Amouröses dahinter, eine heimliche Liebe, ein verbotenes Verlangen? Oder es waren – der russische und der amerikanische Präsident, die bei ihm mitfuhren, um etwas garantiert abhörsicher zu besprechen. Marco öffnete die Pralinenschachtel.
»Auf Jean-François Pilâtre!«, sagte er ironisch feierlich und hielt eine Cognac-Marzipan-Praline hoch.
Der Franzose Jean-François Pilâtre de Rozier war das erste Todesopfer der Luftfahrtgeschichte gewesen. 1785 wollte er zusammen mit seinem Kollegen Pierre Romain den Ärmelkanal mit einem Heißluftballon überqueren. Wenige Kilometer nach dem Start stürzten beide über dem Badeort Wimereux ab. Bis heute hielten deshalb die Ballonpiloten an dem schönen Brauch fest, vor der Fahrt einen kräftigen Schluck alten französischen Cognacs auf die beiden Pioniere zu trinken. Man zelebrierte dies üblicherweise mit einer edlen Flasche De Luze. Da Marco sparen musste, schluckte er ersatzweise die fette Marzipangranate. Der Zuckerschock breitete sich in seinem Körper aus wie Sprudelsalz in der Badewanne. Er musste sich das wieder abgewöhnen. Vielleicht nur noch diese eine Praline, und dann –
Er hob den Kopf und lauschte. Im Garten war ein Geräusch zu hören. Als er aus dem Fenster blickte, sah er, dass sich jemand an seinem Geräteschuppen zu schaffen machte.
4
Im Vortragsraum des Gefängnisses hatten sich ein paar Dutzend Kursteilnehmer versammelt. Jennerwein erschien pünktlich. Wie ein Beamter eben. Er setzte sich in die letzte Reihe und versuchte, sich noch unauffälliger zu geben, als er es ohnehin schon war.
»Wir haben heute hohen Besuch«, begann Dirschbiegel, nachdem er die kleine Bühne bestiegen hatte. »Einen leibhaftigen Kriminaler.«
Ironische Oho!-Rufe. Gespielt bewundernde Pfiffe.
»Ja, liebe Kollegen, wer weiß: Vielleicht will sich der Herr Hauptkommissar ja ein paar Informationen aus erster Hand holen. Wahrscheinlich hat die Polizei kein Budget mehr für Fortbildungsveranstaltungen. Wir sollten den Hut herumgehen lassen.«
Mitleidiges Uooh!-Gestöhne. Herzhaftes Gelächter. Danny DeVito nahm einen fiktiven Hut ab und ging damit herum. Manche warfen pantomimisch Münzen hinein. Noch mehr Gelächter. Da war er in was hineingeraten! Jennerwein fiel auf, dass sich niemand zu ihm umdrehte. Offensichtlich hielt das keiner für nötig. Jeder hier im Raum wusste wahrscheinlich, wer er war. Ein Häftling deutete mit dem Daumen über die Schulter in seine Richtung.
»Hat der dich denn mal eingelocht, Dirschi?«
»Nein, beruflich hatten wir noch nie miteinander zu tun. Wir sind – wie soll ich sagen – alte Weggefährten.«
Alte Weggefährten, dachte Jennerwein. Von wegen. Ihre beiden Wege verliefen diametral entgegengesetzt. Sie kreuzten sich höchstens ab und zu in Gefängnissen.
Jennerwein kannte einige der Zuhörer. Weniger persönlich, eher von Polizeifotos und Phantomzeichnungen. Vorne ein Drogenhändler. Daneben zwei notorische Insolvenzbetrüger. Dahinter ein Brandstifter. Über den ganzen Zuschauerraum verteilt: Muskelansammlungen mit Hirnfortsätzen. Ein paar dieser Jungs kneteten Tennisbälle, um die Unterarmmuckis in Form zu bringen. Jennerwein wunderte sich noch immer, dass diese Kaliber solche Ehrfurcht vor einem relativ kleinen Trickbetrüger hatten. Jennerwein hatte Dirschbiegel auch schon in anderen Gefängnissen besucht, jedes Mal war ihm aufgefallen, dass der Alte von allen Seiten Achtung und Ehre genoss. Woran lag das? Wie hatte er das geschafft? Jennerwein kannte keinen größeren Blender, Schwadroneur und Dampfplauderer als Dirschbiegel. Gerade zog er flinkfingrig und beiläufig drei Gegenstände aus den Jackentaschen und hielt sie hoch.
»Wem wird wohl diese Mundharmonika gehören? Dieses Taschenradio? Diese Geldbörse? Ja, meine Herrschaften: Wer hat denn da nicht aufgepasst?«
Die meisten der Anwesenden griffen sich unwillkürlich an Brust, Gesäß und Bauch, um sich zu vergewissern, dass ihre Habseligkeiten noch an Ort und Stelle waren. Schließlich gab Dirschbiegel den drei ›Opfern‹ ihre Besitztümer zurück, die sie gutmütig grollend entgegennahmen. Die Mundharmonika gehörte einem zäh wirkenden, schlaksigen Mann mit sauber geschnittenem Haar. Bei dem winzigen Taschenradio meldete sich zunächst niemand. Dann wuchs eine Eiche aus einem der Sitze, hoch hinaus ragte sie in über zwei Meter Höhe, schließlich bewegte sie sich langsam nach vorn zu Dirschbiegel. Jennerwein tippte bei der Eiche auf einen Sportmix aus Boxen, Rugby, Catchen, Gewichtheben, Mühlsteinwerfen und Wärmflaschenaufblasen. Das Taschenradio verschwand in der Hand der Eiche. Die Geldbörse schließlich gehörte dem blassen Jüngling ohne Namen. Applaus brandete auf, Dirschbiegel verbeugte sich bescheiden.
»Diese drei Opfer waren furchtbar leicht zu bestehlen. Ich werde euch heute erklären, wie man es vermeidet, zum Diebstahlsopfer zu werden. Und wie man den Tätern erst gar keine Gelegenheit zu ihren Operationen gibt. Wir schneiden sozusagen zwei Bretter mit einer Säge.«
Jennerwein staunte. Dirschbiegel referierte tatsächlich zur Diebstahlsprävention. Offenbar hatte das für die Sozialprognose etwas gebracht. Aber spielte das für den notorischen Gesetzesbrecher überhaupt eine Rolle? Jennerwein zweifelte daran.
»Weil wir heute solch hochherrschaftlichen Besuch haben«, fuhr Dirschbiegel fort, »will ich ausnahmsweise einmal literarisch beginnen. Hat jemand von euch schon mal was von einem Schriftsteller namens Edgar Allan Poe gehört? Nicht? Nun, das dachte ich mir. Von diesem Poe gibt es eine Geschichte mit dem Titel Der stibitzte Brief. Kennt die zufällig jemand?«
»Lesen ist nicht meins«, sagte ein bulliger Mann in der ersten Reihe. Jennerwein tippte auf 450 Kilo im Reißen und schwere Körperverletzung.
»Deshalb erzähl ich euch das ja. Es geht darum, dass ein wichtiger Brief versteckt werden soll. Ein großes Polizeiaufgebot durchsucht die fragliche Wohnung. Sie durchstöbern jede Ritze, sägen jedes Stuhlbein ab, finden aber nichts. Ein Meisterdetektiv namens Dupin kommt schließlich durch logische Schlussfolgerungen hinter das Geheimnis: Der Täter hat den Brief nicht etwa kompliziert versteckt, ganz im Gegenteil. Der Brief liegt offen in einer Ablage und wird gerade deswegen übersehen.«
Dirschbiegel tänzelte zur Rampe und zitierte mit fein wabernder Kaminfeuerstimme:
»… desto überzeugter wurde ich, dass der Minister, um den Brief zu verbergen, zu dem verständlichen und scharfsinnigen Mittel gegriffen hatte, ihn garnicht zu verbergen.«
Die anwesenden Zuhörer grunzten verständig. Alle hingen an den Lippen des Taschendiebes. Jennerwein schüttelte den Kopf. Warum hatte dieser Mann seine Begabungen so verschwendet? Warum hatte er nichts Vernünftiges aus seinem Leben gemacht?
»Was sagen uns diese Zeilen?«, fuhr Dirschbiegel fort und setzte ein pfiffiges Gesichtchen auf. »Ganz einfach: Die schlechtesten Verstecke sind die, die nach Verstecken aussehen. Tresore, Geldbörsen, Schatzkisten – Wenn ich als Dieb auf so was stoße, dann weiß ich, dass da was zu holen ist. Genauso ist es beim Taschendiebstahl. Wenn ich irgendwo spazieren gehe, in übel beleumundeten Gegenden, wo trage ich meine Geldbörse?«
»Ich trage überhaupt keine Geldbörse«, sagte ein dürrer, windig aussehender Mann mit leiser Stimme. Jennerwein tippte auf Scheckbetrug oder Urkundenfälschung.
»Vielleicht«, fuhr der Windige fort, »habe ich die Scheine in der Hand und wedle ganz offen damit herum?«
»Das natürlich auch wieder nicht«, erwiderte Dirschbiegel gelassen. »Aber das andere trifft es voll: Man verwendet überhaupt keine Geldbörse. Auch keinen Geldgürtel, keine Brieftasche, überhaupt nichts, was nach einem Versteck aussieht. Man verwendet etwas, was jeder auf den ersten Blick wahrnimmt, was vollkommen offensichtlich ist, was aber mit einem Geldversteck nicht in Zusammenhang gebracht wird. Ich darf nun unseren hilfreichen Justizvollzugsbeamten bitten –«
Der junge Mann ging schüchtern, aber bereitwillig auf die Bühne. Ganz wohl fühlte er sich bei diesem Auftritt offensichtlich nicht. Dirschbiegel drehte ihn herum wie ein Modeschöpfer sein Model.
»Wo haben wir beide nun das Geld versteckt? Ich bitte um Wortmeldungen.«
Es gab viele Vorschläge. Man tippte auf die Schuhe, die Schulterpolster, auf die geschlossene Faust, das Brillenetui, das Toupet. Alles wurde von Dirschbiegel verworfen. Zu kompliziert, zu viel Aufwand, zu unpraktisch, zu naheliegend, zu blöd. Niemand wusste die Lösung. In die Stille hinein sagte der zähe Schlaks mit der Mundharmonika: »Nun ja, ich finde, das unbeschriftete Namensschild, das er an der Brust trägt, ist das Auffälligste an diesem Mann. Man kommt jedoch nicht auf den Gedanken, dass das ein Versteck ist.«
»Hervorragend«, sagte Dirschbiegel zungenschnalzend, drehte das arme Versuchskarnickel zu sich her, holte zwei zusammengefaltete Hunderter aus dem Namensschild, faltete sie auf und präsentierte sie stolz.
Gelächter und anerkennender Applaus. Bravo!-Rufe. Der mit dem Gesichtstattoo ergriff das Wort.
»Aber wenn das jetzt alle wissen, alle Taschendiebe, ich meine: das mit dem Schild, dann kann ich das Versteck ja wieder nicht gebrauchen.«
»Da hast du recht, Gonzo. Es gibt kein absolut perfektes Versteck. Am besten ist es, wir lassen alles Geld zu Hause. So geben wir keinem Dieb Gelegenheit, zu klauen. Und das Verbrechen stirbt bald aus.«
Gelächter, erneuter Applaus. Jennerwein war fasziniert. Sollte er Dirschbiegel bitten, solch einen Kurs im Polizeipräsidium, bei den Kollegen der Abteilung Eigentumsdelikte zu geben? Tipps von einem Insider? Um Gottes willen, auf was für abwegige Gedanken kam er da nur!
»Noch Fragen?«
Nein, keine Fragen mehr. Die Versammlung löste sich auf. Jennerwein fand es erstaunlich, wie viele der Fleischberge sich bei Dirschbiegel artig für den aufschlussreichen Kurs bedankten. Der mit dem Gesichtstattoo, den sie Gonzo nannten, klopfte ihm wortlos auf die Schulter. Und wieder konnte Jennerwein nicht erkennen, ob die Brille echt oder tätowiert war. Der dürre, windig aussehende Mann mit der leisen Stimme, den Jennerwein für einen Scheckbetrüger oder Urkundenfälscher gehalten hatte, blieb vor dem Kommissar stehen und gab ihm die Hand.
»Gestatten, Dr. Rohrbach«, wisperte er. »Ich bin der Gefängnispsychologe.«
Sein Handschlag war der eines toten Fisches.
»Ein ausgezeichnetes Referat«, sagte der Psychologe zu Dirschbiegel.
»Danke«, knurrte der zurück. Er schien nicht eben begeistert von dem dürren Mann zu sein.
»Ich würde Sie heute noch ganz gern sprechen.«
»Dazu habe ich keine Zeit. Ich muss noch packen. Ich checke morgen aus, wie Sie wissen.«
»Es ist Ihnen sicher nicht entgangen, dass ich Ihnen eine schlechte Abschlussbeurteilung gegeben habe. Darüber wollte ich –«
»Wissen Sie, was: Ihre Beurteilung ist mir so was von egal. Die können Sie sich –«
Dirschbiegel drehte sich um und ließ den Psychologen mit dem schlaffen Händedruck einfach stehen. Er machte sich auf den Weg zurück zu seiner Zelle. Der Justizvollzugsbeamte und der Kommissar begleiteten ihn dabei. Niemand verlor ein Wort über den Vorfall.
Greifen und Begreifen – wo das Herz aller Eltern höher schlägt
Beobachten Sie, wie sich die Fingerfertigkeit Ihres Babys in den ersten paar Monaten entwickelt – es ist ein wahres Schauspiel der Natur!
Schon das Neugeborene schließt seine Hand fest um den elterlichen Daumen. »Dieser Affengriff ist für die Eltern süß und putzig«, sagt Kinderarzt Dr. Stefan Stubenrauch vom Münchner Paul-Heyse-Krankenhaus. »Er ist jedoch lediglich ein angeborener Reflex, der durch die Berührung der Handinnenfläche ausgelöst wird.«
Doch bevor Ihr Baby willentlich etwas festhalten und zu sich ziehen kann, muss es sich erst mit den Fähigkeiten seiner Finger vertraut machen: Es steckt sie in den Mund und saugt daran. Es hält eine Hand vor sein Gesicht und betrachtet, wie sich seine Greifwerkzeuge bewegen. Ab dem vierten Monat ist es bereits in der Lage, kleine Dinge kurz festzuhalten. »Und im siebten, achten Monat kommt der Quantensprung«, sagt Dr. Stubenrauch. »Es ist der Beginn des gezielten Greifens nach Dingen in seiner Umgebung mit dem sogenannten ›Scherengriff‹ – das ist das Festhalten eines Gegenstands zwischen Daumen und Zeigefinger.«
Die eigentliche Errungenschaft des Menschen, die ihn von jeder anderen Spezies unterscheidet, können Sie bei Ihrem Baby gegen Ende des ersten Lebensjahres beobachten. Das Kind beherrscht nun den in der Natur einzigartigen ›Pinzettengriff‹: Es kann kleinste Gegenstände zwischen den Fingerbeeren von Daumen und Zeigefinger fassen und aufnehmen, selbst kleinste Krümel und Fussel. »Am Anfang der menschlichen Entwicklung steht also das Wegnehmen und Aneignen fremder Sachen«, sagt Kinderarzt Dr. Stubenrauch schmunzelnd.
(Quelle: Die Windel, Heft 14)
5
Mehrstimmiges Gelächter hallte durch den sonst so stillen Gefängnisgang. Jennerwein musterte Dirschbiegel von der Seite. Irgendetwas an ihm war anders als sonst, das spürte er. Doch er zögerte, nachzufragen. Sie hatten ein stillschweigendes Übereinkommen, und das schon seit langem. Wenn sie sich trafen (und sie trafen sich immer nur in den Haftanstalten, nie draußen), dann versuchten sie das naheliegende Thema zu vermeiden. Das gelang auch meist, man klammerte alles, was mit Verurteilung, Strafe, Gefängnis, Besserung, Reue, Sühne, Gesetz, Schuld und ähnlichen staatstragenden Dingen zusammenhing, einfach aus. Doch es gelang natürlich nicht immer, denn Jennerwein war voll und ganz Polizist, Dirschbiegel wiederum voll und ganz Dieb. Jennerwein wusste, dass es keinen Zweck hatte, mit ihm über Therapien, Resozialisierung und ethische Normen zu reden. Dirschbiegel konnte gar nicht anders, als wieder mit seinem Gewerbe anzufangen, wenn er entlassen wurde.
»Weißt du, von wem das Graffito an der Gefängnishofwand stammt?«, fragte Jennerwein.
Dirschbiegel schien dankbar dafür zu sein, dass Jennerwein kein Wort über den Zusammenstoß mit dem Psychologen vorhin verlor.
»Das ist von Diego, einem jungen Typen aus einem anderen Block. Hat Einzelhaft. Aufgeweckter Bursche.«
Jennerwein fragte nicht weiter nach der Vorgeschichte von Diego. Er kannte die Etikette. Er wusste, dass es im Knast nicht üblich war, nach dem Delikt zu fragen.
Dirschbiegel blieb plötzlich stehen.
»Das wird meine letzte Nacht in einem Gefängnis sein«, sagte er leise und für seine Verhältnisse überraschend ernst.
Jennerwein blieb ebenfalls stehen und sah ihn erstaunt an.
»Ja, ich höre auf«, fuhr Dirschbiegel fort. »Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen.«
Jennerwein schüttelte ungläubig den Kopf.
»Gibt es einen bestimmten Grund dafür?«, fragte er vorsichtig. Er musste an Maria Schmalfuß denken, wenn sie ihre Psychologenstimme auf butterweich-verständnisvoll stellte. »Ich meine: nach all den Jahren?«
»Die Zeiten haben sich verändert«, seufzte der Häftling. »Diebstahl ist nicht mehr das, was es einmal war. Was mich am meisten nervt, ist dieser ganze digitale Kram, gegen den man sich nicht mehr wehren kann. Handwerkliche Fertigkeiten sind immer weniger gefragt. Ohne EDV-Kenntnisse kommst du heutzutage kaum noch in eine Wohnung rein. Beim Taschendiebstahl, ja, da ist noch einiges zu holen. Aber selbst da gibt es Leute, die mit GPS, Bewegungsmelder und elektronischem Schnickschnack arbeiten. Früher hat man ein Objekt sauber ausbaldowert, heute gibt es Google Earth.«
Dirschbiegel machte eine Pause, Jennerwein blickte ihn prüfend an.
»Ich habe mir den Grund für meine – Pensionierung ganz anders vorgestellt«, fuhr Dirschbiegel fort. »Viel romantischer. Ich hätte eine alte Diebesweisheit beherzigt: Hör auf, wenn du deinen Meister gefunden hast. Beende dein Handwerk, wenn einer auftaucht, der besser ist als du. Gratuliere ihm und mach ihm deinen Platz frei. So aber –« Dirschbiegel verzog wehmütig das Gesicht. »Ich bin immer noch die anerkannte Koryphäe im Taschendiebstahl. Sieh mal her, was mir meine Kumpels geschenkt haben –«
Dirschbiegel knöpfte die Jacke auf. Auf seinem T-Shirt stand:
BURGLAR KING
»Toll«, sagte Jennerwein mit wenig Begeisterung. »Aber warum erzählst du mir das alles?«
»Ich möchte, dass du mich ab jetzt in Ruhe lässt, Kommissar. Nichts für ungut, aber deine Fürsorge nervt mich. Du brauchst deine polizeilichen Superfähigkeiten nicht zu verschwenden, um herauszufinden, wo ich gerade einsitze. Du brauchst dich überhaupt nicht mehr um mich zu kümmern. Ich bin nicht mehr im Geschäft.«
Jennerwein konnte das alles nicht so recht glauben. Es musste noch einen anderen Grund für den plötzlichen Stimmungsumschwung geben. Als wenn er seine Gedankengänge erraten hätte, sagte Dirschbiegel:
»Und dann der ausgemergelte Psycho-Heini, den du grade kennengelernt hast. Der war der Hund, der die Schafherde zum Rennen gebracht hat. Er hat meine Abschlussbeurteilung geschrieben. Man muss sich das einmal vorstellen: Der wollte mich als notorischen Kleptomanen abstempeln.«
Jennerwein schwieg dazu. Er wusste, dass Dirschbiegel nicht um alles in der Welt als Kleptomane bezeichnet werden wollte. Er reagierte allergisch auf diesen Begriff, warum auch immer. Dirschbiegel schnappte nach Luft.
»Ich wäre nicht mehr sozialisierbar, hat er gesagt. Er hat mir sogar mit der Klapse gedroht.«
»So leicht kommt man auch wieder nicht in die Psychiatrie«, hielt Jennerwein beschwichtigend dagegen.
»Ich habe mein ganzes Leben lang gewusst, was ich tue«, fuhr Dirschbiegel ungerührt fort. »Ein Kleptomane hingegen ist wie ein Junkie, der gar nicht anders kann. Ich sage dir, wer ein Kleptomane ist!«
Jennerwein kannte das schon. Jetzt kam sicher wieder so eine Geschichte. Und sie kam. Dirschbiegel sah sich um. Nur der Rotfleckige stand in einiger Entfernung und blickte gelangweilt in die andere Richtung.