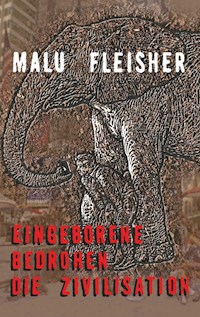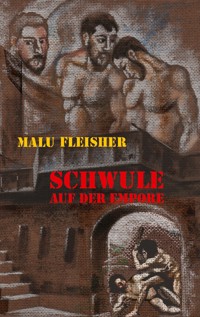
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beim Besuch des elterlichen Grabes in seinem Herkunftsland wird Jovis auf eine Gruppe Schwuler aufmerksam, die sich auf der Empore in der seit Längerem verriegelten Kirche treffen. Sie setzen sich an den gemeinsamen Abenden mit dem Verhältnis von Kirche und Homosexualität auseinander. Eigentlich ist es unerklärlich, dass sich eine Religion, die den Armen hilft und die Schwachen stützt, nicht auch für gleichgeschlechtlich Liebende einsetzt. Die Gruppe findet in einem der Evangelien sogar eine Stelle, die den liebenden Jünger vor den anderen deutlich hervorhebt. Muss man schwul sein, um das zu verstehen? Warum verschließen anders Veranlagte die Augen davor? Im Laufe seiner Begegnungen mit der homosexuellen Gruppe fragt sich Jovis, ob er womöglich diese Neigung auch in sich trägt, ohne davon zu wissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zu diesem Buch
Beim Besuch des elterlichen Grabes in seinem Herkunftsland wird Jovis auf eine Gruppe Schwuler aufmerksam, die sich auf der Empore in der seit Längerem verriegelten Kirche treffen. Sie setzen sich an den gemeinsamen Abenden mit dem Verhältnis von Kirche und Homosexualität auseinander. Eigentlich ist es unerklärlich, dass sich eine Religion, die den Armen hilft und die Schwachen stützt, nicht auch für gleichgeschlechtlich Liebende einsetzt. Die Gruppe findet in einem der Evangelien sogar eine Stelle, die den liebenden Jünger vor den anderen deutlich hervorhebt. Muss man schwul sein, um das zu verstehen? Warum verschließen anders Veranlagte die Augen davor? Im Laufe seiner Begegnungen mit der homosexuellen Gruppe fragt sich Jovis, ob er womöglich diese Neigung auch in sich trägt, ohne davon zu wissen.
Zur Autorin
Malu Fleisher ist das alter Ego von Aro Stocker. 1955 in der Schweiz, im Luzernerland, geboren, kam er mit dreißig nach Stuttgart. Dort lernte er nicht nur seine Frau kennen, mit der er zwei Kinder hat, sondern wurde über die Träume auch mit seiner weiblichen Seite, Malu Fleisher, bekannt. Später zog er mit der Familie auf die Schwäbische Alb. Die nächtlichen Erlebnisse ließen ihn seine Homosexualität entdecken. Heute lebt er mit seinem Partner in Reutlingen. Dem Trend der Zeit folgend, besteht Aro Stockers weibliche Seite darauf, als Autorin genannt zu werden.
Inhalt
Im Obergeschoss der Kirche
Der Einzige, von dem ich wusste
Der liegen gebliebene Zettel
Das erste Treffen
Für und wider die Konfession
Ein Schlüssel zur Gnade
Die Bombe im Boden
Den er liebte
Gib uns unsere Freude
Den Fröschen auf dem Weg nach oben helfen
Madonnenbilder und Phallusse
Die weibliche Seite des Mannes
Vera – das Weiblich-Göttliche
Diskoabend in Sauersee
Das letzte Treffen
Sankt Petersburg statt Basler Rheinknie
Im Obergeschoss der Kirche
Im März – das müsste jetzt drei Jahre her sein – machte ich einen Abstecher zum Heimdorfer Friedhof, um das Grab meiner Eltern zu besuchen. Für meine Eltern hatten die Kirche und der Besuch der Gräber immer einen wichtigen Platz im Leben eingenommen. Der Friedhof wurde heute noch genutzt, aber die Kirche war seit Längerem geschlossen. Ich spritzte etwas Wasser aus der Hohlform des Steins auf die grüne Bodenbedeckung und die Zwergpinie und dachte an die Zeit, die ich als Kind hier in der Kirche verbracht hatte. Es waren schöne Erinnerungen, man hatte mich nicht zum Kirchgang zwingen müssen. Später, als Jugendlicher, wurde es schwieriger. Schule und Kirche, Wissen und Glauben, sie sind wie Schnee und Feuer, sie wollen nicht zueinanderpassen. Während meine Bildung durch die Schule kontinuierlich zunahm, wurde mein Glaube immer brüchiger. Aber ein Glimmen blieb doch irgendwo in mir. Dieses hielt die Erinnerung an die Wärme wach, die ich in der Kindheit durch den Glauben erfahren hatte.
Seither hatte sich einiges geändert. Wegen Priestermangels waren die verbliebenen Gläubigen an größere Orte in der Umgebung verwiesen worden. Der Grabstein meiner Eltern aber stand unverrückt da. Er bestand aus zwei flachen Granitstelen, einer schmaleren linken und einer breiteren rechten, die sich nach oben ein wenig verjüngten und außen gerundet waren. In die rechte Stele waren untereinander die Namen meiner Eltern eingraviert, mit Geburts- und Sterbedatum. Durch die Rundung oben entstand der Eindruck, als würden sich die beiden, durch einen gleichmäßigen Spalt getrennten Stelen einander zuneigen. Diese Empfindung wurde noch verstärkt durch eine Spirale, die in die glatten Steinflächen oberhalb der Namen eingraviert war und sich über die beiden Stelen hinwegzog. Ich fragte mich, ob wohl etwas unternommen worden war gegen die Auflösung der Kirchengemeinde oder ob man sich klaglos damit abgefunden hatte. Ich wusste es nicht. Für die Verwandten, die noch hier lebten, war das kein Thema. Sie gehörten zu den fortschrittlichen Menschen, für die die Kirche etwas von früher war. Mit Religion wurden nicht nur Sinnesfeindlichkeit und Rückständigkeit, sondern auch Armut und Kriege verbunden. In weiterem Sinn gehörte für sie auch der Friedhof dazu, weswegen sie das Grab meiner Eltern hatten auflösen lassen. Eben noch rechtzeitig hatte ich davon erfahren und den Auftrag zur Abräumung annulliert. Ich habe die Nutzungsrechte für das Grab auf meinen Namen, Jovis Ambacher, verlängern lassen und eine Gärtnerei mit der Pflege beauftragt. Mit einer gewissen Befriedigung stand ich nun davor, so wie ich mit meinen Eltern am Grab meiner Großeltern gestanden hatte. Diese Kontinuität war mir wichtig. Ich schaute mich um. Es war noch früh im Jahr, aber ringsum begann sich schon die Natur zu regen. Krokusse auf den Gräbern, Weidenkätzchen im Gebüsch kündeten vom Frühling.
Auf dem Weg vom Grab zurück zum Auto sah ich, dass das geschnitzte Portal zur Kirche offen stand. Wohl um zu lüften, dachte ich und wollte schnell einen Blick hineinwerfen. Der Zugang zum Kirchenschiff aber war durch eine Bretterwand verbaut. Einzig die Stufen hinauf zur Empore waren begehbar. Ich hörte oben ein Hämmern und Klopfen. Wie konnte jemand auf der Empore arbeiten, wenn das Kirchenschiff verriegelt war? Darauf konnte ich mir keinen Reim machen. Neugierig stieg ich die Stufen hoch, öffnete die Türe und betrat eine fast leere Empore. Zwei Handwerker waren damit beschäftigt, die Orgel abzubauen. Beide in ockerfarbenen Handwerkerhosen. Der Nähere kräftig und untersetzt, der hintere, am Orgelrahmen beschäftigt, eher schlaksig. Die Holzpfeifen waren als Quader unterschiedlicher Länge in Pyramidenform aufgestapelt und die metallenen Pfeifen lagen in offenen Kisten mit Lappen umwickelt. Der Nähere der beiden sah mich unter dichten Augenbrauen gesprächsfreudig an.
„Soll die Kirche abgebrochen werden?“, fragte ich.
„Behüte“, rief er, „die Empore geht einer neuen Nutzung entgegen. Dem muss die Orgel weichen.“
„Aber Platz gäbe es unten doch genug“, wandte ich ein, „warum ist der Raum unten verbaut?“
„Tut mir leid, da muss ich passen. Uns hat man mit dem Umzug der Orgel beauftragt. Genaueres haben wir nicht erfahren. Am besten, Sie wenden sich an Herrn Wagner. Er hat das Projekt initiiert. Es heißt: ‚Schule in Kirche‘.“
„Schule in Kirche?, seltsam, noch nie gehört.“
Ja, finde er auch, sagte er und wandte sich wieder seiner Arbeit zu. Sie schienen die Orgel an diesem Tag wegräumen zu müssen. Ich wollte sie nicht behindern, grüßte und ging die Holzstufen wieder hinab. Schule in Kirche, wie ungewöhnlich, ging mir auf dem Weg zum Auto durch den Kopf.
Der Parkplatz der Kirche war auch der der Schule. Da kam mir die Idee, dort nachzufragen. Die neue Schule war auf der Kirchmatt, angrenzend an die Kirchenscheune gebaut. Ich hatte noch die alte Schule auf der anderen Straßenseite besucht. Links war der Schulund Gemeindesaal, rechts das Sekretariat. Es brannte noch Licht. Ich klingelte an der Tür und wurde hereingerufen. Die etwa vierzigjährige Frau musste eine von den Arndts sein. In Heimdorf kannte ich die Alteingesessenen dem Schlag nach. Sie erkundigte sich freundlich nach meinem Anliegen. Als ich jedoch das Stichwort Schule in Kirche aussprach, versteinerte sich ihr Gesicht.
„Hat mit der Schule nichts zu tun“, sagte sie knapp.
„Aber Herr Wagner ist doch Lehrer hier.“
„War hier Lehrer“, entgegnete sie gedehnt und ihre Mimik verriet, dass sie über dieses Thema kein weiteres Wort verlieren wollte.
Ich bedrängte sie nicht weiter, grüßte und zog die Tür hinter mir zu.
Mir war nun klar, das Verhältnis von Herrn Wagner und seiner ehemaligen Schule befand sich in Schieflage.
Normalerweise verbrachte ich die Rückfahrt vom Heimatkanton nach Echazstadt im Nachbarland in entspannter Leere oder beschäftigte mich mit Aufgaben, die mich zu Hause erwarteten. Doch dieses Mal drehten sich meine Gedanken um den Heimatort und die Initiative, die dort im Kirchgebäude geplant wurde.
Schule in Kirche – für mich klang dieser Ausdruck, als wollte jemand Wissen und Glauben zusammenbringen. Diese beiden Fähigkeiten des Menschen waren offenbar nicht so unvereinbar, wie ich im Laufe meines Lebens gelernt hatte. Seitdem die Kirche geschlossen war, wirkte sie wie ein Mahnmal aus einer vergangenen Zeit. Noch ein paar Hundert Jahre und ihr Bestehen würde so rätselhaft erscheinen wie das einer Pyramide, deren Bedeutung uns verloren gegangen ist. Durch das Erschließen der Empore schien mir dieser massige Körper plötzlich wieder zum Leben zu erwachen, zu einem Teilleben im Oberstübchen nur, aber damit vielleicht gerade an der richtigen Stelle.
Etwas bedrückt war ich damals schon gewesen, als ich erfahren hatte, die Kirche in Heimdorf sei geschlossen worden. Eine seltsame Vorstellung, wenn man als Kind jeden Sonntag ein gefülltes Gotteshaus erlebt hatte. Aber ich gehe heute ja selbst auch nur noch selten hin. Warum sollten es andere Menschen also unterschiedlich handhaben. Wenn ich beim Grab meiner Eltern im Kirchhof der Heimatgemeinde war, bedauerte ich, dass die Kirche nicht offen stand. Ich hätte gerne einen Blick hineingeworfen und sei es nur, um im Winter für einen Moment vor dem kalten Wind geschützt zu sein an diesem erhöhten, luftigen Platz. Oder um im Sommer eine Zeit lang der sengenden Sonne zu entkommen, bevor ich ins heiße Auto zurückkehrte. Plötzlich gab dieses wuchtige Gebilde wieder Lebenszeichen von sich. Allerdings in ganz anderer Weise, als ich erwartet hätte.
Zwischendurch ließ ich meinen Blick in die Landschaft gleiten, soweit dies am Steuer möglich war. Die Schlehenbüsche zierten mit ihrem Weiß die Hecken und die Waldränder. Dahinter standen die Bäume noch dunkel, aber nach ein paar warmen Tagen würden auch sie austreiben, in hellem Frühlingsgrün.
Ich war dem Heimatort und dem Heimatkanton schrittweise entwachsen. In der Reußstadt hatte ich eine Buchhändlerlehre absolviert. An diesem Beruf hatte ich jedoch nicht sonderlich Gefallen gefunden. Mit Artikeln für die Reußstädter Zeitung gewann ich einen Einblick in die journalistische Arbeit. Abendgymnasium und Studium folgten. Daran anschließend Praktika in verschiedenen Verlagen. Diese führten mich ganz selbstverständlich ins größere Nachbarland. Ich hätte den Unterschied wohl gar nicht bemerkt, hätte mein Vater nicht geklagt, ich ließe die Heimat im Stich. Sein Radius war eben ein kleinerer. Beruflich war es für mich deutlich einfacher im Nachbarland. Meiner Eltern und der alten Freunde wegen hielt ich an Aufträgen im Heimatkanton fest. So hatte ich Anlass, in regelmäßigen Abständen hinzufahren. Meine damalige Partnerin hielt nicht viel von meiner Heimatverbundenheit. Für sie stand meine frühere Welt in Konkurrenz zu unserer gemeinsamen Zeit. Sogar in den stichhaltigsten Aufträgen witterte sie einen Vorwand, um mein ungebundenes Leben fortführen zu können. Wir haben uns schließlich getrennt. Seither habe ich mich nicht wieder in eine feste Beziehung gewagt. Ich denke schon, dass das Beziehungsleben wichtig ist. Erzwingen sollte man eine Partnerschaft aber nicht. Denn sie kann leicht zum Gefängnis werden.
Selbst als ich die Autobahn verlassen hatte und in der Abenddämmerung durch die Neckarlandschaft auf die Stadt am Fuß des Albtraufs zufuhr, beschäftigte mich noch immer die veränderte Situation in der Dorfkirche. Ich musste versuchen, mit dem Lehrer Wagner ein Treffen zu vereinbaren. Als Initiator von Schule in Kirche würde er gewiss gerne Auskunft geben über dieses Projekt. Doch es kam anders.
Der Einzige, von dem ich wusste …
An einem heißen Junitag machte ich wieder mal einen Abstecher nach Heimdorf. Es war ein schwüler Tag und ich hätte diesen Umweg wohl eher nicht auf mich genommen, wäre ich nicht neugierig gewesen, was aus der Empore geworden war. Da ich am Mittag, nach dem Gespräch mit einem Auftraggeber, nur ein Sandwich gegessen hatte, wollte ich mich vor der Rückfahrt stärken. Ich parkte deshalb nicht wie üblich bei der Schule auf der Kirchmatt, sondern bei der Gaststätte Swisscom an der Hauptstraße unten, um nach dem Friedhofsbesuch etwas Kleines zu essen und zu trinken. Der steile Kirchrain trieb mir noch mehr Schweißtropfen auf die Stirn.
Auf dem Friedhof war es weniger heiß, die Sonne hatte sich schon so weit geneigt, dass die Strahlen von den Bäumen, die den Kirchhof westlich begrenzten, abgeschirmt wurden. Ich meinte sogar einen lindernden Luftzug zu spüren, als ich vor dem Grab meiner Eltern stand. Um den Ritus des Weihwasserspritzens vollziehen zu können, musste ich zum großen Steintrog an der Kirchmauer gehen und von da mit einer Gießkanne etwas geweihtes Wasser holen. Bei diesen Temperaturen würde es in der kleinen Hohlform des direkt am Grab befindlichen Steinquaders wohl längst verdunstet sein. Vom Grab ging ich zum Kirchportal. Doch ich fand die Tür verschlossen. Der Umweg war umsonst gewesen, ich war enttäuscht. Links neben der Tür hing ein hölzerner Kasten an der einfassenden Mauer, mit schräger Bedachung über seiner Glasfront. In diesem Mitteilungskasten wurden früher die Messen, die Taufen und die Begräbnisse angekündigt. Hier stieß ich auf ein Informationsblatt ‚Schule in Kirche‘, Treffen jeweils dienstags um 20 Uhr. Kontakt Louise Wagner-Wildermut und Yoann Wagner, eine Nummer stand auch dabei. ,Interessierte dürfen gerne dazustoßen‘. Ich tippte die Namen und die Nummer in mein Handy. Am westlichen Eingang zur Kirche war die Hitze noch nicht verflogen. Sie strahlte im Gegenteil von den dicken Mauern ab. Ich trat einige Schritte vom Gebäude weg. Etwas enttäuscht war ich schon, denn ich hätte mir gerne angeschaut, wie die Empore jetzt aussah. Kurz überlegte ich, ob ich die Wagners anrufen sollte, um zu erfahren, ob sie in der Nähe sind. Aber das schien mir dann doch zu viel verlangt. Ich kam ja als Teilnehmer nicht infrage, war nur neugierig. Bei meinem nächsten Besuch in einem Vierteljahr würde ich vorher anrufen, dann ließ sich vielleicht eine Besichtigung arrangieren.
Die wenigen Stühle draußen an den kleinen Tischen vor dem Swisscom waren alle besetzt. Die Gäste schauten den seltenen Passanten hinterher. Trotzdem blieb ich einen Moment stehen und betrachtete das Wirtshausschild mit dem kugeligen Fisch. Früher hing dort das Bild einer Postkutsche. Als die Gaststätte Post in Swisscom umbenannt wurde, hatte man das alte Schild nicht mehr für zeitgemäß gehalten. Ein Freund, der seine Wohnung in einem alten Bauernhaus und in der dazugehörigen Scheune seine Werkstatt hatte, war beauftragt worden, ein neues Schild zu erschaffen. Mich erinnerte das an die Zeit, da ich gelegentlich noch hierherkam, um die alte Clique zu treffen. Im Sommer zu Ferienbeginn sahen wir uns in der Zehntscheuer wieder, dem Jugendtreff. Nach durchfeierter Nacht tranken wir morgens unseren Kaffee im Swisscom. In jenem Sommer, an den ich zurückdachte, hing bereits die neue Fassung des Schildes über dem Eingang, aber der Fisch fehlte noch. Er befand sich in der Werkstatt des Freundes, um ein weiteres Mal lackiert zu werden.
Auf der Rückseite des Restaurants waren die Tische fürs Essen gedeckt, rechter Hand drei davon besetzt. Zwei ältere Männer saßen beim Schoppen, eine Gruppe junger Kerle beim Bier und ganz außen wohl eine Mutter mit erwachsener Tochter und deren Kind im Wagen. Man blickte zu mir hinüber, ich grüßte nickend, setzte mich aber ganz links, da es in der Mitte nur große Tische gab. Als die Kellnerin kam, bat ich um einen Salat, eine Portion Ravioli mit Ziegenkäsefüllung an weißer Sauce und eine Rivella. Ich hatte soeben mein Getränk bekommen, als sich ein etwas untersetzter Mann den Gartentischen näherte und sich suchend umsah. Er schien unschlüssig, ob er sich setzen sollte. Erst sah er prüfend zu den anderen Gästen hinüber, dann schaute er in meine Richtung, überlegte vielleicht, ob er auch etwas essen mochte. Ich bemerkte, dass er mich fixierte. Von den jungen Leuten drüben wurde er als Ferdi begrüßt. Da fiel bei mir der Groschen. Ich stand auf und ging auf ihn zu. Jetzt wusste auch er, wer ich war, und wir begrüßten uns händeschüttelnd. Ich bat Ferdi alias Ferdinand an meinen Tisch. Er folgte munter. In den vielen Jahren, in denen ich ihn nicht gesehen hatte, hatte er etwas zugelegt, vor allem am Bauch, und seine Gesichtszüge waren fülliger geworden. Aber er war noch immer gut zu erkennen. Seine Haare waren dunkler, als ich sie in Erinnerung hatte, also waren sie wohl gefärbt. Doch sein etwas kantiger Kopf, die starke Biegung der Brauen und sein flaches, breites Gesicht waren mir noch vertraut. Er schien mir immer wie einer Zirkuswelt entsprungen. Dort hätte er sich nicht zum Athleten geeignet, wohl aber zum Aufund Abbauen des Zeltes und zur Versorgung der Tiere. Ferdi bestellte ein Bier.
Ich erzählte ihm, was mich herführte. Sprach vom Grab, das ich zuweilen besuche. Ich fragte nach seinem Job. Es war immer noch derselbe wie früher. Zwischendurch hatte Ferdi aufgrund einer Mehlstauballergie pausieren müssen. Er hatte zwar eine Umschulung besucht, die ihn aber nicht weiterbrachte. Nun setzte er die alte Arbeit fort, trug eine Maske, solange das Mehl trocken war, eigentlich nur eine kurze Zeit. Da ich nur selten mit einem Bäcker ins Gespräch kam, hatte er mir viele Fragen zu beantworten. Inzwischen war mein Salat und schließlich auch die Pasta gekommen. Ich fragte Ferdi nach der Teigbearbeitung früher und heute und aß genüsslich, während er mir Auskunft gab.
„Warst du eigentlich noch Lehrling oder schon Geselle, während wir zusammen im Verein waren?“ Ferdi war etwas älter als ich. In der Schule hatten wir uns nur aus den Augenwinkeln wahrgenommen. In der Lehrzeit war ich auf Drängen meines ausbildenden Buchhändlers zu dessen Taucherverein mitgegangen. Das war ganz spannend, aber mir fehlte der Ehrgeiz, wie übrigens auch in diesem ersten Beruf. Der Ausbilder gab mir seine alte Ausrüstung, in der Hoffnung, dass ich durch das Tauchen mehr in Schwung käme. In diesem Verein war auch Ferdinand Mitglied. Er war schon etwas länger als ich dabei. Da er bei dem Gerangel, wer ist der Schnellste, wer taucht am tiefsten, nicht mitmachte, war er mir sympathisch. Aufgrund unserer Haltung bildeten wir oft das Schlusslicht, etwa beim Schwimmen im Fluss bis zur Picknickstelle. Oder wir schauten einfach nur zu, wenn es galt, Abfälle bei einer Brücke oder am Kai aus dem Wasser zu bergen. Dass Ferdi aus einem ganz bestimmten Grund zu den Tauchern gegangen war und für ihn das Warten und Zuschauen nicht nur Müßiggang bedeuteten, fiel mir damals nicht auf. Ferdis Neigung war mir so fern, dass ich sie selbst dann nicht begriff, als ein Spötter einmal rief, die Schwulen bilden den Schluss. Ein Wort, auf das ich allergisch reagierte, war Lahmarsch. Schwul dagegen – auch wenn mir das niemand glaubt – fiel bei mir durchs Sieb. Erst später erfuhr ich, Ferdi sei schwul. Wahrscheinlich im Zusammenhang damit, dass man ihn nie mit einer Freundin sah.
„Ich war bereits Geselle“, antwortete er mir auf meine Frage. Vorher hätte er sich den Neoprenanzug nicht leisten können. Ferdinand bestellte sich noch ein Alkoholfreies. Zwischendurch schaute er zu den jungen Kerlen hinüber.
„Auf welchen hast du’s denn abgesehen?“, fragte ich ihn neckend in gedämpftem Ton. Er machte eine wegwerfende Geste.
„Die Frage ist nicht dein Ernst, Jovis! Junges Gemüse!“
Mir ging wieder die Initiative auf der Empore durch den Kopf. Sicher das Letzte, womit sich Ferdi beschäftigte. Trotzdem machte ich eine Bemerkung, dass ich den Abbau der Orgel beobachtet und von einer neuen Nutzung des oberen Raumes gehört hätte. Die Sonne hatte sich inzwischen so weit geneigt, dass sie unter der Markise hindurchschien. Ich war geblendet und konnte seine Mimik nicht prüfen. Er nickte jedoch und sagte mit großer Selbstverständlichkeit:
„Klar, ich war am Donnerstagabend mal dabei …“
„Du meinst am Dienstagabend.“
„Nein, am Donnerstag. Das Treffen der Schwulen findet donnerstags statt.“ Das sagte er mit gedämpfter Stimme.
„Der Schwulen?“ Ich war so überrascht, dass ich das Wort laut aussprach. Die Gäste drüben hatten es aufgeschnappt und starrten zu mir hinüber. Ferdi blickte nicht hin und ich wandte meinen Blick auch nicht weiter in ihre Richtung. Jeder, der in dieser Gaststätte regelmäßig verkehrte, wusste, dass Ferdi zu dieser Fraktion gehörte. Das war heutigentags kein Tabu mehr und auch keine Gefahr. Trotzdem wurde nicht laut übers Schwulsein gesprochen, außer in Schwulenwitzen. Ich sah Ferdi fragend an.
Er flüsterte mehr, als dass er sprach. „Als Untergruppe von Schule in Kirche hat sich Schwule auf der Empore gebildet, die treffen sich jeweils am Donnerstagabend.“
„Und du bist dabei?“
Er wiegte den Kopf, nur einmal habe er vorbeigeschaut. Mit der Hand winkte er der Kellnerin zu, die gerade auf die Terrasse trat. Ferdi bezahlte seine zwei Bier und entschuldigte sich, er müsse den Sauerteig ansetzen. In einer Stunde könne er eine Pause machen.
„Wenn du’s nicht eilig hast, komm vorbei, dann gehen wir ein paar Schritte.“
Ich überlegte kurz. Eigentlich wollte ich fahren, um nicht zu spät nach Hause zu kommen. Was wir aber angeschnitten hatten, interessierte mich sehr. Schule in Kirche auf einer Empore, das war schon etwas ganz Ungewöhnliches, aber Schwule an eben diesem Ort, das konnte ich nicht recht fassen. Also nickte ich und fragte, wo ich ihn treffen könne. Wir verabredeten uns vor der Bäckerei im Ortskern, die Backstube befand sich im Gebäude dahinter. Ferdi ging eilends davon.
Ich bestellte eine zweite Rivella. Der Wunsch, nach Hause zu fahren, war erst einmal passé. Schwule und Kirche, das war eine seltene Verbindung. Eine Kirche war aus meiner Sicht nicht gerade der Ort, wo Schwule sich trafen. Sie suchten sich eher ein schickes Café oder Klubräume. Noch nie hatte ich von einem Schwulentreffen in einem Gotteshaus gehört. Es gab Vereinigungen schwuler Christen, aber das waren überregionale Organisationen mit Bildungsangeboten und kirchenpolitischen Zielen. Mochte sein, dass gelegentlich ein schwuler Chor in einer Kirche sang, aber üben würden sie dort wohl eher nicht. Das Erstaunlichste aber war, dass dieses Treffen in Heimdorf stattfinden sollte. Ich kannte keine weiteren Schwulen hier. Ferdi war der Einzige in meiner Heimatgemeinde, von dem ich wusste, dass er schwul war. Gut, ich wohnte schon einige Zeit nicht mehr hier, länger bereits, als ich hier gelebt hatte. Die Zeiten hatten sich seither deutlich zum Besseren gewendet. Aber noch immer war es so, dass das Wort schwul aufhorchen ließ, wenn es außerhalb eines Witzes laut ausgesprochen wurde – wie sich gerade gezeigt hatte. Ganz unvorstellbar war für mich die Verbindung mit der Kirche, die an diesem Ort ja die italienisch-konfessionelle war beziehungsweise gewesen war. Ich konnte Ferdi noch immer nicht glauben. Doch warum sollte er mir etwas vormachen? Das war noch unwahrscheinlicher.
Zwei von den jungen Kerlen drüben kamen mir bekannt vor, nachdem ich immer mal wieder einen Blick zu ihnen geworfen hatte. Ich ging, nachdem ich bezahlt hatte, an ihren Tisch und fokussierte einen der beiden.
„Wie geht’s Toni?“, fragte ich. Er war sichtlich verlegen. Was soll ein junger Kerl sagen, wenn er auf seinen Vater angesprochen wird.
Er wählte einen Joke und sagte: „Der hat’s im Kreuz und meint, wir Jungen sollten mehr schaffen.“
„Gute Gelegenheit für dich zu zeigen, wo’s langgeht“, sagte ich ebenfalls im Spaß.
„Er muss erst seinen Meister machen“, rief einer dazwischen.
Und ein anderer: „Danach setzt er sich ins Büro und lässt die anderen für sich rackern.“
„Sag ihm einen Gruß“, bat ich und verabschiedete mich. Er fragte nicht, von wem. Eine weitere Bestätigung, dass sie mich einzuordnen wussten.
Ich war eine halbe Stunde zu früh, als ich auf einem der Kundenparkplätze der Bäckerei meinen Wagen anhielt. Das Ortszentrum auf und ab bummelnd, ließ ich den Blick über die stattlichen Fassaden des Fleckens gleiten. Er hatte sich einst als Anhängsel eines Stifts herausgebildet. Auf den ersten Blick hatte sich nichts verändert, seit ich hier das Gymnasium besucht hatte. Im Detail erwies sich aber doch einiges als anders. Manche Läden schienen noch dieselben, aber bestimmt hatten die Besitzer gewechselt. Ebenso bei den Gaststätten, wie viele Pächter mochten in dieser Zeit ihr Glück versucht haben? Der auffallendste Wechsel waren die Schnellimbisse. Das hatte es früher nicht gegeben. Die Bäckerei war ein Familienbetrieb geblieben und damit eine Ausnahme.
Ferdinand erschien mit weißem Fleck auf seiner dunklen Hose, wo die Schürze nicht hingereicht hatte. Er bemerkte meinen Blick und wischte mit der Linken den Mehlstaub ab. Er wandte sich in die Querstraße, vom Zentrum weg. Wir gelangten in die Gerberstraße, die schmucklose, etwas schmuddelig wirkende Parallelstraße zum protzigen Zentrum. Während wir sie hinaufschlenderten, lenkte ich das Gespräch zurück zur Gruppe auf der Empore.
„Es gibt also parallel zu dieser Initiative Schule in Kirche eine Gruppe Schwule auf der Empore und die treffen sich donnerstagabends?“, versicherte ich mich.
„Genau, die haben sich etwa ein Vierteljahr später gebildet. Yoann und Aleks kennen sich.“
„Yoann Wagner ist der Initiator von Schule in Kirche, wer ist Aleks?“
„Ein Schwuler, der in Semperach wohnt. Er hat mit ein paar anderen zusammen Schwule auf der Empore gegründet.“
„Aber von Heimdorf ist sonst niemand dabei, oder?“ Wir hatten die Metzgerei erreicht. Ich wollte hinunter nach links abbiegen. Aber Ferdinand wies geradeaus.
„Da hinunter kommt man nur bis zur Sägerei.“ Also gingen wir die Gerberstraße weiter aufwärts. Oben führte sie uns in die Willestraße.
„Doch, Isedor“, gab Ferdi zur Antwort.
„Welcher Isedor?“, fragte ich.
„Der mit uns im Tauchverein war.“
Ich musste eine Weile überlegen, bis mir einfiel, wen er meinte.
„Der kleine, fixe?“
„So klein ist der nicht. Er war damals nur der Jüngste.“
Ich erinnerte mich. Isedor war das pure Gegenteil von uns beiden gewesen. Der Kleinste, aber der Schnellste von allen. Ich hatte deshalb eine Abneigung gegen ihn empfunden und ihn gemieden. Doch im Grunde war er ein netter Kerl.
„Der hat doch Modellschreiner in der Gießerei gelernt. Ist er noch immer dort?“
„Oh nein, er hat schon lange umgesattelt. Er ist bei der Kreditbank.“
„Und Isedor ist bei Schwule auf der Empore?“, fragte ich noch einmal. Nichts an ihm damals brachte ich mit schwul in Verbindung.
Wir wandten uns nach links in die Willestraße und wenig später wieder nach links auf den Weg zur Badanstalt. Er führte an der Wienaa entlang. Der Bach führte bei diesem heißen Wetter nur wenig Wasser, trotzdem mussten wir etwas lauter reden, weil die künstlichen Stufen im kanalisierten Bachbett das Wasser rauschen ließen.
Isedor, Aleks und ein gewisser Kovin seien die Leitenden, obwohl es kein Verein sei und jeder mitmischen dürfe und solle.
„Du warst erst einmal dabei?“, versicherte ich mich.
Für ihn sei es schwierig mit der Uhrzeit. Und es sei auch nicht gerade sein Thema. Mit Kirche habe er noch nie etwas am Hut gehabt.
Der Weg war jetzt beidseitig von Büschen gesäumt. Wir mussten ausweichen, weil Jugendliche auf Fahrrädern und Motorrollern zur Badanstalt oder von dort zurück nach Hause fuhren.