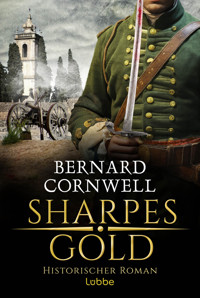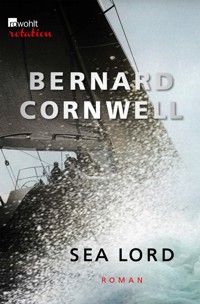
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Segel-Thriller
- Sprache: Deutsch
Niemals wieder wollte John Rossendale, Earl of Stowey, nach Hause zurückkehren. Als seine Mutter im Sterben liegt, überwindet er sich: Er lenkt seine Segelyacht «Sunflower» gen Devon – zum ersten Mal seit vier Jahren. Dort entbrennt der Streit ums Erbe. Erneut wird John vorgeworfen, vor vier Jahren den einzigen Familienbesitz geklaut zu haben: einen millionenschweren van Gogh. Als er knapp einem Mordanschlag entkommt, macht er sich gemeinsam mit der Kuratorin Jennifer Pallavicini daran, das Gemälde aufzuspüren und den wahren Dieb zu stellen. Doch als Jennifer bei einer Gasexplosion auf seinem Schiff schwer verletzt wird, übernimmt etwas anderes das Ruder: der Wunsch nach Rache … Ein neues Segelabenteuer aus der Feder des großen Bestsellerautors Bernard Cornwell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Bernard Cornwell
Sea Lord
Roman
Über dieses Buch
Niemals wieder wollte John Rossendale, Earl of Stowey, nach Hause zurückkehren. Als seine Mutter im Sterben liegt, überwindet er sich: Er lenkt seine Segelyacht «Sunflower» gen Devon – zum ersten Mal seit vier Jahren. Dort entbrennt der Streit ums Erbe. Erneut wird John vorgeworfen, vor vier Jahren den einzigen Familienbesitz geklaut zu haben: einen millionenschweren van Gogh. Als er knapp einem Mordanschlag entkommt, macht er sich gemeinsam mit der Kuratorin Jennifer Pallavicini daran, das Gemälde aufzuspüren und den wahren Dieb zu stellen. Doch als Jennifer bei einer Gasexplosion auf seinem Schiff schwer verletzt wird, übernimmt etwas anderes das Ruder: der Wunsch nach Rache …
Ein neues Segelabenteuer aus der Feder des großen Bestsellerautors Bernard Cornwell.
Vita
Bernard Cornwell, geboren 1944, machte nach dem Studium Karriere bei der BBC. Nach Übersiedlung in die USA entschloss er sich, einem langgehegten Wunsch nachzugehen: dem Schreiben. Im englischen Sprachraum gilt er als unangefochtener König des historischen Abenteuerromans. Bernard Cornwells Werke wurden in über 20 Sprachen übersetzt, die Gesamtauflage liegt bei mehr als 20 Millionen Exemplaren.
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der gedruckten Ausgabe, die 1991 unter dem Titel «Der Lord muss sterben» im Paul List Verlag erschien.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Die Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel «Sea Lord» im Verlag Michael Joseph in der Penguin Group, London.
«Sea Lord» Copyright © 1989 by Rifleman Productions Ltd.
«Der Lord muss sterben» Copyright © 1991 by Paul List Verlag in der Südwest Verlag GmbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung shutterstock.com
ISBN 978-3-644-40265-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Sea Lord ist Diedree und Oscar Morong gewidmet, den Skippern des braven Schiffes Diedree Anne.
Die Übersetzerin dankt H.A. Gernhardt von der DHH Chiemsee-Yachtschule für die seemännische Beratung.
Erster Teil
Ich hatte nicht heimkehren wollen. Ich hatte mir geschworen, nie wieder heimzukehren, und doch quälte ich mich jetzt in einer scheußlichen Nacht mit der Flut über die Western Approaches.
In den vergangenen sieben Jahren war ich nur einmal zu Hause gewesen. Diese Rückkehr war eine familiäre Pflicht gewesen und hatte sich dann als familiäre Katastrophe herausgestellt. Ich hatte das alles so lange wie nur möglich ertragen und war dann, überwältigt von meiner Verantwortung und ausgeplündert von Anwälten, davongesegelt. Damals hatte ich mir geschworen, nie mehr nach England zurückzukehren.
Und jetzt, vier Jahre später, kehrte ich heim.
Wieder war es die Pflicht, die mich zurückrief, Familienpflicht.
Heimweh war es mit Sicherheit nicht, denn in sieben Jahren des Herumzigeunerns auf den Weltmeeren hatte ich England keine Sekunde lang vermisst. Ich versuchte mich davon zu überzeugen, dass es Neugierde war, die mich nach Norden in die kalten Gewässer des Kanals zog, aber Neugierde bedarf der Provokation von Zuneigung oder Hass – und für meine Familie empfand ich weder das eine noch das andere. Und trotzdem – wenn die Nachricht zutraf, dann wollte meine Familie, dass ich heimkam. Also kehrte ich pflichtschuldig, vielleicht auch schuldbewusst, heim.
Die Nachricht hatte mich in English Harbour auf Antigua erreicht. Sie kam von den Anwälten meiner Familie, die sie bei meiner Londoner Bank hinterlegt hatten. In der Hoffnung, dass mich ein paar Dividenden aus den roten Zahlen geholt hätten, hatte ich die Bank kontaktiert. Doch anstelle von Geld übermittelte sie mir die Nachricht, dass meine Mutter krank sei und mich sehen wolle. Es war das erste Mal in vier Jahren, dass meine Mutter meine Existenz zur Kenntnis nahm oder – um gerecht zu sein –, dass ich mich an sie erinnerte. Ich wollte dem Ruf nicht folgen, aber die Nachricht hatte einen so pathetischen Beiklang, dass ich den Anker lichtete und den Bug der Sunflower nach Osten richtete.
Ich beeilte mich nicht mit der Heimkehr. Tatsächlich schien es so, als segelte die Sunflower eher zögerlich über den Atlantik. Aber das konnte auch meine Einbildung sein. In den Rossbreiten gerieten wir eine Woche lang in eine Flaute, und danach zeigte sie eine Schlagseite, die ich an ihr noch nie erlebt hatte. Zum ersten Mal in seinem Leben ließ sich mein Boot schwierig segeln, und ich fragte mich, ob diese neuartige sture Widerspenstigkeit ein Spiegelbild meines eigenen Zauderns war, nach England zu gelangen. Irgendwie schafften wir es bis zu den Azoren, doch dann, eine Woche nach dem Auslaufen aus Horta, entwickelte sich ein unangenehmer Zahnschmerz hinten rechts im Oberkiefer, und ich wurde zu der Annahme verleitet, dass diese Schmerzen wie auch die Schlagseite der Sunflower ein stummer Protest gegen meine Überfahrt waren. Die Zahnschmerzen verstärkten sich, während ich lange Zeit nordwärts kreuzen musste, bis mich der Westwind energisch auf den Englischen Kanal zutrieb. Ich segelte allein.
Nur die Sunflower und ich. Die Sunflower war ein Segelkutter mit einem Knickspant-Stahlrumpf französischer Bauart, 38 Fuß lang, der in einer ruhigen See rollte und in einer unruhigen stampfte und gierte. Sie war in diesem Frühjahr zwanzig Jahre alt, und das sah man ihr an. Das Großsegel einer modernen Jacht verfügt über etwa so viel Tuch wie ein Bikinihöschen, aber die Sunflower besitzt ein anständiges Großsegel mit allem Drum und Dran, ein bauschendes Ungetüm von Segel. Sie hat auch einen anständigen Mast, einen ordentlichen Baum, der einem den Schädel zertrümmern kann, statt einer dieser Hightech-Albernheiten. Sie verfügt nicht über diese modischen Verfeinerungen wie ein Patentreff für das Großsegel oder eine Rollfock. Stattdessen hat die Sunflower altmodische Reffleinen, die per Hand festgebunden werden müssen. In einer kalten, nassen Nacht kann das ein mörderischer Job sein, aber immer noch besser, sich die Finger roh und blutig zu scheuern, als ein Großsegel zu haben, das sich verklemmt und dadurch in einer stürmischen Bö ein Querschlagen verursachen kann. Ihre Vorsegel müssen in ihren steifen Säcken auf das Vordeck gezerrt, sorgfältig angeschlagen und dann vorgeheißt werden. Sie war nie ein schnelles Boot gewesen, nicht zu vergleichen mit den federleichten, glanzrumpfigen Rennziegen, die heutzutage alle Ozeanrekorde einheimsen, aber die Sunflower würde notfalls zur Hölle und zurück segeln. Und das ist es schließlich, was ein anständiger Seemann von seiner Jacht verlangt.
Jedenfalls war es das, was ich verlangte, denn die Sunflower war mein Zuhause. Wir beide hatten jede Menge Seemeilen zurückgelegt. Wir haben die südlichen Ozeane durchsegelt, das Horn umrundet, den Agulhas-Strom bewältigt, den afrikanischen Urwald geschnuppert und vor Koralleninseln geankert. Und nun, aufgrund einer Nachricht der Anwälte meiner Familie, durchpflügten wir die Wellen der Western Approaches, eine kabbelige, graue, unfreundliche See, die an die kantige Form des Rumpfes peitschte, Gischt zu beißenden, eiskalten Schrapnells zerfetzte, die über das Schanzkleid der Sunflower fegten, um mich im Cockpit zu überschütten.
Es war Nacht, und der Wind nahm zu. Es war Englands Heimkehrwind, ein Südwest, aber es lag nichts Willkommenheißendes in seiner bösartigen, kalten Gewalt. Zur Dämmerung hatte der Wind Stärke drei oder vier gehabt, gegen Mitternacht war er fünf und zunehmend, gegen drei Uhr morgens reffte ich das Großsegel, und jetzt, eine Stunde vor Sonnenaufgang, musste die Sunflower mit Stärke sieben fertig werden. Ich hatte das Großsegel geborgen und segelte nur mit der Fock. Das klingt nach Vorsicht, aber ich hatte die Segel nicht aus Sorge eingeholt, sondern weil ich hundemüde war. Zu schlafen wagte ich nicht, weil wir uns in der Nähe von Schifffahrtswegen befanden und man angesichts der Riesentanker, die achtlos durch die Dunkelheit preschen, kein Risiko eingeht. Einen dieser Tanker hatte ich kurz nach Mitternacht zu Gesicht bekommen, oder besser gesagt, ich hatte den großen Klotz seiner Brücke mit den dunstigen Lichtern bemerkt, seinen Rumpf jedoch nicht gesehen, da der Sturm die Wellenkronen zu einem grauen Nebel zerfetzte, der über der See stob und tanzte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Sunflower und ich über die Schaumkronen gerast, waren nur Lichtpünktchen in der Dunkelheit gewesen, und ich hatte gewusst, dass der Tanker keine Ahnung von unserer Anwesenheit hatte. Eine halbe Meile südlich von uns hatte er passiert, mit Richtung Biskaya.
Sein Anblick hatte mich wieder wachsam gemacht, aber diese Aufmerksamkeit hielt nicht lange vor. Trotz der grässlichen Schmerzen in meinem Zahn döste ich vor mich hin. Ich hockte auf der Backbordseite des Cockpits, hatte ein Knie über die Ruderpinne der Sunflower gehängt und lehnte den Kopf gegen die Reling. Das Schlagen der See gegen den Rumpf war hypnotisch. Ich schlief für wenige Augenblicke ein, um dann hochzuschrecken und in plötzlicher, unbegreiflicher Unruhe auf den Kompass zu starren. Ein-, zweimal rieb ich mir die Augen, um besser sehen zu können, bekam aber nur trockenes, ätzendes Salz in die Augen. Der Schmerz in meinem Zahn war eine einzige puckernde Qual, doch selbst er reichte nicht aus, mich wach zu halten. Ich wusste jedoch, dass ich wach bleiben musste. Dann und wann stand ich auf, ließ mir Gischt ins Gesicht peitschen und hoffte, dass mich das wach hielt. Aber kaum hatte ich mich wieder gesetzt, überfiel mich nahezu unverzüglich der Schlaf. Ich war mitten in einem Fast-Sturm, in einer kabbeligen See, in einem Boot, das auf und ab tanzte wie ein wildgewordenes Schaukelpferd und segelte den gefährlichsten Seeweg der Welt mit Zahnschmerzen und brennenden Augen, und alles, was ich tun konnte, war zu schlafen. Und zu halluzinieren.
Ich war an die Halluzinationen der Erschöpfung während des Nachtsegelns gewöhnt, und doch schaffte es diese Vertrautheit nicht, mich von der Irrealität zu überzeugen. Die Halluzinationen sind Halbträume einer unheimlichen Wirklichkeit. In dieser Nacht sah ich den Schimmer eines Leuchtturms, der mich nach Hause geleitete, und später eine Küstenlinie. Wäre es bei diesen Halluzinationen um phantastische Dinge gegangen, sagen wir um Frauen und warmes Essen, dann hätte sie mein Verstand als Hirngespinste abgetan. Aber diese nächtlichen Visionen handelten von Sachen, die ich am dringendsten zu sehen wünschte – die Anzeichen eines sicheren Landfalls –, und so «erblickte» ich eine sanfte Küste im Zwielicht mit Kirchtürmen, Bäumen und Klippen. Und diese Küste verfügte sogar über halbverwischte Leuchtfeuer, die den rechten Weg wiesen. Ein Teil meines Verstandes wusste, dass ich einer ausgeklügelten Illusion erlag, aber dennoch gab ich mich ihr hin. Nur wenn irgendetwas den Rhythmus der Sunflower unterbrach, wandte sich der Geist träge von der angenehmen Phantasie ab und akzeptierte, dass wir in Wirklichkeit durch eine bewegte See bretterten – in einem Fast-Sturm und ohne jedes Leuchtfeuer, das uns sicher hätte nach Hause führen können. Das waren die Momente des Wachseins.
Schließlich gab ich den Kampf gegen den Schlaf auf. Irgendwie arrangierten sich meine nassen Kleidungsstücke so, dass ich die Illusion von Behaglichkeit hatte. Dabei bedeutete jede Bewegung, dass kalte, feuchte Kleidung auf eine wundgescheuerte Haut traf. Also verhielt ich mich so reglos wie möglich und träumte, während die Sunflower den Kanal hinauf dorthin flog, wo die großen Schiffe ihre Bahnen zogen und die dunklen Felsen warteten.
Und immer noch wusste ich nicht, warum ich heimkehrte oder was mich in England erwartete.
Vier Jahre zuvor war ich aus England geflüchtet. Ich war nach Hause zurückgekehrt, weil mein Bruder gestorben und ich das neue Oberhaupt der Familie geworden war. Sie hatte darauf vertraut, dass ich ihre Probleme löste, aber stattdessen kaufte ich die Sunflower, stattete sie mit Proviant aus und segelte aufs Meer hinaus. Ich hatte mich in dem gleichen Südwestwind um Ushant herumgequält und dann gespürt, dass sich eine unendliche Freiheit vor meinem Bug ausbreitete. Ich war gegangen, ich war sicher, und ich war frei. Die ungewollte Verantwortung und die ätzenden Beschuldigungen meiner Familie blieben achtern zurück wie Anker, deren Leinen durchschnitten worden waren.
Ich habe diesen Abschied nie bereut. Ich hatte ferne Strände betreten, war in fremde Nächte gesegelt und hatte mich mit Menschen angefreundet, die nichts von meiner Vergangenheit wussten. Für sie war ich lediglich John Rossendale, Skipper vor dem Herrn des guten Schiffes Sunflower, ein willkommener Mechaniker, Zimmermann, Schweißer und Takler. Ich war anonym. Ich war frei.
Und nun kehrte ich heim. Allein.
Ich bin nicht immer allein gesegelt. Als ich England zum ersten Mal verließ, vor sieben Jahren, war Charlie Barratt mit mir gesegelt. Wir haben drei gute Jahre miteinander in südlichen Gewässern verbracht. Und dann, als meine Familie meine Rückkehr gefordert hatte, war Charlie mit mir gekommen. Wir waren in Australien gewesen, als die Nachricht vom Tod meines Bruders eintraf, und wir sahen uns gezwungen, unser Boot zu verkaufen, um das Geld für die Flugtickets zusammenzubekommen. Wir versprachen einander, uns in England eine neue Jacht zu kaufen, aber Charlie heiratete, und das war das Ende seiner Träume von fernen blauen Meeren. Ich schlug mich, solange ich konnte, mit dem Vermächtnis meines Bruders herum; dann, in schierer Verzweiflung, kaufte ich die Sunflower und stach allein in See. Ich bin nicht allzu lange allein geblieben. In Belize kam eine junge Deutsche an Bord und blieb bis zu den Marquesas, wo sie die Sunflower verließ, um sich einer zweifelhaften Kommune anzuschließen, die sich einen riesigen Katamaran teilte, dessen Skipper ein übellauniger Pole war. Ich hörte, dass der Katamaran vor den Trobriands auseinanderbrach, dass alle an Bord ertranken, aber die Seewege sind voll von derlei Gerüchten, also ist das deutsche Mädchen vielleicht noch am Leben. Auf den Solomons lernte ich eine Australierin kennen, die ein ganzes Jahr bei mir blieb, doch dann fand sie heraus, wer ich war, und wollte mich heiraten. Als ich standhaft und entschlossen ablehnte, wechselte sie in Kalifornien das Schiff. Es hat noch andere gegeben. Die Meere sind voll von Anhaltern, die sich auf betagten Jachten von einer Küste zur anderen kämpfen und glauben, dass ihre Freiheit von der Bürokratie ewig dauert. Manche dieser Anhalter ertrinken, manche werden ermordet, manche verschwinden, viele von ihnen werden Huren und wenige, sehr wenige, kehren nach Hause zurück.
Jetzt kehrte ich nach Hause zurück, aber ich wollte das nicht. Ich halluzinierte, ich schlief, und ich träumte von fernen südlichen Meeren.
In der Morgendämmerung wurde ich abrupt geweckt. Es war nicht das barbarische graue Licht, das mich wach machte, auch nicht meine Zahnschmerzen. Es war die Tatsache, dass der Wind unvermittelt auf Süd gedreht hatte und die Sunflower darauf reagierte.
Es konnte nur wenige Sekunden gedauert haben, das Zwinkern eines Traumes, nicht mehr, aber die Ruderpinne war dem Griff meines Knies entglitten, und die Sunflower brach aus. Einen Moment lang raste sie die zischende Krone einer Woge entlang, doch als die Welle brach, kippte das Boot nach Steuerbord. Wasser ergoss sich wie der Niagara über das Schanzkleid an Backbord. Für zwei Sekunden stand ich verdutzt auf der Ruderbank, dann wurde ich nach vorn in den Malstrom aufgischtenden Wassers geschleudert. Gerade als mein Kopf ins Wasser tauchte, sah ich die Mastspitze ins Wasser krängen. Dann zappelte ich in plötzlicher Panik, bis mich die Sicherheitsleine schnell und heftig zurückriss. Die Welle kochte und brodelte noch immer um mich herum, brach hoch über den Rumpf der Sunflower hinweg, der flach auf der See lag. Einen Augenblick lang packte mich Verzweiflung, doch dann setzten die physikalischen Gesetze ein, und der tiefe, schwere Kiel fing an, die Sunflower wieder in eine aufrechte Lage zu ziehen. Mich würde kein physikalisches Gesetz retten. Ich musste mein wasserschweres Gewicht auf die hohe Bordwand hieven und irgendwie wieder ins Boot klettern. Doch dann warf mich eine gnädig gestimmte Gegenströmung gegen eine Relingsstütze. Ich verspürte einen scharfen Schlag gegen meine Rippen, klammerte mich jedoch an die Reling, während sich das Boot aufrichtete; anfangs nur träge, fast zögernd, doch dann riss sie sich aus dem Griff der See, und ich kam mit ihr hoch, um mich dann recht unsanft über die Reling in das überschwemmte Cockpit zu hieven.
Das war der Weckruf des Meeres. Guten Morgen und herzlich willkommen im Kanal. Ich kroch in das wassergefüllte Cockpit und rang nach Atem. Der Schmerz in meinen Rippen machte mir zu schaffen, aber es war nicht der rechte Zeitpunkt für die Frage, ob da vielleicht etwas gebrochen war. Die Fock peitschte hin und her, und eine neue hohe Welle griff das Boot an. Ich stemmte die Ruderpinne hart nach Backbord und holte dann die Fock ein. Die Sunflower drehte ihr Achterschiff träge den Wellen zu. Noch immer strömte Wasser über Vordeck und Kajütdach, sprudelte grün und grau in die weiß aufgischtende, wogende See zurück.
Die Abflüsse leerten das Cockpit. Ich bezweifelte, dass Wasser ins Innere des Bootes gelangt war. Der Kajütaufbau der Sunflower ist aus zweieinhalb Zentimeter dickem Teak, und wie die Niedergangsluke halte ich sie bei miesem Wetter geschlossen. Ich hatte Glück gehabt. Der K.o. war meine eigene Schuld gewesen, aber dank der Sicherheitsleine war ich noch am Leben. Besorgt befühlte ich meine Rippen, aber trotz des stechenden Schmerzes schien nichts gebrochen zu sein.
Ich war bis auf die Haut durchnässt, aber die Sunflower bewegte sich wieder durch die aufgewühlte See. Ich zurrte die Ruderpinne fest und zog mich zitternd und bibbernd aus. Es war zwar Frühling, aber die Luft über dem Kanal war noch immer frisch und die See kalt wie ein offenes Grab. Ich öffnete den Niedergang, wartete, bis die Sunflower von einer emsigen See übernommen worden war, kletterte mühsam über das Steckschott und ließ mich in die Kajüte hinunter.
Es waren nur noch wenige trockene Kleidungsstücke übrig, aber ich fand zwei Paar Jeans, ein Paar Socken und drei Pullover. Ich zog sie alle an. Sie fühlten sich zwar warm an, aber ich wusste, sie steckten voller Salzkristalle. Und die würden, wenn sie auch nur mit der geringsten Feuchtigkeit in Berührung kamen, die Nässe anziehen und mich wieder erschauern und frösteln lassen. Ich rieb mir die Haare mit einem moderigen Handtuch halbwegs trocken, dann zwängte ich mich in die Kombüse und holte die Thermosflasche aus ihrer Halterung. Ich goss mir einen Becher Tee ein. Obwohl die Sunflower stampfte und rollte, verschüttete ich keinen Tropfen der kostbaren heißen Flüssigkeit. In derart kleinen Dingen bringt es Erfahrung zur Perfektion. In der Zeit, die ich brauchte, um den Tee zu trinken, hätte mich ein Tanker in einen Haufen Schrott verwandeln können, aber ich brauchte unbedingt etwas Warmes, und ich sehnte mich nach einer Pfeife trockenen Tabaks.
Nachdem ich diese Grundbedürfnisse befriedigt hatte, ging ich zurück ins Cockpit und kramte mein Ölzeug aus der nassen Masse auf der Gräting. Angesichts dessen, dass das Wasser im Ölzeug meine trockenen Sachen durchnässen würde, verzog ich angewidert das Gesicht, aber mir blieb keine Wahl. Ich zog mich an, schlüpfte in triefende Stiefel und setzte dann das Großsegel mit drei Reffs. Der Sunflower gefiel das zusätzliche Tuch, und ihre Fahrt wurde stetiger. Wir waren auf dem richtigen Kurs, und mein Boot durchsegelte den verfluchten Sturm wie einen Traum. Jetzt war ich hellwach, meine Halluzinationen waren mit der Morgendämmerung verschwunden, und ich kehrte heim.
Aber warum und wozu, das wusste ich nicht.
Ich hätte in Falmouth oder einem der anderen Häfen von Cornwall Zuflucht suchen sollen, aber ich hatte plötzlich etwas dagegen, meine feuchte Kleidung gegen einen Landfall einzutauschen. Der Wind, er kam noch immer von Süden, frischte zur Sturmesstärke auf und peitschte die Wellenkämme zu beißenden weißen Nebeln hoch, die die graue See undeutlich machten. Die Wogen donnerten aus Südwest heran, wurden jedoch vom Wind geschnitten, der ihre Täler ins Strudeln brachte. Der Sunflower machte das nichts aus. Sie war ein zähes Luder und hatte weit Schlimmeres überstanden. Sie verfügte über einen Stahlrumpf, und im Laufe der Jahre hatte ich den Umfang ihrer Wanten und Stage verdoppelt. Einmal war sie am Rand eines Taifuns entlanggesegelt, aber alles, was dabei zu Bruch ging, war ein bisschen Geschirr in der Kombüse. Und jetzt segelte sie an einem trüben neuen Tag kanalaufwärts. Das Tageslicht war grau, dunstig von Gischt und kalt. Ich ließ die Sunflower langsamer laufen, denn ich wollte vermeiden, dass eine achterliche Sturzsee sie von hinten traf, aber wenn sie auch rollte und stampfte, so war sie doch in keiner Gefahr. Alles, was sie jetzt umbringen konnte, war ein größeres Schiff oder meine Sorglosigkeit.
Mein erster Anblick der Heimat war ein kurzes Auftauchen des Leuchtturms Eddystone. Das war, als ich auf Salcombe zuhielt. Vermutlich hatte ich immer gewusst, dass ich nach Salcombe segeln würde, weil Charlie dort gewohnt hatte. Charlie und ich waren miteinander aufgewachsen, hatten gemeinsam unseren ersten Mädchen nachgestellt, hatten uns gemeinsam betrunken, waren miteinander festgenommen worden und hatten dann zusammen fremde Meere besegelt. Was auch immer mich in England erwarten mochte: Charlie war dort, und allein schon seine Freundschaft war die Heimkehr wert. Also hielt ich im kräftigen Morgenwind auf Charlies Heimathafen zu: Salcombe.
Auf einer Seekarte sieht es so aus, als wäre Salcombe einer der geschütztesten Häfen an der englischen Südküste. Und das trifft auch zu, wenn man sich in seinem dichten Netz von Flusstälern befindet. Viele Jachten hatten in Salcombe schon die Stürme auf dem Kanal abgewartet, und selbst dem miesesten Teufel fiele es schwer, die inneren Seen zu kräuseln, doch bei einem auflandigen Wind gegen eine ablaufende Ebbe ist die Einfahrt nach Salcombe eine tödliche Falle. Salcombe bedeutet Sicherheit, aber diese Sicherheit in einem Südsturm erreichen zu wollen ist eine selbstmörderische Torheit. In der Hafeneinfahrt liegt eine Sandbank wie eine versteckte Barrikade. Die windgepeitschten Wellen schlagen wegen des plötzlichen Hindernisses auf dem Grund um und verursachen ein kochendes Chaos von Brechern, die gischtend zusammenschlagen und die fast noch steiler und gefährlicher werden, wenn sie auf ablaufenden Flutstrom treffen. Nur ein Narr entscheidet sich bei einem Südsturm für Salcombe. Dartmouth liegt nur wenig entfernt in östlicher Richtung und kann bei jedem Wetter angelaufen werden. Und Plymouth, das fast noch sicherer ist als Dartmouth, ist nicht allzu weit weg im Westen. Torbay, der klassische Zufluchtsort bei einem Sturm aus Süd oder West, liegt eine leichte Segelstrecke kanalaufwärts, aber ich entschied mich für Salcombe.
Vielleicht dachte ich, dass es mir die Sandbank in der Flussmündung schon sagen würde, wenn mir die Heimkehr nicht bestimmt war. Ich würde den Teufel herausfordern, und wenn ich verlor, würden die Sunflower und ich auf der Sandbank sterben – quergeschlagen, überflutet und auseinandergebrochen im Anblick der Heimat. Diese Gedanken waren der törichte Mut der Übermüdung, zusätzlich verschlimmert durch eine fatale Mischung aus Selbstmitleid und Überheblichkeit. Das Selbstmitleid kam aus meinem Zögern, meine Familie wiederzusehen, die Überheblichkeit aus meiner Entschlossenheit, mein seemännisches Können unter Beweis zu stellen, wenn ich nach Hause kam.
Der Großbaum arbeitete hart auf der Backbordseite, als wir auf Bolt Head zuliefen. Jetzt schnitten wir die Wellen, glitten diagonal über die nach Osten gehende Strömung. In einem Augenblick waren wir auf dem Kamm der Welle, flogen triumphierend dahin, um danach tief und tiefer in die nasse Dunkelheit zu tauchen und achtern bereits die nächste Woge drohen zu sehen, deren Krone vom Wind gepeitscht wurde. Das glasige dunkle Herz des Todes traf backbords auf die Sunflower, sodass wir – gerade als ich dachte, sie würde nie wieder hochkommen – auf die nächste Wellenkrone gehoben wurden, von wo aus ich nach einem Zipfelchen Land Ausschau hielt. Die Müdigkeit war wie weggeblasen. Es machte mir überhaupt nichts mehr aus, dass ich nass war und fror. Jetzt hielt mich das Abenteuer in seinem Bann, eine stürmische See mit all ihren Wagnissen zu besiegen.
Doch im Grunde war die sturmgepeitschte See gar nicht unser Feind. Unser Feind war die steile Erhebung der Sandbank, die schweigend und verborgen vor der Hafeneinfahrt von Salcombe wartete. Charlie und ich hatten einmal miterlebt, wie eine Jacht auf der Sandbank von Salcombe in ein Wellental stürzte. Das Boot war wieder hochgekommen, aber im Tal war sein Kiel hart auf den Meeresboden geprallt, und diese Wucht hatte jeden Spant im Rumpf zerschmettert und auch den Schädel des Mannes, der am Kartentisch gesessen hatte. Sogar ein Rettungsboot war auf der Sandbank von Salcombe verloren gegangen, und Rettungsboote lassen die Sunflower im Vergleich ausgesprochen zierlich wirken. Ungezählte Witwen verfluchen die Sandbank von Salcombe, aber wir rauschten nun auf sie zu – getrieben von einem Sturm und dem schieren Wahnsinn.
Am frühen Nachmittag gab es einen Moment, an dem ich mir klarmachte, ich könnte nach Osten abdrehen und es immer noch nach Prawle Point schaffen, um sicher nach Dartmouth zu gelangen. Eine Sekunde lang war ich unschlüssig, hörte auf die Vernunft, doch dann gewann die Versuchung wieder Oberhand, den Teufel so richtig in den Schwanz zu kneifen. Ich war ein Rossendale, der letzte seines Geschlechtes, und ich würde heimkehren mit all den typischen Merkmalen für das wilde, unerfreuliche Familienblut.
Wie eine graue Drohung tauchte Bolt Head backbord voraus auf. Das Land war nur undeutlich zu erkennen, der Sturm machte Geräusche wie Todesschreie, und die See trieb mich weiter auf die Leeküste zu. Die Wellen waren riesig, ragten hoch auf und wurden durch die Landnähe absolut unberechenbar. Auf dem Scheitel jeder brechenden Woge starrte ich nach vorn und wusste, was ich da sehen würde. Aber als ich es dann sah, kam die Angst. Ich sah nur Weiß. Es ist eine Sache, sich eine Gefahr vorzustellen, aber eine ganz andere, das ganze Ausmaß ihrer Bedrohung zu erkennen und sich klarzumachen, dass jede Vorstellung von der Wirklichkeit übertroffen wird. Die Sandbank kochte vor alles zerschmetternden Brechern. Mir bot sich der Anblick von tosenden Wellenkämmen, über denen weißer Nebel aufstob; darunter musste das Gewicht des Wassers ein tödlicher Malstrom sein. Inzwischen konnten die Menschen an Land mit Sicherheit meine Segel sehen. Sie waren bestimmt gescheite Menschen, die mich für meine Torheit verfluchen und beten würden, dass mein Boot trotz meiner Dummheit am Leben blieb. Zweifellos hatten sie bereits die Rettungswacht alarmiert – aber nur um meine Leiche aus den Wellen zu bergen.
Ich hielt mich an der westlichen Seite der Hafeneinfahrt. Dort ist der Wasserstand tiefer, allerdings wartet dort auch der Bass Rock für den Fall, dass die Sandbank mit ihrem tödlichen Anschlag versagt. Ich sah eine Explosion in Weiß hochstieben, als eine Welle am Little Mew Stone in Fragmente zerbarst, dann senkte die Sunflower den Bug, als eine Woge ihr Heck anhob. Doch diesmal begann der Rumpf auf den Tonnen wirbelnden Wassers zu gleiten, statt über die Wellenkrone zu fliegen. Nun verhielten wir uns nicht anders als die Surfer auf dem Pazifik. Wir waren kein Boot mehr, sondern ein Haufen Schrott und Holz, der von der Macht einer Welle dorthin getragen wurde, wo die Sandbank aus der See eine kochende Hölle machte. Wir befanden uns auch genau da, wo ich sein wollte: direkt unter den westlichen Klippen. Mit der Ruderpinne zwischen den Beinen und beiden Händen an der Großsegelschot bereitete ich mich im Cockpit vor, denn ich wusste, was passieren würde.
Das gereffte Großsegel der Sunflower stand noch immer nach Backbord. Jede Sekunde konnte der Wind von den Klippen zurückspringen, ich musste halsen. Ich hätte das Großsegel einholen sollen, um uns von einer kleinen Fock und der hohen See in den Hafen bringen zu lassen; doch das Niederholen hätte bedeutet, Feigheit zu zeigen. Lass die See machen, was sie will – auch das Schlimmste. Ich hatte mich dazu entschlossen, nach den Regeln der See zu spielen, und ich würde nicht passen.
Das Achterliek des Großsegels erzitterte. Es war nicht viel, nur ein winziges Beben des schweren grauen Stoffes, aber es war das Zeichen, auf das ich gewartet hatte. Bevor uns der von den Klippen abprallende Wind entmasten konnte, holte ich das Tuch mit beiden Händen herum. Ich stützte die Ruderpinne kräftig, da ich wusste, dass die Sunflower sonst nach Backbord gedrückt werden würde, wenn ich das Segel schiftete.
Wir halsten.
Wenn man nicht gerade hart am Wind segelt und eigentlich kein besonderes Ziel ansteuert, stehen die Segel eines Bootes stets entweder nach Steuer- oder Backbord. Es gibt zwei Möglichkeiten, sie von der einen Seite auf die andere zu bringen. Eine ist das Kreuzen. Dabei bringt man das Boot durch den Wind, damit der um den Bug streicht und die Segel gehorsam wie Flaggen, die vom Fahnenmast wehen, ihre Richtung ändern. Die andere ist das Halsen, bei dem man das Boot vor den Wind bringt. Das ist so, als würde sich der Wind schnell um den Mast drehen, und das Segel wird gegen den Mast gedrückt, bevor es sich auf seinem neuen Bug bläht. Das Halsen kann überaus riskant und gefährlich sein. Anstelle einer Flagge ließ ich einen Sturm in ein schweres Segel fahren, das an einem Baum befestigt war, der beim Übergehen einem gut und gern den Schädel zertrümmern konnte. Der Schwung des schweren Großsegels konnte sehr leicht meine Wanten aus der Verankerung reißen und damit schließlich auch den Mast von oben kommen lassen. Allerdings hatte ich so viel von der Großschot eingeholt, dass, als das Segel herumschwang, ich sie wieder fieren konnte, um die Wucht zu bremsen. Dabei schürfte ich mir die rechte Handfläche blutig, aber es war eine saubere Leistung. «Eine saubere Leistung» war Charles’ größtes Lob. Er äußerte es selten und wenn, dann nur praktischen Errungenschaften gegenüber, etwa einem gut verlaschten Stück Holz, einer anständig geschweißten Fuge oder einem wahnwitzigen Halsemanöver vor der Sandbank von Salcombe.
Nicht, dass ich Zeit gehabt hätte, mein Manöver zu bewundern. Wir hatten die Halse überlebt, aber sobald das Segel wieder stand, spürte ich, dass sich der Bug der Sunflower senkte, und wusste, dass sich die Sandbank genau unter dem Heck des Bootes befand. Ich brüllte eine irrsinnige Kampfansage heraus und starrte hinunter in das Wellental, wo Schlamm und Sand das Wasser verfärbten. Schäumende Schlammstreifen wogten wild hin und her. Ich raste in das tödliche Wellental, und für wenige Sekunden wurde das Heulen des Windes durch die aufragende Woge hinter mir gedämpft. Dieser Welle blieben noch etwa hundert Meter, um mich umzubringen, nicht mehr, aber das waren die scheußlichsten hundert Meter. Wenn ich jetzt aus dem Ruder lief, würde mich nichts mehr retten können, denn die Sunflower würde überspült, ihr Mast brechen und die See über uns hereinstürzen, um Mann und Rumpf in Schrott und blutige Fetzen zu verwandeln. Ich umklammerte die Ruderpinne mit beiden Händen, die Muskeln aufs äußerste gespannt, als der Wellenkamm hinter mir sich wie verschüttetes Eis über das dunkle Antlitz der dunklen Woge ergoss. Himmel, dachte ich, warum habe ich mich darauf nur eingelassen?
Die Fock schlug hin und her, abgedeckt vom Großsegel. Die Sunflower gierte nach Backbord, ich brachte sie zurück auf Kurs. Die uns tragende Welle brach zusammen, als ihre Masse durch die aufragende Sandbank weggerissen wurde. Plötzlich war die Sunflower nicht viel mehr als ein Stückchen Eisen im Zentrum einer zusammenfallenden Woge. Das Wasser schlug bis zur Hälfte ihres Mastes empor. Achtern baute sich eine neue Welle auf, und der Kiel der Sunflower begann sich zu senken, raste durch eine wirbelnde See auf das verborgene Land zu, das ihren Rumpf zerschmettern konnte, als wäre er eine Nussschale. Wir stürzten hinab, immer weiter hinab, und hinter mir brach sich der Wellenkamm, und ich sah das glasige Schwarz unter dem Weiß, der Schaumkrone, aber immer noch ging es hinab. Ich sah bereits, wie ich zwischen der Sandbank und der folgenden Grundsee zerschmettert wurde, doch da begann sich die Sunflower, die gute alte Sunflower, zu heben. Zentimeter um Zentimeter kämpfte sie gegen ihren Tod. Der obere Teil des gerefften Großsegels zog, zwang sie weiter. Sie hatte noch immer Fahrt drauf, und sie schnitt mit ihrem Stahlrumpf durch das Wasser. Sie würde nicht aufgeben, aber immer noch drohte diese alles überrollende Welle uns von hinten zu überspülen, und ich wusste, sie konnte uns mit ihrer Sturzsee ebenso erschlagen, wie sie uns ertränken konnte.
Die Woge brach. Das dunkle, schwarze, glasige Zentrum der Welle wurde wie durch Dynamit gesprengt. Sie wurde schneeweiß, als sie brach und in eine Million Fragmente zerbarst. Sie stürzte herab und hätte mich mit Sicherheit getötet, wäre sie nicht kurz hinter dem Heck der Sunflower zusammengebrochen. Außerdem wurde die Wucht der Sturzsee von der Sandbank gemildert. Die Woge hob uns an und trug uns weiter. Weiter über die strudelnde Grundsee der Sandbank, weiter am Wolf Rock und dem Bass Rock vorbei, knapp vorbei am Poundstone. Ich halste noch einmal und wusste, dass ich für die Menschen eine Schau hinlegte, die da an Land standen, um meinen Tod mit anzusehen. Doch ich bewies, dass ich mein Handwerk verstand, und durch die Demonstration dieses Könnens war ich höchst stilvoll nach Hause gekommen. Und so halste ich mit der Sunflower wieder, hievte danach an, und plötzlich segelten wir in ruhigeres Wasser, als Limebury Point dem Sturm die brutale Macht nahm. Ich blickte zurück. Die Sandbank war eine Masse von brodelndem Weiß – so erschreckend, wie ich es noch nie gesehen hatte –, aber die Sunflower hatte es geschafft.
Und ich war mit einer sauberen Leistung heimgekehrt.
Charlie war nicht zu Hause. Seine Frau, die mein R-Gespräch widerwillig angenommen hatte, sagte, er wäre geschäftlich in Herfordshire. Mir war klar, dass sie über meine Rückkehr nicht gerade begeistert war. Sie hielt mich für verkommen, darauf aus, ihren Mann auf See zurückzulocken. «Wann wird er zurück sein, Yvonne?», fragte ich.
«Das weiß ich nicht.» Ihre Stimme klang wachsam. Irgendwo im Hintergrund jammerte ein Kind.
«Sag ihm, dass ich angerufen habe. Und sag ihm auch, dass ich in Salcombe liege.» Yvonne versprach, diese Nachrichten zu übermitteln, aber ich zweifelte, dass sie sich damit sehr beeilen würde. Ich fragte mich, warum Charlie, mein bester, engster und ältester Freund, jemanden heiraten musste, der mich so verabscheute.
Ich legte den Hörer auf. Die ungeduldigen Leute vor der Telefonzelle ignorierend, versuchte ich dann, das Haus meine Mutter per R-Gespräch anzurufen. Es meldete sich niemand, daher ließ ich mich von der Vermittlung mit meiner Zwillingsschwester in Gloucestershire verbinden. Elizabeth war ebenfalls nicht zu Hause, aber ihr Mann erklärte sich missmutig dazu bereit, die Telefonkosten zu übernehmen. Einmal war er mein Freund gewesen, hatte sich dann aber entschlossen, auf die Seite seiner Frau in unserem Familienstreit überzuwechseln. «Glaubst du, wir schwimmen im Geld?», lautete seine Begrüßung.
Ich verzichtete auf die mühevolle Erklärung, dass ich gerade erst in England an Land gegangen sei und keine anderen Münzen als amerikanische, antiguanische und portugiesische besäße. «Ist Elizabeth da?», wollte ich stattdessen wissen.
«Nein, ist sie nicht.» Er klang betrunken.
«Ich habe versucht, Mutter anzurufen.»
«Sie ist im Krankenhaus.»
Ich wartete, ob er gewillt war, weitere Informationen zu liefern. War er aber nicht. «In welchem Krankenhaus?», fragte ich.
«South Devon General. Sie ist in der letzten Woche eingeliefert worden. Liegt in einem Privatzimmer, das wir bezahlen.»
Das war eine Aufforderung, mich an den Kosten zu beteiligen, aber ich ignorierte den Wink mit dem Zaunpfahl. «Auf welcher Station?», wollte ich stattdessen wissen.
«Edith Cavell Ward. Im dritten Stock.»
«Weißt du, wie die Besuchszeiten sind?»
«Ich bin kein Auskunftsbüro für den National Health Service», fauchte er gereizt, sagte dann aber nachgiebiger: «Du kannst jederzeit hingehen. Es ist ihnen offenbar völlig egal. Verdammt unsinnig, finde ich. Wenn ich ein Krankenhaus leiten würde, hätte ich mit Sicherheit entschieden etwas dagegen, dass mir Tag und Nacht die Besucher durch die Flure latschen. Aber sie werden wissen, was sie tun, nehme ich an.»
«Ist Elizabeth vielleicht im Krankenhaus?»
«Keine Ahnung, wo sie ist.» Es entstand eine lange Pause, als wolle er noch etwas hinzufügen, doch dann legte er ohne ein weiteres Wort den Hörer auf.
Sonst gab es niemanden mehr, den ich hätte anrufen können. Mir war klar, dass ich meine jüngste Schwester nicht erreichen konnte, die sich außer Charlie als Einzige über meine Heimkehr freuen würde, daher ruderte ich zur Sunflower zurück und kramte eine Dose gebackene Bohnen hervor, die ich mit einer Dose Stew mischte und auf dem Herd in der Kombüse aufwärmte. Die Schmerzen in meinem Zahn hatten wundersamerweise nachgelassen. Und das war ein Segen, denn mir waren sowohl die Aspirin als auch der irische Whiskey ausgegangen.
Es hatte heftig zu regnen begonnen. Wasser trommelte auf das Kajütdach der Sunflower und gurgelte ihre Speigatten hinunter. Der Wind heulte in der Takelage und ließ die Falle gegen den Mast schlagen. Ich löffelte mein Essen und dachte daran, dass ich genauso gut sechs Meere entfernt und vogelfrei sein könnte.
Doch stattdessen war ich heimgekehrt.
Am nächsten Morgen waren die Zahnschmerzen völlig verschwunden. Zum ersten Mal seit Wochen wachte ich ohne Beschwerden auf, bis auf die Prellung meiner Rippen, die ich mir zugezogen hatte, als ich gegen die Relingsstütze geschleudert worden war. Doch diese Art Schmerz war ein Berufsrisiko und konnte daher ignoriert werden. Der Zahn war jedoch erstaunlicherweise in Ordnung. Probeweise biss ich kräftig zu, verspürte aber nicht das geringste Aufmucken. Die wundersame Heilung und der erholsame Schlaf kamen zusammen, um mich mit Optimismus zu erfüllen.
Doch die Busfahrt verscheuchte meine gute Laune nur allzu schnell.
Das lag weniger an der Landschaft von Devon, die – wenn auch nass und grau – einladend genug aussah. Das lag eher an meinen Mitfahrern. Der Bus war voller junger Mütter mit ihren plärrenden Kindern. Auf See sind die Geräusche schreiender Babys wohltuend abwesend, und als ich ihnen nun unverhofft ausgesetzt war, kam es mir so vor, als kratzten Nägel über eine Schieferplatte. Durch ein beschlagenes Fenster starrte ich auf die Autos, die durch Pfützen platschten, und fragte mich, wie es Charlie ertrug, Vater zu sein.
Der Bus setzte mich anderthalb Kilometer vom Krankenhaus entfernt ab. Ich hätte auf einen anderen Bus warten können, der mich den Hügel hinaufbefördert hätte, aber die Vorstellung weiterer kreischender Kleinkinder bewog mich zum Laufen. Ich trug meine schwere Öljacke, daher wurden nur meine Jeans vom Regen durchtränkt. Das Ölzeug war fett- und dreckbeschmiert, aber es war die einzige Jacke, die ich besaß, also musste es als formelles Kleidungsstück dienen. Ich stakste durch den strömenden Regen und wählte die Abkürzung über den tropfnassen Rasen des Krankenhauses. Die große Eingangshalle war vom Spektakel weiterer plärrender Kinder erfüllt. Ich verzichtete auf den Fahrstuhl, stieg die drei Stockwerke hinauf und fragte mich, warum ich sechs Wochen und dreitausendfünfhundert Seemeilen gesegelt war.
Halb hatte ich erwartet, halb befürchtet, dass meine Schwester Elizabeth im Krankenhaus zu Besuch sein würde. Sie war es nicht. Mit Ausnahme der Patienten war das Edith-Cavell-Zimmer leer. An der Wand gegenüber den beiden Betten zeigte ein stummer Fernsehbildschirm einen turbulenten Zeichentrickfilm. Eine ältere Frau lag im mir nächsten Bett, Kopfhörer über den grauen Haaren. Sie musterte meine triefenden Jeans und die Turnschuhe mit Abscheu, und ihr Gesicht verriet Erleichterung darüber, dass ich nicht gekommen war, sie zu besuchen. «Sie schläft», stellte sie missbilligend fest und ruckte mit dem Kopf zum zweiten Bett, dessen Vorhänge zugezogen waren.
Ich überquerte den Linoleumfußboden und zog die hellen Vorhänge behutsam zur Seite.
Meine Mutter schlief.
Zunächst erkannte ich sie nicht. In den letzten vier Jahren hatten sich ihre goldblonden Haare in ein schmutziges Grau verwandelt. Sogar im Schlaf sah sie alt und verbraucht aus. Sie lag hinfällig und ausgezehrt in den Kissen, die grauen Haare hingen unordentlich in ihre Stirn. Sie war immer eine sehr stolze Frau gewesen, dumm und übertrieben stolz, doch nun war sie zu dieser ausgemergelten Kreatur reduziert. Ihre große Schönheit war verschwunden, vergangen wie ein Traum. Ihr Atem rasselte in ihrer Kehle. Jedes Füllen ihrer Lungen war Anstrengung. Einst hatte sie ein Vermögen in Diamanten am Körper getragen, aber jetzt kämpfte sie um ihr Leben. Sie war erst neunundfünfzig, sah aber zehn Jahre älter aus.
«Sie hat eine schlechte Nacht hinter sich», erklärte die grauhaarige Frau.
Ich erwiderte nichts.
Die Frau nahm die Kopfhörer ab. «Sie hat sich mit Händen und Füßen gegen das Sauerstoffzelt gesträubt, wissen Sie. Die reine Unvernunft nenne ich so etwas. Das habe ich ihr auch gesagt, habe ich. Ich sagte, sie solle doch auf die Ärzte hören, aber sie hat einfach nicht auf mich gehört. Sie sagte, sie wolle rauchen. Rauchen! Das ist es doch, was sie umbringt. Aber davon will sie nichts wissen. Sie sagte, sie könne nicht rauchen, wenn sie am Sauerstoffgerät hängt. Die reine Unvernunft, so etwas.»
Ich schloss die Vorhänge hinter mir, was die segensreiche Nebenwirkung hatte, dass die Stimme der Frau gedämpft wurde. Die Atmung meiner Mutter hörte sich erschreckend an.
Eine Sauerstoffflasche stand neben ihrem Bett. Dicht neben einer Sauerstoffmaske lagen eine Schachtel Zigaretten und ihr goldenes Feuerzeug. Ich nahm die Maske auf und hörte das Zischen des entweichenden Gases. Ich drehte den Hahn zu und legte die Maske auf die dünne Bettdecke zurück. Ich hatte sehr behutsam hantiert, aber meine Mutter musste doch irgendetwas mitbekommen haben, denn ihre Augen öffneten sich, und sie sah zu mir auf. Zunächst sah es nicht aus, als ob sie mich erkannte – die Sonne hatte mein helles Haar fast weiß gebleicht und meinem Gesicht die Farbe alten Firnisses gegeben –, doch dann, mit einem fühlbaren Stutzen, zeigte ihr Blick Erkennen. Ich war ihr überlebender Sohn, und ich war heimgekehrt.
«Guten Tag, Mutter», sagte ich.
Sie sagte nichts. Stattdessen griff sie nach ihren Zigaretten, aber bevor sie sie in den Händen hielt, erschütterte ein furchterregender Husten ihren Körper. Es war ein bösartiger, quälender Husten, und er klang so, als würde Glas mit einem Stein zermalmt. Er kam aus den Tiefen ihres Oberkörpers und wollte kein Ende nehmen. Ich drehte die Sauerstoffflasche auf und legte die Maske auf ihr Gesicht. Irgendwie schaffte sie es, den Hustenanfall zu besiegen, rang verzweifelt nach Atem, und als hätte sie Angst, ich könnte ihr die Maske fortnehmen, umklammerte sie mit der rechten Hand meine Finger. Ihre gekrümmten, dünnen Finger waren wie Klauen. Es war das erste Mal in vierzehn Jahren, dass sie mich berührte. Damals war ich zwanzig Jahre alt gewesen, und sie hatte mich flüchtig an dem Grab umarmt, in das mein Vater hinabgelassen wurde. Seither hatten wir einander nie mehr berührt – bis jetzt nicht, da sie um ihr Leben kämpfte. Sie legte ihre Hand auf meine und griff so fest zu, dass sie sich anfühlte wie eine schuppige Vogelklaue, die sich an eine Zuflucht klammert. Ihre Augen waren wieder geschlossen. Ihre Handfläche lag auf meinem Handrücken, ihre Finger verkrampften und entkrampften sich, und ihre Nägel gruben sich in meine Haut.
Dann, sehr langsam, ging ihre Atmung etwas leichter. Ich konnte spüren, wie die Erleichterung durch ihren Körper lief, während ihr Griff nachließ. Sie hatte zwei blutige Male dort hinterlassen, wo ihre Fingernägel in mein Fleisch gedrungen waren. Sie öffnete die Augen und starrte mich an, dann winkte sie gereizt mit der Hand, als wolle sie sagen, ich solle endlich die Maske entfernen.
Ganz langsam hob ich die Sauerstoffmaske, nicht sicher, ob sie es auch wirklich wollte. Der Hustenanfall hatte Blutfleckchen auf den Lippen meiner Mutter hinterlassen, während die unförmige Kunststoffmaske ein rotes Mal auf ihre weißen Wangen gedrückt hatte. Gegen die kreidige Blässe ihrer Haut wirkten ihre Augen sehr dunkel und glänzten, als sie zu mir aufstarrte.
«Guten Tag, Mutter», sagte ich noch einmal. Sie versuchte etwas zu erwidern, aber die Anstrengung drohte einen weiteren krampfartigen Husten auszulösen. «Ist schon gut», sagte ich beruhigend, «du brauchst nicht zu sprechen.» Ich näherte mich mit der Sauerstoffmaske ihrem Mund, aber sie schüttelte den Kopf und schloss die Augen, als konzentriere sie sich darauf, einen neuen Hustenanfall abzuwehren. Das bedurfte einer immensen Willensanstrengung, aber sie hatte Erfolg, und anstatt wieder zu husten, öffnete sie ihre Augen und sah mir direkt ins Gesicht.
«Du Bastard», sagte sie.
Dann begann sie wieder zu husten, und diesmal half keine noch so große Menge Sauerstoff. Obwohl ich auf den Alarmknopf drückte, obwohl mich Schwestern und Ärzte beiseitedrängten, um ihr Erleichterung bringen zu können, gab es nichts mehr, was man für sie hätte tun können. Zwanzig Minuten nach meinem Erscheinen an ihrem Krankenbett war meine Mutter tot.
Als alles vorüber war, trat auf dem Flur ein junger Arzt auf mich zu. Er wollte wissen, ob ich ein Verwandter sei, und auch wenn ich das bestätigte, sagte ich doch nicht, dass ich der Sohn der Toten war. «Ich bin nur ein entfernter Angehöriger», sagte ich stattdessen.
«Sie hat zu viel geraucht», meinte der Arzt hoffnungslos.
«Ich weiß.» Schuldbewusst befingerte ich die Pfeife in der Tasche meiner Öljacke. Ich hatte durchaus die Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören. Einmal war es mir auch gelungen, aber nur weil mir tausend Meilen hinter Auckland der Tabak ausging. Nach drei Wochen experimentierte ich mit in der Sonne getrocknetem Seetang, aber es war besser als die Abstinenz. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Arzt zu.
«Sie wollte unbedingt ihren Sohn sehen.» Der Arzt beäugte misstrauisch meine auffällige Öljacke. «Er soll auf See sein, oder?»
«Ich glaube, ja», antwortete ich wenig hilfreich.
Der Arzt wirkte wie ein Mann, der gerade einen Sturm mit Windstärke zwölf durchsegelt hat, aber er bekämpfte seine Erschöpfung äußerst höflich in dem Bemühen, freundlich zu sein. «Sie hat gestern die Sakramente erhalten», erzählte er mir. «Und das schien sie zu beruhigen.»
«Davon bin ich überzeugt.»
Der Arzt unterdrückte ein Gähnen. «Wollen Sie vielleicht mit dem Krankenhauspfarrer sprechen? Manchmal kann das nach einem Todesfall sehr tröstlich sein.»
«Ein so enger Verwandter bin ich nicht», meinte ich abwehrend.
«Es wird wohl das Beste sein, wenn wir die älteste Tochter anrufen, um uns nach den Modalitäten für die Begräbnisfeierlichkeiten zu erkundigen?»
«Ja, das wird das Beste sein», antwortete ich. «Das Allerbeste.» Zwei Männer schoben eine Trage in das Zimmer. Ich wollte nicht mit ansehen, wie der verhüllte Körper davongefahren wurde, daher ging ich schnell hinaus in den Regen von Devon.
Du solltest irgendetwas empfinden, dachte ich. Du kannst doch nicht deine Mutter sterben sehen und nichts empfinden. Zumindest könntest du weinen. Mein Gott, selbst die fehlerhafte Liebe einer Mutter und das widerwillige Pflichtgefühl eines Sohnes sollten für eine kleine Träne reichen. Aber ich war zu keiner entsprechenden Reaktion fähig. Ich verspürte weder Freude noch Trauer, keine Überraschung – nichts. Alles, was ich empfand, war eine gewisse Gereiztheit über eine überflüssige Seereise und Verärgerung darüber, dass ich zwei Stunden lang auf den Bus nach Salcombe warten musste.
Endlich wieder im Hafen, rief ich bei Charlie an, aber es meldete sich niemand. Also ruderte ich zur Sunflower hinaus und spleißte ein neues Auge in das Fall des Vorsegels.
Ich war heimgekommen und hatte nichts empfunden. Ich hatte nicht einmal eine einzige Träne vergossen.
Fünf Tage später versammelte sich die Familie um zehn Uhr vormittags in Stowey.
Stowey war der Familiensitz. In einem seiner Bücher hatte es Pevsner als «das wahrscheinlich schönste Wohnhaus des Spätmittelalters in England» bezeichnet, was in Wirklichkeit nur bedeutete, dass die Familie zu arm gewesen war, um es mit dem architektonischen Mischmasch des 18. oder der falschen Gotik des 19. Jahrhunderts aufzumotzen. Aber der Wahrheit die Ehre: Stowey ist schön. Es ist ein flaches Steingebäude, nur zwei Stockwerke hoch, mit einem zinnenbewehrten Turm an der Ostseite. Mitten bei den Bauarbeiten dämmerte es ihnen, dass sich Devon im Frieden befand, und so blieb der Westflügel unbewehrt. Stattdessen erhielt er anheimelnde Fenster mit Mittelpfosten, die jetzt auf Gärten hinausführten, die an jedem Sommerwochenende Hunderte von Besuchern anlocken. Heute ist Stowey ein Landhotel, aber es war ein Bestandteil des Kaufvertrages, dass die Trauerfeierlichkeiten für meine Mutter in den alten Herrschaftsräumen und der Trauergottesdienst in der Kapelle von Stowey stattfinden durften. Die Kapelle ist nicht mehr geweiht, aber die Hotelleitung hat in ihr nichts verändert, und der Ortspfarrer war glücklich, den Wunsch meiner Mutter zu erfüllen. Sie würde also in der Familiengruft unter der Kapelle bestattet werden; wahrscheinlich als Letzte der Familie, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich die Hotelbesitzer weitere dieser makabren Zeremonien ersehnten. Tatsächlich duldeten sie auch dieses Begräbnis nur, weil sie rechtlich keine andere Wahl hatten. Mir war jedoch die Abneigung nicht entgangen, mit der sie die verstreuten und altersschwachen Reste der Familie Rossendale empfangen hatten.
Die Familie wiederum empfing mich mit ähnlichem Widerwillen. «Ich bin überrascht, dich hier zu sehen», stellte einer meiner weniger klapprigen Onkel fest.
«Warum?»
«Nun, das weißt du sehr gut.»
«Nein, ich weiß es nicht», forderte ich ihn heraus.
Er machte einen Rückzieher und ließ sich murmelnd über das Wetter aus, das einfach schrecklich sei. Immer wenn ein Rossendale zur letzten Ruhe gebettet werde, scheine es zu regnen. «Es hat bei Frederick geregnet», stellte er fest, «und auch bei dem armen Michael.» Frederick war mein Vater gewesen, Michael mein älterer Bruder. Für die Familie war er stets der «arme Michael» gewesen. Er hatte sich mit einer doppelläufigen Flinte in den Kopf geschossen, und nun hatten die Rossendales an seiner Stelle mich am Hals. Mein Bruder Michael war ein fader, sorgenvoller Mensch gewesen, der seine chronische Entschlusslosigkeit hinter einer Maske schlechter Laune verbarg, aber nach seinem Tod wurde er für die Familie eine Art Held – vielleicht weil sie ihn mir vorzog. Wenn Michael noch am Leben wäre, schienen ihre vorwurfsvollen Blicke auszudrücken, wäre dieses ganze Unglück nie geschehen.
Ein Familienmitglied freute sich jedoch, mich zu sehen. Das war meine jüngere Schwester, die in unschuldiger Freude lächelte, als ich auf ihren Sessel zuging. «Johnny?» Sie streckte mir glücklich beide Arme entgegen. «Johnny!»
«Guten Tag, mein Liebling.» Ich ergriff Georginas Hände und beugte mich hinab, um sie auf die Wangen zu küssen.
Sie lächelte fröhlich. Es musste einer ihrer guten Tage sein, da sie mich erkannt hatte. Bei ihr war eine junge, stämmige Ordensschwester, eine der Pflegerinnen, die sich in einem katholischen Privatkrankenhaus auf den Kanalinseln um sie kümmerten. «Wie geht es ihr?», fragte ich die Schwester.
«Wir sind alle sehr stolz auf sie», erwiderte die Ordensschwester, was auch bedeuten konnte, dass meine kleine Schwester endlich auf die Toilette gehen konnte.
«Und Schwester Felicity?», wollte ich wissen. Schwester Felicity war Georginas übliche Pflegerin.
«Es geht ihr nicht gut», antwortete die Ordensschwester mit einer weichen irischen Stimme. «Sie wäre gern heute hier gewesen, aber sie ist nicht gesund. Wir alle beten für sie.»
«Schwester Felicity geht bald in den Himmel», erklärte Georgina heiter. Sie ist sechsundzwanzig und hat den Verstand einer zurückgebliebenen Zweijährigen. Niemand weiß, warum. Am besten hat es einmal Charlie ausgedrückt, als er sagte, dass Gott die Hefe weggelassen hat, als er Georginas Leib formte. Sie ist wunderschön, mit dem herzergreifenden Gesicht eines Engels, aber dem Verstand eines Regenwurms.
«Schwester Felicity wird nicht sterben», sagte ich, aber Georgina hatte ihren Kommentar bereits vergessen.
«Hier gefällt es mir.» Sie hielt noch immer meine Hände fest.
«Du siehst gut aus», sagte ich ihr.
«Ich möchte wieder hier leben, Johnny. Mit dir», erklärte Georgina mit rührender Hilflosigkeit.
«Ich wünschte, du könntest es, Darling. Aber du bist doch glücklich im Konvent, oder etwa nicht?» Das Krankenhaus des Ordens hatte sich auf die Pflege geistig Beeinträchtigter spezialisiert. Vor dem Tod meines Vaters und dem auf ihn folgenden Zusammenbruch des Rossendale-Besitzes war ein Fonds eingerichtet worden, dessen Erlöse für Georginas Bedürfnisse sorgen würden. Es hatte durchaus eine gewisse Ironie, sich daran zu erinnern, dass das einzige Familienmitglied ohne finanzielle Probleme das mit dem verwirrten Geist war.
«Es gefällt mir hier», stellte Georgina mit brutaler Klarheit fest. «Mit dir.»
Zum ersten Mal seit dem Tod meiner Mutter fühlte ich mich den Tränen nahe. Wir waren eine miese Familie, aber Georgina und ich hatten einander stets nahegestanden. Als sie ein kleines Kind gewesen war, hatte ich sie zum Lachen gebracht und war manchmal überzeugt davon gewesen, dass es nur eines winzigen Wunders bedurfte, um die Sperre in ihrem Hirn zu lösen. Doch dieses Wunder hatte sich nie ereignet. Stattdessen hatte meine Mutter Georginas Anwesenheit als belastend empfunden, und so wurde meine jüngere Schwester sicher in dem Konvent verwahrt – aus den Augen, aus dem Sinn. Ich ging neben dem Sessel in die Knie. «Bist du denn unglücklich?», fragte ich.
Sie antwortete nicht. Die kleine Blase der Vernunft war geplatzt, und jetzt starrte sie mir nur leer in die Augen. Ich bezweifelte, dass sie überhaupt wusste, warum sie nach Stowey gebracht worden war.
«Sie sind alle sehr nett», sagte sie schwerfällig und blickte dann auf, weil jemand neben mich trat. Es war meine andere Schwester, mein Zwilling Elizabeth, aber da war kein Erkennen in Georginas Blick.
Elizabeth nahm keine Notiz von Georginas Existenz. Wie meine Mutter hatte sie sich stets durch die Tatsache peinlich berührt gefühlt, eine geistig Behinderte in der Familie zu haben. Also ignorierte sie Georgina und wartete darauf, dass ich meine Hände sanft aus deren Griff löste und aufstand. Elizabeth hatte ein Glas hoteleigenen Sherrys in der Hand. Ihr Mann Peter, einst mein Segelgefährte, nun aber ein erfolgloser Landbesitzer in den Cotswolds, funkelte mich quer durch den Raum düster an. Ich war der böse Geist dieser Trauerfeier. Sie alle beschuldigten mich, das Familienvermögen um die Ecke und damit die Schande der Armut über eine Familie gebracht zu haben, die dieses Fleckchen Englands besessen hatte, seit es der erste Rossendale mit seinem blutigen Schwert eroberte. Dieser Mann war im 12. Jahrhundert nach Devon gekommen, während sich seine Nachkommen des 20. Jahrhunderts verlegen im Empfangsraum eines Hotels drängeln mussten. Alle bis auf Elizabeth, die eine tadellose, wenn auch leicht bittere Haltung bewies. Sie zog mich von Georginas Sessel fort. «Ich weiß gar nicht, warum sie eigentlich hier ist», erklärte Elizabeth gereizt.
«Warum sollte sie denn nicht hier sein?»
«Sie begreift doch überhaupt nicht, was hier passiert.» Elizabeth nippte an ihrem Sherry, dann unterzog sie mich einer langen und missbilligenden Prüfung. «Ich weiß auch nicht, warum du eigentlich hier bist.»
«Ein Relikt der Sohnespflicht», erwiderte ich ein bisschen zu lässig.
«Du siehst ekelerregend gesund aus.» Ihre Worte klangen widerwillig. Es war eine Übung in Höflichkeit, in dem Bemühen, so zu tun, als wären wir nicht die erbittertsten Feinde.
«Sonne und Meer.» Ich war schlagfertig. «Du siehst auch gut aus. Reitest du noch?»
«Selbstverständlich.» Fast hätte es Elizabeth als Reiterin bis in die britische Olympiamannschaft geschafft. Hätte sie diesen Erfolg gehabt, wäre sie vielleicht weniger unzufrieden mit ihrem Leben seither.
Unruhe an der Tür kündigte die Ankunft von Father Maltravers aus London an. Father Maltravers war Mutters Lieblingsbeichtvater gewesen, und nun würde er sie auch unter die Erde bringen. Der Anblick des Priesters veranlasste Elizabeth dazu, ihren Schein der Höflichkeit fallenzulassen. «Wirst du an der Messe teilnehmen?», forderte sie mich heraus.
«Ich glaube nicht.»
«Mutter hätte es gern gesehen, wenn du daran teilgenommen hättest.»
Sie schwieg und sah mir in die Augen, als erwartete sie, dort irgendeine verborgene Botschaft zu lesen. Elizabeth ist groß, nur fünf Zentimeter kleiner als meine ein Meter achtzig. Sie hat das goldblonde Haar unserer Familie und mehr als nur ihren gerechten Teil vom guten Aussehen der Rossendales. «Aber selbstverständlich», fuhr sie mit einer bissigen Lässigkeit fort, «würdest du zuvor beichten müssen. Hast du in den vergangenen Jahren gebeichtet, John?»
«Hast du?», konterte ich schwach. Die Rossendales sind eine der alten katholischen Familien. Wir wurden von den Tudor-Fanatikern verfolgt, haben aber hartnäckig an unserem Land festgehalten und die fünf Austernschalen neben die Tür von Stowey gelegt. Sie sind der Ursprung der Zeile «Five for the symbols at your door» in dem alten Kinderlied. Die fünf Muschelschalen waren ein Zeichen, dass drinnen im Haus die alte Religion praktiziert, dass ein Priester gefunden werden konnte, der die Messe las. Heutzutage ist das Hotel entzückt, seinen Gästen ein Priesterversteck zeigen zu können, in dem der illegale Gottesmann vor den Schergen Elizabeths I. verborgen wurde. Das Priesterverlies befand sich nach Aussage des Hotels in dem Raum, der das Schlafzimmer meines Vaters gewesen ist, und den Gästen wird erzählt, dass dort in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts ein Jesuit den Hungertod fand. Aber das ist Unsinn. Das tatsächliche Priesterverlies befand sich in den Ställen von Stowey, denn kein Rossendale hätte je einen Priester in seine Privatgemächer gelassen. Das angebliche Priesterverlies war in Wirklichkeit der niedrige Wandschrank, in dem mein Großvater seine Reitstiefel verwahrte, aber die Verfälschung versetzt die Touristen in Hochstimmung.
«Hast du Mutter gesehen, bevor sie starb?», fragte Elizabeth jetzt.
«Ja.»
«Und?», hakte sie nach.
Ich zuckte mit den Schultern und entschied, dass die Wahrheit über Mutters letzte Worte besser mein Geheimnis blieb. «Sie war zu Gesprächen nicht in der richtigen Verfassung.»
Elizabeth schwieg, schien ein Ausweichen zu vermuten. Mir entging keineswegs, dass die anderen Familienmitglieder Abstand zu uns hielten, als wollten sie eine Arena für einen Kampf schaffen. Sie hatten wahrscheinlich damit gerechnet, dass Elizabeth mich angreifen würde, und so war eine erwartungsvolle Atmosphäre in dem holzgetäfelten Raum entstanden. Sie taten alle so, als würden sie uns ignorieren, scharten sich um Father Maltravers, aber ich wusste, dass sie nur allzu begierig auf meine Auseinandersetzung mit Elizabeth waren.
«Hast du Mutters Testament gesehen?» Die Frage war wie die vorherigen eine sondierende Attacke.
«Nein.»
«Du bist darin nicht bedacht.»
«Ich habe nichts erwartet.» Ich sprach ruhig und freundlich, denn ich spürte bereits den Stimmungsumschwung bei Elizabeth. Sie hat das Rossendale-Temperament. Ich auch, aber ich glaube, die See hat mich gelehrt, meines zu beherrschen. Aber in Elizabeths hellen Augen konnte ich jetzt den Zorn glimmen sehen.
«Sie hat dir nichts hinterlassen, weil du sie betrogen hast.» Die Stimme meiner Schwester war laut genug, dass sich die in der Nähe stehenden Verwandten zu uns umdrehten und uns beobachteten. Alle bis auf Georgina, die angestrengt ihre Finger zählte. «Sie hat dich gehasst», fuhr Elizabeth fort. «Deshalb hat sie mir das Gemälde vererbt.»
Diese Feststellung bewies, dass Elizabeth nicht fähig gewesen war, der Versuchung eines direkten Angriffs zu widerstehen. «Gut», meinte ich gleichmütig, was sie aber nur noch mehr in Rage brachte.
«Also wo ist es?», erkundigte sie sich aufgebracht.
Wir sind Zwillinge, im Abstand von acht Minuten auf die Welt gekommen, aber wir hassen einander. Ich kann mir das nicht erklären. Charlie hat oft gesagt, wir wären uns zu ähnlich, als sei das allein schon die Antwort, aber ich kann in mir die Gehässigkeit nicht entdecken, die Elizabeths exzessive Abneigung gegen mich erklären würde. Außerdem denke ich nicht, dass wir uns allzu ähnlich sind. Mir fehlt Elizabeths brennender Ehrgeiz. Das ist ein verblüffender Ehrgeiz; so offen und unverblümt, dass er fast schon mitleiderregend ist. Sie sehnt sich nach einem gesellschaftlichen Status, der den vergangenen Ruhm unserer Familie widerspiegelt. Sie will Reichtum, Bewunderung und Erfolg, hatte jedoch genau wie ich ein Talent zum Scheitern. Ich hatte mich mit meinem Mangel an Ehrgeiz abgefunden, wurde zum Wanderer auf den Meeren, während Elizabeth mit jeder neuen Schicksalswende mehr und mehr verbitterte. Sie hatte sich gut verheiratet, aber die Ehe ging schief, sie war reich geboren, aber nun war sie arm, und dieses Scheitern schien sie am meisten zu schmerzen.
«Wo ist das Bild?», fragte sie mich noch einmal, diesmal so laut, dass sich jeder umdrehte, selbst die verwirrte Georgina. Elizabeths Mann, der an der gegenüberliegenden Wand lehnte, schien mich mit seinen Blicken zu durchbohren. Father Maltravers trat einen Schritt vor, als wolle er Frieden stiften, aber die Intensität in Elizabeths Stimme ließ ihn innehalten. «Wo ist das Bild?», fragte sie mich wieder.
«Ich versichere es dir noch einmal», sagte ich, «und das zum allerletzten Mal – ich weiß es nicht.»
«Du lügst, John. Du bist ein erbärmlicher kleiner Lügner. Das warst du schon immer.» Elizabeths Wut war losgelassen, hatte sich durch meine Anwesenheit aus der Vertäuung gerissen. Sie würde sich dafür verabscheuen, in der Öffentlichkeit derart aus der Rolle gefallen zu sein, war aber dennoch nicht fähig gewesen, sich zu beherrschen. Mein Schweigen auf ihre Angriffe erboste sie nur noch mehr. «Ich weiß, dass du lügst, John. Ich habe Beweise.»
Ich schwieg. Das tat auch der Rest der Familie. Ich bezweifle, dass auch nur einer damit gerechnet hat, mich auf der Trauerfeier zu sehen, aber wenn doch, dann haben sie mit Sicherheit halb befürchtet, halb erwartet, dass dieses Gespenst aus der überfüllten Familiengruft seinen makabren Auftritt hatte. Jetzt war es so weit, und keiner hatte die Absicht, diese Schau abzubrechen. Elizabeth spürte ihre Unterstützung und meine Niederlage. Sie griff erneut an. «Du solltest schnell wieder das Weite suchen, John. Bevor die Polizei erfährt, dass du wieder da bist.»
«Du bist hysterisch.» Die Wut nagte in meinem Inneren, aber ich war entschlossen, sie nicht zu zeigen. Doch trotz aller Bemühungen gelang es mir nicht, eine gehässige Bemerkung zu unterlassen. «Warum nimmst du nicht eine Tablette und legst dich ein bisschen hin?»
«Du verfluchter Kerl!» Sie zuckte mit dem Handgelenk, und der klebrige Sherry spritzte mir ins Gesicht und auf den billigen schwarzen Anzug, den ich mir zu Ehren des Anlasses gekauft hatte. «Du verfluchter Kerl», sagte sie noch einmal. «Du verfluchter Kerl, verfluchter Kerl, verfluchter Kerl.»