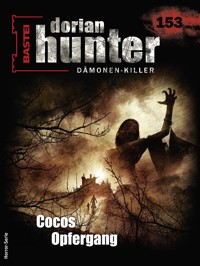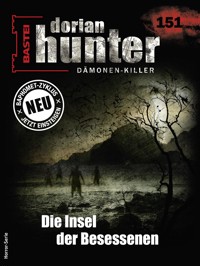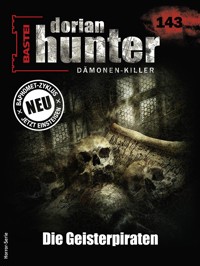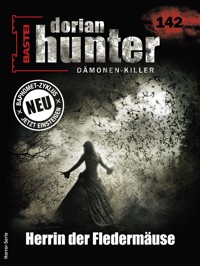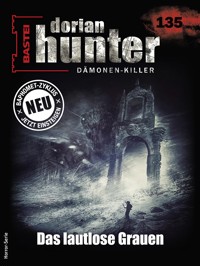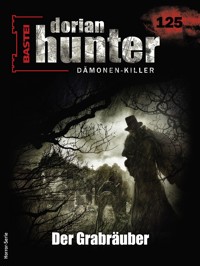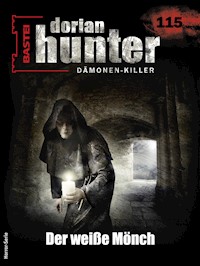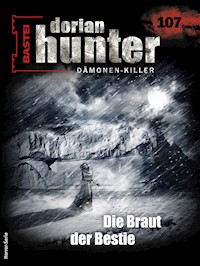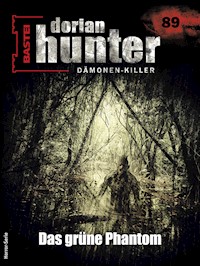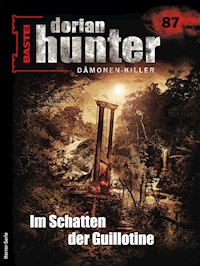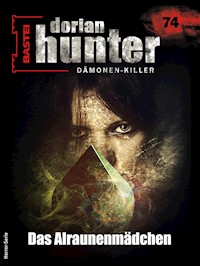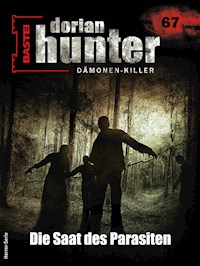Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
Luis Carrero riß die eine der beiden erbeuteten Pistolen heraus. Er drehte sich halb um, spannte den Hahn, legte auf die Hündin an und drückte mit wutverzerrtem Gesicht ab. Die Wölfin schien den Schuß geahnt zu haben. Sie schnellte zur Seite. Carrero feuerte auf den huschenden Schatten, der aber plötzlich hinter einem Uferfelsen verschwand. Es schien sie nie gegeben zu haben, diese teuflische Wolfshündin. Es wirkte, als habe sie sich in Luft aufgelöst wie ein Spuk. Der Schuß donnerte in die Nacht - und ging fehl. Irgendwo prallte die Kugel von den Felsen ab und jaulte als Querschläger davon. Carrero stöhnte auf. Dann schleuderte er wie von Sinnen die Pistole von sich und hetzte weiter.....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2301
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum© 1976/2018 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-95439-782-2Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Nr. 441
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 442
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 443
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 444
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 445
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 446
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 447
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 448
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 449
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 450
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 451
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 452
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 453
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 454
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 455
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 456
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 457
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 458
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Nr. 459
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 460
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1.
Luis Carrero war ein an Leib und Seele gebrochener Mann. Wie lange hockte er jetzt schon in der scheußlichen, stinkenden Vorpiek dieses gräßlichen Schiffes, der „Estrella de Málaga“? Wie viele Tage? Er wußte es nicht mehr. Mit dem Zählen hatte er aufgehört. Er schrie und fluchte nicht mehr, begehrte nicht mehr gegen seine Gegner auf. Er sprach auch nicht mehr, sondern blickte nur starr auf die düsteren Planken und das Schott, das ihm die Freiheit verwehrte.
Das Bilgewasser schwappte unter der Gräting. Jedesmal, wenn es hochschwappte, stieg Carrero der abscheuliche Gestank in die Nase. Schon oft war er kurz davor gewesen, sich zu übergeben. Immer wieder mußte er gegen die Übelkeit ankämpfen. Es fiel ihm schwer, furchtbar schwer.
Hundeelend war ihm zumute. Einmal war er bereits drauf und dran gewesen, sich zu dem schwarzhaarigen Bastard führen zu lassen und ihn um Gnade zu bitten. Aber der letzte Rest Stolz, den er noch in sich verspürte, hatte ihn daran gehindert.
Sehr stolz war er einst gewesen – der stolzeste und härteste Mann von Potosi. Nicht einmal Don Ramón de Cubillo, der Provinzgouverneur, hatte ihm Respekt eingeflößt. Mit dem hatte er geredet, wie es ihm paßte. Als Oberaufseher in den Silberminen des Cerro Rico war er ein geachteter und gefürchteter Mann gewesen, und wenn er mit seinen Hunden durch die Stadt zog, buckelten und dienerten die Bewohner vor ihm.
Aber der Schwarzhaarige – dieser elende Bastard – hatte alles zerstört. Gefangengenommen hatte er ihn, Luis Carrero, denn er brauchte eine Geisel und einen Führer, der ihn nach Potosi brachte. Unter den Namen de Castellano hatte er sich vorgestellt, dieser Halunke, aber sie nannten ihn den Seewolf. Mit seinem richtigen Namen hieß er Killigrew. Ein Engländer also. Und er hatte eine Crew von Hurensöhnen um sich geschart, zu der sogar ein Neger und eine Indianerin gehörten. Wie konnte es geschehen, daß ein verdammter Engländer, der sich, mit solchem Pack einließ, einen stolzen Spanier entwürdigte?
Nun, Carrero hatte versucht, sich gegen diese Teufelsmeute aufzulehnen. Es hatte keinen Zweck gehabt. Immer wieder war er gescheitert. Von dem gräßlichen Narbenkerl, dem Profos, hatte er sogar eine Tracht Prügel bezogen.
Dafür sollte der Hund büßen – und auch der Bastard Killigrew und die anderen Kerle mußten über die Klinge springen. Aber wie sollte er es schaffen, sich zu befreien, sich eine Waffe zu besorgen und gegen sie zu kämpfen?
Unmöglich. Er hatte alles versucht, was in seinen Kräften stand. Jetzt gab es nur noch eine Chance – die letzte. Er sollte dieses Drecksgesindel also durch die Berge führen, nach Potosi. Das würde er auch tun. Aber der Marsch war lang, er nahm mehrere Wochen Zeit in Anspruch. In einer der kalten Nächte, die dort oben herrschten, würde er, Luis Carrero, es schon verstehen, seine Bewacher zu überrumpeln und sich abzusetzen. Dann brauchte er nur noch den Provinzgouverneur zu alarmieren, und sich ein paar Soldaten aus Potosi zu holen – und das große Aufräumen begann.
Davon träumte Luis Carrero in seinem grimmigen, verdrossenen Schweigen. Aber er wartete vergebens darauf, daß sie ihn holten. Hatten die Schiffe – die „Estrella de Málaga“ und die „San Lorenzo“ – denn nicht längst die Küste nahe Arica erreicht? Was war los? Bootsbewegungen glaubte Carrero registriert zu haben, es schien sich etwas zu tun. Doch ihn schien man vergessen zu haben. Brauchten ihn die Hunde nicht mehr?
Eine dumpfe Ahnung bohrte in ihm. Wollten sie ihn etwa doch aufknüpfen, an der Nock der Großrah, wie sie es ihm schon mehrfach angedroht hatten? Erhoben sie sich zu Richtern über sein Leben? Wagten sie das wirklich?
Er spürte, wie ihm wieder einmal der Schweiß ausbrach. Nein, sie hatten kein Erbarmen mit ihm. Er war ihr Feind, wie auch sie seine erklärten Todfeinde waren. Hatte nicht die spanische Krone ein Kopfgeld für die Ergreifung dieses Killigrew ausgesetzt? Ja, Don Ramón de Cubillo hatte einmal – so konnte er sich jetzt wieder entsinnen – erwähnt, für welche englischen Hurensöhne man eine Prämie kassieren könnte, wenn man sie tötete und ihren Kopf Seiner Allerkatholischsten Majestät, Philipp II., überbrachte. Der Name Killigrew war dabeigewesen.
Wenn es ihm gelang, auszubrechen und Killigrew als Geisel zu nehmen, war alles gewonnen. Nein, unmöglich. Er gab sich nur falschen Hoffnungen hin. Hier, aus dem stinkenden Loch, dem Eingang der Hölle, gelangte er nicht mehr heraus. Nur zum Luftholen. Aber dann sperrten sie ihn gleich wieder ein. Er hatte jede Chance, die es möglicherweise noch für ihn gegeben hätte, verspielt.
Doch wo befand man sich in der Zwischenzeit? Wo ankerten die beiden Schiffe? Und was hatte der Betrieb zu bedeuten, der in Abständen an Oberdeck herrschte? Von dem, was sie sprachen, verstand Carrero kein Wort, denn er war des Englischen nicht mächtig, während sie Spanisch sehr gut beherrschten. Was hatte dieses Piratenpack vor? Wieder eine dieser Teufeleien? Schier Unglaubliches hatte Carrero erlebt, seit er ihr Gefangener war, und die Schreckensserie schien nicht mehr abzureißen. Was heckten sie jetzt wieder aus?
Er konnte es nicht ergründen. Es hatte auch keinen Sinn, daß er sich bei dem Kerl, der gerade vor dem Schott der Vorpiek Wache schob, danach erkundigte. Wie üblich würde er keine richtige Auskunft, sondern nur dumme Antworten erhalten.
Luis Carrero schwieg auch weiterhin. Er hatte die Beine an den Leib gezogen und starrte auf die düstere Schiffswand. Irgendwann hat alles ein Ende, dachte er – alles.
Carrero sollte nicht den Trupp von Männern führen, die nach Potosi aufbrachen – so hatte der Seewolf entschieden. Ursprünglich hatte der Oberaufseher der Silberminen tatsächlich als „Lotse“ dienen sollen, jetzt aber hatte Hasard die Pläne geändert.
Pater Aloysius hatte die Rolle des Bergführers übernommen, oben, im Tal von Tacna, wo die Männer der „Estrella de Málaga“ und der „San Lorenzo“ die Dominikanermönche unter Pater Franciscus und die dort ansässigen Indios vor dem Zugriff der Spanier bewahrt hatten – und vor dem Schicksal, als Sklaven in den Minen des Cerro Rico zu enden.
Mithin konnte der Potosi-Trupp auf Carrero verzichten. Mit Pater Aloysius hatten sie einen guten Mann auf ihrer Seite, einen, der in den Bergen zu Hause war, der Potosi kannte und außerdem auf der Seite der Indios stand. Dieser Mann, so hatte Hasard von Anfang an richtig erkannt, war mehr als Gold für das Unternehmen wert.
Smoky hatte den Potosi-Trupp bis auf Hasard selbst, Carberry, Dan O’Flynn und Karl von Hutten, die bereits oben in Tacna gewesen waren, zum Tal hinaufgebracht, und inzwischen rüsteten die Männer dort zum Aufbruch: Hasard, Pater David, Pater Aloysius, Jean Ribault, Karl von Hutten, Carberry, Dan O’Flynn, Matt Davies, Gary Andrews, Stenmark, Mel Ferrow und Fred Finley. In den nächsten Tagen und Wochen würden die Männer an Bord der Schiffe nichts mehr von ihren Kameraden hören. Eine lange Wartezeit begann.
Ben Brighton hatte von Hasard das Kommando über die „Estrella de Málaga“ übernommen. Auf der „San Lorenzo“ war es Jan Ranse, der Jean Ribault als stellvertretender Kapitän ersetzte.
Smoky hatte über diesen Beschluß Hasards berichtet, als er zur Ankerbucht der Schiffe zurückgekehrt war. Weiter hatte er erzählt, daß der Seewolf mit von Hutten, Carberry, Dan und Pater Aloysius am Vortag die drei Hängebrücken zwischen Arica und dem Tal von Tacna zerstört und einen weiteren spanischen Trupp, der ihnen ins Gehege geraten war, vernichtet hatten. Am Vormittag dieses neuen Tages – man schrieb den 27. November 1594 – pullte Smoky mit der Jolle, mit der man nur den Unterteil des Rio Tacna befahren konnte, zur „Estrella de Málaga“. Er ging längsseits, legte an der Bordwand an und enterte an der Jakobsleiter auf.
Als Ben Brighton sich nach Hasards vorerst letzten Befehlen erkundigte, erwiderte Smoky: „Die Order lautet, daß wir auch weiterhin den Gefangenen scharf bewachen sollen. So lange, bis der Trupp aus Potosi zurückgekehrt ist.“
„Und was geschieht dann mit Carrero?“ wollte Ferris Tucker wissen. „Hasard will ihn doch wohl hoffentlich nicht laufen lassen.“
Smoky hob die Schultern und ließ sie wieder sinken. „Das weiß ich nicht. Hasard hat es noch nicht entschieden. Er hat nur etwas angedeutet.“
„Raus damit“, sagte Shane schroff. „Du willst es doch wohl nicht für dich behalten.“
„Er will ihn vielleicht auf einer Insel aussetzen.“
„Was, den Carrero?“ sagte Roger Brighton ziemlich aufgebracht. „Das fehlte noch. So ein Dreckskerl ist eine Gefahr für die Menschheit, wo immer er sich auch aufhält.“
„Er muß verschwinden“, sagte Shane. „Für immer.“
„Also töten wir ihn?“ fragte Ben.
„Wir sollten über ihn richten“, entgegnete Ferris Tucker. „Was anderes als den Tod hat so ein Kerl ja wohl nicht verdient.“
„Darüber sind wir uns einig“, sagte Ben. „Aber die Entscheidung liegt bei Hasard. Wenn ein Bordgericht zusammentritt, wird er den Vorsitz haben, das wißt ihr genau.“
„Klar“, sagte Will Thorne, der Segelmacher, von der Kuhl aus. „Und deshalb lohnt es sich auch nicht, über diesen Punkt weiter herumzudiskutieren. Morgen bricht der Potosi-Trupp auf, und wir halten hier Wache und passen auf, daß Carrero uns nicht entwischt.“
„Es müßte schon mit dem Teufel zugehen, wenn ihm das gelingen sollte“, murmelte Sam Roskill.
„Aber jetzt mal weiter“, meinte Shane zu Smoky. „Du hast noch nicht zu Ende berichtet. Was hat Hasard noch alles gesagt?“
Smoky grinste. „Nichts Besonderes. Nur, daß er uns alle herzlich grüßen läßt und auf ein gemeinsames gesundes und glückliches Wiedersehen hofft.“
Sie alle standen beieinander und lauschten Smokys Worten. Die Zwillinge schnitten allerdings etwas mürrische Mienen. Sie waren enttäuscht, daß sie bei dem Potosi-Unternehmen nicht dabeisein konnten. Aber wer war das nicht? Araua ging es ebenso, und auch Jan Ranse und die Männer der „San Lorenzo“ waren alles andere als begeistert, daß sie nun so lange warten mußten.
Ja – etwas traurig waren sie schon, denn die Kameraden fehlten ihnen. Dann mußten sie aber doch grinsen. Der Anlaß dafür war Smokys Äußerung.
„Übrigens, von Ed soll ich auch was ausrichten“, sagte er und grinste von einem Ohr zum anderen.
„Was denn?“ fragte Ferris sofort. „Was kann der uns schon wünschen?“
„Einen herzlichen Gruß zunächst mal“, sagte Smoky fröhlich. „Und dann hat er sogar was für uns gedichtet, unser guter alter Profos. Ist das nicht rührend?“
Big Old Shanes Augen verengten sich ein wenig. „Was denn? Ein Gedicht? Für uns? Was hat das jetzt wieder zu bedeuten?“
„Du traust dem Braten nicht, was?“ fragte Ben und mußte lachen.
„Ich hab’ meine Gründe“, brummte Shane.
„Also“, sagte Roger aufmunternd zu Smoky. „Nun mal los. Wie lautet denn das Verslein?“
Smoky räusperte sich, dann legte er los: „Lebt wohl, ihr alten Affenärsche, ihr Rübenschweine und ihr Hirsche! Wir zieh’n jetzt los nach Potosi, vergeßt nicht euren Carberry!“
„He!“ rief Batuti von der Kuhl zum Achterdeck. „Habe ich das richtig verstanden? Affenürsche?“
„Ja“, erwiderte Smoky, und er grinste immer noch.
„Das haut dem Faß den Boden aus“, sagte Shane. Was anderes fiel ihm nicht ein.
„Affenürsche ist ein starkes Stück“, sagte nun auch Ben.
„Und Potosi“, sagte Ferris. „Das heißt doch gar nicht so. Das heißt Potosi.“
„Er hat aber Potosi gesagt“, erklärte Smoky.
„Potosi – wieso?“ fragte Bob Grey. „Das kapier’ ich nicht.“
„Das hat was mit Pott zu tun“, sagte Al Conroy.
„Quatsch“, entgegnete Luke Morgan. „Hör doch auf. Ich glaube, Carberry ist es ganz egal, ob er Potosi oder Potosi sagt.“
„Paddy scheint anders darüber zu denken“, meinte Sam Roskill. „Seht mal, er ist schwer beschäftigt.“
Verstohlen blickten sie zu Paddy Rogers, bei dem der Groschen bekanntlich nicht ganz so schnell fiel wie bei den anderen. Manchmal fiel er überhaupt nicht, der Groschen. So wie jetzt – und nicht einmal Jack Finnegan, sein bester Freund, konnte Paddy auf die Sprünge helfen.
Jack war selbst einigermaßen erstaunt und sann darüber nach, was es mit dem Profosspruch auf sich haben könnte.
„Affenürsche!“ stieß Paddy plötzlich etwas heiser hervor. Auf seiner Stirn hatten sich schwere Denkfalten gebildet. „Was ist das denn?“
Die Männer lachten. Smoky schaute zu Paddy und sagte: „Na, dann will ich dich aufklären. Das muß sich doch auf Hirsche reimen, klar?“
„Was denn?“
„Na, das mit den Ürschen.“
„Den Affenürschen?“
„Richtig“, erwiderte Smoky „Leuchtet dir das nicht ein?“
„Nein.“
„Paß mal auf“, erklärte Jack. „Sag mal Hirsche und Ürsche, dann fällt dir doch sicher was auf.“
„Ich sage Hirsche und Ärsche, das ist das gleiche“, sagte Paddy störrisch. „Das ist sogar richtig, oder?“
„Nicht, was den Reim betrifft“, versuchte Smoky ihm auseinanderzusetzen. „Ärsche reimt sich höchstens auf Bärsche.“
„Stimmt nicht“, sagte Jeff Bowie. „Es heißt Barsche und nicht Bärsche.“
„Was? Hab’ ich doch auch gesagt!“ stieß Smoky hervor.
„Nein! Und Barsche hat mit Ärsche nichts gemeinsam“, sagte der Kutscher, der sich nun ebenfalls zu ihnen gesellt hatte.
Paddy kratzte sich verzweifelt am Kopf, er war jetzt völlig verstört.
„Das mit den Affenürschen“, sagte er. „Das kann er doch nicht einfach machen.“
„Wer?“ rief Pete Ballie aufgebracht.
„Na, der Profos“, sagte Paddy bestürzt.
„Der macht, was er will!“ brüllte Pete. „Und ich hab’ keine Lust, mich mit Ürschen und Hirschen ’rumzuschlagen!“
„Paddy“, sagte der Kutscher und legte ihm dabei sogar mitfühlend die Hand auf die Schulter. „Nun hör mal gut zu. Man nennt das dichterische Freiheit. Ein Dichter darf auch zu einer Rah Baum sagen, wenn die Verse es so erfordern.“
„Was? Nein!“
„Es ist aber so, und man muß es ihm nun mal durchgehen lassen.“
„Wem?“ brüllte Pete. „Dem Profos? Unerhört!“
Blacky trat zu dem Rudergänger und sagte: „Nun halt aber mal die Luft an, Mister Ballie. Du brauchst dich hier nicht gleich aufzuregen, wenn es um solche Kleinigkeiten geht, nicht wahr?“
Pete sah ihn verdutzt an. „Wer regt sich denn auf?“
„Eins ist jedenfalls sicher“, sagte der Kutscher zusammenfassend. „Unser verehrter Profos ist ein großer Dichter und Poet. Vielleicht wird er mal berühmt.“
„Jetzt versteh’ ich die Welt nicht mehr“, sagte Paddy und zog dabei ein Gesicht, als wolle er mit Mac Pellew, der mit der Miene eines Totengräbers neben ihn getreten war, in Tränen ausbrechen. „Plötzlich sind die Affenärsche zu Affenürschen geworden – das geht doch nicht!“
„Alles Unsinn!“ rief Bob Grey plötzlich. „Ürsche reimt sich höchstens auf Hürsche, hat das noch keiner bemerkt?“
„Ich hab’s gleich begriffen“, erwiderte Hasard junior grinsend.
„Und Potosi reimt sich auch nicht auf Carberry“, fügte Philip junior hinzu.
„Das ist dichterische Freiheit!“ brüllte Pete Ballie.
„Hört jetzt endlich auf!“ schrie Blacky. „Ich habe die Schnauze voll. Merkt ihr nicht, daß ihr spinnt?“
Batuti blickte ihn an und entblößte seine perlweißen Zähne. „Du spinnst wohl nicht, was? Wenn wir schon spinnen, dann spinnen wir alle zusammen.“
„Soll ich den Spruch noch mal wiederholen?“ fragte Smoky mit treuherziger Miene.
„Nein!“ schrie Luke Morgan. „Schluß! Das hält keiner mehr aus!“
Auch auf dem Achterdeck herrschte Frohsinn.
„Sieh mal an“, sagte Ben lachend. „Ed ist wirklich ein Mann, den man so leicht nicht vergißt. Er sorgt auch dann noch für Heiterkeit, wenn er nicht an Bord ist und ihn alle vermissen.“
„Wer vermißt ihn denn?“ fragte Shane.
„Ohne ihn wird’s langweilig“, sagte Ferris. „Warte mal ab.“
„Wir haben aber noch zu tun“, sagte Ben. „Wir werden hier nicht nur rumstehen und Däumchen drehen. Wir haben noch eine Aufgabe, oder habt ihr das schon vergessen?“
2.
Es fiel den Männern jetzt, nachdem genügend über Carberrys „Gedicht“ gelacht und diskutiert worden war, wieder ein: Ein weiterer Vorschlag von Hasard mit einer entsprechenden Empfehlung an Ben Brighton lautete, er möge doch in Erwägung ziehen, den Padres oben im Tal von Tacna bei den Aufbauarbeiten ihrer ziemlich zerstörten Anlagen zu helfen.
Ben Brighton sprach diesen Plan noch einmal mit den Männern durch. „Wir sollten gleich einen Trupp einteilen, der mit der Jolle nach Tacna aufbricht“, erklärte er. „Hasard hat ja auch gesagt, wir könnten unsererseits von dort Proviant beziehen, nicht wahr?“
„So ist es“, bestätigte Smoky. „So vervollkommnen wir unseren Speisezettel, nicht wahr?“
„Hat jemand was an der Kombüse auszusetzen?“ fragte der Kutscher mit ziemlich lauter Stimme.
„Niemand“, erwiderte Ben lachend. „Aber es bietet sich hier eine Gelegenheit, ein wenig Abwechslung zu schaffen.“
„Wir können nicht immer nur Eier essen, und die Hühner legen im Moment auch ziemlich schlecht“, sagte Blacky.
Mac Pellew sah ihn giftig an. „Setzen wir euch etwa nur Eier vor, du Prielwurm?“
„In letzter Zeit nicht, weil die Hühner schlecht legen“, erwiderte Blacky grinsend.
„Los, keine Sprüche mehr klopfen“, sagte Sam Roskill. „Geht’s endlich los? Gut!“ Er spuckte in die Hände. „Es wird Zeit, daß es wieder was zu tun gibt!“
„Sehr richtig!“ rief Ferris. „Ganz abgesehen davon, daß die Wartezeit dann nicht so eintönig ist!“
„Das hab’ ich ja gemeint“, brummte Sam.
„Ein guter Vorschlag“, sagte Big Old Shane. „Ich glaube, die Männer begrüßen ihn auch alle, Ben.“
„Ja.“ Ben ließ seinen Blick über die Gesichter der Männer wandern. „Wer meldet sich freiwillig?“
„Ich als erster!“ rief Sam.
„Alle!“ brüllte Pete Ballie, und schon flogen die Arme hoch.
„Ferris“, sagte Ben. „Du übernimmst die Leitung des Trupps. Stell ihn beliebig zusammen.“
„He!“ schrie Jan Ranse von Bord der „San Lorenzo“ zu ihnen herüber. „Wir haben alles gehört! Nehmt wenigstens ein paar von uns mit! Wir sterben sonst vor Langeweile!“
„Einverstanden!“ rief Ben.
„Wann bricht der Trupp auf?“ wollte Smoky wissen.
„Morgen“, erwiderte Ben. „Heute bleiben wir noch an Bord. Ihr könnt euch also Zeit lassen.“
Ferris stellte in aller Ruhe den Trupp zusammen.
„Smoky“, sagte er. „Du bist auf jeden Fall mit dabei. Schließlich kennst du die Route bereits.“
„He, Ferris“, sagte Sam Roskill. „Vergiß mich nicht. Schließlich habe ich mich als erster gemeldet.“
Der rothaarige Riese grinste. „Gut, einverstanden. Weiter hätte ich gern Roger Brighton und den Kutscher dabei – und Bill.“
„Uns hättest du aber auch gern mitnehmen können“, sagte Philip junior, und sein Bruder Hasard pflichtete ihm mit grimmigem Nicken bei.
„Hier wird nicht debattiert“, sagte Ferris. „Wen ich brauchen kann und wen nicht, das bestimme ich, klar?“
„Aye, Sir“, antworteten sie wie aus einem Mund.
„Kerls, beruhigt euch“, sagte Ferris einlenkend. „Wir lösen uns natürlich ab, und zwar im Drei-Tage-Turnus. Bei der nächsten Schicht seid ihr mit dran.“
Die Mienen der Zwillinge hellten sich wieder auf, und auch die anderen Mitglieder der Crew blickten wieder etwas zuversichtlicher drein. Nichts setzte ihnen mehr zu als die Aussicht, auf unabsehbare Zeit dem absoluten Nichtstun ausgeliefert zu sein.
Sie waren daran gewohnt, zu handeln, und jedes zu lösende Problem gingen sie am liebsten frontal an. Potosi hingegen war ein besonderer Fall. Das hatten sie schon gewußt, als Jean Ribault auf der Schlangen-Insel das Unternehmen zur Sprache gebracht und sie darüber abgestimmt hatten.
Nicht die kompletten Crews der Schiffe konnten sich auf den ziemlich langen Marsch begeben, der durch unwirtliches Bergland führte, es durfte nur ein kleiner Trupp sein, nicht stärker als ein Dutzend Mann. Dafür gab es mehrere Gründe.
Erstens durften die „Estrella“ und die „San Lorenzo“ nicht unzureichend bewacht in der Bucht zurückbleiben. Die Erfahrung hatte bewiesen, daß immer wieder völlig unversehens die Spanier auftauchen konnten. Deshalb mußten die Männer der Karavelle und der Galeone stets auf ein Gefecht vorbereitet sein.
In Potosi wiederum durfte Hasard nicht mit zu vielen Männern auftauchen, sonst erregte er sofort Aufsehen. Selbst als Spanier getarnt, mußten sie stets höllisch aufpassen, auch das hatten sie in den vergangenen Wochen immer wieder feststellen müssen. Und ein Kerl wie der Provinzgouverneur Don Ramón de Cubillo, der in Potosi hockte und auf Nachschub an Sklaven für die Minen wartete, war mit Sicherheit auch nicht zu unterschätzen.
Richtig war daher die Entscheidung, mit einer kleinen Gruppe zum Cerro Rico aufzubrechen. Der Rest der beiden Crews war zum Nichtstun verdonnert, aber man mußte das Beste aus jeder Situation machen.
Ferris Tucker wählte von den Männern der „San Lorenzo“ Mulligan, Grand Couteau und Roger Lutz aus – Kerle, die zupacken konnten.
Mulligan lachte, als er vernahm, daß er mit zum ersten „Aufräumtrupp“ gehörte.
„Das ist mal was“, sagte er. „Die Padres werden sich wundern, wie schnell wir ihnen wieder alles herrichten. Hoffentlich haben sie auch einen guten Schnaps.“
„Entschuldige mal“, sagte Albert, der von Montbars der „Gelegenheitsbucklige“ genannt wurde, mit süffisantem Grinsen. „Wieso sollen denn ausgerechnet diese frommen Ordensbrüder so ein Zeug brauen?“
„Ich habe gehört, daß die den besten Kräuterschnaps herstellen“, sagte Mulligan. „Aber davon hast du offenbar keine Ahnung.“
„Hugenotten haben mit Mönchen nicht viel im Sinn“, sagte Albert kichernd.
„Du bist gar kein Hugenotte“, sagte Mulligan mit wildem Grinsen. „Du bist bestenfalls Hugo, der Sohn einer N…“
„Halt“, sagte Le Testu beschwichtigend. „Das geht wirklich zu weit. Mit dem Dichten nimmt es überhand, und nicht jeder ist dazu geboren. Mulligan, ich mach’ dir einen Vorschlag. Du fragst diese Franciscus-Brüder, oder wie sie heißen, frei heraus, ob sie Schnaps haben. Wenn ja, bringst du welchen mit.“
„Und du säufst die Flasche aus und erzählst mir, wie das Zeug geschmeckt hat, ja?“
„So ungefähr habe ich mir das vorgestellt“, erwiderte Le Testu lachend. „Und beim nächsten Turnus bin ich mit von der Partie und bringe dir eine Pulle mit.“
„Ihr seid ganz schön bescheuert“, sagte Mulligan und meinte die „französische Landsmannschaft“ an Bord der „San Lorenzo“, die ja recht stark vertreten war. Ehe die „Franzmänner“ jedoch Protest erheben konnten, erschien Jan Ranse bei ihnen und sprach mit ihnen durch, wie er sich die Einteilung der nächsten Arbeitsgruppen vorstellte. Ferris hatte ihm dabei völlig freie Hand gelassen.
So hatten alle Männer die Gelegenheit, das Tal von Tacna kennenzulernen und sich bei den Dominikanermönchen nützlich zu machen. Sie spuckten schon jetzt in die Hände und nahmen eine kräftige Abendmahlzeit ein, um sich für den nächsten Tag zu stärken. An Bord der „Estrella de Málaga“ beriet Ben Brighton unterdessen noch einmal mit seinen Männern auf dem Achterdeck, wie das „Programm“ für die nächsten Tage aussehen sollte.
„Eins dürfen wir nicht vergessen“, sagte er. „Wir wollen auch Arica erkunden. Das war schon vorher so mit Hasard geplant.“
„Aber sicher doch“, sagte Big Old Shane. „Da werden wir mal kräftig zuschlagen, bevor wir uns von dieser Küste wieder empfehlen.“
„Wir wollen doch dafür sorgen, daß die Dons uns so schnell nicht wieder vergessen“, sagte Smoky. „Und wie kann man das erreichen? Am besten durch zündende Beispiele.“
„Dann muß Ferris aber noch entsprechend viele Höllenflaschen herstellen“, warf Roger Brighton ein.
„Das wird er auch tun“, sagte Ferris grimmig. „Ich hätte mich ohnehin um Nachschub gekümmert. Es ist ja meistens so, daß man die Dingerchen dann am dringendsten braucht, wenn man es am wenigsten vermutet.“
„Also gut“, sagte Ben. „Dann wollen wir also Einsatz zeigen. Sollten uns in der Zwischenzeit irgendwelche vorwitzigen Dons aufstöbern, erteilen wir ihnen eine Lektion. Wir werden mit beiden Schiffen fast immer in Gefechtsbereitschaft sein.“
„Recht so“, sagte Big Old Shane. „Und ich schätze, daß Batuti und ich morgen wieder einen Vorrat an Brand- und Pulverpfeilen schaffen. Die können wir schließlich irgendwann auch noch gut gebrauchen, nicht wahr?“
„Ja“, erwiderte Smoky. „Aber trotz allem befinden wir uns in einer miesen Situation.“
„Fang jetzt nicht wieder damit an“, sagte Ferris drohend. „Ich weiß selber, daß es Mist ist, von Hasard und dem Trupp nichts mehr zu erfahren. Sie sind sich selbst überlassen, wir können nichts für sie tun. Aber das ist nun mal so. Wenn du von Falmouth querfeldein nach London marschieren würdest, wüßte ich von dir auch nicht, was dir passiert.“
„London ist von Falmouth nicht so weit weg wie Potosi von dieser Bucht“, sagte Smoky.
„Da würde ich mal nicht so sicher sein“, sagte Ben.
Ferris lachte. „Außerdem gibt es in Potosi mehr zu holen als in London, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“
„Amen“, sagte Smoky. „Du weißt immer alles besser, wie? Aber die ganze Sache scheint mir unter einem Unstern zu stehen. Weißt du, was ein Unstern ist? Er ist fast so schlimm wie ’ne Wasserleiche.“
„Aufhören“, sagte Shane grollend. „Spar dir die Sprüche für die Schlangen-Insel auf, da hast du einen besseren Zuhörer für deine dummen Sprüche, nämlich Donegal.“
„Wenigstens einer, der Ahnung hat“, sagte Smoky.
„Ich glaube, daß Hasard und der Trupp gute Chancen haben, unbehelligt nach Potosi zu gelangen“, sagte Ben Brighton. „Pater Aloysius ist sicherlich ein besserer Führer als Carrero, bei dem man ständig mit einem Fluchtversuch hätte rechnen müssen.“
„Oder er hätte versucht, unsere Leute in die Irre zu führen“, sagte sein Bruder. „Bestimmt hätte er sie am liebsten in eine Schlucht geleitet.“
„Der ist giftiger als hundert Schlangen“, sagte Ferris. „Aber er kriegt sein Fett auch noch, verlaßt euch drauf.“ Seine Vorhersage sollte sich bewahrheiten, aber ganz anders, als sie alle es sich vorstellten.
Am nächsten Tag brach Ferris Tuckers Arbeitstrupp mit einer der Jollen nach Tacna auf. Eine andere Jolle war ständig bereit, den Posten – in diesem Fall Mac Pellew – ablösen zu lassen, den Ben an der Küste hatte aufziehen lassen.
Mac – und die Männer, die ihn bei den nächsten Wachschichten ablösen würden – hatte die Aufgabe, die Bucht von der Seeseite her so abzuschirmen, daß man gegen unliebsame Überraschungen gewappnet war. Zumindest war auf diese Weise gewährleistet, daß jedes Auftauchen fremder Segler rechtzeitig gemeldet wurde.
Mac befand sich auf der Südseite des Mündungstrichters des Rio Tacna, und zwar auf einer überhöhten Felsnase, die fast unmittelbar bis in die See reichte. Er hatte einige Zeit hier zuzubringen, denn es war seine Aufgabe, im Sechs-Stunden-Törn rund um die Uhr hier Ausguck zu halten. Nach ihm würde Blacky an der Reihe sein, dann Pete Ballie, dann Philip junior und danach Hasard junior. So ging es weiter, der Turnus war von sechs Uhr früh beginnend eingerichtet, nur zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens gab es zweimal eine Drei-Stunden-Wache.
Der jeweils neue Posten segelte mit der Jolle zur Felsnase, der andere abgelöste Posten kehrte zur „Estrella de Málaga“ zurück. Bei Alarmmeldung oder Gefahr im Verzug mußte der Wachtposten durch die Felsen zurück zur Bucht klettern – ein etwas unbequemer Weg. Darum hatten die Männer die Jolle als Transportmittel vorgezogen. Andererseits aber wäre sie zu auffällig gewesen, wenn sie bei der Annäherung eines Schiffes flußaufwärts zur Bucht gesegelt wären, um die Kameraden zu alarmieren.
Das felsige, buschbestandene Gelände bis zur Bucht hin bot genügend Deckung. Das bedeutete also: Die normalen Wachwechsel wurden mit der Jolle vollzogen, aber bei dem geringsten Anzeichen von Gefahr begab sich der jeweilige Aufpasser zu Fuß auf den Weg und arbeitete sich auf dem „Kriechpfad“ bis zum Ufer der Bucht vor.
An Bord beider Schiffe herrschte wieder völlige Ruhe, nachdem Ferris mit seinem Trupp verschwunden und Mac als erster Wachtposten zu der Felsnase übergesetzt war. Ben Brighton überprüfte noch einmal den Plan für die Wachschichten, dann ließ er Luis Carrero an Deck holen, der wie üblich zumindest eine Stunde Luft schnappen durfte.
Carrero erschien, bewacht von Batuti und Bob Grey. Er sprach kein Wort und hielt den Kopf gesenkt. Vor dem Vordecksschott blieb er stehen, als warte er auf einen Befehl.
„Nun geh schon“, sagte Bob. „Vertritt dir ein bißchen die Füße.“
Carrero setzte sich etwas wankend in Bewegung. Rein äußerlich war er nur noch ein Schatten seiner selbst. Aber wie sah es in seinem Inneren, in seiner unauslotbaren Seele aus? Das fragten sich die Männer, während sie ihn beobachteten. Aber sie waren sich darüber einig, daß es keinem von ihnen gelingen würde, jemals ganz zu erforschen, was in diesem Kerl vor sich ging.
Carrero verhielt sich wie ein folgsames Hündchen. Er zeigte sich nicht mehr renitent, stellte keine Fragen und vermied alles, was seine Bewacher in irgendeiner Weise reizen konnte. Die Abreibungen, die Carberry ihm verpaßt hatte, sowie das Wahnsinnsabenteuer mit dem Kranken hatten ihn wirklich mächtig mitgenommen. Er schlurfte über das Hauptdeck, und an seinem Gebaren war kaum etwas Gespieltes, Vorgetäuschtes.
„Der ist wirklich am Ende“, sagte Philip junior leise zu seinem Bruder und zu Araua, die mit ihm auf der Back standen.
„Laßt euch nichts vorgaukeln“, sagte Araua. „Er hat immer noch Kraft und Haß genug, um etwas Böses auszuhecken.“
Plymmie schien ihrer Meinung zu sein, sie duckte sich etwas und fletschte die Zähne. Leise begann sie zu knurren.
„Sei still“, sagte Hasard junior. „Wir wissen ja, daß du ihn nicht ausstehen kannst.“
Er mußte die Wolfshündin aber doch unter Deck bringen, denn sie wollte keine Ruhe geben. Kurz darauf enterten die Zwillinge in eine Jolle ab, die schon an der Bordwand der „Estrella“ bereitlag. Auch sie hatten ihr „Programm“ für diesen Vormittag: Fischen. In der Bucht gab es ihrer Überzeugung nach einiges zu holen – und sie sollten sich nicht täuschen, wie sich noch herausstellte.
Ben Brighton hatte Luis Carrero die Ketten abnehmen lassen. Dennoch blieb der Mann gefesselt, aber er hatte immerhin nicht mehr an der Last der Eisen zu schleppen. Er konnte sich ganz gut bewegen. Nur an Flucht brauchte er nicht zu denken. Wenn er über Bord sprang und ans Ufer zu schwimmen versuchte, ertrank er jämmerlich.
Das hielt er sich noch einmal vor Augen, während er sich müde über die Planken bewegte. Überhaupt: Sie paßten scharf auf und verfolgten jede seiner Bewegungen mit ihren Blicken. Der schwarze Riese schaute drein, als warte er nur auf eine Gelegenheit, ihn packen und würgen zu können. Nein – Carrero brauchte sich auch weiterhin nicht den geringsten Illusionen hinzugeben.
Wo er sich befand, wußte Luis Carrero nicht. Hatte er diese Bucht jemals gesehen? Vorsichtig blickte er sich um. Nein, er konnte sich dessen nicht entsinnen. Er hatte keine Ahnung, wo sie ankerten. Fragen wollte er nicht, die Kerle teilten es ihm aus freien Stücken sowieso nicht mit.
Allerdings war da ein Punkt, der ihm jetzt wieder einfiel. Der schwarzhaarige Bastard Killigrew, dieser Teufel aller Teufel, hatte sich kürzlich bei ihm nach Tacna erkundigt. War das eine Möglichkeit? Konnte es sein, daß sie sich in einer Bucht unterhalb des Tals von Tacna befanden?
Carrero unterdrückte ein schwaches Grinsen. Möglich war es – sehr wahrscheinlich sogar. Somit war er schon einen Schritt weiter. Er ahnte wenigstens, wo er war und das war eine Menge wert.
Noch etwas fiel ihm jetzt auf. Der Bastard Killigrew zeigte sich nicht an Deck. Dabei war er sonst immer anwesend, wenn er, Carrero, seine Runde drehte. Was hatte das zu bedeuten?
Und wo war dieser Profos – das Ungeheuer? Er schien ebenfalls verschwunden zu sein. Seltsam war das. Waren sie überhaupt nicht mehr an Bord? Auch eine Jolle war verschwunden, ebenso einer der beiden Hakenmänner, den sie Matt Davies nannten.
Carrero schaute sich etwas aufmerksamer um. Da fehlten noch mehr Leute: Die beiden Hellblonden beispielsweise, die, wenn er sich nicht irrte, Gary und Sten gerufen wurden. Und dieser andere hellhaarige Kerl, der mit der Navigation zu tun hatte – Dan! Auch er war spurlos verschwunden.
Die Zwillinge hatten unterdessen mit der Jolle ungefähr das Zentrum der Bucht erreicht. Sie warfen ihre Angeln aus. Philip junior stieß seinen Bruder jedoch plötzlich mit dem Ellenbogen an. „He, sieh mal!“
„Was? Wo?“ stieß Hasard junior etwas verblüfft aus.
„Da drüben! Da wimmelt’s!“
„Von Fischen!“ rief Hasard junior. „Mann, das sieht ja aus, als ob das Wasser kocht!“
Keine zehn Yards von ihrem jetzigen Standort entfernt zappelte und zuckte es unmittelbar unter der Wasseroberfläche. Sie packten die Angeln weg, griffen wieder nach den Riemen und pullten auf die Stelle zu.
„Den Haken kannst du dir sparen“, sagte Philip schwer atmend. „Bruder, gib mal den Kescher her.“
Blacky hatte Mac Pellew auf der Felsnase abgelöst. Mac war wieder an Bord und verfolgte mit gemischten Gefühlen, wie die Zwillinge die Kescher ins Wasser tauchten und hüpfende, zappelnde Fische in die Jolle luden.
„Sind die auch eßbar?“ rief er ihnen zu.
„Klar!“ rief Philip junior zurück. „Die sehen aus wie Heringe!“
Carrero registrierte, daß die Männer von diesem Geschehen mehr und mehr abgelenkt wurden. Auch der schwarze Affe, wie er ihn insgeheim nannte, und der andere Aufpasser, dieser Grey, warfen jetzt immer öfter Blicke auf die fischenden Zwillinge.
Langsam schritt Carrero weiter und rückte der Nagelbank des Großmastes näher. Gab es denn nirgends eine Waffe, die er an sich reißen konnte? An Flucht war nicht zu denken, aber er konnte sich zumindest ein Hilfsmittel besorgen, wenn sie gerade nicht auf ihn achteten.
Der Zeitpunkt schien günstig zu sein. Von der Vorpiek aus hatte er gehört, daß mehrere Male in eine Jolle abgeentert worden war, die dann auch ablegte. Und richtig – an diesem Vormittag schienen viel weniger Leute als sonst an Bord zu sein. Das war sehr merkwürdig, für ihn aber möglicherweise von großem Vorteil. Es kam eigentlich nur darauf an, wie er das nutzte.
Er schritt auf und ab und tat so, als sei er mit sich selbst beschäftigt. Hin und wieder blickte er aus den Augenwinkeln zu den fischenden Jungen. Es war wirklich erstaunlich, was sie da an Bord der Jolle hievten. Ihr Tun fand mittlerweile das ungeteilte Interesse der kompletten Crew.
„Silbrige Fische“, sagte Nils Larsen mit Kennermiene. „Die sehen wirklich aus wie richtige Heringe.“
„Hast du schon mal falsche Heringe gesehen?“ fragte Mac Pellew knurrig.
„Ja, und zwar als Heringe verkleidete Dorsche“, erwiderte Nils schlagfertig. „Wie findest du das?“
„Ziemlich dusselig.“
„Fangt nicht an zu zanken!“ rief Bob Grey ihnen lachend zu. „Denkt lieber an die schöne Mittagsmahlzeit, die wir jetzt kriegen!“
„Denk mal an die Auswirkungen“, sagte Nils.
„An die was?“ fragte Batuti. „Spinnst du? Fisch ist gut für ’n Geist und für die Muskeln, das weiß doch jeder.“
Nils musterte ihn. „Nicht nur dafür. Kannst du dich nicht erinnern? Heringe bewirken so allerlei.“
„Ich krieg’ zuviel“, sagte Al Conroy stöhnend. „Geht das jetzt wieder mit der Manneskraft los? Hör bloß auf!“
Mac rollte plötzlich mit den Augen.
„Her mit den Fischen!“ rief er den Zwillingen zu. „Ich will sie braten, verdammt noch mal!“
3.
„Was ist denn in Mac gefahren?“ fragte Ben Brighton überrascht.
„Er kriegt sich nicht mehr ein“, erwiderte Shane, der die Fäuste in die Seiten gestemmt und eine grimmige Miene aufgesetzt hatte. „Wegen der Heringe.“
„Das sind keine Heringe“, sagte Ben. „Das sind allenfalls Anchovetas.“
„Was für Dinger?“
„Eine Fischart, die in Massen vor dieser Küste auftritt“, erklärte Ben. „Sie ist wohl mit den Heringen verwandt, aber eben doch anders, auch vom Geschmack des Fleisches her. Die Anchovetas können unterarmlang werden.“
„He!“ brüllte Mac zur Jolle hinüber. „Ihr habt den Kahn doch voll! Gleich sauft ihr ab! Kommt her! Pullt an, Jungs!“
Carrero war stehengeblieben und tat so, als genieße er die Sonne, die sein Gesicht und seine Gestalt wärmte. Dabei versuchte er, die Windrichtung festzustellen und sich zu orientieren. Wo war Norden, wo Süden? Er atmete tief durch, überlegte und spähte aus schmalen Augen nach allen Seiten. Allmählich gelang es ihm, sich zurechtzufinden.
Pete Ballie war inzwischen zu Mac Pellew getreten und legte ihm die rechte Pranke auf die Schulter. „Mac, hör mal zu. Was soll das Geschrei?“
„Wird Zeit, daß wir was zu beißen zwischen die Zähne kriegen“, entgegnete Mac hastig. „Ist doch Mittag, oder?“
„Die Suppe ist schon gar, oder täusche ich mich?“
„Wir hauen ein paar ordentliche Kaventsmänner mit in die Suppe rein, äh – Fische, meine ich.“
„Es sind Anchovetas“, sagte Bob Grey, der nähergetreten war. Er hatte vernommen, was Ben und Shane gesprochen hatten.
„Das ist egal“, sagte Mac. „Wir wollen Fisch futtern, gebraten und gekocht. Jawohl, und einlegen kann man die Biester auch, dann hat man immer einen Vorrat.“
Pete packt auch Nils am Arm und zog ihn langsam zu sich heran.
„Ich habe nichts gegen Fisch“, sagte er. „Aber mir stinkt euer Gequatsche.“
„Halt die Luft an, Pete“, sagte Jeff Bowie. „Das ist doch eine feine Sache, das mit der Manneskraft.“
„Laß dich nicht anstecken“, sagte Pete drohend. „Ich habe noch von seinerzeit, von der Ostsee vor Bornholm, die Nase voll, als Mac das große Spinnen anfing.“
„Ich und spinnen?“ Mac wurde wütend. „Glaub bloß nicht, daß ich mich von dir beleidigen lasse!“
„Wo willst du mit deiner Manneskraft hin, wenn keine Frauen da sind?“ fragte Pete. „Wir können schließlich nicht nach Arica segeln, du Walroß. Wie stellst du dir das vor?“
Mac kratzte sich am Kopf. „Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.“
„Außerdem sind es Anchovetas und keine richtigen Heringe“, stellte Bob noch einmal fest. „Damit hat sich wohl der Fall.“
Batuti blickte ins Wasser. „Im klaren Wasser kann man ganze Schwärme sehen“, brummte er. „Wie in Gambia. Man kann sie mit Pfeilen schießen.“
„Die Mühe brauchst du dir nicht zu machen“, sagte Jack Finnegan. „Unsere Kerlchen haben genug gefangen und kehren zu uns zurück.“
Die Zwillinge pullten zur „Estrella de Málaga“ zurück. Von der „San Lorenzo“ legte nun auch eine Jolle ab – Eric Winlow, Tom Coogan und Jonny erschienen, um sich ihren „Anteil“ zu holen, den Philip und Hasard Jan Ranse großzügig versprochen hatten.
„Ihr könnt die Viecher euch selber keschen!“ rief Mac Pellew ihnen zu.
„Ha, ha!“ rief Winlow und deutete auf die Jolle der Zwillinge, die vor lauter Fisch wahrhaftig auf Tiefe zu gehen schien. „Das reicht doch für alle, und wir haben noch was dabei übrig!“
„Faulpelze“, sagte Mac. Dann aber suchte er die Kombüse auf, um mit den Vorbereitungen für das Ausnehmen der Anchovetas zu beginnen.
Luis Carrero hatte die Gelegenheit genutzt. In dem Augenblick, in dem wegen der Fische Aufregung entstanden war, hatte er sich auf die Nagelbank des Großmastes zubewegt und einen der Belegnägel an sich gebracht.
Seine Hände waren ihm auf den Rücken gefesselt, aber er stellte sich vor die Nagelbank, packte zu und schob sich den Belegnagel hinten unter das Hemd. Immer wieder blickte er sich dabei nach allen Seiten um. Doch niemand hatte sein Handeln bemerkt – nicht einmal Ben Brighton, der in diesem Moment ebenfalls durch die Ankunft der „Fisch-Jolle“ abgelenkt war.
Luis Carrero nahm seinen Gang über das Hauptdeck wieder auf. Die Begebenheit mit den Anchovetas schien er nicht verfolgt zu haben, sein Benehmen war – nach außen hin – apathisch und stumpf. Innerlich aber begann er wieder Hoffnung zu schöpfen. Er hatte eine Schlagwaffe! Das war besser als gar nichts, und er würde sie zu nutzen wissen.
An diesem Mittag setzte auf beiden Schiffen das große Fischbraten ein. Die Männer der „San Lorenzo“ waren von den Arwenacks gewissermaßen angesteckt worden: Aus der Kombüse der Galeone stiegen mächtige Qualmwolken auf. Tom Coogan und Jonny gingen Eric Winlow kräftig zur Hand. Le Testu hatte sich freiwillig gemeldet – er würzte die Fische.
Winlow drehte und wendete sie auf dem Eisenrost über dem offenen Holzkohlenfeuer. Donald Swift holte immer eine „Fuhre“ ab, wenn sie gar war, und teilte die Fische auf der Kuhl an die Männer aus, die sofort zulangten und mit begeisterten Gesichtern zu essen begannen.
„Die schmecken wirklich gut“, sagte George Baxter. „Aber ich könnte sie mir auch eingelegt vorstellen.“
„In Öl, mit Lorbeer, Thymian und Pfeffer“, schwärmte Montbars.
„Was sagst du da?“ fuhr Gordon McLinn ihn an. „Pfui, Teufel! Man muß die Biester räuchern und in Essig einlegen, dann sind sie erst richtig gut!“
Jan Ranse trat zu ihnen, er hatte selbst gerade einen Anchoveta verspeist.
„Nun streitet euch nicht“, sagte er. „Jeder hat seinen Geschmack und seine Gewohnheiten.“
„Stimmt“, sagte Baxter. „Aber was ist das drüben bei den Arwenacks für ein Gerede von den Ostseeheringen? Die schwärmen ja in allen Tönen.“
„Nun ja“, sagte Jan grinsend. „Mac meinte damals, die geräucherten Fische verhelfen einem Kerl zu mächtiger Manneskraft.“
„So ist das“, sagte Baxter, dann lachte er dröhnend. „Na, wer’s glaubt, wird selig!“
„Wenn schon, dann muß man die Dinger richtig würzen“, meinte Albert mit listiger Miene.
„Wie denn?“ fragte McLinn. „Etwa mit Knoblauch? O Hölle!“
„Ihr Engländer lernt es nie“, sagte Albert giftig. „Für euch ist das Essen eine Notwendigkeit. Für uns ist es eine Kunst und eines der höchsten Vergnügen.“
„Es kommt gleich nach dem anderen“, erklärte Pierre Puchan. „Und damit wären wir wieder beim Thema Nummer eins. He, Montbars, willst du die Pulle Wein ganz allein aussaufen? Her mit dem Zeug!“
Die Flaschen machten die Runde. Auch an Bord der „Estrella de Málaga“ sorgte Ben Brighton für die entsprechende Stimmung, indem er sogar eine Extrarunde Brandy spendierte. Es wurde gelacht und geredet, und wieder gingen die haarsträubendsten Gerüchte über die Bornholm-Heringe im allgemeinen und die Arica-Anchovetas im besonderen um.
„Ich finde, die lieben Tierchen sind noch besser als Heringe“, sagte Shane, nachdem er die letzten Gräten seiner Ration abgelutscht hatte. „Wie viele davon können wir mitnehmen, Ben?“
„Ich würde gern die Proviantkammer füllen“, erwiderte Ben. „Aber frischer Fisch wird natürlich schnell schlecht.“
„Wir können ihn einsalzen.“
„Oder einlegen“, sagte Ben. „Besser noch wäre es, ihn zu räuchern. Wir sollten an Land eine Räucherei einrichten.“
„Meinst du das im Ernst?“
„Ja. Auch das wäre eine willkommene Abwechslung.“
„Im Trott des Wartens, ja“, brummte der graubärtige Riese. „Keine schlechte Idee.“
Sie aßen weiter, tranken dazu Wein und Brandy und legten die Details zurecht: wo die Räucherei gebaut werden sollte, welches Material man sich besorgen würde und wer als „Räuchermeister“ in Aktion treten sollte. Mac Pellew wäre der richtige Mann gewesen, aber da der Kutscher nicht an Bord war, war er eigentlich in der Kombüse unentbehrlich.
„Wie wär’s mit Blacky?“ fragte Shane.
„Der läßt die Fische verräuchern“, sagte Ben.
Araua, die sich inzwischen zu ihnen gesellt hatte, lachte. „Das ist ja wirklich ein Problem. Ich melde mich freiwillig. Ich kann Fische backen, braten und räuchern.“
„Aber du verräucherst dir dein schönes Haar“, sagte Ben. „Nein, das ist nichts für dich.“
„Baxter ist der richtige Mann“, sagte Shane. „Der hat keine Haare und kann sich nichts versengen oder verräuchern.“
Sie lachten zusammen. Die Stimmung war prächtig und hätte besser nicht sein können. An und für sich hatten sie nicht gedacht, daß der erste Tag nach der „Abreise“ des Potosi-Trupps so gut verlaufen würde. Die Stunden verstrichen recht schnell, allmählich wurde es dunkel. Was aber die Nacht für sie bereithielt, ahnte keiner von ihnen.
Luis Carrero hockte wieder in seinem Verlies. Er lehnte sich mit dem Rücken gegen die Wand und atmete erst einmal tief durch. Dann tastete er mit den Fingern nach dem Belegnagel, der hinten unter seinem Hemd steckte, und grinste. Soweit hatte er es geschafft. Jetzt folgte der zweite Teil des Unternehmens.
Irgendwie mußte es ihm gelingen, sich der Handfesseln zu entledigen. Daß er keine Ketten mehr trug, war bereits ein erheblicher Vorteil. Sie hatten ihn derart behindert, daß er nicht einmal durch die Vorpiek hatte kriechen können. Jetzt änderte sich einiges an seiner Lage – und sein Trübsinn und seine Niedergeschlagenheit waren wie weggewischt.
Die Hoffnung auf Flucht war wieder da. Es gab eine Rettung – und er würde nicht sterben, wie diese Bastarde ihm prophezeit hatten. Nein, er würde nicht an der Rah baumeln, und sie würden seinen leblosen Leib auch nicht wild lachend in die See werfen.
All die Schreckensvisionen von seinem eigenen Ende, die ihm die Angst und die Verzweiflung in Alpträumen und Trugbildern vorgegaukelt hatten, verblaßten. Er schöpfte wieder Mut und Selbstvertrauen.
Nicht sie würden triumphieren – diese elenden Bastarde –, sondern er würde der stolze Sieger sein, stolz wie ehemals, als er mit seinen Bluthunden durch Potosi zog und jedermann Furcht einflößte und Respekt abverlangte.
Er, Luis Carrero, allein gegen diese Horde von Schlagetots und Galgenstricken! Ja, er traute sich das zu. Der schwarzhaarige Hurensohn Killigrew war nicht an Bord, der Profos und ungefähr ein Dutzend der Bande schienen allein auf der „Estrella de Málaga“ zu fehlen.
Drüben, auf der „San Lorenzo“, war die Crew ebenfalls nicht mehr vollständig, soviel hatte Carrero bei seinem kurzen Decksaufenthalt erkennen können. Zum Beispiel hatte er diesen dreisten Franzosen nicht gesehen, der sich Ribault nannte.
Für das Fehlen dieser Kerle gab es nur eine Erklärung. Sie hatten sich auf den Marsch nach Potosi begeben. Warum sie ihren Gefangenen nicht mitgenommen hatten, wie es geplant gewesen war? Carrero machte sich keine Gedanken mehr darüber. Es war ihm gleichgültig. Er würde dieses Teufelsschiff verlassen, nach Potosi zurückkehren – dabei vielleicht einen Umweg über Arica einlegen – und Alarm schlagen.
Dann würde er mit de Cubillos Hilfe eine Streitmacht auf die Beine stellen und die Engländer jagen – quer durch das Gebirge und bis an die See, und wenn es sein mußte, über das Meer bis nach Panama hinauf.
Er würde sie fassen und sich an ihnen rächen. Ihr Ende waren die Minen des Cerro Rico, dort würden sie mit den Indios zusammen schuften. Dort hatte Carrero noch jeden aufsässigen Hundesohn weichgeklopft. Es gab keinen, der standgehalten hatte.
Alle diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, als er nun das tat, was ihm vorher wegen der Ketten versagt gewesen war. Er ließ sich auf den Knien nieder, schob sich durch die Vorpiek und begann, sie Stück für Stück zu untersuchen, so gut es ging. Natürlich waren die Voraussetzungen immer noch ungünstig, aber er gab sich alle Mühe, das Beste daraus zu machen.
Es war stockdunkel, und er konnte nur herumtasten. Zweimal stieß er sich den Kopf, und es gab dabei dumpfe Geräusche. Er verharrte und lauschte. Hatte der Posten, der vor dem Schott stand, etwas gehört? Ahnte er etwas? Nein. Nichts rührte sich. Der Mann schien keinen Verdacht zu schöpfen. Warum sollte er es auch tun?
Er wußte ja nicht, daß Carrero einen Koffeynagel an sich gebracht hatte. Und wenn der Spanier durch sein Gefängnis kroch, war das im Grunde nur allzu verständlich. Wer schon einmal in der Vorpiek gesessen hatte, wußte, wie eng und stickig es dort war.
Carrero setzte sein Werk fort. Seine Füße waren nicht gefesselt, er konnte die Beine also gut bewegen. Aber das nutzte ihm im Grunde nicht viel. Für die Inspektion brauchte er seine Finger – und da ihm die Hände auf den Rücken gebunden waren, war es eine schweißtreibende Arbeit, alles abzutasten.
Schließlich fand er, was er suchte: einen Nagel in einem Spant. Der Nagel befand sich sogar in Hüfthöhe. Besser hätte es gar nicht sein können. Carrero grinste triumphierend. Am liebsten hätte er einen Schrei ausgestoßen.
Egal, aus welchen Gründen die einstige Besatzung der „Estrella de Málaga“ diesen Nagel in den Spant getrieben hatte. Vielleicht war einmal irgend etwas daran befestigt gewesen. Was kümmerte es ihn, Carrero? Der Nagel diente ihm nur zu dem einen Zweck – die Handfesseln aufzuscheuern. Alles andere interessierte ihn nicht.
Er grinste immer noch. Er ließ sich wieder nieder und lehnte sich gegen die Schiffswand. Das Öffnen der Fesseln verlegte er aus Sicherheitsgründen auf die Nacht. Es war jetzt Abend geworden. Die Kerle würden ihm seine Mahlzeit bringen, und die mußte er zu sich nehmen, ohne daß sie etwas von dem, was er plante, ahnten. Mit anderen Worten: Er mußte sie in Sicherheit wiegen. Sie sollten nach wie vor davon überzeugt sein, daß er ein erschöpfter, erledigter Mann sei. Es paßte hervorragend zu seinem einfachen, aber – wenn alles klappte, wie er sich das vorstellte – genialen Plan.
Hunde, dachte er, ihr werdet euch noch wundern! Eine Welle der Genugtuung und des Siegesgefühls durchlief ihn. Er mußte handeln, solange die Stärke der Mannschaften reduziert war. Hier lag seine Chance, und die würde er ausnutzen.
4.
Bevor das Schott der Vorpiek geöffnet wurde, sorgte Luis Carrero dafür, den Belegnagel zu verstecken. Es gelang ihm, die Gräting ein wenig zu lockern und ihn darunterzuschieben. Jetzt mußte es schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie ihn entdeckten.
Schritte näherten sich.
„Batuti, mach mal auf“, sagte eine Stimme. Sie gehörte diesem anderen Hakenmann, der offenbar auf den Namen Bowie hörte. „Ich habe gebratenen Fisch und Wasser für unseren Don Luis.“
„Na, dann los“, brummte der Gambia-Mann. Eigentlich hätte er lieber mit Shane Pulver- und Brandpfeile angefertigt, als hier Posten zu gehen. Aber er fügte sich in sein Schicksal.
Batuti schob den Riegel des Schotts zur Seite und öffnete. Jeff Bowie setzte den Essensnapf und den Wasserkrug auf den Planken ab und hängte die Öllampe, die er mitgebracht hatte, an einen Haken an einem der Deckenbalken. Die Lampe schwankte ein bißchen hin und her und verbreitete rötlich-dämmriges Licht.
Jeff bückte sich und trat zu dem Gefangenen, Batuti zog seine Pistole und spannte den Hahn. Es knackte, aber Carrero wandte nicht den Kopf. Er schien ins Leere zu blicken, völlig apathisch und entrückt.
„Carrero“, sagte Jeff. „Ich nehme dir jetzt die Fesseln ab, damit du essen kannst.“
„Ja“, sagte Carrero. „Ja.“
„Sei hübsch brav und versuche keine Dummheiten.“
„Keine Dummheiten.“
Jeff löste die Handfesseln, kehrte zu Batuti zurück und schob dem Spanier den Essensnapf und den Wasserkrug zu. Er stellte sich neben den Gambia-Mann, und sie unterhielten sich leise miteinander.
Carrero griff mit seltsam eckigen, beinah linkisch wirkenden Bewegungen nach dem Fisch und aß ein wenig davon. Dann trank er Wasser in großen, gierigen Schlucken.
Jeff wartete noch eine Weile, aber Carrero ließ die Hälfte der Anchovetas unberührt im Napf liegen. Jeff zuckte mit den Schultern, legte dem Mann die Fesseln wieder an und trug das Geschirr aus der Vorpiek. Er übergab es Batuti, nachdem dieser das Schott geschlossen und zugeriegelt hatte, und der Gambia-Mann schob grinsend damit, ab.
„Danke für die Ablösung“, sagte er.
„Gern geschehen“, sagte Jeff und lehnte sich gegen die Wand. Er verschränkte die Arme vor der Brust. Bis Mitternacht war er mit der Wache an der Reihe, dann löste ihn Luke Morgan ab. Bis dahin hieß es, sich in Geduld zu fassen – es gab keinen langweiligeren Posten als diesen. Da hatten es sogar die Männer besser, die drüben, auf der Felsnase, ihren Dienst versahen. Die hatten wenigstens die frische Luft und konnten dem leisen Rauschen des Wassers lauschen.
Carrero überlegte unterdessen, ob er richtig gehandelt hatte. Eigentlich hatte er einen Bärenhunger, und der Magen knurrte ihm immer noch. Aber er hatte absichtlich so getan, als habe er keinen Appetit. Er spielte den Leidenden, Entmutigten. Er hatte kaum noch die Kraft, die Hand an den Mund zu heben. Bei dieser Rolle mußte er bleiben.
Aber später, auf der Flucht, würde ihm der Hunger zusetzen. Wann erhielt er wieder etwas zu essen? Er wußte es nicht. Aber das mußte er auf sich nehmen. Wenn es ganz schlimm war, würde er Wurzeln essen. Oder Dreck. Lieber das, als noch weiter diesen Höllenhunden ausgeliefert zu sein.
Am Mittag, bei seinem Spaziergang auf das Hauptdeck, hatte er die Himmelsrichtung einigermaßen genau festgestellt. Er würde sich nach Süden absetzen, dorthin, wo Arica liegen mußte. Dies hatte er sich inzwischen in den Kopf gesetzt, denn es war besser, zunächst nach Arica zu laufen, als sich auf den langen Marsch nach Potosi zu begeben.
Im übrigen hatte er festgestellt, daß draußen – vor der Bucht – ein Fluß verlief. Fast war er sich sicher, daß es sich um den Rio Tacna handeln mußte. Folglich lag Arica südlich.
Dies war Luis Carreros Plan: Um Mitternacht, beim neuerlichen Wachwechsel, würden die beiden Posten, der abgelöste und der neue, seine Fesseln gemeinsam überprüfen. Danach hatte er wieder Ruhe bis vier Uhr morgens, wenn wiederum die gleiche Prozedur begann. Er hatte beschlossen, nach der Prüfung um Mitternacht die Fesseln zu lösen, den Posten in die Vorpiek zu locken, ihn niederzuschlagen und zu fliehen.
Er wollte sich mit der Jolle absetzen, die längsseits vertäut war. Das mußte zu schaffen sein. Bis zum Ufer war es nicht weit, und vielleicht waren die Ankerwachen der Schiffe nicht so scharf, weil sie mit keiner Bedrohung von außen zu rechnen hatten. Wenn er viel Glück hatte, schliefen sie sogar. Das wagte er nicht zu hoffen, aber er rechnete sich einige Chancen aus, das Ufer ungehindert zu erreichen.
Er entspannte sich und schloß die Augen. Bis Mitternacht mußte er Energien schöpfen – danach begann die Arbeit. Er atmete tief durch und versuchte zu schlafen. Es gelang ihm tatsächlich. Es war mehr ein Dahindämmern, jedes Geräusch riß ihn wieder hoch. Aber er ruhte sich doch aus. Allein darauf kam es ihm jetzt an.
Mitternacht nahte, und wieder ertönten Schritte, die vor dem Schott verharrten. Der neue Posten war da. Es war Luke Morgan. Er wechselte ein paar Worte mit Jeff, dann öffneten sie das Schott der Vorpiek und befaßten sich mit ihrem Gefangenen. Jeff hielt die Öllampe hoch, Luke überprüfte die Handfesseln des Mannes.
„Alles in Ordnung“, sagte Luke.
„Ich habe auch nichts anderes erwartet“, sagte Jeff. „Gibt es an der Küste was Neues?“
„Nichts.“
„Nicht die Spur?“
„Bist du so versessen darauf, daß was passiert?“ fragte Luke.
„Das bin ich nicht“, entgegnete Jeff. „Nur finde ich, daß es hier allzu ruhig ist.“
„Mal nicht den Teufel an die Wand. Wir können uns nicht beklagen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, schieben wir hier einen wirklich ruhigen Lenz, bis Hasard und der Trupp aus Potosi zurück sind.“
„Ich wäre lieber nach Potosi gegangen, wenn du mich fragst.“
„Das wären wir alle“, sagte Luke. „Aber darüber haben wir schon genug diskutiert.“
„Mann, ich will mich doch nur mit dir unterhalten.“
„Hau dich aufs Ohr“, sagte Luke grinsend. „Und denk an die Anchovetas. Morgen wird wieder geangelt – gefischt, meine ich.“
„Die Kinderarbeit können wir den Zwillingen überlassen“, brummte Jeff. „Mann, ich melde mich lieber bei Ferris und helfe ihm bei den Höllenflaschen.“
„Wie du willst. Ben hat sicher nichts dagegen.“
„Also dann – viel Spaß, Luke“, sagte Jeff.
„Ich werde die Zeit schon ’rumkriegen“, sagte Luke.
Das Schott der Vorpiek krachte zu, der Riegel wurde vorgeschoben. Luis Carrero grinste, aber am liebsten hätte er vor Freude geschrien. Ihr Narren, dachte er, ihr wißt ja nicht, was euch blüht.
Carrero begann sofort zu arbeiten. Lautlos bewegte er sich durch die Vorpiek, verharrte wieder, lauschte und setzte dann, als er sicher war, daß der Mann vorm Schott nichts bemerkte, seinen Weg fort. Er erreichte den Nagel, setzte sich hin und drehte sich so, daß er die gefesselten Hände an den Nagel bringen konnte.
Dann begann er, seine Hände reibend zu bewegen. Das Tauwerk glitt über den Nagel. Aber es war solide – und es dauerte einige Zeit, bis sich die ersten Fasern zu lösen begannen.
An der erforderlichen Geduld, Zähigkeit und Ausdauer mangelte es dem Spanier nicht. Lange genug hatte er tatenlos in dem engen, stickigen Verschlag brüten müssen. Und wenn er Stunden an den Fesseln herumsäbeln mußte, bis sie nachgaben – er würde nicht kapitulieren.
Etwa nach einer Viertelstunde hielt er für kurze Zeit inne und fing an, Schnarchgeräusche zu imitieren, nicht zu laut, aber für den vor dem Schott stehenden Luke Morgan deutlich zu vernehmen. Carrero nahm seine Tätigkeit wieder auf, schnarchte aber noch einige Zeit weiter. Das Tauwerk schabte über den Nagel, hin und her, und er hatte den Eindruck, daß es etwas rissig geworden war. Seine Haut wurde inzwischen auch in Mitleidenschaft gezogen. Er spürte, wie sie zu brennen und zu schmerzen begann.
Weiter, dachte er, nicht aufhören. Und wenn die Haut in Fetzen geht – weiter!
In unregelmäßigen Zeitabständen wiederholte er die Schnarchgeräusche. Nach ungefähr einer Stunde intensiver Arbeit hatte er die Hände endlich frei. Er ließ die Arme herunterbaumeln, lehnte sich gegen die Wand und atmete tief durch. Dann massierte er vorsichtig die Handgelenke. Sie taten immer noch weh. Er hatte sie blutig geschrammt, wie ihm schien – aber was bedeutete das schon?
Er wartete ab. Jetzt nicht zu hastig vorgehen, prägte er sich immer wieder ein, Geduld haben. Noch ein wenig Zeit verstreichen lassen.
Carrero schnarchte wieder ein bißchen und stieß auch hin und wieder einen Seufzer aus wie ein Mann, der von nicht gerade angenehmen Träumen geplagt wird. Dann verstummte er wieder – und wartete weiterhin ab.
Als es nach seiner Schätzung auf zwei Uhr zuging, begann er erneut zu schnarchen, diesmal jedoch stärker als zuvor. Das gehörte zu seiner Taktik.
Er hatte inzwischen den Belegnägel aus dem Versteck zum Vorschein geholt und bewegte ihn prüfend in der Hand. Hartes Holz, dachte er, vielleicht Steineiche. Für spanische Schiffe wie die „Estrella de Málaga“ wurden nur die besten Hölzer verwendet: Eiche, Steineiche, Edelkastanie, Nußbaum und Pinie. Es waren allesamt knochentrockene und harte Materialien, mit denen man einem Mann gut und gern den Schädel einschlagen konnte.
Carrero grinste jetzt. Er schnarchte immer lauter, nahm den Belegnagel in die rechte Hand und klopfte damit an die äußere Bordwand. Das gab dumpfe, pochende Laute.
Luke Morgan horchte auf. Was war das? Er war ein bißchen dösig geworden. Für kurze Zeit wäre er um ein Haar eingeschlafen, hatte sich aber immer wieder einen Ruck verliehen. Die Augen durften ihm nicht zufallen.
Wenn der Spanier auch keine Chance hatte, aus seinem Verlies zu entwischen – es war eine Schande für einen Arwenack, auf Wache einzupennen. Und die Blamage war noch größer, wenn man ihn dabei ertappte. Nein, das durfte sich keiner erlauben. Notfalls gab man sich lieber selbst eine Ohrfeige, als den Dienst zu vernachlässigen, was immer auch geschah.
Es hämmerte dumpf im Schiffsbauch, und der Kerl in der Vorpiek schnarchte wie ein Besessener. Aber was hatte das eine mit dem anderen zu tun? Luke war ein wenig verwirrt.
Luis Carrero lag inzwischen in Schlafstellung auf der Gräting der Vorpiek, die Hände auf dem Rücken, leicht zusammengekrümmt und die Front dem Schott zugewandt. Er stellte das Schnarchen kurz ein – und fing im nächsten Moment wieder damit an, noch lauter diesmal. Zwei- bis dreimal klopfte er wieder mit dem Koffeynagel gegen die äußere Wand, dann hörte er auf, schnarchte aber weiter.
Komm schon, du Ratte, dachte er. Wie lange brauchst du, um mißtrauisch zu werden? Stunden? Hölle das dauert mir zu lange. Warum, zum Teufel, kommst du nicht?
War der Bastard von einem Engländer am Ende eingeschlafen? Carrero wagte nicht, daran zu denken. Wenn der Posten ihn nicht hörte, war sein ganzer Plan, den er sich zurechtgelegt hatte, hinfällig. Dann konnte er auch nichts Neues ersinnen, denn es gab keine Alternative. Alles hing davon ab, daß der Mann dort draußen versuchte, dem Klopfen auf den Grund zu gehen.
Carrero setzte mit dem Schnarchen aus. Er hämmerte den Belegnagel gegen die Beplankung – viermal in kurzen Abständen. Wenn jetzt nichts passiert, ist alles verloren, dachte er.
Luke Morgan lauschte dem Schnarchen und dem Pochen. Verdammt, dachte er, was hat das zu bedeuten? Das Schnarchen beunruhigte ihn nicht, wohl aber das Klopfen. Es klang so, als klopfe von draußen jemand an die Bordwand, nicht laut, aber doch gut hörbar.
Was das wohl war? Wieder trat Stille ein. Dann ertönte wieder das Schnarchen aus der Vorpiek – und plötzlich war erneut das Pochen da, dumpf und unheimlich.
Luke nahm die Öllampe vom Haken, trat auf das Schott zu und schob den Riegel zur Seite. Er zog das Schott auf. Es knarrte ein wenig in seinen Angeln. Luke bückte sich und hielt die Lampe etwas tiefer. Der Lichtschein fiel etwas flackernd ins Innere und erhellte die Gestalt des Spaniers.