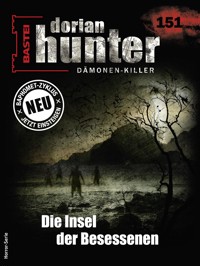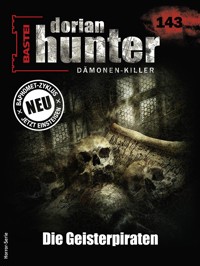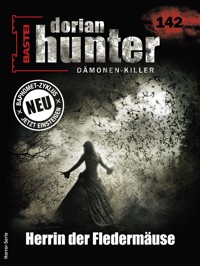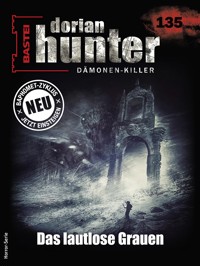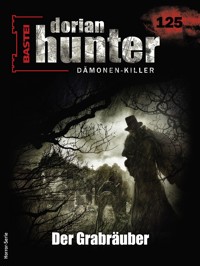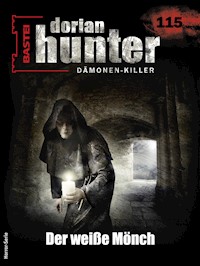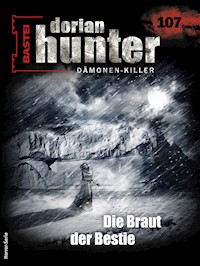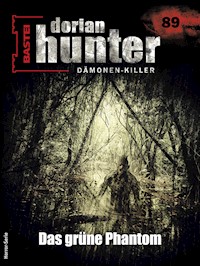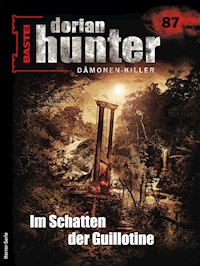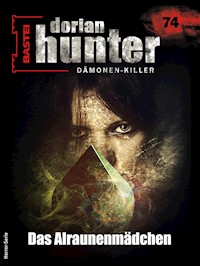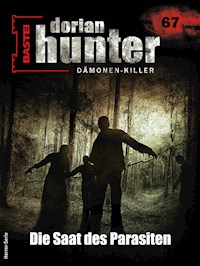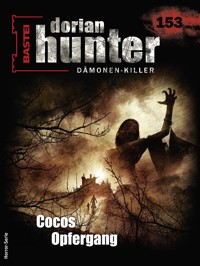
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
»Du hast mich genügend verletzt«, schleuderte Coco Rebecca entgegen. »Ich habe gefühlt, wie Martin gelitten hat, und all die Pein habe ich bloß dir zu verdanken!«
»Ich will deinem Sohn nicht schaden - obwohl ich es könnte. Die Entwicklung der Dinge muss dir doch klar und deutlich zeigen: Ich will, dass Martin lebt.«
»So selbstlos kenne ich dich nicht«, gab Coco voll Spott zurück.
Rebecca lehnte sich zurück. »Ich habe die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben. Ich will dich, Coco, für mich gewinnen ...«
Olivaro hat sein zweites Gesicht geopfert, um Dorian von der magischen Pest zu heilen. Zudem wurde der Bann Baphomets über Martin Zamis gebrochen. Aber da ist immer noch die Vampirin Rebecca, die nach der Macht greift und dabei auch nicht davor zurückscheut, Coco für sich einzuspannen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
COCOS OPFERGANG
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
Als Rückzugsort in seinem Kampf bleibt Dorian neben der Jugendstilvilla in der Baring Road in London noch das Castillo Basajaun in Andorra, in dem er seine Mitstreiter um sich sammelt – darunter die ehemalige Hexe Coco Zamis, die aus Liebe zu Dorian die Seiten gewechselt hat. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Martin hat Coco diesen zum Schutz vor den Dämonen an einem Ort versteckt, den sie selbst vor Dorian geheimhält.
Auf der Suche nach dem Erbe des Hermes Trismegistos findet Dorian den Steinzeitmenschen Unga, der Hermon gedient hat und sich nach seinem Erwachen schnell den Gegebenheiten der Gegenwart anpasst. Die Invasion der Janusköpfe von der Parallelwelt Malkuth wird mit Dorians Hilfe abgewehrt. Hermes Trismegistos wird klar, dass er für das Entstehen der Psychos auf Malkuth verantwortlich ist. Um zu büßen, geht er durch eins der letzten Tore nach Malkuth. Olivaro, das ehemalige Oberhaupt der Schwarzen Familie und selbst ein Januskopf, beschließt, seine auf der Erde gestrandeten Artgenossen zu jagen. Ein Diener des Januskopfes Pyko hext Dorian eine magische Pest an. Der Dämonenkiller droht bei lebendigem Leib zu verfaulen.
Dorian, Olivaro, Jeff Parker und Abi Flindt spüren die Janusköpfe Ogiv und Xyno in Mexiko auf. Doch dort taucht auch Trigemus, der Psycho des Hermes Trismegistos, auf, um die letzten beiden Janusköpfe zu töten. Da greift eine magische Macht ein und vernichtet Trigemus. Bedeutet das, dass Hermes Trismegistos auf Malkuth gestorben ist? Mit dem Tod Ogivs und Xynos erlischt Dorians Hoffnung auf Heilung, doch Olivaro opfert sein zweites Gesicht und befreit Dorian so von der magischen Pest.
In Wien durchkreuzen Coco und Unga den Plan der Vampirin Rebecca, den Kinddämon Baphomet und Martin von ihrem Werkzeug Tina Bauer töten zu lassen. Der Bann über Martin und Tina erlischt, doch Rebecca entkommt.
COCOS OPFERGANG
von Roy Palmer
Die Vorhänge der hohen Fenster waren zurückgezogen. Kaltes, weißes Mondlicht fiel in den Raum und zeichnete das Gittermuster der Scheibenfassungen auf den Fußboden, erfasste auch die Tastatur und Frontseite des Konzertflügels, skizzierte die Konturen der schlanken Mädchengestalt vor dem Instrument und modellierte die feinen Finger nach, die sanft und doch bestimmt über die Tasten glitten.
Es gab sonst keine Beleuchtung im Raum. Das Mädchen wollte es so haben, denn die Dunkelheit war die passende Atmosphäre für ihren Vortrag. Ihr Gesicht lag im Dunkeln, und selbst wenn sie ihre Hände nicht hätte sehen können, hätte sie das Musikstück doch genauso meisterhaft zu interpretieren gewusst.
Sonate 14 in cis-Moll, Opus 27, Nummer 2 – die Mondscheinsonate von Beethoven. Die Töne des Adagio sostenuto waren Perlen, die von einem Silberdraht glitten und durch den Raum schwebten. Sie stahlen sich durch Fensterritzen in die Nacht hinaus und flohen zu dem Trabanten hinauf, der mit bleichem Antlitz teilnahmslos die Geschehnisse der Nacht verfolgte.
1. Kapitel
Gea, das Mädchen, spielte mit Gefühl, doch ihre Gedanken waren woanders. Sie folgten ihrem Bruder Hans und ihren Eltern Edda und Herbert Bronski und bedrängten sie mit Fragen, immer wieder mit den gleichen: Wohin geht ihr mitten in der Nacht? Welches ist euer Ziel? Warum wollt ihr es mir nicht verraten?
Sie waren wieder fort, wie so oft. Es lag ihnen fern, die üblichen Vergnügungen wie Tanz und andere Arten blendenden Rummels zu suchen – nein, dorthin hätten sie sie auch sicherlich mitgenommen. Sie gaben vor, Freunden eine Visite abzustatten. Gea war die Jüngste der Familie. Für sie wurde das zu spät. Gea glaubte kein Wort von dem, was ihr Bruder und ihre Eltern ihr vorschwindelten. In ihrem Kummer hatte sie sich wieder in das Zimmer an ihren geliebten Flügel geflüchtet. Die Musik war ein Freund, der Trost vermittelte. Aber die Musik vermochte nicht die Mauer des Schweigens und der Ungewissheit zu durchbrechen. Was taten Hans und die Eltern wirklich in diesen schlaflosen Nächten, die sich in unregelmäßigen Zeitabständen wiederholten? Warum weihten sie sie nicht ein? Was verbarg sich hinter der ganzen Geheimnistuerei?
Gea Bronski war ein ziemlich hübsches Mädchen mit großen, ängstlich blickenden Augen, sanft geschwungenen Lippen und einem schmalen, gertenschlanken, fast knabenhaften Körper mit Gazellenbeinen. Seit vier Jahren besuchte sie das Konservatorium, und bald würde sie vor der entscheidenden Prüfung ihres Lebens stehen – wenn nichts dazwischen kam.
Irgendwie, aus einem unerklärlichen Grund, hatte sie Angst. Sie wollte gerade zum Allegretto übergehen, da fühlte sie sich plötzlich unangenehm beeinflusst. Im Raum war etwas. Sie hielt inne. Ihre Fingerspitzen lösten sich von den Tasten, die Musik verflog wie ein Hauch, schien nie da gewesen zu sein. Gea lauschte in die Dunkelheit hinein. Sie war ein sensibles Mädchen, empfand tief und war mit geschärften Sinnen ausgestattet. Ihr Gehör hatte ein winziges Geräusch aufgenommen. Langsam drehte sie sich um. Der Schemel knarrte. Gea sah sie vom Esszimmer aus eintreten. Es waren zwei.
Ihr Entsetzen ließ Gea wie gelähmt sitzen. Sie brachte nicht einmal einen Schrei heraus; nicht den leisesten Ton. Sie saß da, wie zur Salzsäule erstarrt. Sie fühlte sich wie eine leere Hülle. Die beiden näherten sich ihr, waren darauf eingestellt, sie zu überraschen, zu überfallen – es war unheimlich! Unfassbar!
Sie waren hochgewachsen und schlank. Ihre Gesichtszüge konnte man nicht genau erkennen. Es schien, als ob sie Mäntel trugen. Nein, es waren eher Flügel, die bis auf den Boden reichten. Sie näherten sich behutsam, und mit etwas eckigen Bewegungen kamen die beiden auf sie zu.
Der Erste, der sich verbal bemerkbar machte, war der Linke. Er schritt aufrecht, leicht gebückt wie sein Begleiter. Seine Stimme klang etwas merkwürdig, als er sagte: »Diese Musik, der goldene Schein in cis-Moll, die Sonate des Mondes; sie wirkt wie eine einzige Poesie. Warum spielst du nicht weiter, Gea Bronski?«
»Du hast recht, Edu«, meinte der Gefährte. »Ich finde es auch blöd, dass sie das Konzert unterbrochen hat. Hat etwa eine Treppenstufe geknarrt, als wir von oben heruntergekommen sind?
»Sei still.«
»Du kannst mir nicht einfach den Mund ...«
»Ich kann. Sei still.«
Gea bebte jetzt am ganzen Körper. Die Angst schien ihren Körper durchzuschütteln, doch sie konnte sich etwas beruhigen und fand sogar ihre Sprache wieder. Sie schluckte zweimal, dann sagte sie: »Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Und wie ... wie sind Sie hier eingestiegen?«
Edu lachte verhalten. »Wie wir eingestiegen sind, will sie wissen. Sag's ihr, Soldan.«
»Wir kommen von oben.«
»Von oben.« Das Ganze war lächerlich. Ihr Benehmen war närrisch, aber Gea versuchte, Zeit zu gewinnen. Das hier war eine Farce, aber eine, die einen bitteren Ausgang verhieß.
»Vom Dach führt ein kleines Oberlicht auf den Dachboden«, erklärte Soldan. Er trat noch ein Stück vor. Das Mondlicht fiel jetzt auf sein Antlitz. Gea sah, dass er hager aber wachsbleich war und einen verschlagenen Ausdruck im Gesicht trug. »Der Rest war einfach«, sagte Soldan noch, dann ergriff Edu wieder das Wort.
»Einen schönen Hals hat sie, findest du nicht auch?«
»Ein Schwanenhals.«
»Zum Verlieben.«
»Ich denke, solche Hälse sind selten. Wirklich zum Anbeißen.«
»Du lässt mir den Vortritt!«, erwiderte Edu eine Spur härter.
»Selbstverständlich«, erwiderte Soldan.
Gea blickte nun auch in das Gesicht des linken Eindringlings. Dieser Edu hätte ein gut aussehender Bursche sein können, wenn er nicht auch so entsetzlich gewesen wäre und einen Pickel am Kinn und an der linken Wange gehabt hätte. Er streckte seine Hand nach ihr aus. Es war eine dürre Hand.
Gea zuckte zurück. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte fast vom Schemel, doch dann schlug sie mit den Ellbogen auf die Tastatur des Flügels. Es gab einen harten Misston. Die Dissonanz war eine Beleidigung für die Ohren, doch das Grinsen auf den Gesichtern dieser Eindringlinge überbot alles, es war die Gefahr und das Böse – es war die Hölle.
»Nein!« Geas Stimme klang schrill. »Fort! Gehen Sie! Ich schreie!«
Edu sprach sanft. »Schrei, so viel du willst. Man wird dich vielleicht hören, aber es ist zu spät, wenn Hilfe kommt. Zu spät. Wir sind schnell und gründlich und Meister des Rückzuges. Pack sie, Soldan.«
Soldan hob die Hände, und Gea meinte ein trockenes Rascheln zu vernehmen. Die Aufschläge seines Mantelumhanges schlugen hoch und die weiten Ärmel waren wie Flügel. Krallen glänzten im Mondlicht. Gea schrie, sprang auf, riss den Drehschemel um. Soldan lachte – und sie sah seine dolchspitzen, überlangen Eckzähne schimmern.
Soldan stürzte von rechts auf sie zu. Edu nahte von links. Gea besaß noch die Geistesgegenwart, sich fallen zu lassen. Sie kroch zwischen den Holzbeinen des Flügels hindurch, während über ihr Soldan auf die Tasten schlug. Der Flügel entließ ein Dröhnen. Soldan fluchte. Edu rief: »Du Idiot!«
Gea raffte sich wieder auf, stieß sich fast den Hinterkopf an der Kante des Instrumentes, rannte zum Fenster. Sie wandte nicht den Kopf. Aber sie spürte das Grauen in ihrem Rücken und sie glaubte wahrzunehmen, wie Soldan und Edu über den Konzertflügel hinwegsprangen und hinter ihr her flogen.
Sie war am Fenster. Aber aufzerren konnte sie es nicht mehr. Soldan packte ihre Beine. Edus Krallenfinger streckten sich nach ihrem Hals aus. Geas Schrei erstickte in einem Gurgeln, die Angst schnürte ihr die Kehle zu.
»Beiß zu, beiß zu«, drängte Soldan.
Edu sprach wispernd, sein Atemhauch war modrig. »Endlich habe ich dich, liebliche Gea. Lass dir den Hals küssen und Bruderschaft mit einem stolzen Geauscu trinken.«
Wie in Trance erlebte Gea, dass sich die Tür öffnete und drei Gestalten hereingeweht kamen – Hans und ihre Eltern.
Edu und Soldan, die beiden Unheimlichen, kreischten, aber dann gingen ihre Sinne in einem wahren Orgeldröhnen unter. Die Fensterkonturen verschwammen, die Wand leuchtete in intensivem Blaugrün. Ein Riss lief zuckend wie ein Blitz von oben nach unten; die Wand klaffte auf, ein heißer Windhauch packte die Eindringlinge und hob sie mit sich zum Haus hinaus. Ein pfeifendes Keuchen war das Letzte, das Gea von ihnen vernahm. Sie sank hin. Dann waren die Gesichter von Edda und Herbert Bronski und ihrem Sohn Hans über ihr. Gea fand, dass ihre Haut ein bisschen grün war und ihre Ohren nach oben hin spitz zuliefen, aber sie war zu verwirrt, um echte Feststellungen zu treffen.
»Ein Glück, dass wir eher zurückgekehrt sind«, sagte Herbert Bronski. »Sie hat keine Bissmale am Hals. Nicht auszudenken, wie es gewesen wäre, wenn ...«
Hans fluchte, wie Gea es nie von ihm gehört hatte. »Wir müssen sie doch einweihen, Vater.«
»Das sage ich auch«, meinte Edda Bronski. »Wir müssen sie endlich zu einer der unseren machen und ihr etwas von unseren Fähigkeiten beibringen.«
»Ich wollte es vermeiden«, sagte Herbert Bronski leise.
Seine Frau stieß eine wüste Beschimpfung aus, dann fügte sie noch hinzu: »Willst du vielleicht, dass die Geauscus, die Hunde, es noch mal versuchen und sie in ihren Bann reißen? Soll ganz Wien dieser Bande anheimfallen? Willst du das?«
Martin, der Sohn des Dämonenkillers, stand in einer Ecke des Innenhofes von Castillo Basajaun und blickte starr in Richtung des Burgfrieds. Er schaute aber nicht wirklich auf den Torm del Homenaja, er schaute hindurch. Seine Miene war verschlossen. Die Sonne schien, und der Himmel über dem Seitental des Valtra del Norte war azurblau, doch Martin erfreute sich nicht daran.
Virgil Fenton verließ das Hauptgebäude und betrat den Innenhof. Er war sehr besorgt um Martin. Seit seinem Eintreffen – Unga hatte ihn gesund und wohlbehalten hergebracht – hatte der Junge kaum gesprochen.
Er war scheu und zurückhaltend, aber das wäre nicht das Schlimmste gewesen. Seine Stimmung war depressiv wie die eines Erwachsenen in der tiefsten Krise. Er schien echt gemütskrank zu sein. Virgil Fenton wollte Martins Verhalten auf den Grund gehen. Er hatte es sich fest vorgenommen, aber er wurde durch etwas abgelenkt.
Das Hauptgebäude besaß einen unförmigen Grundriss. Die Seitenflügel ragten also in den Hof hinein, flankierten ihn praktisch – und hinter einem Fenster des linken Seitentraktes war soeben ein rundliches Gesicht aufgetaucht. In ihren Ansätzen war die Physiognomie kindlich, aber da hörte es mit den Maßstäben der Normalbeschaffenheit auch schon auf. Bläulich war die Farbe, und ein Auge glänzte über der Nasenwurzel und war neugierig auf Martin gerichtet. Virgil Fenton wusste nur zu gut, welche überirdischen Fähigkeiten dieses Auge barg und was sonst noch an Außergewöhnlichem in dem Knaben hinter dem Fenster steckte. Er kannte seine komplette Lebensgeschichte. Schließlich war er sein Hauslehrer und fast so etwas wie ein Pflegevater für ihn. Aber es waren nicht nur seine magischen Fähigkeiten, die ihn in diesem Zusammenhang beunruhigten. Tirso, der Zyklopenjunge, würde sich hüten, seinen Feuerblick einzusetzen, allemal Martin gegenüber. Nein, Arglist und Bosheit lagen ihm fern. Aber sein Verhalten – trug es nicht dazu bei, Martins deprimierten Zustand nur noch zu verschlechtern?
Virgil Fenton ging zu dem Fenster. Tirsos Kopf war urplötzlich verschwunden.
»Tirso«, sagte Virgil. »Was soll denn dieses Versteckspiel? Findest du es nicht selbst reichlich albern?«
Er erhielt keine Antwort. Er versuchte es noch einmal.
»Tirso, ich weiß, dass du dort drinnen steckst.« Als wieder keine Erwiderung kam, wurde es Fenton zu bunt. »Hör zu, ich kann auch verdammt unangenehm werden, wenn du es auf die Spitze treibst. Komm jetzt raus und lass den Unsinn.«
Tirsos Stimme klang eingeschüchtert. »Ich habe Angst.«
Fenton verzog ärgerlich den Mund. »Ach was, du hast keine Angst. Martin ist das friedlichste Kind der Welt. Außerdem musst du dir doch sagen, dass du ihm mit deiner Neugierde und all dem Getue ganz schön auf den Wecker fällst. Na los, zeig dich. Ihr werdet bestimmt gute Freunde und spielt miteinander.«
»Ich hab aber Angst.«
Virgil Fenton zuckte die Achseln. Vorläufig gab er es auf. Zwingen konnte er Tirso ja auch nicht. Im Übrigen wusste er, worauf der Zyklopenjunge mit seinen Bemerkungen anspielte. Natürlich, er, Tirso, war sich seines ungewöhnlichen Aussehens vollauf bewusst. Und er hielt sich Martin gegenüber zurück, um ihn nicht zu erschrecken.
Wahrscheinlich schämte er sich auch ein bisschen. Im Grunde wäre Tirsos Benehmen sozusagen rücksichtsvoll. Aber er lief vor Martin davon und beobachtete ihn neugierig aus Verstecken. Wahrscheinlich betrachteten sich beide heimlich und verstohlen, als sei jeder ein seltenes exotisches Tier.
Virgil trat zu Martin. Er legte ihm die Hand auf die Schulter. Es tat ihm in der Seele weh, den kleinen Kerl so leiden zu sehen. Was hatte er nur?
»Hör mal, Martin, hast du nicht Lust, mich in die Küche zu begleiten? Ich glaube, Tante Ira hat eine Überraschung für dich.«
»Eine Überraschung«, wiederholte Martin apathisch.
»Also, was ist, kommst du?«
»Na. Meinetwegen.«
Sie kehrten in das Hauptgebäude zurück und gelangten in die Küche, ohne den Rittersaal zu betreten. Martin schritt wie ein Traumwandler dahin. Virgil Fenton drehte sich einmal um und sah zu seinem Unmut wieder Tirso, der sich in einen Alkoven drückte und tatsächlich glaubte, nicht entdeckt worden zu sein.
Ira Marginter, die blonde Restaurateurin aus Köln mit der tollen Figur, erwartete sie tatsächlich in der Küche. Sie hatte einen Kuchen gebacken. Es duftete betörend. Virgil lief das Wasser im Mund zusammen. Ira öffnete die Backofenklappe des Herdes. Martin durfte mal mit einer langen Nadel in den Kuchen pieksen, ob er gar war, dann meinte Ira: »Na, Junge, wie gefällt dir das?«
»Ganz gut.«
»Kriegst du keinen Hunger?«
»Nein.«
»Na, jedenfalls ist das erste große Stück Kuchen für dich reserviert.« Ira blickte Martin an und nickte ihm aufmunternd zu, aber er entgegnete nur:
»Ja. Meinetwegen.«
Ira sah zu Virgil. Er schnitt eine Miene der Resignation, lächelte aber gleich wieder, als Martin den Kopf wandte. Virgil war sehr besorgt, genau wie Ira und alle anderen auf Castillo Basajaun, aber er warf nicht die Flinte ins Korn. Das lag nicht in seiner Natur. Er war ein hochgewachsener Amerikaner mit ehrlichem, treuherzigem Jungengesicht, ein unverbesserlicher Optimist und außerdem ein guter Psychologe. Virgil blickte Martin an. Wird schon wieder werden, dachte er.
»Bleibst du noch bei Tante Ira, Martin?«
»Ja.«
»Hebt mir ein Stück von dem Kuchen auf, ja?«
»Ja. Meinetwegen.«
Virgil ging durch den Rittersaal und betrat die Halle mit den zwölf ›Bestiensäulen‹, wie Dorian Hunter sie nannte. Es gab noch zwölf andere Säulen, aber die verfügten nicht über so eindrucksvolle Reliefs. Sie waren glatt und besaßen lediglich Kapitelle, die schaurige Dämonen und magische Ornamente darstellten.
Unga, der Cro Magnon, kam die Treppe zum Obergeschoss herunter. Er schüttelte den Kopf. »Also, Virgil, ich weiß wirklich nicht, was mit Phillip los ist. Er läuft planlos von einem Zimmer zum anderen, stammelt unverständliches Zeug und gestikuliert. Hysterisch, würde ich meinen.«