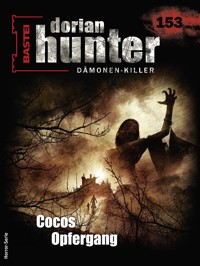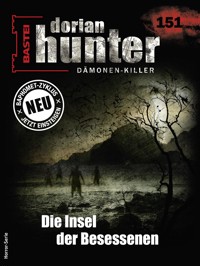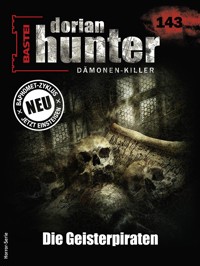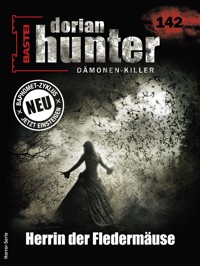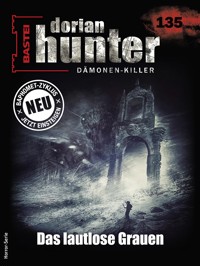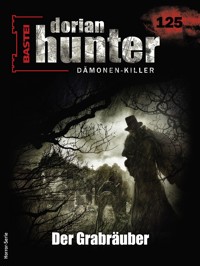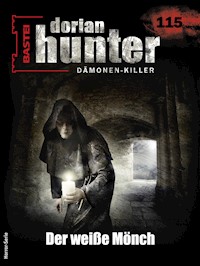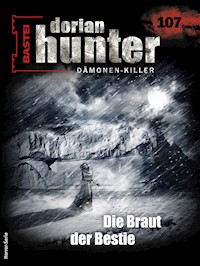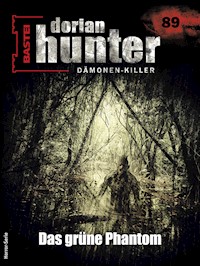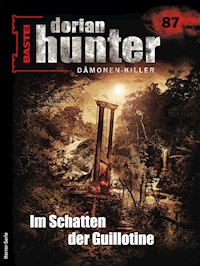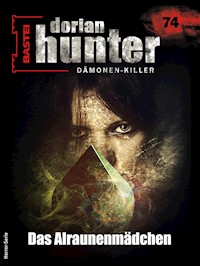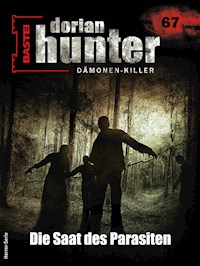
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Der Nachtportier Charles Hopkins hetzte zum Ausgang der Pension und weiter auf die Straße hinaus. Sein Herz hämmerte, als wollte es den Brustkorb sprengen. Noch zehn, fünfzehn Schritte bis zum gegenüberliegenden Haus. Dann, urplötzlich, traf ihn der Schlag. Etwas schüttelte ihn, hob ihn hoch, packte ihn und schleuderte ihn der Bordsteinkante entgegen. Dass er hart aufschlug, spürte er nicht mehr.
Bevor Menschen aus den umliegenden Häusern zur Stelle waren, verließ ein zweiter Mann die Pension und ging wortlos an Charles Hopkins’ verkohlter Leiche vorüber. Der Fremde hatte es sehr eilig, Hampstead zu verlassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 132
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DIE SAAT DES PARASITEN
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den gesamten Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen. Unterstützung in seinem Kampf erhält er zunächst durch den englischen Secret Service, der auf Hunters Wirken hin die Inquisitionsabteilung gründete.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In der Folge beginnt Dorian die Dämonen auf eigene Faust zu jagen. Als die Erfolge ausbleiben, gerät Trevor Sullivan, der Leiter der Inquisitionsabteilung, unter Druck. Die Abteilung wird aufgelöst, und Sullivan gründet im Keller der Jugendstilvilla die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld: die junge Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; weiterhin der Hermaphrodit Phillip, dessen hellseherische Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie ein Ex-Mitarbeiter des Secret Service namens Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.
Trotz der Rückschläge gelingt es Dorian, Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie, zu vernichten. Doch mit Olivaro steht schon ein Nachfolger bereit, der die schwangere Coco Zamis zur Rückkehr in die Schwarze Familie zwingt. Es gelingt Dorian, Coco zu retten. Nach einer Flucht um den halben Erdball bringt sie ihr Kind in London zur Welt, und Olivaro muss den Thron räumen.
Coco versteckt das Neugeborene an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält – und ihre Vorsicht ist berechtigt, da bald eine neue, »alte« Gegnerin auf sich aufmerksam macht, die Dorian aus seinem Leben als Georg Rudolf Speyer kennt: Hekate lockt den Dämonenkiller in ein lebensfeindliches, fantastisches Reich außerhalb der Realität, in dem er ihren Aufstieg zum neuen Oberhaupt der Schwarzen Familie erlebt. Mit knapper Not entkommt Dorian und kehrt nach London zurück. Um Abstand zu gewinnen, reist er gemeinsam mit Coco nach Antibes. Aber statt eines Urlaubs erwartet die beiden dort ein Rendezvous mit dem Sensenmann ...
DIE SAAT DES PARASITEN
von Roy Palmer
Charles Hopkins galt als ausgesprochen neugieriger Mann. Er hasste nichts mehr als rätselhafte Vorgänge und verschlossene Menschen, aus deren Mienen man nichts von dem ablesen konnte, was sie gerade dachten.
Hopkins stieg über die mit einem weinroten Spannteppich bedeckten Stufen der Treppe in die obersten Stockwerke der Pension in Hampstead. Niemand außer ihm schien auf den Beinen zu sein. Es war tiefe Nacht in London.
Regen prasselte gegen die Fensterscheiben. Draußen ballten sich schwarze Wolken zu einem heftigen Juligewitter zusammen.
Hopkins hatte außer seiner Wissbegierde noch eine zweite große Leidenschaft – seine Redseligkeit. Mr. Ives, der Besitzer der Pension, und dessen gesamte Familie sowie das Personal, das sich jeden Tag auf den Feierabend freuen konnte, wenn er seinen Dienst antrat, bescheinigten ihm seine Geschwätzigkeit immer wieder. Vielleicht lag das an seinem Job. Er hatte ja so viel Muße und so wenig Gesprächspartner, seitdem er vor zehn Jahren den Autounfall gehabt hatte.
1. Kapitel
Hopkins, der Nachtportier, hatte die zweite Etage erreicht. Aufmerksam blickte er sich um. Wurde er beobachtet? Nein, kein Mensch ließ sich sehen. Offenbar lagen alle Gäste schlafend in ihren Betten, wie man es um diese Zeit annehmen sollte. Er hatte absichtlich so lange gewartet. Trotz aller Neugierde wäre es ihm äußerst peinlich gewesen, falls ihn jemand bei seinem Vorhaben überrascht hätte. Hopkins – klein, stämmig und das linke Bein nachziehend – näherte sich der Tür auf der rechten Seite des durch die Notbeleuchtung schwach erhellten Korridors. Sie trug die Nummer 17.
Erstes Donnergrollen wurde laut. Ein Blitz zerriss die Dunkelheit und tauchte den Flur für den Bruchteil einer Sekunde in geisterhaftes Licht.
Hopkins war fünfzig. Damals, vor zehn Jahren, hatten ihn die Ärzte mit modernsten Methoden mühsam wieder zusammengeflickt. Sonst hätte er das Bein ganz verloren. Der Mann, der den Unfall verschuldet hatte, zahlte noch heute für seinen Fehler. Man hatte Hopkins eine Tätigkeit als Nachtportier vermittelt, weil er nicht mehr fahren und seinen Beruf als Handelsvertreter nie wieder ausüben konnte. Das hatte ihn verbittert. Seine Missgunst gegenüber den Mitmenschen verdrängte er durch übertriebene Redelust und fortwährendes Schnüffeln, wie seine Frau das abwertend nannte.
Wer war der Mann auf Nummer 17?
Warum benahm er sich so merkwürdig? Hatte er ein Geheimnis? Bestimmt hat er etwas auf dem Kerbholz, dachte Hopkins. Die Erwartung, etwas Ungeheuerliches, Skandalöses aufzudecken, beflügelte ihn förmlich.
Draußen brach das Gewitter nun mit voller Heftigkeit aus. Nach der Distanz zwischen den einzelnen Stößen und den Blitzen zu urteilen, musste sich das Unwetter bald über der Pension befinden.
Hopkins blieb vor der Tür stehen und lauschte. Es war nichts zu hören. Er bückte sich und guckte angestrengt durch das Schlüsselloch, konnte jedoch nichts ausmachen, weil es im Inneren des Zimmers stockdunkel war. Etwas enttäuscht richtete er sich wieder auf. Er hatte sich mehr versprochen, zumindest vage Bewegungen oder ein Selbstgespräch des Gastes.
Dieser Mann war am späten Abend eingetroffen. Hopkins war fast erschrocken, denn der Gast war unvermittelt aufgetaucht. Kein Wagen, der vorgefahren war. Niemand, der seinen Koffer trug – nein, er war plötzlich da gewesen. Ohne Fahrzeug. Ohne Gepäck.
Cyrus St. John lautete sein Name. So stand es jedenfalls in dem kanadischen Pass, den er am Pult der Rezeption vorgezeigt hatte. Hopkins war jedoch davon überzeugt, dass der Ausweis gefälscht sein musste oder jemand anderem gehörte. St. John sprach Englisch mit starkem Akzent. Woher kam er also wirklich?
St. Johns Gesicht wirkte wie aus Stein gemeißelt. Maskenhaft, dachte Hopkins. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Ich bin sozusagen verpflichtet, ihn zu überprüfen. Denn falls er ein Krimineller ist, muss ich Anzeige erstatten.
Diese Erkenntnis veranlasste ihn, den Hauptschlüssel aus der Hosentasche zu ziehen. Cyrus St. John hatte sich gleich nach seiner Ankunft auf sein Zimmer zurückgezogen. Er hatte nicht einmal um einen Imbiss oder eine Tasse Tee gebeten. Er hatte überhaupt nichts mehr von sich hören lassen.
Ein greller Blitz zerteilte den Vorhang der Nacht wie ein Schwert. Hagel schlug gegen die Fensterscheiben, die Mauern, das Dach des Gebäudes. Während der Donner polterte, steckte Hopkins den Bart des Hauptschlüssels in das Türloch. Er war überzeugt, weder von dem seltsamen Gast noch von sonst irgendjemandem gehört zu werden.
Innen steckte kein Schlüssel. Hopkins hatte also keine Mühe, die Klinke nach unten zu drücken und die gut geölte Tür behutsam zu öffnen. Er wollte den dahinter liegenden Raum lediglich einer kurzen Inspektion unterziehen, nur einen Blick auf St. John werfen. Trug er einen Schulterhalfter mit geladenem Revolver? Hopkins' Phantasie arbeitete. Er malte sich die abenteuerlichsten Dinge aus.
Mr. Ives hätte sein Tun garantiert nicht gutgeheißen. Aber Mr. Ives war nun einmal nicht im Haus. Er befand sich sechs Kilometer entfernt in Willesden, in seinem schönen neuen Zehn-Zimmer-Bungalow, den er vor zwei Monaten mit seiner Familie bezogen hatte. Tagsüber leitete Ives die Pension, aber nachts konnte Hopkins ungestört das genießen, was er seine persönlichen Freiheiten nannte.
Mit klopfendem Herzen schob der Nachtportier seinen gedrungenen Körper durch den Türspalt. Er machte einen vorsichtigen Schritt in den Raum hinein. Dann stand er still und nahm die Eindrücke in sich auf: Der rätselhafte Fremde lag auf dem Bett – ausgestreckt, offenbar tief schlafend. Das Wetterleuchten ließ die Konturen der Gestalt erkennen. St. John hatte sich nicht entkleidet. Er trug den zerknitterten Anzug, in dem er Hopkins gegenübergetreten war.
Hopkins wurde nun noch misstrauischer. Gleichzeitig fürchtete er sich. Sein Herz klopfte heftig, und er wagte kaum zu atmen. Wieso legte der Mann sich völlig angezogen hin?
Die entfesselten Naturgewalten trieben draußen dem Höhepunkt entgegen. Hopkins schaute einen Augenblick zum Fenster hinaus, als ein Blitz zu Boden zuckte. Dann nahm er den Kopf wieder herum. Er blickte erneut zu dem Bett hinüber – und stellte fest, dass die Gestalt des Mannes verschwunden war! Sie schien sich in nichts aufgelöst zu haben.
Entsetzt wich Charles Hopkins zurück. Das Herz klopfte ihm bis zum Hals hinauf. Bevor er aber die Tür erreichen konnte, schob sich neben ihm etwas Großes, Dunkles in die Höhe. Der Unheimliche war neben ihm!
»Himmel, haben Sie mir einen Schreck eingejagt!«, stammelte Hopkins. »Ich wollte nur nachsehen, ob ...«
Der Mann stand dicht neben ihm. Hopkins sah, dass er den Mund aufmachte, und er hörte Worte in einer Sprache, die er nicht verstand. Der Atem des anderen roch widerwärtig. Hände griffen nach ihm, doch er entzog sich ihnen durch eine hastige Bewegung und warf sich herum.
Hopkins stieß gegen die Kante, dann gegen den Pfosten der Tür. Er spürte die Finger von Cyrus St. John auf seinem Rücken und am Hals. Mit einem Aufschrei riss er sich wieder los. Er rannte auf den Flur hinaus. Hinter ihm ertönte ein tiefer, verächtlicher Grunzlaut.
Hopkins rannte so schnell er konnte. Angst und Grauen trieben ihn. Er war sicher, der unheimliche Mann würde ihn umbringen. So hetzte er im Erdgeschoss an seinem Pult vorüber und blieb nicht stehen, um nach dem Telefon zu greifen und die Polizei oder Mr. Ives anzurufen. Er rannte wie vom Teufel gejagt aus der Pension – in den Hagel und das Gewitter hinein.
Er hatte nur noch einen Gedanken: fort! Keuchend lief er durch den Vorgarten. Das lädierte Bein vertrug die ungewohnte Anstrengung nicht und begann zu schmerzen. Hopkins stolperte und fiel. Doch er erhob sich wieder und hastete weiter.
Als er über die Schulter zurücksah, erkannte er die Umrisse des Fremden unter der erleuchteten Eingangstür. Mit einem Schrei rannte er auf die Straße hinaus. Noch zehn, fünfzehn Schritte bis zum gegenüberliegenden Haus. Hopkins bewegte sich unter Qualen. Sein Herz hämmerte, als wollte es den Brustkorb zersprengen.
Dann, urplötzlich, traf ihn der Schlag. Es durchfuhr ihn von oben bis unten, und in seinem Inneren dröhnten Kirchenglocken. Etwas schüttelte ihn, hob ihn hoch, packte ihn und schleuderte ihn der Bordsteinkante entgegen. Dass er hart aufschlug, spürte er nicht mehr.
Bevor Menschen aus der Pension und dem gegenüberliegenden Haus zur Stelle waren, schritt der Mann, der sich als Cyrus St. John ausgegeben hatte, an Charles Hopkins' verkohlter Leiche vorüber. Er hatte es sehr eilig, Hampstead zu verlassen.
Arnold S. Keaton Ltd. & Sons hieß die Firma, deren Name auf einem der vielen Messingschilder neben dem Eingang des Hochhauses prangte. Trevor Sullivan ging daran vorüber. Im Erdgeschoss verschaffte er sich Gewissheit darüber, in welchem Stockwerk das Büro des Unternehmens lag. Dann stieg er in eine der Kabinen des Paternosters. Sie trug ihn schwerfällig nach oben.
Der Aufzug war so alt wie das Gebäude selbst – mindestens hundert Jahre. Ein Denkmal aus der Blütezeit des englischen Welthandels. Die Keaton Ltd. war bekannt. Sie hatte mit allen möglichen Gütern – von britischen Lokomotiven bis zu indischem Kautschuk – gehandelt. Erst in den letzten Jahren war die Firma in Schwierigkeiten geraten.
Sullivan verließ den knarrenden Paternoster in der vierten Etage. Wenige Sekunden später klopfte er mit seiner knochigen Faust gegen eine Tür.
Diesmal öffnete keine Sekretärin, wie das bei früheren Besuchen der Fall gewesen war. Automatisch entriegelte sich die Tür und schwang auf. Sullivan trat ein. Ein junger Mann, der sich mit dem Namen Mandell vorstellte, begrüßte ihn. Es herrschte eine seltsame Stille. Die Abteilungen schienen verlassen zu sein.
»Ich habe ein Schreiben erhalten«, erklärte Sullivan. »Man bat mich um eine persönliche Unterredung, und da ich Mr. Keaton kenne und schätze, bin ich der Aufforderung nachgekommen.«
»Folgen Sie mir!« Mehr sagte Mandell nicht. Er machte auf dem Absatz kehrt.
Sullivan folgte ihm und hatte Gelegenheit, einen Blick durch verglaste Trennwände zu werfen. Er sah leere Schreibtische. Das machte ihn noch misstrauischer. Unwillig zog er die Augenbrauen zusammen. Sullivan besaß ein geierähnliches Gesicht, er war hager und nicht besonders groß, dennoch verlangte sein Äußeres Respekt ab.
Der Mann, dem er wenig später im mondän eingerichteten Chefbüro gegenüberstand, war ihm kein Unbekannter. Mit feinem ironischem Lächeln kam er hinter dem Mahagoni-Schreibtisch hervor und ging auf ihn zu.
»George Ferguson-Baynes«, sagte Sullivan. »Einer meiner früheren Vorgesetzten vom Secret Service im Rang eines Colonels. Hat man Sie Ihre Demission einreichen lassen, oder ist der Stellungswechsel nur ein Trick? Was hat das zu bedeuten?«
Mandell war stumm neben dem Türrahmen stehen geblieben. Ferguson-Baynes näherte sich Sullivan nun bis auf zwei Schritte. Aufmerksam musterte er ihn. Er war ein Mann mit rotem Teint und fleischiger Nase, was ihm ein vierschrötiges Aussehen verlieh. Dieser Eindruck täuschte jedoch. Was ihn auszeichnete, waren hohe Intelligenz, Gerissenheit, Kompromisslosigkeit und Fingerspitzengefühl.
»Sie scheinen alt geworden zu sein, Sullivan.«
»Haben Sie dieses Theater inszeniert, um mir das zu sagen?«
»Keineswegs. Wir wussten, dass Sie sich um ein Treffen mit uns drücken würden. Vielleicht hätten Sie auch rundheraus abgelehnt, wie das Ihre Art ist. Da wir nicht viel Zeit haben, wählte ich diesen Weg. Ich wusste, dass Sie kommen würden. Keaton würden Sie niemals versetzen.«
»Wo ist er?«
»Umgezogen. Mit der gesamten Firma. Wir haben diese Räume vorübergehend gemietet.« Ferguson-Baynes setzte eine ernste Miene auf. »Wir benötigen Ihre Dienste, Sullivan. Dringend.«
Trevor Sullivan schüttelte den Kopf. »Ausgeschlossen. So kommen wir nicht ins Gespräch. Nach allem, was vorgefallen ist, halte ich es für besser, wenn jeder von uns seine eigenen Wege geht. Ich habe weder mit dem Secret Service oder dem Intelligence Service noch mit irgendeinem anderen Geheimdienst etwas zu schaffen. Suchen Sie sich einen anderen, Ferguson-Baynes!« Er wandte sich ab und wollte den Raum verlassen. Doch Mandell trat ihm in den Weg.
Sullivan verhielt den Schritt. Ohne sich umzudrehen, sagte er: »Das können Sie nicht machen. Lassen Sie mich gehen!«
»Keine Diskussionen«, sagte Ferguson-Baynes mit schneidender Stimme. »Wir brauchen Sie – Sie und keinen anderen.«
»Zwingen können Sie mich nicht.«
»Bedenken Sie, dass wir Sie und Ihre Freunde aus der Jugendstilvilla unter Druck setzen können!«
Sullivan lachte verbittert auf. Er fuhr herum und sah den Colonel aus schmalen Augen an. »Ich bedaure es, dass Sie so etwas überhaupt aussprechen. Es muss schlecht bestellt sein um den Secret Service.«
»Sie irren. Nur sind Sie der am besten geeignete Mann für die Aufgabe. Deshalb ist mir jedes Mittel recht, um Sie gefügig zu machen.« Er zog sich hinter den Schreibtisch zurück und machte eine einladende Geste. »Bitte setzen Sie sich! Wir wollen uns jetzt in aller Ruhe unterhalten.«
Achselzuckend willigte Sullivan ein. Er machte es sich in einem Ledersessel bequem.
»Worum geht es? Wollen Sie mir ein Himmelfahrtskommando anbieten? Das sähe Ihnen ähnlich.«
»Ein Mann hat den Service um Hilfe gebeten«, entgegnete Ferguson-Baynes. »Ein Russe. Er heißt Alexej Dorochow. Wir müssen ihn in unsere Obhut nehmen, bis wir über alle Details Bescheid wissen.«
»Wer ist dieser Dorochow?«
»Das tut im Augenblick nichts zur Sache.«
»Hören Sie, wenn ich zuverlässig für Sie arbeiten soll ...«
Ferguson-Baynes unterbrach Sullivan rigoros. »Es wäre der Sache nicht dienlich, wenn Sie jetzt weitere Informationen erhalten würden. Das muss Ihnen genügen. Sehen Sie es um Himmels willen nicht als Mangel an Vertrauen an – es handelt sich um eine taktische Maßnahme.« Er blickte auf und wandte sich an den jungen Mann: »Holen Sie ihn jetzt, Mandell!«
Mandell verschwand.