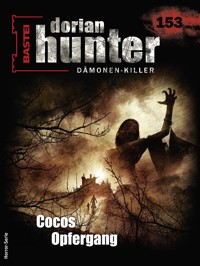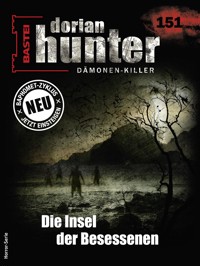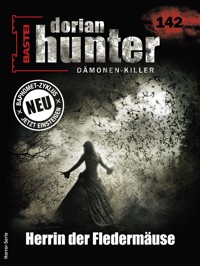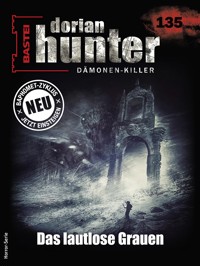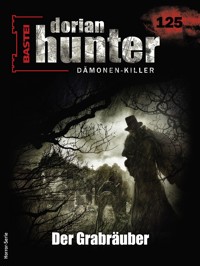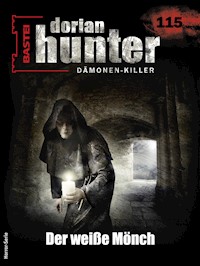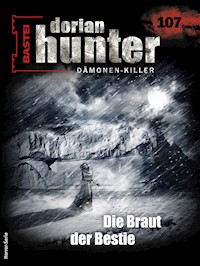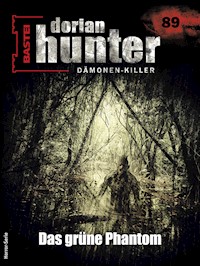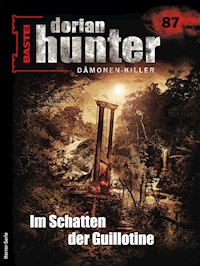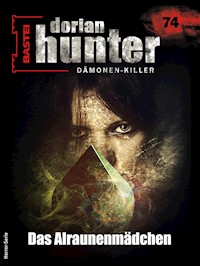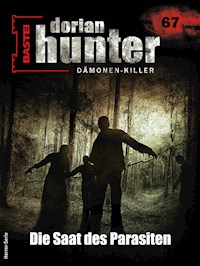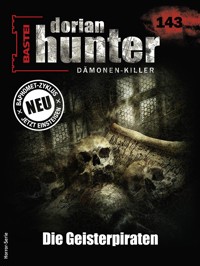
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Martin horchte auf. Da war eine Stimme im Raum, die ihm keine Angst einjagte. Schon mehrfach hatte er sie vernommen.
»Sei ganz ruhig, Martin! Ich bin bei dir.«
»Horst?«
»Du musst dir Mut machen, Junge.« Die Stimme schwebte durch die Kombüse und verharrte neben seinem rechten Ohr.
»Horst, bist du ein Geist?«, fragte Martin.
»Ja.«
Martin klatschte in die Hände. »Dann bin ich auch einer! Ich bin dein Freund ...«
Das Geisterschiff mit Martin Zamis an Bord begibt sich auf Kaperfahrt und ermöglicht damit Dorian und Coco, sich auf seine Fährte zu setzen. Doch auch die Schwarzen Witwen planen ihr Spiel mit den Geisterpiraten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DIE GEISTERPIRATEN
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
Als Rückzugsort in seinem Kampf bleibt Dorian neben der Jugendstilvilla in der Baring Road in London noch das Castillo Basajaun in Andorra, in dem er seine Mitstreiter um sich sammelt – darunter die ehemalige Hexe Coco Zamis, die aus Liebe zu Dorian die Seiten gewechselt hat. Nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Martin hat Coco diesen zum Schutz vor den Dämonen an einem Ort versteckt, den sie selbst vor Dorian geheimhält.
Auf der Suche nach der Mumie des Hermes Trismegistos findet Dorian den Steinzeitmenschen Unga, der Hermon gedient hat und der sich nach seinem Erwachen schnell den Gegebenheiten der Gegenwart anpasst. Auf Island gewinnt Dorian den Kampf um das Erbe des Hermes Trismegistos.
Die Invasion der Janusköpfe von der Parallelwelt Malkuth wird von den Padmas mit Dorians Hilfe abgewehrt. Dem Padmasambhawa –niemand anderes als Hermes Trismegistos – wird klar, dass er für das Entstehen der Psychos auf Malkuth verantwortlich ist. Um zu büßen, geht Hermon durch eins der letzten Tore nach Malkuth. Auf der Erde sind zehn Janusköpfe gestrandet. Olivaro, das ehemalige Oberhaupt der Schwarzen Familie und selbst ein Januskopf, beschließt, seine Artgenossen zu jagen. Der Tempel des Hermes Trismegistos in Island wird zerstört, aber kurz zuvor zeigt der magische Tisch sieben düstere Prophezeiungen. Fünf davon haben sich bereits bewahrheitet, auch jene über Martin Zamis: Der Sohn des Dämonenkillers wird vom Kinddämon Baphomet, der Reinkarnation des Dämonenanwalts Skarabäus Toth, entführt und von den Geisterpiraten aus Vigo rekrutiert. Miss Pickford prognostiziert als »Magic Martha« chaotische Zustände in New York. Dorian und Coco werden mit Baphomet-Anhängerinnen konfrontiert, die von der Vampirin Rebecca, Cocos Jugendfreundin, angeführt werden. Zurück in London erfahren sie, dass Miss Pickford und Trevor Sullivan geheiratet haben und auf dem Weg nach New York sind.
DIE GEISTERPIRATEN
von Roy Palmer
Das Gesicht der Frau glitt aus der Dunkelheit auf ihn herab und verharrte über ihm. Ihre Züge entspannten; in ihnen spiegelten sich Liebe und Güte, aber auch Sorge. Die sinnlich geschwungenen Lippen bewegten sich und sprachen seinen Namen aus. Ihre Stimme besaß einen leicht rauchigen Klang.
Martin, Martin!
»Mutter!« Er streckte seine Hände nach ihr aus, doch ihr Gesicht wich abrupt zurück. Es schwang hoch, fort von ihm, wollte sich erneut in der Finsternis auflösen.
Martin wollte es nicht zulassen. Seine Hände – kleine, patschige Kinderhände – öffneten und schlossen sich. Das Gesicht blieb. Die Augen waren groß und dunkelgrün, die Lippen wie weicher Samt, die Zähne perlweiß. Schwarzes Haar rahmte das Gesichtsoval ein.
»Mutter! Liebe Mutter!«
Ihre Konturen zerfaserten in tintenschwarzer Nacht. Es nützte ihm nichts, wenn er nach ihr griff, strampelte und schließlich um sich schlug. Es war sinnlos.
1. Kapitel
Sein Mund öffnete sich zu einem lautlosen Schrei. Er wälzte sich auf etwas Glitschigem, rutschte ein Stück auf dem Rücken, verlor den Boden unter sich und stürzte in die Tiefe.
Weit fiel Martin nicht. Er setzte sich auf und spreizte die Beine weit von sich. Martin hatte die Augen jetzt geöffnet und nahm seine Umgebung in sich auf.
Er hatte geträumt. Diese Erkenntnis ließ ihn einen klagenden Laut ausstoßen. Er schluchzte. Es war schön gewesen, im Schlaf auf seine Mutter zuzusegeln und ihre Stimme zu hören; und es war bitter, in die Realität zurückzukehren.
Wie lange war es her, dass er die Stimme seiner Mutter tatsächlich gehört hatte? Er wusste es nicht. Er kannte kein Zeitmaß – nur das eines Tages. Schwester Ines im Kinderheim hatte manchmal gesagt, ein Tag finge an, wenn die Sonne ins Zimmer lacht, und er hörte auf, wenn sie zu Bett ging und mit ihr die vielen, vielen Kinder.
Nein, Martin hatte keine Ahnung, ob die Sonne viele oder wenige Male aufgestanden und wieder schlafen gegangen war, seit er zum letzten Mal telepathischen Kontakt mit seiner Mutter gehabt hatte. Nur an eines erinnerte er sich: Durch dicken Nebel hindurch hatte er ein großes, wuchtiges Gemäuer gesichtet, während er auf gedanklichem Wege mit ihr gesprochen hatte. Einen Turm. Und es war ihm gewesen, als hätte ein kleines Schiff munter auf den Wellen geschaukelt, ein Schiff wie ein Spielzeug; und Mutter und Vater hatten auf diesem Schiff gestanden und ihm zugewunken. Aber auch da war es wie in seinem Traum gewesen: Das Bild war aufgetaucht und schnell wieder verschwunden.
Alles war nur für kurze Zeit da und verschwand dann. Nur das Schiff, auf dessen glitschigen Decks er sich bewegte, blieb immer. Es war jetzt sein Zuhause, aber er fühlte sich nicht wohl darauf. Und dazu diese Männer. Auch sie waren Teil der Wirklichkeit. Wo steckten sie? Was für seltsame Männer waren das eigentlich?
Böse Männer. Mutter.
Er hatte es ihr gesagt, aber er hatte sie gleichzeitig auch zu besänftigen versucht. Sie sind böse, aber sie tun mir nichts. Mutter.
Mutter war lieb. Sie durfte sich nicht aufregen.
Mutter, mir geht es gut. Das hatte er ihr in Gedanken als Letztes zugerufen. Aber hatte sie es noch verstanden? Ihre Stimme hatte zuletzt so entfernt geklungen, als hörte er sie durch viele dicke Pfropfen Watte hindurch.
Martins Hände gruben sich in etwas Weiches, Schlüpfriges, aber es war nicht angenehm anzufassen wie Watte. Er ekelte sich davor. Überall auf dem Schiff war diese Masse. Sie roch übel. Auf dem ganzen Schiff stank es unsäglich. Martin war sicher, dass es ein ganz alter Kasten war, denn es war aus Holz gebaut und überall kaputt.
»Deck!«
Da war sie, eine der merkwürdigen Männergestalten. Martin schaute auf und beobachtete sie hoch oben im Mast. Die Gestalt beugte sich über die Plattform, die sie Großmars nannten, und brüllte wieder. »Deck, Deck! Das Knäblein ist gefallen! Satan, hilft ihm denn keiner auf die Beine?«
Komisch – Martin verstand jedes Wort; und doch erschien ihm die Sprache so fremd wie die Gestalt des Mannes selbst.
Der Kerl lehnte sich so weit vor, dass er aus dem Ausguck zu trudeln drohte. Er war grün im Gesicht, furchtbar mager und trug nur Fetzen am Leib. Martin glaubte, durch ihn hindurchsehen zu können; und meistens verschwand der Mann auf rätselhafte Weise, wenn er sich erst kurze Zeit gezeigt hatte. Weil er immer so schrie und viel schimpfte, hatte Martin ihm den Namen Donnerwetter verliehen.
Donnerwetter hatte gebrüllt, und plötzlich waren sie alle zur Stelle. Sie huschten um ihn herum – Schemenwesen, abenteuerlich gekleidete, unglaublich flinke Burschen.
»Er ist wieder mal eingepennt«, sagte einer.
Martin wandte den Kopf um.
Der Sprecher, ein Hüne von Gestalt, löste sich beim Näherkommen in Luft auf. Martin hatte ihn aber erkannt. Er hielt einige von ihnen auch den Stimmen nach auseinander. Dieser hier war von ihm Riese getauft worden.
»Vom Achterdeck aufs Quarterdeck gefallen ist er«, rief ein anderer. Er trug eine schwarze Augenklappe. Schwarzauge hatte Martin ihn getauft. »Sämtliche Knochen hätte er sich brechen können.«
»Soll er doch«, meinte ein alter, buckliger Kerl, der auch gleich wieder im Nichts zu verschwinden drohte. »Ich weine ihm keine Träne nach, dem Rotzlümmel. War von Anfang an dagegen, ihn in die Mannschaft aufzunehmen. Was sollen wir mit so einem Bengel? Ist doch bloß ein Klotz am Bein.«
Er war einer von denen, die Martin überhaupt nicht wohlgesonnen waren. Böser Opa wurde er von Martin genannt.
Einer schlug mit einem morschen Belegnagel gegen den Großmast, um sich Gehör zu verschaffen. Er tat das oft. Oder er riss Fässer und andere Gegenstände an Bord herum. Kurzum, er war nie zu überhören, und deswegen hatte Martin ihm den Beinamen Polter gegeben.
»Sollen wir ihm den Hals umdrehen?«, fragte Polter lauernd.
Er war ein grobschlächtiger Kerl mit tückischem Blick, aber irgendwie war er doch nicht ganz so gemein wie Böser Opa; er tat nur so. »Kommt nicht in Frage!«, schrie Donnerwetter aus dem Großmars.
»Wir reißen den Bengel in Stücke«, rief Böser Opa und tanzte um die Nagelbank herum. Dann löste er sich in Luft auf. Martin blickte Hilfe suchend auf Riese und einen bärtigen Seemann, der dicht neben ihm aufgetaucht war: Weißbart von Martin benannt.
»Nein«, sagte Weißbart. »Der Kapitän will es nicht, dass wir eigenwillig Entscheidungen treffen.«
»Er kann das Früchtchen auch nicht leiden«, entgegnete Polter. Martin konnte ihn nicht mehr sehen, aber seine Stimme dröhnte immer noch von dem Platz, an dem er eben gestanden hatte, zu ihm hinüber.
»Das besagt nichts«, wandte Riese ein.
»Schlagt ihn tot, schlagt ihn tot!«, krähte Böser Opa.
»Halt das Maul, du!«, schrie Weißbart.
»Hört zu streiten auf!«
Der das sagte, war ein Meister im Umgang mit Hieb und Stichwaffen. Deshalb nannte ihn Martin Messer. Messers Umrisse verloren sich in der Nacht, doch der Dolch, den er spielerisch zwischen seinen Fingern bewegt hatte, schwebte weiterhin in der Luft. »Ich rate euch wirklich, friedlich zu sein. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt da der Kapitän.«
Ihre Stimmen entfernten sich.
Martin vernahm das Pochen und Klopfen der Holzprothese und das schleifende Geräusch, mit dem der Kapitän sie nach dem Aufsetzen nachzog. Der Kapitän hatte nur noch ein Bein. Das andere wurde durch ein stockähnliches Gebilde ersetzt. Martin hatte dies zu Beginn lustig gefunden. Doch er hatte gelernt, dass er nicht über den Kapitän lachen durfte. Kapitän Einbein, wie er ihn titulierte, konnte fuchsteufelswild werden, wenn man sich über ihn amüsierte.
Martin glitt ein Stück zurück, blickte sich dabei aber nicht um. Er stieß mit dem Rücken gegen die Nagelbank am Großmast. Dann war es zu spät, die Flucht zu ergreifen.
Kapitän Einbein erschien hoch über ihm hinter der Schmuckbalustrade des Achterdecks. Er war ein grausamer König, der von seinem Thron auf den Untergebenen, den Knecht, den Wurm herabblickte. Martin sah seine Gestalt für wenige Augenblicke, bevor auch sie wie eine Tuschezeichnung verlief – und dann ganz verschwand. Kapitän Einbein war groß und breitschultrig und hatte oft die Arme verschränkt, wenn er sichtbar war. Seine Uniform musste einst prachtvoll gewesen sein; jetzt hing sie in Fetzen an dem merkwürdig mageren Leib. Was die Färbung des Gesichtes betraf, so unterschied sie sich in nichts von seinen Seeleuten: Sie war grün.
»Profos!« Seine Stimme klang wütend und drohend. Martin zuckte zusammen.
»Senor?« Polter antwortete aus den Regionen des Vorkastells. Zu sehen war er nicht. Er war der Profos, und Martin hatte gehört, dass er manchmal auch der Stockmeister genannt wurde. Vielleicht polterte er deswegen so gern.
»Dieser Drecksjunge – warum wird er nicht beschäftigt? Ich dulde keine Faulenzer und keinen Schlendrian an Bord meiner Galeone. Wer nicht pariert, der bekommt die neunschwänzige Katze zu spüren.«
»Ja, Senor«, brüllte Polter.
»He, du!« Kapitän Einbein wandte sich nun direkt an Martin. Seine Stimme klang so schrecklich tief, als käme sie geradewegs aus der Hölle. »Du! Schrubb das Deck! Was ist das für eine Schweinerei hier? Räum die Kombüse auf! Sorge für Ordnung! Und wenn du damit fertig bist, marschierst du in der Kapitänskammer an und machst dort weiter! Kapiert?«
»J-ja«, stotterte Martin.
Einbeins Gestalt war fort, doch es war noch das Pochen und Schleifen zu hören, mit dem er seine hölzerne Prothese über Deck zog.
Martin zitterte. Einbein entfernte sich. Die anderen Stimmen waren auch verstummt. Doch Martin hatte den Eindruck, von Zeugen aus der tintenschwarzen Finsternis beobachtet zu werden. Polter, Riese, Böser Opa, Weißbart, Donnerwetter, Messer, Schwarzauge und wie sie alle hießen – sie wachten darüber, dass er seine Aufgaben auch pflichtgemäß verrichtete.
Martin begann, die Planken zu scheuern – unbeholfen, wie ein Dreieinhalbjähriger es nur vermochte.
Mutter, ich will zu dir!
Der Wind strich heulend durch die zerfetzten Segel der spanischen Dreimastgaleone. Sie war ein Geisterschiff, das die Weltmeere befuhr und durch die Jahrhunderte kreuzte. Weder Raum noch Zeit schienen zu existieren, und doch glitt die Galeone rastlos dahin, als gäbe es ein konkretes Ziel.
Decksteward Geoffrey McBain balancierte das Tablett auf der rechten Hand über die Köpfe der Passagiere hinweg. Auf dem Tablett standen viele Gläser, und alle bewunderten das Geschick und das Lächeln, mit dem Geoffrey es über das Sonnendeck zwischen den Liegestühlen hindurch jonglierte.
Es war Anfang Mai. Die Sonne hatte während der Atlantiküberquerung der »Viktoria« an Kraft gewonnen. Sie setzte den Wogen glitzernde Silberkronen auf, und auf den Azoren, die sie passiert hatten, hatten die Urlauber mit Ferngläsern die volle Pracht der Flora bewundern können.
Der Frühling war da.
Geoffrey McBain wusste, dass die allgemeine Stimmung ihren Höhepunkt erreichen würde, wenn sie die Karibik erreicht hatten. Die Karibik verzauberte jeden Passagier eines Luxusschiffes.
Geoffrey lächelte. Er war ein erfahrener Steward, der Sympathien zu erobern und viele, viele Trinkgelder einzustreichen verstand.
Geoffrey servierte die eisgekühlten Getränke vom Tablett. Im letzten Glas schwappte Tee mit Zitrone. Er sparte diesen Drink auf, bis er am Ende seines Ausfluges kreuz und quer über das Sonnendeck angelangt war.
Der Mann, der den Tee bestellt hatte, lag fast reglos auf seinem Liegestuhl; nur seine Brust hob und senkte sich leicht. Er hatte sich das Gesicht zugedeckt und bis obenhin in eine Wolldecke gehüllt. Nichts schien ihm ferner zu liegen, als sich von der Sonne rösten zu lassen. Was suchte er dann auf dem Sonnendeck?
Geoffrey McBain forschte nach keiner Antwort. Er hatte schon verrücktere Dinge an Bord erlebt. Mit der Zeit gewöhnte man sich in diesem Metier das Wundern ab. Entweder war der Mann ein spleeniger Exzentriker – oder er war krank. Hätte Geoffrey ihn vielleicht doch als Ersten bedienen sollen?
Nein. Er hatte ihn sich für zuletzt aufgehoben. Als Sonderfall. Wollte mehr Zeit für ihn aufwenden. Außerdem war der Tee kalt und brauchte nicht in aller Eile abgeliefert zu werden.
Geoffrey McBain glaubte, mit dem untrüglichen Instinkt eines Deckkellners einen Kunden gefunden zu haben, der gewonnen werden wollte. Hatte er ihn erst aus seiner Reserve gelockt, würde es ein einträgliches Geschäft werden. Solche Leute, egal, ob sie einen Stich hatten oder kränkelten, zahlten meistens die höchsten Trinkgelder.
Geoffrey setzte das Glas auf einem Beistelltischchen ab. »Sir?«
Zunächst reagierte der Mann nicht, dann bewegten sich seine teuren, auf Hochglanz polierten Halbschuhe. Sein Körper ruckte etwas herum, aber er blieb vermummt. Seine Stimme klang dumpf unter dem Schal, den er sich um den Kopf gewunden hatte. »Ja. Ja, bitte?«
»Sir, ich bringe den kalten Tee mit Zitrone.«
»Setzen Sie ihn da ab!«
»Sir, ich wollte noch sagen ...«
»Ja?«
»Falls Sie irgendwelche Sonderwünsche haben, ich erledige sie gern für Sie.« Geoffrey bedauerte, dass der Mann ihn nicht ansah und sein smartes Lächeln registrierte. »Unser Service an Bord der ›Viktoria‹ wird allgemein gelobt.«
»Schon gut. Danke.«
»Was kann ich also für Sie tun?«
Der Mann zog plötzlich den Schal von seinem Gesicht.
Geoffrey McBain erschrak. Am liebsten hätte er einen Schritt zurückgetan, aber die Selbstbeherrschung verbot es ihm.
Der Mann war sehr mager und besaß ein regelrechtes Geiergesicht. Faltige, ledrige Haut spannte sich über den stark hervortretenden Knochen und füllte die eingefallenen Partien mit schlaffen Runzeln. Trübe Augen musterten den Steward. Der Mund war verzerrt, als wäre der Mann verbittert. Aber all das hätte McBain nicht schockiert, wenn nicht jene furchtbare Entstellung der einen Gesichtshälfte gewesen wäre. Es war die rechte Hälfte. Sie glühte purpurrot wie eine bösartige Geschwulst und stand im krassen Kontrast zu dem ansonsten bleichen Rest des Antlitzes.
»Verzeihen Sie, Sir«, murmelte Geoffrey McBain.
»Wie heißen Sie, Steward?«
Geoffrey sagte seinen Namen.
»Gut, Mr. McBain. Mein Name ist Trevor Sullivan. Ich bezweifle, dass Sie jemals von mir gehört haben.« Sullivan sprach langsam. Es bereitete ihm Mühe. »Nun, das tut auch nichts zur Sache. Nachdem wir uns miteinander bekannt gemacht haben, bedanke ich mich für Ihre Umsicht. Wie Sie sehen, geht es mir nicht gut, aber Sie können dennoch nichts für mich tun.«
»Sir, wir haben ein eigenes Hospital an Bord. Ich ...«
Sullivan winkte müde ab. »Ich habe mich von hundert Ärzten untersuchen lassen, Mr. McBain. Bitte, tun Sie mir den Gefallen und lassen Sie mich jetzt in Ruhe!«