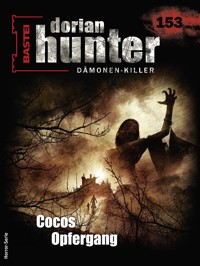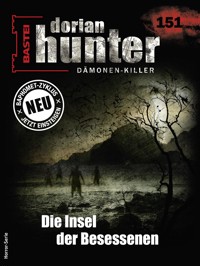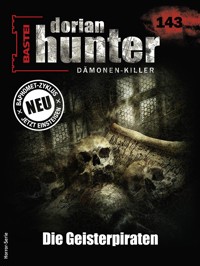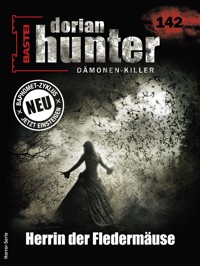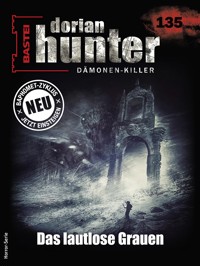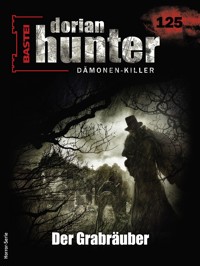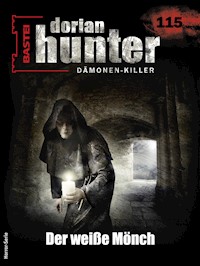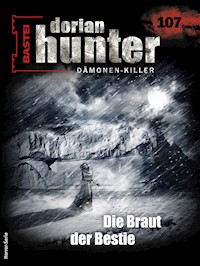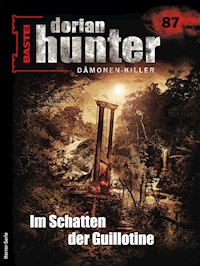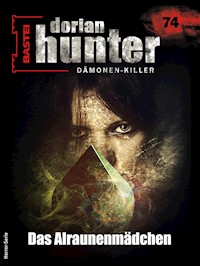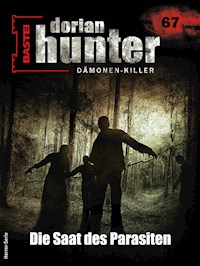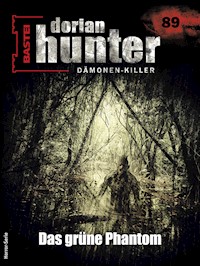
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Dorian Hunter - Horror-Serie
- Sprache: Deutsch
Das Gesicht des Tohunga, des Meisters, war eine scheußliche Fratze. Im flackernden Feuerschein erkannte der gefangene Werner Schmidt, dass es sich um einen Polynesier handelte, dessen Gesicht durch eine Narbentatauierung entstellt war.
"Iss!", sagte der Tohunga. Alle möglichen Fischteile waren es, die er Schmidt in den Mund stopfte: Kiemen, Luftblasen, Schuppen, Fischaugen, Flossen und Innereien ... Schmidt würgte und rang nach Luft. Er sah bunte Nebel tanzen, aus denen ihn fratzenhafte Gesichter anstarrten. Das Trommeln und die triumphierenden Schreie der Tanzenden hörte er nicht mehr. Er fiel in einen schwarzen Abgrund ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DAS GRÜNE PHANTOM
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In der Folge beginnt Dorian die Dämonen zu jagen – doch diese schlagen zurück und zersetzen die »Inquisitionsabteilung« des Secret Service, der Dorian vorübergehend unterstützt hat. Der ehemalige Leiter der Inquisitionsabteilung, Trevor Sullivan, gründet die Agentur Mystery Press, die Nachrichten über dämonische Aktivitäten aus aller Welt sammelt. Hunter bleibt nur sein engstes Umfeld in der Jugendstilvilla in der Londoner Baring Road: die Hexe Coco Zamis, die selbst ein Mitglied der Schwarzen Familie war, bis sie wegen ihrer Liebe zu Dorian den Großteil ihrer magischen Fähigkeiten verlor; der Hermaphrodit Phillip, dessen Fähigkeiten ihn zu einem lebenden Orakel machen, sowie ein Ex-Mitarbeiter des Secret Service namens Donald Chapman, der bei einer dämonischen Attacke auf Zwergengröße geschrumpft wurde.
Beinahe wird die schwangere Coco Zamis ein Opfer der Machtkämpfe innerhalb der Schwarzen Familie, doch nach einer Flucht um den halben Erdball bringt Coco ihr Kind in London sicher zur Welt – und versteckt es an einem Ort, den sie selbst vor Dorian geheimhält. Cocos Vorsicht ist berechtigt, da bald eine neue, »alte« Gegnerin auftaucht: Hekate, die Fürstin der Finsternis, wurde von Dorian einst in seinem vierten Leben als Michele da Mosto verraten, sodass ihre frühere Liebe sich in glühenden Hass verwandelt hat.
Die Erinnerung an seine Existenz als Michele da Mosto veranlasst Dorian, sich mit Alchemie zu beschäftigen. In Andorra kauft er mit dem Geld seines alten Freundes Jeff Parker eine Burg als Rückzugsort für Mitglieder des Dämonenkiller-Teams sowie der verbündeten Magischen Bruderschaft. Deren Pariser Großmeister Guillaume Fernel entpuppt sich jedoch als künstlicher Mensch – als Humunkulus, der Donald Chapman seine ursprüngliche Größe zurückgibt. Die Begegnung mit dem »Mann aus der Retorte« erinnert Dorian an ein ähnliches Abenteuer, das er als Michele in Prag erlebt hat ...
DAS GRÜNE PHANTOM
von Earl Warren
Werner Schmidt fuhr zur See, seit er die Volksschule verlassen hatte. Er konnte sich kein anderes Leben vorstellen. Seinen 29. Geburtstag feierte er als Matrose an Bord des Frachters Senator Burmester in der Südsee.
Die Senator Burmester gehörte einer großen Hamburger Reederei, und Schmidt fuhr nun schon das sechste Jahr auf diesem Schiff. Er war ein großer, kräftiger Blondschopf mit blauen Augen, in denen ständig der Schalk blitzte. Seine Kameraden mochten ihn, seine Vorgesetzten schätzten ihn als einen guten und tüchtigen Seemann.
Schmidt war mit sich und seinem Leben rundherum zufrieden. An übernatürliche Dinge und dergleichen glaubte er nicht. Hätte ihm jemand gesagt, dass er der Sklave und das Opfer eines Dämons werden sollte, Schmidt hätte ihn ausgelacht.
Es geschah, als die Senator Burmester den Hafen von Rarotonga im Cook-Archipel anlief, um zwei Kisten mit Maschinen zu leichtern. Schmidt wollte seinen Geburtstag noch einmal nachfeiern und ging mit ein paar Kameraden an Land.
1. Kapitel
Sie fanden bald eine Hafenbar, die ihnen zusagte. Dort gab es ein paar hübsche Mädchen, und mit einer von ihnen ging Schmidt gegen Abend nach Hause. Der Alkohol machte ihn beschwingt und ausgelassen, und die Aussicht auf das bevorstehende Liebesabenteuer hob seine Stimmung noch mehr.
Die glutäugige schlanke und ranke Südseeschönheit führte Schmidt zu einem kleinen Flachdachhaus am Rande des Hafenstädtchens. Sie wohne allein hier, hatte sie Schmidt gesagt. Im Haus angekommen, führte sie ihn in das kleine, spärlich möblierte Wohnzimmer, in dem ein Ventilator vergebens gegen die Hitze ankämpfte. Dann ließ sie Schmidt eine Weile allein.
Eine Bierdose in der Hand, wartete er, auf einer Bastmatte sitzend. Es dauerte reichlich lange. Schmidt wurde schon ungeduldig. Endlich kam die schöne Aiuna wieder. Lächelnd umarmte sie den Matrosen, und ihre Küsse ließen ihn alles andere vergessen. Er spürte den Druck ihres schlanken, gut gebauten Körpers. »Warum hast du mich so lange warten lassen?«, fragte er seine Südseeschönheit.
Ihr Körper in seinen Armen versteifte sich. In ihren Pupillen sah Schmidt, der mit dem Rücken zur angelehnten Tür stand, eine Bewegung. Es war das winzige Spiegelbild eines Mannes, dessen Hand soeben herabsauste. Ehe Schmidt noch reagieren konnte, krachte ein harter Gegenstand auf seinen Kopf. Warum?, war sein letzter Gedanke.
Wie lange Schmidt ohnmächtig gewesen war, wusste er nicht. Als er wieder zu sich kam, glaubte er zunächst an einen Albtraum. Er sah Feuerschein und hörte dumpfes Getrommel und das Stampfen nackter Füße.
Schmidt öffnete die Augen. Er lag auf dem Boden, mit den Händen und Füßen an in die Erde gerammte Pflöcke gefesselt. Um ihn herum tanzten Menschen – allesamt Polynesier – ekstatisch zum Klang der Trommeln. Ihre halb nackten Körper waren schweißüberströmt, die Gesichter verzückt, die Augen starr. »Te-Ivi-o-Atea!«, riefen sie immer wieder mit der gleichen Betonung. »Te-Ivi-o-Atea!«
Der Matrose zerrte an seinen Fesseln. Noch hatte er keine Angst. Er war nur verwundert und auch wütend, dass man gerade ihn für diesen Mummenschanz ausgesucht hatte. Er wusste nicht, dass Te-Ivi-o-Atea, der Göttervogel, ein mächtiger Dämon war, der Herr der Südsee. Schmidt erkannte unter den Tanzenden Aiuna, deren hübsche bloße Brüste im Rhythmus ihrer Bewegungen wippten. »Was soll das?«, fragte er. »Bindet mich los, verdammt noch mal! Ich habe keinen Sinn für solche Späße.«
Aiuna merkte, dass er wieder zu sich gekommen war, und stieß einen gellenden Schrei aus. Die anderen Tänzer hielten inne und schrien gleichfalls zum Sternenhimmel empor. Es war ein wilder animalischer Schrei.
Schmidt, der zuvor englisch gesprochen hatte, sagte jetzt auf Deutsch: »Blöde Kanaken!«
Er hatte weder Kopfschmerzen, noch spürte er andere Nachwirkungen von dem Schlag auf den Kopf. Er war nur wütend. Plötzlich wurde es still – bis auf eine Trommel, die leise und dumpf weiterpochte. Eine hoch gewachsene Gestalt trat durch die Schmidt umringende Menge. Es war ein Mann mit einem bunt gefärbten Mantel aus Kiwifedern, dem höchsten Rangabzeichen der Häuptlinge und Priester der Südsee. Der Mann trug eine silberne Schale in der Hand. Als er sich über Schmidt neigte, konnte Schmidt einen Aufschrei nicht unterdrücken.
Das Gesicht des Tohunga, des Meisters, war eine scheußliche Fratze. Im flackernden Feuerschein wirkte sie noch fürchterlicher. Erst beim zweiten Hinsehen erkannte Schmidt, dass es sich um einen Polynesier handelte, dessen Gesicht durch eine Narbentatauierung entstellt war. Er trug einen Pflock quer durch die Nasenscheidewand. Kräftige weiße Zähne blitzten, als er das Gesicht zu einer dämonischen Grimasse verzog. Die Augen des Unheimlichen aber funkelten wie die eines Raubtiers. War das ein Trickeffekt, oder war es etwa kein Mensch, der sich über Werner Schmidt beugte? Dem Matrosen wurde unheimlich zumute. Ein Schauer überlief ihn.
Der Tohunga sagte etwas, und zwei kräftige Männer mit großen Messern huschten herbei. Sie näherten sich dem Unheimlichen unter vielen Verbeugungen.
Als er die Messer funkeln sah, bekam Schmidt Angst. Wollten diese Irren ihn etwa umbringen und irgendwelchen Göttern opfern? Würden sie ihn vielleicht sogar auffressen? Bei manchen Südseestämmen hatte es in früheren Zeiten Kannibalismus gegeben.
Ein Mann setzte Schmidt das Messer an die Kehle. Der andere bohrte ihm die Messerspitze leicht über dem Herzen in die Brust.
Schmidt schloss die Augen.
»Iss!«, sagte der Tohunga.
Schmidt hätte nicht angeben können, in welcher Sprache er redete, aber er verstand den Befehl. Als er die Augen öffnete, hielt ihm der Narbengesichtige etwas Undefinierbares hin. Es roch nach Fisch.
»Wenn du nicht isst, lasse ich dir die Ohren und die Finger abschneiden. Wenn du dich dann immer noch weigerst, stirbst du.«
Schmidt öffnete den Mund und schluckte den Bissen hinunter, leichenblass im Gesicht. Es war rohes Fischfleisch und schmeckte abscheulich. Der Narbengesichtige fütterte Schmidt, und die Todesangst brachte den Matrosen dazu, seinen Ekel zu überwinden.
Alle möglichen Fischteile waren es, die der Tohunga ihm in den Mund stopfte: Kiemen, Luftblasen, Schuppen, Fischaugen, Flossen und Innereien ... Schmidts Magen revoltierte, und der Schweiß lief ihm übers Gesicht. Aber jedes Mal, wenn er zu würgen anfing, drückte ihm der kräftige Polynesier, der neben ihm kauerte, das Messer fester gegen die Kehle. So behielt er das scheußliche Zeug bei sich.
Endlich war der letzte Bissen heruntergeschluckt. Der Narbengesichtige zwang Schmidt mit einem Würgegriff, den Mund zu öffnen. Mit spitzen Fingern griff er ihm in den Rachen. Schmidt stöhnte vor Schmerz, als der Tohunga sich in seiner Rachenhöhle zu schaffen machte. Es war, als drehte er dort etwas um.
Als der Tohunga die Hand zurückzog und der Schmerz nachließ, konnte der Matrose die Bissen nicht mehr ausspeien.
Der Narbengesichtige reckte die Arme gen Himmel empor und intonierte einen Sprechgesang. Schmidt konnte nichts verstehen, aber es überlief ihn erst eiskalt, dann wurde ihm glühend heiß.
Der ekstatische Tanz und das Getrommel setzten wieder ein.
Schmidts Körper verkrampfte sich. Sein Kopf lief rot an und schien platzen zu wollen. Der Matrose rang nach Luft.
Der Unheimliche mit den Glutaugen ging zum nächsten Feuer. Er griff unter seinen bunten Federmantel, und als er die Hand wieder hervorzog, lag ein Pulver darauf. Der Tohunga hielt die Hand ins Feuer, ohne dass sie versengt wurde. Das Pulver aber begann zu rauchen und zu brennen. Dann kehrte der Tohunga zu Werner Schmidt zurück. Er hielt ihm eine Hand vors Gesicht, sodass er den Rauch einatmen musste.
Schmidt würgte und rang nach Luft. Sein Gesicht verzerrte sich noch mehr, und er sah bunte Nebel tanzen, aus denen ihn fratzenhafte Gesichter anstarrten. Das Trommeln und die triumphierenden Schreie der Tanzenden hörte er nicht mehr. Er fiel in einen schwarzen Abgrund. Furchtbare Albträume plagten den Matrosen. Er lebte in einer Tiefseewelt, in die nie ein Strahl Sonnenlicht drang – als Fisch, als Krake und als scheußliches amorphes Ding. Er fraß und wurde gefressen. Es war furchtbar.
Irgendwann fand sich der Matrose hinter einem Gebüsch in der Nähe des Hafens wieder. Er erhob sich mühsam und wankte zu seinem Schiff. Zwei Tage war er verschollen gewesen, erfuhr er. Der Kapitän hatte ihn schon bei der Hafenbehörde als vermisst gemeldet.
Schmidt mochte nicht über das sprechen, was ihm widerfahren war. Er legte sich in seine Koje, schwitzte kalten Schweiß und starrte teilnahmslos zur Decke. Am späten Nachmittag lief das Schiff aus.
In der Nacht begann Schmidt zu toben. Acht Männer konnten den Rasenden kaum bändigen. Der Kapitän ließ ihn auf seiner Koje festbinden. Gegen Morgen beruhigte sich Schmidt, den ganzen Tag dämmerte er wieder teilnahmslos und apathisch vor sich hin. Er wurde in die Krankenkabine gebracht, und Bootsmann Enders, der als Sanitäter ausgebildet war, kümmerte sich um ihn. Der Kapitän wollte wegen Schmidt nicht umkehren, und so nahm er ihn in den nächsten Hafen, nach Christchurch, Neuseeland, mit.
Jede Nacht tobte Schmidt, und tagsüber schrie er oft, weil er Albträume und Visionen hatte. Man konnte nicht aus ihm herausholen, was in der Zeit seines Verschwindens mit ihm passiert war. Nur manchmal schrie er wirre Sätze, aus denen keiner klug wurde.
»Das Narbengesicht mit den glühenden Augen. Nein, nein, Erbarmen! Feuerschein und Getrommel! Sie kommen, sie kommen! Ich werde gefressen! Arrgggh! Finstere, lichtlose Welt, in der es nur Fressen und Gefressenwerden gibt. Kälte. Tod. Ich bin dein Sklave, Tohunga.«
In Christchurch ließ der Kapitän der Senator Burmester Werner Schmidt ins Tropenkrankenhaus einliefern. Der Frachter lief nach Sidney aus.
Sechs Wochen lag Schmidt auf der psychiatrischen Station. Die Ärzte probierten alles Mögliche mit ihm aus. Dann besserte sich sein Zustand abrupt. Die Ärzte schrieben das ihrer Kunst zu. Sie wussten nicht, dass eine Phase abgeschlossen war und jetzt die nächste begann. Werner Schmidt wurde als geheilt entlassen. Was damals auf Rarotonga mit ihm vorgefallen war, sagte er noch immer nicht. Etwas hinderte ihn daran, eine mächtige magische Barriere in seinem Geist.
Die Reederei bezahlte Schmidt den Heimflug von Wellington aus. In Hamburg musterte er ab und kehrte nach Schössen zurück, seinem Heimatort.
Werner Schmidt hatte sich verändert. Zur See fahren mochte er nicht mehr. Er war düster und in sich gekehrt. Nachts hatte er noch immer Albträume und Schweißausbrüche. Er begann, in seinem Inneren Veränderungen wahrzunehmen. Seine Organe arbeiteten anomal, und manchmal hatte er starke Schmerzen, und ständig hatte er einen Fischgeschmack im Mund, so als hätte er die Fischteile immer noch im Magen, die er auf Rarotonga hatte schlucken müssen.
Er konnte sich niemandem anvertrauen, konnte nur Andeutungen über sein allgemeines Befinden machen. Jene Schreckensnacht auf Rarotonga hatte sein Bewusstsein verdrängt. Wenn er einmal daran dachte, erschien sie ihm nebelhaft und unwirklich, so als hätte er alles nur geträumt.
Er spürte, dass mit ihm etwas nicht in Ordnung war, aber er wusste nicht, was es war. Werner Schmidt konnte nicht ahnen, dass er dem Dämon Te-Ivi-o-Atea selbst in die Hände gefallen war und den Keim des Bösen in sich trug – die Saat zu einer grauenvollen Metamorphose. Te-Ivi-o-Atea hatte sie gelegt, und er würde bestimmen, wann es so weit war.
Olivaro, der mächtige alte Dämon, der große Intrigant im Hintergrund, war noch immer wütend. Nur knapp war er dem Anschlag des Hermes Trismegistos entkommen, als der sich in München an Hekate II. für die auf Madagaskar erlittene Niederlage rächte.
Olivaro hatte sich auf sein magisches Atoll in der Südsee zurückgezogen, um allein zu sein und nachzudenken. In ihm kochte es. Diesmal war Hermes Trismegistos, der sagenumwobene und geheimnisvolle Begründer der weißen Magie, entschieden zu weit gegangen. Und Hekate, die Herrin der Finsternis, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, ging nach Olivaros Meinung nicht kompromisslos genug gegen ihn vor.
Besonders hatte Olivaro Hekate, die frühere Hexe Alraune, nie gemocht. Ihr Thron wackelte. Olivaro sann darüber nach, wie er die Auseinandersetzung zwischen Hermes Trismegistos und Hekate forcieren könnte.
Olivaro war der Dämon der Falschheit, der große Meister der Intrige. Er liebte es, seine Kämpfe von anderen austragen zu lassen. Bald keimte ein Plan in seinem dämonischen Gehirn.
Er brauchte einen Verbündeten, denn direkt einzugreifen hätte seinem Naturell widersprochen; das tat er nur, wenn es unumgänglich war. Nach seinem Sturz als Fürst der Finsternis und Oberhaupt der Schwarzen Familie hatte Olivaro viel an Macht und Einfluss eingebüßt und viele Verbündete verloren.
Hekate hatte bei seinem Sturz wohl nachgeholfen, ihn aber nicht verursacht; daran trugen andere Umstände die Schuld. Dennoch hatte Olivaro für Hekate überhaupt nichts mehr übrig. Wenn er schon nicht selbst Fürst der Finsternis sein konnte, hätte er zumindest gern jemanden auf dem Thron gesehen, den er beeinflussen und lenken konnte.
Olivaro wollte sich an Te-Ivi-o-Atea wenden, den Herrn der Südsee. Er nahm auf seine übliche Art und Weise mit dem polynesischen Dämon Kontakt auf, also auf Umwegen. Auf Olivaros Insel gab es exotische Tiere und Vögel. Manche von ihnen waren Züchtungen des Dämons selbst, die er in Mußestunden in die Welt gesetzt hatte.
Olivaro beschwor einen besonders farbenprächtigen Vogel und schickte ihn durch Zauber auf Te-Ivi-o-Ateas heilige Insel Raiatea. Dann brauchte er nur noch auf den Dämon zu warten.
Auf Raiatea fiel der unbekannte Vogel Te-Ivi-o-Ateas Dienern auf. Er ließ sich willig von ihnen einfangen, und sie brachten ihn in die große Rundhütte des Dämons. Te-Ivi-o-Atea, der sich irgendwo in der Südsee aufhielt, erhielt die Botschaft, ein merkwürdiges Tier habe sich auf seiner Insel gezeigt. Te-Ivi-o-Ateas Insel befand sich genau wie die von Olivaro in einer magischen Sphäre und war Menschen und Tieren auf normalem Weg nicht zugänglich.
Der Dämon manifestierte sich in Gestalt einer Rauchwolke, die den größten Raum der Rundhütte mit dem Spitzdach erfüllte. Auf vorstehenden Dachsparren der Hütte steckten Totenköpfe, überall auf der Insel waren Totempfähle mit dem Zeichen des Dämons und monumentale Steinköpfe verstreut.
Die Rauchwolke wurde zu Te-Ivi-o-Atea. Der Dämon zeigte sich in der Gestalt eines großen Polynesiers mit narbentatauiertem Gesicht. Seine Diener, junge Männer und Mädchen von vielen Inseln, hatten sich zu Boden geworfen. Sie trugen den bunt bedruckten Pareo, das Hüfttuch der Insulaner.
Der seltsame Vogel hockte zwischen ihnen, an den Beinen gefesselt. Te-Ivi-o-Atea sah den Vogel an und wusste, wer ihn geschickt hatte. Solche farbenprächtigen Vögel gab es nur auf Olivaros Insel.
Te-Ivi-o-Atea nahm den Vogel und trug ihn in einen Nebenraum. Dort schlachtete er das Tier, schnitt ihm die Leber heraus und ließ sein Blut in eine Schale mit Wasser tropfen. Aus den Blutschlieren, die sich im Wasser bildeten, las er manches heraus. Das meiste aber erfuhr er durch die Betrachtung der Vogelleber.
Te-Ivi-o-Atea reinigte seine Hände in einer Wasserschale, die ihm zwei hübsche Mädchen reichten. Ohne zu zaudern, kehrte er in den Hauptraum zurück und begann einen Zauber, der ihn auf Olivaros Insel bringen sollte. Als er eine Beschwörung rief, verschwammen die Konturen seines Körpers. Dann war der Dämon verschwunden.
Auf Olivaros Insel zeigte er sich wieder. Olivaro erwartete ihn bereits. Er begrüßte ihn und führte Te-Ivi-o-Atea in sein Haus auf einer Anhöhe in der Mitte der Insel.
Olivaro pflegte seine durch Magie errichteten Behausungen häufig auszuwechseln. Zurzeit benutzte er ein Herrenhaus, wie es in den amerikanischen Südstaaten Mitte des 19. Jahrhunderts Mode gewesen war. Der Prunkbau leuchtete weiß, und kunstvolle Säulen trugen das Vordach.
Olivaro und Te-Ivi-o-Atea suchten das Herrenzimmer auf. Ein großer Farbiger brachte Erfrischungen. Der Südseedämon betrachtete ihn prüfend, und Olivaro machte ein Zeichen mit der Hand.
Die Kleider des Farbigen lösten sich auf, und das Fleisch fiel von seinen Knochen. Ein Skelett blieb zurück.
»Ein Untoter«, sagte Olivaro. »Mit ihnen hat man am wenigsten Probleme.«
Eine magische Formel gab dem Bediensteten wieder das frühere Aussehen. Er entfernte sich durch die Tür. Er hätte auch durch die Wand gehen oder auf andere Weise verschwinden können, aber Olivaro war dafür, gewisse Normen beizubehalten. Wenn man alles unorthodox machen wollte, war das mit Arbeit verbunden und auf die Dauer höchst irritierend und unbequem.