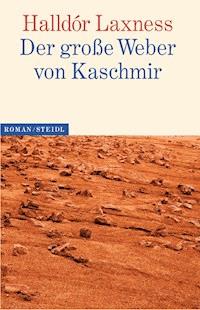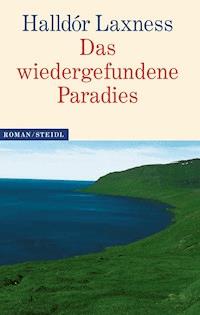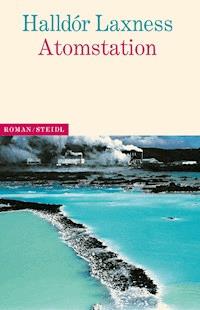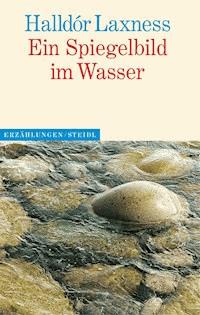Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bjartur hat achtzehn Jahre lang als Knecht geschuftet, um eines Tages seinen eigenen Hof zu besitzen. Sumarhus nennt er sein kümmerliches Anwesen, das abseits im unwirtlichen Heideland liegt. Bjartur ist entschlossen, ein freier und unabhängiger Mensch zu sein, sein eigener Herr - diesem Ziel opfert er Glück und Gesundheit seiner Familie. Starrköpfig verschuldet er den Tod seiner Frau, und auch seine zweite Frau unterliegt in dem bitteren Überlebenskampf. Nach vielen mageren und wenigen guten Jahren ist Bjartur schließlich gezwungen, Sumarhus zur Versteigerung freizugeben. Doch er resigniert nicht. Mit seiner geliebten Stieftochter Asta Sollilja bricht er zu noch ferneren Regionen auf, um von neuem einen eigenen Hof aufzubauen. Aber in dem Flüstern der kranken Sollilja, seiner „Lebensblume“, klingt bereits die Stimme des Todes an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 940
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Halldór Laxness Sein eigener Herr
Roman
Aus dem Isländischen von Bruno Kress
1. Kolumkilli
Isländische Bücher berichten, daß sich vor Zeiten hierzulande Iren aufhielten und Kreuze, Glocken und andere magische Gegenstände zurückließen. In lateinischen Quellen werden die Namen von Männern aufgeführt, die in der ersten Zeit des Papsttums von den Britischen Inseln hierher gesegelt sind. Ihr Anführer hieß Kolumkilli der Ire, ein großer Geisterbeschwörer. Zu jener Zeit war Island ein außerordentlich fruchtbares Land. Doch als sich hier nordische Menschen ansiedelten, flohen die irischen Zauberer aus dem Land, und alte Schriften meinen, daß Kolumkilli dem neuen Volk aus Rache auferlegt habe, daß es ihm in diesem Lande niemals wohlergehen möge und anderes mehr in diesem Sinne, was sich dann auch in hohem Grade zu erfüllen schien. Viel später fielen die nordischen Menschen in Island vom rechten Glauben ab und wandten sich den magischen Künsten fremder Völkerstämme zu. Da wurde in Island alles in sein Gegenteil verkehrt, die nordischen Götter wurden verhöhnt und neue angenommen, wie auch Heilige, einige aus dem Morgenland, andere aus dem Abendland. Der Überlieferung nach wurde damals Kolumkilli in dem Tal eine Kirche errichtet, wo später das Gehöft Albogastadir auf der Heide gestanden hat. In alten Zeiten war es ein Herrenhof. Jon Reykdalin, Bezirksvorsteher auf Utiraudsmyri, trug viel Wissenswertes über dieses Heidetal zusammen, als das Gehöft nach dem großen Spuk von 1750 schließlich verlassen wurde und verfiel. Der Bezirksvorsteher war selbst Augen- und Ohrenzeuge der verschiedenen seltsamen Vorgänge, die sich dort abspielten, wie in seiner bekannten Geschichte über den Unhold von Albogastadir zu lesen ist. Von Anfang Februar bis nach Pfingsten konnte man das Gespenst im Gehöft laut sprechen hören, so daß die Leute in die Siedlung im Tal flüchteten; es sagte dem Bezirksvorsteher seinen Namen zweimal ins Ohr, doch andere Fragen beantwortete es, wie sich der Bezirksvorsteher ausdrückt, mit »infamen lateinischen Strophen und anstößigen Unflätigkeiten«.
Die berühmteste aller Geschichten über dieses Gehöft ereignete sich lange vor der Zeit des Bezirksvorstehers Jon, und es ist nicht unangebracht, sie noch einmal zum Vergnügen derer zu erzählen, die noch nicht über die grasigen Gründe am Fluß geritten sind, wo die Jahrhunderte in Gestalt mehr oder minder vernarbter, von den Pferden vergangener Zeiten ausgetretener Reitpfade nebeneinander liegen, und die vielleicht bei ihrem Ritt durch das Tal einen Blick auf den alten Hofhügel werfen.
Es kann nicht später als gegen Ende der Amtszeit des Herrn Bischofs Gudbrandur gewesen sein, als hier in Albogastadir auf der Heide ein Ehepaar wohnte. Der Name des Bauern ist nicht erwähnt, doch seine Frau hieß Gunnvör oder Gudvör. Sie trat großspurig auf und neigte zu heidnischen Bräuchen; man schrieb ihr übersinnliche Kräfte zu. Sie führte das große Wort vor ihrem Mann, weshalb ihn auch alle als großen Schwächling ansahen.
Anfangs erging es den Eheleuten nicht gut, und sie hatten nur wenig Gesinde. Es geht noch das Gerücht, die Frau habe ihre Kinder durch ihren Mann aussetzen lassen, als es ihnen zu viele wurden. Einige wurden auf dem Berg unter ein flaches Felsstück gelegt, und noch kann man im zeitigen Frühjahr, wenn der Schnee zu schmelzen beginnt, ihr Wimmern vom Berg her vernehmen. Anderen wurde ein Stein umgebunden, und der Bauer versenkte sie im See, und noch kann man bei Mondschein mitten im Winter, besonders bei Frost und vor Unwetter, ihr Weinen hören.
Als Frau Gunnvör zu altern begann, so erzählt die Sage, hat es sie sehr nach Menschenblut gedürstet. Besonders hatte sie Hunger nach Menschenmark. Es wird auch erzählt, daß sie denen von ihren Kindern, die groß wurden, Blut abnahm und es mit ihrem Munde trank. Hinter ihrem Haus ließ sie sich einen Hexenaltar bauen und hielt dort an Herbstabenden dem Unhold Kolumkilli Messen in Feuer und Rauch.
Einmal, so wird erzählt, wollte der Mann weglaufen und den Leuten in der Siedlung ihr ganzes schändliches Tun offenbaren, doch sie verfolgte ihn und holte ihn auf dem Raudsmyrarpaß ein, steinigte ihn und verstümmelte seine Leiche. Seine Gebeine trug sie zu ihrem Altar, Fleisch und Eingeweide ließ sie auf dem Paß zurück, den Vögeln zum Fraß. In der Gegend verbreitete sie, er wäre bei der Schafsuche im Gebirge umgekommen.
Von dieser Zeit an mehrte sich Frau Gunnvörs Geld, und man schrieb das ihrem bösen Vertrag mit Kolumkilli zu, und sie gelangte in den Besitz guter Pferde.
Zu jener Zeit kamen häufig Leute durch die Gegend, sowohl zur Winterszeit, wenn man zur Fischerei vor dem Jökull ging, als auch im Frühjahr, wenn man aus anderen Landesvierteln dorthin kam, um seinen Dörrfischvorrat zu holen. Im Lauf der Zeit gaben die Bewohner der Gegend einander zu verstehen, Frau Gunnvör wäre nicht gleichermaßen gastfreundlich, wie die Zahl ihrer Pferde zunähme. Und obwohl sie nach der Sitte jenes Jahrhunderts eine fleißige Kirchgängerin war, wird in Annalen erwähnt, sie habe bei der Kirche von Raudsmyri nach der Messe selbst am Pfingstsonntag bei heiterem Himmel die Sonne nicht sehen können.
Kurz und gut, es kamen Gerüchte über das Schicksal ihres Mannes in Umlauf und auch darüber, daß sie Menschen mordete, die einen wegen ihres Geldes, die anderen wegen des Bluts und Marks, und daß sie manchen ins Gebirge nachgeritten wäre. Im Tal südlich von Albogastadir, nicht weit vom Gehöft, liegt ein See, genannt der Igelsee; er trägt diesen Namen bis auf den heutigen Tag. Die Frau brachte ihre Gäste des Nachts um, indem sie die Schlafenden mit einem großen Messer erstach, ihnen dann die Kehle durchbiß und sie zerstückelte. Aus ihren Gebeinen machte sie Spielzeug für sich und den Unhold Kolumkilli. Anderen setzte sie bis auf die Heide nach und hieb mit ihrem Messer nach ihnen, daß die Schneide blitzte; sie überwältigte sie, denn sie hatte die Kräfte mehrerer Männer und für ihre Untaten außerdem den Beistand des Teufels. Noch kann man dort, wo die Heide am höchsten ist, Blutspritzer im Schnee sehen, besonders in der Vorweihnachtszeit. Die Leichen trug sie hinunter ins Tal, beschwerte sie mit Steinen und versenkte sie im See. Das Gepäck ihrer Gäste nahm sie in Beschlag, deren Kleider, Pferde und Geld, wenn sie welches hatten. Alle ihre Kinder aber verfielen der Raserei und bellten wie Hunde vom Dach des Gehöfts herab, oder sie saßen idiotisch mit abscheulichem Grinsen auf der steinernen Türschwelle und bissen die Leute, denn der Unhold hatte ihnen die menschliche Sprache und den gesunden Menschenverstand genommen. Deswegen singen noch heute die Kinder in den Landstrichen diesseits und jenseits der Hochebene dieses Wiegenlied:
Keiner bleib als Gast bei Gunnvör
mit Kleidern gut.
Bringt sie ihn in den Igelteich
und dillido.
Fließt das Blut in der Spur.
Ich wiege dich, mein Kind.
Keiner bleib als Gast bei Gunnvör
mit seinem Pferd,
blank ihr großes Messer blitzt
und tilliteß.
Fließt das Blut in der Spur.
Ich wiege dich, mein Kind.
Keiner bleib als Gast bei Gunnvör
mit Menschenblut,
keiner mit Mark im Gebein
und dillido.
Fließt das Blut in der Spur.
Ich wiege dich, mein Kind.
Keiner bleib als Gast bei Gunnvör,
der glaubt an Gott.
Mir hat sie Rippe, Schlüsselbein
und Mittelhandknochen zerbrochen
und fillibu.
Fließt das Blut in der Spur.
Ich wiege dich, mein Kind.
Glaubst du an den Kolumkilli,
so sagt er dir:
Mark und Blut, Mark und Blut
und dododo.
Fließt das Blut in der Spur.
Ich wiege dich, mein Kind.
So ergab es sich schließlich, daß die Untaten Frau Gunnvörs an den Tag kamen. Sie war also zur Mörderin vieler Leute geworden, von Männern, Frauen und Kindern, und des Nachts hatte sie dem Unhold Kolumkilli Messen gehalten. Auf dem Bezirksthing wurde sie zum Tode verurteilt und am Sonntag Trinitatis im Kirchhofseingang bei der Kirche von Raudsmyri gerädert. Arme und Beine wurden vom Rumpf getrennt, und schließlich wurde sie enthauptet. Sie ertrug ihren Tod gefaßt; im Sterben verwünschte sie die Leute mit sonderbaren Flüchen. Ihr Rumpf, ihr Kopf und ihre Glieder wurden in einen Ledersack getan, der Ledersack wurde auf den Paß westlich von Albogastadir geschleift und an der höchsten Stelle verscharrt. Dort ist ihr Grabhügel noch heute zu sehen; er ist jetzt unten herum mit Gras bewachsen. In späteren Zeiten wurde er Gunnas Grab genannt. Wen sein Weg zum ersten Mal über den Paß führt, der wirft einen Stein auf das Grab; man glaubt dadurch Unglück abzuwenden. Manche werfen jedesmal, wenn sie hier vorbeikommen, einen Stein auf dieses Grab; damit wollen sie sich Ruhe und Frieden erkaufen.
2. Das Anwesen
Auf einem niedrigen Hügel im Wiesenmoor stehen alte Hausruinen.
Vielleicht ist dieser Hügel nur in gewissem Sinne das Werk der Natur, vielleicht ist er das Werk längst dahingeschiedener Bauern, die hier auf der Erhebung am Bach ihr Gehöft bauten, Generation auf Generation, eins auf die Ruinen des anderen. Jetzt ist hier seit über hundert Jahren ein Lämmerpferch, hier haben seit über hundert Jahren Lämmer geblökt. Vom Pferchhügel breiten sich, besonders nach Süden, weitflächige Wiesenmoore mit vereinzelten Heidekrautinseln aus. Aus dem Raudsmyrarpaß kommt ein kleiner Fluß herunter ins Wiesenmoor, und ein zweiter fließt aus dem See nach Osten durch die Täler der östlichen Heide. Im Norden des Hügels ragt ein steiler Berg empor, mit Gesteinshalden am Abhang hinauf und heidekrautbewachsenen Keilen zwischen den Halden. Aus den Halden erheben sich schroff die Felswände, und an einer Stelle gegenüber dem Pferch ist der Berg gespalten. Dort ist eine Schlucht im Basalt, und oben in die Schlucht stürzt im Frühjahr ein Wasserfall, lang und schmal. Mitunter steht der Südwind auf den Wasserfall und fegt den Wasserstaub über die Bergkante. Dann fließt der Wasserfall bergauf. Unten am Berg verstreut sind Felsen. Diese Lämmerwiese, wo früher das Gehöft Albogastadir auf der Heide stand, wurde in den letzten Menschenaltern Veturhus genannt.
Ein kleiner Bach fließt an der Lämmerwiese entlang, er fließt im Halbkreis um die Wiese, klar und kalt, und versiegt nie. Im Sommer spielen die Sonnenstrahlen in seiner heiteren Strömung, und das Schaf liegt wiederkäuend am Ufer und hat ein Vorderbein ins Gras gestreckt. Dann ist der Himmel blau. Dann glitzert es schön auf dem Schwanensee und dem stillen Forellenfluß im Wiesenmoor. Dann zwitschert es froh in Wiese und Moor.
Das Tal ist auf allen Seiten von Bergrücken und Höhenzügen umgeben. Im Westen ist ein kurzer Paß, und das nächste Gehöft auf der anderen Seite ist Utiraudsmyri, Raudsmyri, Myri, der Sitz des Gemeindevorstehers. Dieses Heidetal hat bisher ihm gehört. Dort drüben schließen sich weitläufige Siedlungen an. Die östliche Heide wird auf fünf Stunden Lastpferdegang zwischen den Siedlungen geschätzt, dort liegt der Weg hinunter in die Fjorde zum Handelsplatz. Im Süden erheben sich hinter dem Tal niedrige, wellige Heideflächen, die höher und höher werden, bis die Blauberge den Horizont verdecken. Es ist, als ob die Berge dort versonnen in den Himmel wachsen; nur selten taut der Schnee auf ihnen vor der Johannismesse. Und was kommt hinter den Blaubergen? Dort sind die Einöden des Landes.
Und die Frühlingswinde wehen durch das Tal.
Und wenn die Frühlingswinde durch das Tal wehen, wenn die Frühlingssonne auf das weiße vertrocknete Gras auf dem Flußufer scheint und auf den See und auf zwei weiße Schwäne des Sees und das erste Grün aus Wiese und Moor hervorlockt – wer würde da glauben, daß dieses grasige, friedliche Tal die Geschichte unseres früheren Lebens in sich birgt; und dessen Gespenster? Die Menschen reiten am Fluß entlang, wo die Pferde vergangener Zeiten auf einer breiten Fläche Jahrhundert für Jahrhundert Pfad neben Pfad ausgetreten haben – und ein frischer Frühlingshauch geht durch das Tal im Sonnenschein. An solchen Tagen ist die Sonne stärker als die Vergangenheit.
Eine neue Generation vergißt die Gespenster, die frühere Generationen gepeinigt haben mögen.
Wie oft ist das Gehöft Albogastadir auf der Heide von Gespenstern zerstört worden? Und wieder aufgebaut worden, trotz der Gespenster? Jahrhundert für Jahrhundert kommt der alleinwirtschaftende Bauer von unten aus der Gemeinde, um auf diesem Hügel zwischen dem See und der Bergspalte sein Glück zu versuchen, entschlossen, den Mächten zu trotzen, die den Hof verzaubert haben und sein Blut und Mark fordern. Wieder und wieder hebt der Bauer sein Lied an, ohne Achtung vor den Gewalten, die das Vorrecht auf seine Glieder und sein Schicksal bis zum letzten Atemzug haben. Die Geschichte der Jahrhunderte im Tal ist die Geschichte des selbständigen Mannes, der mit bloßen Fäusten das Gespenst angeht, das ihm unter immer neuen Namen entgegentritt. Einmal ist das Gespenst ein halbgöttlicher Teufel, der sein Land verhext. Einmal zerbricht es in Gestalt einer Norne seine Knochen. Einmal bringt es in Gestalt eines Unholds seine Leute um den Verstand. Einmal zerstört es in Gestalt eines Ungeheuers sein Gehöft. Und doch ewig dasselbe Gespenst, das denselben Menschen peinigt, Jahrhundert für Jahrhundert.
»Nein«, sagt er trotzig.
Es ist der Mann, der nach Albogastadir auf der Heide unterwegs ist, anderthalb Jahrhunderte nachdem das Gehöft das letzte Mal zerstört wurde. Und während er an Gunnvörs Grab auf dem Paß vorbeigeht, spuckt er wütend aus: »Den Teufel von Stein kriegst du von mir, du Hexe!« – und denkt nicht daran, ihr einen Stein zu geben.
Seine Bewegung entspricht der Brise, sein Gang dem unebenen Gelände. Bei ihm ist eine gelbe Hündin, eine schmalschnäuzige Knechtstöle, die Läuse hat, denn sie wirft sich oft zu Boden und beißt sich heftig, wälzt sich zwischen den Grasbuckeln mit jenem eigentümlichen unruhigen Gewinsel, das für verlauste Hunde typisch ist. Es ist eine vitaminlose Hündin, denn sie frißt Gras. Es ist auch ganz offensichtlich, daß sie Würmer hat. Und der Mann hält das Gesicht dem frischen Maiwind entgegen. Die Sonne scheint auf die erhobenen Hälse einstiger Pferde, und im Wind steckt das Getrappel längst vergangener Hufe; es sind die Pferde entschwundener Zeiten auf den Pfaden am Flußufer, Jahrhundert für Jahrhundert, Generation nach Generation, und noch immer wird der Weg begangen – er kommt nach, mit seiner Hündin, kühn, der jüngste Grundbesitzer, ein Besiedler Islands im dreißigsten Glied; er bleibt auf dem Weg der Jahrhunderte stehen, blickt über sein Tal im Sonnenschein des Kreuzmeßtages.
Da kommt die Hündin und springt an ihm hinauf. Sie steckt ihre schmale Schnauze in seine harte Pranke, läßt sie dort eine Weile ruhen, wedelt weiter mit dem Schwanz und dreht und wendet sich. Der Mann betrachtet das Tier eine Zeitlang nachdenklich. Angesichts der Unterwürfigkeit seines Hundes schwillt ihm die Brust wegen seiner Macht, und vor ihm ersteht der höchste Traum der Menschennatur wie bei einem Heerführer, der seine unbesiegbare Armee inspiziert und weiß, daß er sie loshetzen kann. Eine kleine Weile vergeht; der Hund hat sich vor ihm auf das vertrocknete Gras am Flußufer gesetzt und sieht ihn fragend an, und er antwortet: »Ja, was der Mensch sucht, das findet er – beim Hund.«
Darüber spricht er weiter mit sich selbst, nachdem er vom Weg abgebogen ist, hinaus in die Moorwiesen, in Richtung auf die Lämmerwiese. Er wiederholt es bei sich mit verschiedenen Variationen: Was der Hund sucht, das findet er beim Menschen; suchet, so werdet ihr finden. Er bückt sich und umfaßt mit seinen dicken Fingern einen Wurzelstock des Fieberklees und mißt ihn an seinen Fingern, reißt einen Wurzelstock aus einem Sumpfloch und wischt den Lehm an seinen Hosen ab, nimmt ihn in den Mund wie ein Schaf und denkt, während er kaut, und fängt an zu denken wie ein Schaf. Das Zeug schmeckt bitter, doch er spuckt es nicht aus, er saugt schmatzend daran und spürt den Wurzelgeschmack im Schlund; es hat manches Leben nach einem langen Winter mit wenig Heu gerettet; es ist irgendein Honig darin, wenn es auch für den Geschmack bitter ist. Dieser Wurzelstock im Moor ist es nämlich, der dem Schaf im Frühjahr Leben gibt; und das Schaf gibt der Menschenkreatur Leben im Herbst. Der Mann spricht weiter über diesen Wurzelstock und bringt ihn in allerlei Variationen mit der Philosophie durcheinander, bis er auf der Lämmerwiese angelangt ist.
Er steht auf der höchsten Stelle des Hügels mit dem Lämmerpferch wie ein Landnahmemann, der die Säulen seines Hochsitzes gefunden hat, und er sieht sich um, läßt sein Wasser, erst nach Norden in Richtung des Berges, dann nach Osten über die sich senkenden Moorwiesen und den See, wo der Fluß, langsam aus dem See kommend, durch das Moor fließt, und über die Heideflächen im Süden, wo die noch schneebedeckten Blauberge den Horizont verdecken, wenn man den Blick hebt. Und die Sonne steht am heiteren Himmel.
Auf der Südseite des Hügels stehen zwei Schafe von Utiraudsmyri und knabbern am Grün der Lämmerwiese. Er scheucht sie fort, obwohl es die Schafe seines Herrn sind, er jagt sie zum ersten Mal von seiner eigenen Hauswiese: Das ist mein Hof.
Doch dann tut es ihm anscheinend leid, der Hof ist vielleicht nicht ganz bezahlt, der Hund darf ihnen nicht nachsetzen, vielmehr schimpft er ihn aus. Er fährt fort, die Welt von seiner eigenen Hauswiese aus zu betrachten, die Welt, die er gekauft hat. Der Sommer geht gerade über dieser Welt auf.
Deshalb sagt er zum Hund:
»Es ist ganz verkehrt, daß dieses Gehöft Veturhus heißt, das ist kein Name. Und Albogastadir auf der Heide – das ist auch kein Name, nichts als eine Volkssage aus dem Papismus. Der Teufel soll mich holen, wenn mein Hof einen Namen haben soll, der mit Gespenstern der Vergangenheit zusammenhängt. Ich heiße Bjartur. Deswegen soll der Hof Sumarhus, Sommerhäuser, heißen.«
Und Bjartur in Sumarhus geht auf seiner eigenen Hauswiese umher, untersucht die grasbewachsenen Ruinen, betrachtet die Steine in den Mauern des Lämmerpferchs. In seiner Phantasie reißt er ein Gehöft wie jenes, in dem er östlich der Heide geboren und aufgewachsen ist, ab und baut es wieder auf.
»Es kommt nicht auf die Firsthöhe an«, sagt er laut zum Hund, als hätte er ihn im Verdacht, daß er sich zu großartige Vorstellungen machte. »Du kannst dich auf mich berufen; die Freiheit ist mehr wert als die Deckenhöhe im Haus, zumal ich achtzehn Jahre dafür gearbeitet habe. Der Mann, der einen eigenen Hof besitzt, er ist sein eigener Herr im Lande. Niemand hat ihm etwas zu sagen. Wenn ich meine Schafe durchbringe und Jahr für Jahr meinen Verpflichtungen nachkomme, dann komme ich meinen Verpflichtungen nach und habe meine Schafe durchgebracht. Nein, es ist die Freiheit im Lande, nach der wir alle streben, meine Titla. Wer seinen Verpflichtungen nachkommt, ist König. Wer seine Schafe durchbringt, wohnt in einem Schloß.«
Und als die Hündin das hört, wird auch sie glücklich. Die Freude ist ungetrübt. Sie läuft mit leichtsinnigem Gebell um den Mann herum, legt sich jagdlustig mit der Schnauze auf die Erde und nimmt ihn aufs Korn. Im nächsten Augenblick springt sie wieder auf und schlägt einen Kreis.
»Na, na«, sagt er ernst. »Keinen Unfug hier. Oder laufe ich im Kreis und belle? Lege ich mich etwa mit der Schnauze auf die Erde mit Schelmereien in den Augen und nehme Leute aufs Korn? Nein, dafür habe ich meine Unabhängigkeit zu teuer erkauft: achtzehn Jahre für den Gemeindevorsteher auf Utiraudsmyri und die Dichterin und Ingolfur Arnarson Jonsson, der jetzt angeblich nach Dänemark geschickt wird. Waren es vielleicht bloß Vergnügungsreisen, die ich hierher nach Süden auf die Hochweiden machte, um die Schafe dieser Leute aufzustöbern, obwohl wir schon Dezember hatten? Nein, doch ich habe mich in den Schnee gegraben. Es war nicht ihnen zu verdanken, diesen guten Leuten, daß ich am nächsten Morgen mit Anzeichen von Leben herauskroch.«
Bei dieser Ermahnung wurde das Tier merklich stiller, es setzte sich und begann sich zu flöhen.
»Doch es soll mir niemand nachsagen, daß es mir auf ein paar Schritte mehr oder weniger angekommen ist, dafür habe ich dann auch die erste Rate für die Hütte am Ostersonntagsmorgen pünktlich bezahlt. Und fünfundzwanzig Mutterschafe habe ich, mit Wolle und Lamm; manch einer hat mit weniger begonnen, und noch mehr sind ihr Leben lang anderer Leute Sklaven gewesen, ohne jemals Schafbesitzer zu werden. Mein Vater wurde achtzig Jahre alt, ohne eine Krankenunterstützung von zweihundert Kronen zurückzahlen zu können, die er seit seiner Jugend der Gemeinde schuldete.«
Die Hündin sieht ihn eine Weile zweifelnd an, als glaube sie das nicht. Sie hat vor zu bellen, doch wird nichts daraus; sie reißt nur die Schnauze auf und gähnt lange, wie wenn sie etwas fragen wollte.
»Ja, es ist nicht zu erwarten, daß du das verstehst«, sagt der Mann. »Erbärmlich ist die Hundekreatur und noch erbärmlicher die Menschenkreatur. Doch mag das sein, wie es will; jedenfalls müßte es mit dem Teufel zugehen, wenn meine Rosa nach dreiundzwanzig Jahren Wirtschaft hier in Sumarhus ihren Leuten am Heiligen Abend Knochenreste von einem alten Gaul vorsetzen sollte, was sich die Dichterin auf Utiraudsmyri nicht schämte zu tun – es war erst voriges Jahr.«
Die Hündin flöhte sich jetzt wieder heftig.
»Ja, es ist nicht zu verhindern, wenn die Knechtstöle dieser Leute verlaust ist und Gras frißt, wo selbst die Wirtschafterin zwanzig Jahre lang nicht den Speisekammerschlüssel zu sehen bekommen hat. Und dann glaube ich, daß die Winterweidepferde des Gemeindevorstehers ihr Leid zu klagen hätten, wenn ihnen das Zungenband gelöst würde, diesen elenden Tieren, von den Schafen ganz zu schweigen: All diese Jahre war es ein endloser Kampf, und für gewisse Leute ist es wahrlich ein Glück, daß das Schaf im Himmel keinen Richterstuhl hat, das arme Geschöpf.«
Oben vom Berg kam der künftige Hofbach in gerader Richtung auf den Lämmerhügel zu und bog nach Westen im Halbkreis um den Hügel, um seinen Weg hinunter in das Wiesenmoor zu nehmen. Er hatte zwei kniehohe Wasserfälle und zwei knietiefe Gumpen. Auf seinem Grund lagen Geröll, Kieselsteine und Sand. Er floß in vielen Windungen. In jeder Windung gab es einen besonderen Ton, doch einen tiefen Ton hatte er nicht, er war fröhlich und sangeslustig wie die Jugend, dennoch hatte er verschiedene Saiten und spielte seine Töne, unbekümmert um Zuhörer. Er machte sich nichts daraus, auch wenn ihm hundert Jahre lang niemand zuhörte, wie der wahre Dichter. Der Mann untersuchte alles gründlich, blieb am oberen Wasserfall stehen und sagte: Hier kann man Strümpfe spülen; am unteren Wasserfall sagte er: Hier kann man Klippfisch wässern. Der Hund steckte die Schnauze ins Wasser und schleckte. Auch der Mann legte sich am Ufer auf den Bauch und trank, und ein bißchen Wasser kam ihm in die Nase. »Es ist auserlesenes Wasser«, sagte Bjartur in Sumarhus und sah den Hund an, während er sich das Gesicht mit dem Ärmel abwischte. »Man könnte fast glauben, es ist geweiht.«
Wahrscheinlich kam ihm in den Sinn, daß er mit dieser Bemerkung unbekannten Mächten eine Angriffsfläche bot, denn plötzlich drehte er sich im Frühlingswind um, drehte sich ganz im Kreis und sagte in alle Himmelsrichtungen:
»Darum geht es nicht, das Wasser könnte deswegen auch ungeweiht sein: Vor dir habe ich keine Angst, Gunnvör. Schwer soll es dir fallen, gegen mein glückliches Geschick anzugehen, du Hexe; Wiedergänger fürchte ich nicht!« Er ballte die Fäuste, blickte voll Trotz hinauf zur Bergspalte, nach Westen zum Paß und nach Süden zum See und murmelte noch ein paar Kraftworte im Sagastil. – »Nie!«
Die Hündin jagte los und raste erschrocken zwischen die Schafe unten am Hügel und biß sie in die Haxen, denn sie meinte, der Mann wäre zornig, wo er doch nur vom Geist der Gegenwart erfüllt und entschlossen war, in seinem Land ein freier und unabhängiger Mensch zu sein, wie andere Generationen, die sich hier vor ihm niedergelassen hatten.
»Kolumkilli!« sagte er und lachte verächtlich, nachdem er die Hündin zurückgerufen hatte, »das wäre noch schöner – das hat irgendein Spaßvogel den alten Weibern vorgelogen!«
3. Hochzeit
Anfang Juni sprießen die vortrefflichen Pflanzen des Landes am schnellsten. Auf gut gedüngten Hauswiesen steht sogar schon mähbares Gras, das Schaf hat wieder Fleisch an den Knochen und hält den Kopf hoch; das augenlose Gesicht des Kadavers im Wiesenmoor ist im Gras versunken. Ja, dann ist es eine Lust zu leben, dann ist die Zeit gekommen, sich zu verheiraten: Alle Mäusenester in den alten Ruinen sind ausgerottet, und ein neues Gehöft ist gebaut. Es ist das Gehöft Bjarturs in Sumarhus. Steine wurden herangebracht, Torf gestochen, Grassoden geschnitten, Bauholz geholt, Mauern geschichtet, ein Gerüst gebaut, Sparren aufgerichtet, Bretter zu einem Klinkerdach gefügt, die Rasenbedachung aufgelegt, ein Herd ausgemauert, ein Schornstein gesetzt – und dort steht das Gehöft wie ein Teil der Natur.
In einem ähnlichen Gehöft unten in der Siedlung, in Nidurkot, bei den Eltern der Braut, dort fand die Hochzeit statt. Die meisten Hochzeitsgäste kamen aus Gehöften der gleichen Art, sie stehen dort unten an den Abhängen der Berge oder kauern an der Südseite von Anhöhen, durch die Hauswiese fließt ein kleiner Bach, unterhalb der Hauswiese ist ein Wiesenmoor, und durch das Wiesenmoor fließt ein stiller Fluß. Geht man von einem Gehöft zum anderen, so ist einem nichts wahrscheinlicher, als daß alle Gehöfte denselben Namen haben und derselbe Mann und dieselbe Frau in ihnen allen wohnen, dennoch ist es nicht so. Zum Beispiel war es all die Jahre hindurch der Traum des alten Thordur in Nidurkot, am Hofbach eine kleine Mühle zu errichten, denn der Bach hatte etwas Strömung, und dann für die Leute Gerste zu mahlen und sich dadurch ein paar Einkünfte zu verschaffen. Doch um die Zeit, als er die Mühle errichtet hatte, wurde kein ungemahlenes Getreide mehr eingeführt, auch wollten die Leute lieber gemahlenes. An den abendlosen Frühlingstagen der Jugend spielten die Kinder des Ehepaars am Mühlenhaus, da war der Himmel blau, sie vergaßen ihn nicht, solange sie lebten.
Es waren ihrer sieben. Sie verschwanden nach fernen Orten, zwei Söhne ertranken in einem fernen Meer, ein Sohn und eine Tochter verschwanden in ein noch ferneres Land, nach Amerika, das weiter weg ist als der Tod. Doch ist vielleicht keine Entfernung größer als die, welche arme Verwandte im selben Land trennt: Zwei Töchter verheirateten sich in Küstenorten, die eine ist Witwe mit einer großen Kinderschar, die andere erhält Unterstützung von der Gemeinde, sie heiratete einen Lungenkranken – was ist das Menschenleben?
Die jüngste Tochter, Rosa, hatte am längsten daheim gesessen und war schließlich als Magd zum Gemeindevorsteher nach Utiraudsmyri gegangen. So blieb im Haus niemand mehr als das alte Ehepaar und eine alte Frau, die zu ihnen gehörte, wie auch ein achtzigjähriger Mann, ein Gemeindearmer. Und heute also sollte Rosa heiraten, soviel hatte ihr die Mühe eingebracht. Morgen geht sie für immer fort. Und das Mühlenhaus steht am Bach. Das ist das Menschenleben.
Obgleich Bjartur die Zeit seit seiner Jugend auf einem großen Hof zugebracht hatte, wählte er seine Bekannten am liebsten aus der Schar der Kleinbauern unten aus der Siedlung, Schafzüchter wie er, Männer, die alle Tage des Jahres für ihre Tiere schufteten, bis sie starben, ohne jemals mit Geld spekuliert zu haben. Einige gelangten auf eine solche Stufe der Kultur, daß sie sich ein Wohnhaus aus Holz bauten, in Form einer schmalen Schachtel, mit Wellblech auf dem Dach. In solchen Gebäuden entsteht Zugluft und Nässe. Die Zugluft verursacht die Gicht, in der Nässe gedeiht die Schwindsucht. Doch die meisten priesen sich glücklich, wenn sie die eine oder andere Mauer ihrer Erdhütten einmal in fünf Jahren erneuern konnten, trotz besserer Träume. In jedem Gehöft wohnt der Traum von etwas Besserem; seit tausend Jahren haben sich die Menschen eingebildet, sie kämen auf geheimnisvolle Weise aus den Schwierigkeiten heraus und erwürben stattliche Höfe und würden Großbauern; das ist der ewige Traum. Einige meinen, er erfülle sich erst im Himmel.
Sie lebten für ihre Schafe und handelten mit Kaufmann Bruni (Tulinius Jensen) in Fjord; nur der Gemeindevorsteher tat das nicht. Er handelte in Vik, setzte dort selbst den Preis seiner Schafe fest, und es hieß, er wäre am Geschäft in Vik beteiligt.
Übrigens hielt man es für ein gutes Zeichen, wenn man ein Konto bei Bruni erlangte. Zwar bekam man von da an kein bares Geld zu sehen, doch war es nahezu sicher, daß sich die Leute unter seinem Schutz durchs Leben schlugen und Roggenmehl, Klippfisch zweiter Wahl und Kaffee bekommen konnten, um ihre Kinder aufzuziehen, wenigstens die, welche nicht starben (die anderen wurden vergessen); auch war im Frühjahr nur eine Mahlzeit am Tage Brauch. Bruni verhalf ihnen sogar zum Kauf ihrer Höfe, wenn ihm die Leute gefielen, wie es hieß. Dann gehörte ihnen der Hof, wenigstens dem Namen nach, und auf den Gemeinde- und Kirchensteuerbescheiden wurden sie Hofbesitzer tituliert, und wenn sie gestorben waren, so standen sie in den Kirchenbüchern zur Einsichtnahme für die Ahnenforscher.
Es waren keine unterwürfigen Männer und keine Massenmenschen, sie lebten auf eigene Verantwortung; die Unabhängigkeit war ihr großes Grundkapital. Es waren Männer der privaten Initiative; schließlich zitierten sie aus den Sagas und den Rimur, wenn sie Schnaps bekamen. Sie waren Männer des Kampfes, die vor keiner körperlichen Überanstrengung zurückschreckten, auch nicht vor der, mit ihrer Familie in den letzten zwei oder drei Wintermonaten zu hungern. Sie waren auch keine geistlosen Materialisten, die ihren Magen vergöttern, vielmehr konnten sie viele Einzelstrophen auswendig, darunter manche kunstvoll gebaute. Einige konnten aus dem Stegreif Verse dichten, über die anderen oder über ihre Schwierigkeiten oder über Lebensgefahr oder die Natur oder die Hoffnungen auf annehmbare Tage, die sich erst im Himmel erfüllen, ja sogar über die Liebe (pornographische Verse). Einer von ihnen war Bjartur. Sie kannten auch viele Geschichten von sonderbaren Männern und Frauen, gewöhnlichen Schwachsinnigen, sowie Erzählungen von wunderlichen Pfarrern. Selbst hatten sie das Glück gehabt, einen wunderlichen Seelsorger zu bekommen und keinen Dummkopf oder Mann von zweifelhaftem Charakter; über ihren Sira Gudmundur konnten sie viele vortreffliche Geschichten erzählen. Außerdem waren sie diesem Pfarrer besonders zu Dank verpflichtet für die ausgezeichnete Schafrasse, die er in diese Gegend mitgebracht hatte, sie hieß die Sira-Gudmundur-Rasse. Und obwohl der Pfarrer nie müde wurde, gegen das Schaf zu predigen und diese Tierart zu verleumden, weil er der Meinung war, es wendete die Herzen der Menschen von Gott ab, so hatte er ihnen doch mit seinen Schafböcken mehr geholfen als jemals ein anderer einzelner Mensch, denn diese Schafe waren fleischig und widerstandsfähig, wenn auch nicht besonders groß. Deshalb hatten die Leute Achtung vor dem Pfarrer und hielten ihm manches mehr als anderen zugute.
Jedoch war es nicht das Schaf allein, das nach Ansicht des Pfarrers die Menschen an der rechten Denkungsart hinderte und ihre Herzen von Gott abwendete und von jener Erlösung, die nur in ihm allein zu finden ist. Derselbe Vorwurf lastete auch auf der berühmten Dichterin, der Bäuerin auf Utiraudsmyri, die viele jedoch lieber gnädige Frau nannten. Wenden wir uns jetzt ihr zu.
Diese Frau war die Tochter eines Bauern und Fischers aus Vik und hatte die Landesfrauenschule besucht. Nach ihren eigenen Worten hatte sie den Bauern Jon aus lauterem Interesse am idyllischen Landleben geheiratet; mit diesem Idyll war sie im Elternhaus durch ausländische Dichtung, besonders von Björnstjerne Björnson, bekannt geworden und später in der Frauenschule. Als sie das erste Mal schwanger war, erschien ihr im Traum der erste Landnahmemann Islands, Ingolfur Arnarson, sprach in wohlgesetzten Worten mit ihr über Landwirtschaft und verlangte, daß das Kind seinen Namen bekäme.
In die Wirtschaft hatte sie Land im Wert von hundertzwanzig Kühen eingebracht und später, als ihr eine Erbschaft zufiel, bares Geld im gleichen Wert. Sie liebte die Talbauern über alles und ließ nichts unversucht, sie von den Vorzügen des idyllischen Landlebens und von jenem Glück zu überzeugen, das darin besteht, als Häusler zu leben und zu sterben. Sie strahlte geistigen Sonnenschein über die ganze Gegend, sie war Initiator des Gemeindefrauenvereins und dessen Vorsitzende, schrieb für Reykjaviker Zeitungen Artikel und Gedichte über die Vorzüge des idyllischen Landlebens und über das Heil für Leib und Seele, das dem Leben als Häusler entspringt. Nach ihrer Ansicht hatte von allen Industrien die Heimindustrie allein Daseinsrecht in Island; sie betrieb die Brettchenweberei mit großer Kunst. Deshalb wurde sie als Delegierte zur Konferenz des Landesfrauenverbandes in der Hauptstadt gewählt, wo über Heimindustrie und andere sittliche Güter diskutiert wurde, die das idyllische Landleben hervorbringt und die allein imstande sind, unsere Nation aus der Gefahr zu retten, in der sie in diesen schweren Zeiten schwebt. Diese Frau verstand jene Schönheit zu genießen, die im Mienenspiel der Jahreszeiten und in den blauen Bergen liegt, wenn sie an ihrem Fenster auf Utiraudsmyri saß, und sie konnte auch über diese Schönheit auf Versammlungen sprechen; sie sprach über sie mit ebensoviel Gefühl wie Vergnügungsreisende auf einem Sommerausflug. Die Arbeit draußen in der Natur war in ihren Augen gleichsam eine gesundheitsfördernde Körperübung inmitten der unbeschreiblichen Schönheit des Landes. Außerdem beneidete sie die Kleinbauern, weil sie so wenig Sorgen haben. Auch haben sie so wenig Ausgaben. Hingegen hatte sich ihr Mann in Schulden gestürzt wegen enormer Bauten, Meliorationen und landwirtschaftlicher Maschinen, vom Personal in diesen schweren Zeiten nicht zu reden, während die Talbauern des Morgens nur eine Stunde früher aufzustehen und des Abends nur eine Stunde später mit der Arbeit aufzuhören brauchten, um vollkommen glücklich zu werden. Wohlhabende Leute sind nie glücklich, arme Leute sind nahezu ausnahmslos glücklich.
Immer wenn ein armer Mann heiratete und in den Tälern eine Wirtschaft gründete, heiratete sie im Geiste mit. Deshalb lieh sie auch zu dieser Hochzeit ein großes Zelt, damit man geschützt vor Wind und Wetter den Kaffee trinken und eine Rede halten konnte.
Die Bauern standen auf dem Hofplatz oder lehnten sich an die Hausmauer, sogen mit großen Grimassen Schnupftabak in die Nase und unterhielten sich mit dem Bräutigam. Es waren die unveränderlichen Gesprächsstoffe des Frühjahrs, und das Hauptgewicht lag auf den zahlreichen Schafkrankheiten. Lange Zeit war der Bandwurm einer der Hauptfeinde der Nation gewesen, doch durch die fortschreitenden Erfolge in der Hundepurgierung hatte dieser Plagegeist den kürzeren ziehen müssen. Hingegen hatte sich in den letzten Jahren bei den Schafen ein neuer Wurm bemerkbar gemacht, der Nation keineswegs günstiger gesinnt als der vorige: Es war der Lungenwurm. Und wenn auch der Bandwurm nie gänzlich aufhörte, ein aktuelles Gesprächsthema zu sein, so mehrten sich doch die Frühjahre, in denen er in den Unterhaltungen dem neuen Wurm Platz machen mußte.
»Es ist schon immer meine Meinung gewesen«, sagte Thorir auf Gilteigur, »daß, wenn es einem gelingt, die Schafe im Winter frei von Durchfall zu halten, nichts zu befürchten ist. Selbst wenn ihnen die Würmer aus der Nase kriechen, so glaube ich, daß nichts zu befürchten ist, solange der Magen sauber ist. Und solange der Magen sauber ist, sollten sie das junge Gras sehr wohl vertragen können. Doch es kann gut sein, daß ich mich in dieser wie in anderen Sachen irre.«
»Nein«, sagte der Bräutigam. »Dieselbe Erfahrung machte Thorarinn in Urdarsel, der jetzt im Sterben liegen soll: Er war ein Meister in der Behandlung des Durchfalls. Was Lämmer betraf, so vertraute er am meisten auf Kautabak. Ich erinnere mich, daß er mir vor Jahren sagte – ich übernachtete bei ihm –, es gebe Winter, in denen er seinen Lämmern bis zu einem Viertel einer starken Rolle gebe, und lieber würde er Kaffee im Hause sparen, von Zucker gar nicht zu reden, als Priem an den Lämmern.«
»Ja, ich bin zwar kein besonders guter Bauer«, sagte Einar auf Undirhlid, der Psalmen- und Nachrufdichter der Gemeinde, »und habe außerdem bemerkt, daß es denen am schlechtesten geht, die sich um das Essen die größten Sorgen machen. Anscheinend macht sich die Vorsehung besonders über sie lustig. Doch wenn ich meine Meinung äußern sollte, nach meinem eigenen Verstand, so bin ich der Ansicht, wenn das Futter den Wurm nicht von den Jungtieren fernhalten kann, dann tut es der Kautabak noch weniger. Es ist denkbar, daß der Kautabak ein bißchen hilft, wenn nichts anderes mehr übrigbleibt. Genau betrachtet, ist Kautabak Kautabak, und Futter ist Futter.«
»Daran besteht natürlich kein Zweifel«, sagte Olafur in Ystidalur schnell und mit leicht kreischender Stimme, »Futter ist nun einmal Futter. Aber nichtsdestoweniger ist Futter und Futter zweierlei, denke ich, was sich auch jeder selbst sagen kann und was sogar Zoologen immer wieder in den Zeitungen hervorgehoben haben. Und das eine ist vollkommen gewiß, daß nämlich in manchem Futter die verfluchte Krankheitsbakterie steckt, aus welcher der Wurm entsteht. Eine Bakterie ist nun einmal eine Bakterie, und kein Wurm kann ohne Bakterie entstehen, das könnte sich, denke ich, jeder selber sagen. Und wo ist denn die Bakterie ursprünglich, wenn nicht im Futter, frage ich mich?«
»Ich weiß es nicht, ich verbürge mich für nichts«, sagte Thorir auf Gilteigur. »Man gibt sich Mühe mit dem Futter für die Schafe; und man gibt sich Mühe mit dem Christentum für die Kinder. Es ist nicht möglich zu sagen, woher der Wurm kommt– weder im Tierreich noch in der menschlichen Gesellschaft.«
Die Frauen saßen im Haus und tuschelten gerade über Steinka auf Gilteigur, die ihrem Vater sozusagen den Haushalt führte. Sie hatte nämlich in der vergangenen Woche ein Kind bekommen, und einige der Frauen waren herzlich gern bereit gewesen, sich bei dieser Gelegenheit als Freiwillige dort auf dem Hof zu melden, wie es zu sein pflegt, wenn jemand ein uneheliches Kind bekommt: Da wollen alle helfen, wenigstens die erste Woche, solange man nicht weiß, wer der Vater ist. Sie war ziemlich schwer niedergekommen, das arme Ding, und das Kind war nicht gesund, es war noch fraglich, ob es am Leben bleiben würde. Allmählich jedoch nahm die Unterhaltung der Frauen Kurs auf ihre eigenen Wochenbetten und Krankheiten sowie die Krankheiten der Kinder überhaupt. Wie es scheint, fehlt es der Nation heutzutage ganz und gar an Gesundheit; dennoch machen sich keine schweren Krankheiten bemerkbar wie etwa in alten Zeiten die Blattern oder die Pest. Es sind diese ewigen Unpäßlichkeiten: Zahnschmerzen, Ausschlag, Gelenkentzündung, Herzbeklemmung, Atemnot, oft mit Hustenanfällen, andauerndes Ziehen in der Brust und Druck im Hals, ganz zu schweigen von diesem Glucksen beim Laufen und den Winden im Gedärm; doch vielleicht ist keine Krankheit so zermürbend für Leib und Seele wie die Nerven.
Die Hausfrau auf Utiraudsmyri floh aus dem Haus und trat hinaus auf den Hofplatz zu den Männern. Als sie das Gesprächsthema hörte, bat sie die Männer, mit diesem Geschwätz aufzuhören. Sie machte viel her, denn sie war eine stattliche Erscheinung. Sie hatte ein breites Gesicht, trug eine Brille und sah imponierend aus wie der Papst auf Fotografien. Sie forderte sie auf, ein Gesprächsthema zu wählen, das besser zu diesem herrlichen Frühlingstag paßte. Sie zeigte auf die lieben blauen Berge und den sonnenklaren Himmel darüber, auf die Wiesen, die sich jetzt mit Grün schmücken – »hier sind doch wenigstens zwei ortsberühmte Dichter; zuerst ist der Bräutigam selbst zu nennen und dann Einar in Undirhlid. Und da ist Olafur in Ystidalur, Freund wissenschaftlicher Lehren und Mitglied des Vereins der Volksfreunde. Irgend etwas Schönes muß euch doch in diesem Frühling draußen in der gesegneten Natur eingefallen sein.«
Doch diese Dichter waren nie abgeneigter, ihre Dichtungen vorzutragen, als in Anwesenheit dieser Frau. Denn wie überaus bereitwillig sie auch ihre Freundschaft zu ihnen und ihre Bewunderung für ihre Lebensbedingungen beteuerte, ihr Lächeln war doch sehr kalt, so daß die Männer das Gefühl hatten, es liege eine unüberbrückbare Kluft zwischen ihnen und ihr. In ihrer Geisteshaltung standen beide der Frau auf Raudsmyri fern. Diese Frau schwärmte für die großen Dichter der Welt und konnte die Schönheit dieses Lebens nicht genug bewundern. Sie glaubte fest an den Gott, der dieses Leben lenkt, und war der Ansicht, daß er in allen Dingen wohne und daß es die einzige Aufgabe des Menschen sei, ihn in guten wie in bösen Zeiten zu unterstützen und ihm zu helfen. Zum Leben im Jenseits nahm sie keine Stellung. Eine solche Geisteshaltung betrachtete der Pfarrer als finsterstes Heidentum. Einar auf Undirhlid hingegen stand kritisch zur Welt, er dichtete besonders gern über Menschen, wenn sie starben, und tröstete sich mit der Gottheit, von der er annahm, daß sie den Bauern im Jenseits mehr als im Diesseits beistehen werde. Der Pfarrer aber verbot, seine Sterbelieder bei Beerdigungen zu singen, denn er hielt es für unpassend, daß einfache, in der Theologie unbewanderte Bauersleute auf diesem Gebiet mit den sanktionierten Psalmendichtern der Nation konkurrierten. Bjartur seinerseits schätzte den alten Geist der Nation, wie er sich in den Rimur zeigt, und er hielt am meisten von denen, die sich auf ihre Kraft und Stärke verließen, wie Bernotus, der Kämpe von Borney, die Jomswikinger und andere große Männer der Vorzeit, und was weniger kunstvoll gedichtet war als vierzeilige Strophen mit Binnenreim und Endreim, das sah er nicht für vollendete Dichtkunst an. In diesem Augenblick traf der Pfarrer ein. Er stieg schnaufend aus dem Sattel, ein hochgewachsener Mann mit blauem Gesicht und grauem Haar, verdrießlich in seinen Antworten, nie der gleichen Meinung wie andere. Und die Sache wurde dadurch nicht besser, daß er hier zuerst die Dichterin erblickte.
»Ich sehe nicht ein, weshalb man mich überhaupt hierherholt«, sagte er. »Hier sind wahrlich die zusammengekommen, die mehr davon verstehen, vor Leuten zu sprechen, als ich.«
»Ja«, sagte Bjartur grinsend und nahm ihm die Pferde ab, »es ist einem doch stets angenehmer, der Liebe einen Namen zu geben.«
»So etwas von Liebe«, murmelte der Pfarrer, indem er schnell über den Hofplatz zur Haustür ging. Er wollte vor der Amtshandlung seinen Kaffee haben, denn er hatte es eilig. Es war Sonnabend, er hatte vor dem Abend ein Kind zu taufen und mußte noch nach Norden über die Sandgilsheide in seine Filialkirche. – »Ich sage kein Wort mehr, als im Handbuch steht, ich denke, ich habe mir an diesen Hochzeitspredigten genug den Mund verbrannt, die Leute stürzen sich in diese Ausweglosigkeit ohne die geringste Spur der Gesinnung, die zu einer wahrhaft christlichen Ehe gehört, und wo endet es dann? Zwölf Ehepaare habe ich schon getraut, die Unterstützung von der Gemeinde bekamen, und vor solchen Leuten soll man eine Traurede halten!« – beugte sich unter den Türbalken und verschwand im Haus.
Kurz darauf wurde die Braut von der Frau des Gemeindevorstehers zum Zelt geführt. Sie ließ den Kopf hängen, aus einem Auge blickte schielende Ratlosigkeit; sie trug Tracht. Die Frauen kamen hinterher, dann die Männer und die Hunde, schließlich der Pfarrer im zerknitterten Talar; er hatte eben seinen Kaffee getrunken. Rosa aus Nidurkot war sechsundzwanzig, als sie sich verheiratete. Sie hatte ein volles Gesicht, sprach wenig und schielte ein bißchen. Sie hatte rote Wangen, war drall und nicht besonders groß. Sie hielt weiter den Blick auf ihre Schürze gesenkt. An der inneren Zeltstange stand ein kleiner Tisch, der Altar; der Pfarrer blieb dort stehen und begann im Handbuch zu blättern.
Keiner sagte ein Wort, nur die Sänger flüsterten sich etwas zu, einige rauhe und mißtönige Stimmen sangen den Hochzeitspsalm mit verschiedenen Melodien, verschiedenem Tempo, »wie gut und schön und wonniglich«, die Frauen wischten sich die Tränen aus den Augen, der Pfarrer griff in die Tasche, holte seine Uhr hervor und zog sie vor dem Brautpaar auf. Dann traute er sie nach dem Handbuch. Hinterher wurde kein Psalm mehr gesungen, der Pfarrer gratulierte nur dem Brautpaar seiner Amtspflicht gemäß und fragte den Bräutigam, ob jemand seine Gäule bereithielte, er hätte jetzt keine Zeit mehr. Bjartur lief froh nach den Pferden, die Frauen umringten die Braut, um sie zu küssen. Dann dachte man an den Kaffee.
Tische und Bänke wurden aufgestellt, und die Gäste waren so frei und nahmen Platz, die Frau des Gemeindevorstehers setzte sich zum Brautpaar, da der Pfarrer über alle Berge war. Es wurden Teller mit fetten Schürzkuchen und Napfkuchen mit herrlichen Rosinen hereingebracht, und die Männer fuhren fort, Prisen zu nehmen und über die Schafe zu sprechen. Dann kam der Kaffee.
Die Gesellschaft war lange ziemlich geistlos. Die Leute schlürften pflichtbewußt je vier bis acht Tassen Kaffee, hier und dort wurden Rosinenkerne zerbissen.
»Trinkt nur tüchtig Kaffee«, sagte Bjartur, strahlend vor Gastfreundlichkeit, »und habt keine Angst vor den Happen!«
Schließlich hatte keiner mehr Appetit auf Kaffee. Draußen konnte man den Regenbrachvogel rollen hören, es war auch seine Zeit.
Da stand die Frau auf Raudsmyri auf, die Dichterin. Ihr Gesicht leuchtete imponierend in seiner Papstwürde über die Schar, sie griff in ihre Rocktasche und holte ein paar beschriebene Blätter hervor.
Sie sagte, daß sie sich in dieser feierlichen Stunde, die die Herzen an diesem Ort vereine, nicht der Worte enthalten könne. Es käme zwar anderen eher zu, ihr Licht über diesem jungen Brautpaar leuchten zu lassen, das jetzt ins Leben hinaustrete, um seine Pflicht gegenüber dem Vaterland zu tun, die schönste Pflicht, die man für das Vaterland tun könne, und für Gott. Doch es sei wie in dem alten Gleichnis: Die Geladenen entziehen sich und entschuldigen sich mit allerlei Vorwänden, so daß sie sich keinen anderen Rat wisse, als selbst eine kleine Rede zu halten, wie jeder andere einfache Mensch. Sie könne es nicht ungesagt lassen, diese Brautleute seien in gewissem Sinne ihre Kinder, ein Teil von ihr selbst, sie hätten ihrem Hause treu gedient, der Bräutigam sogar achtzehn Jahre lang; sie könne es sich nicht vorstellen, daß sie sich auf den heiligen Weg des Lebens begäben, ohne daß ihnen einige Worte des Ansporns und der Ermunterung zuteil würden. Sie sagte, ihr sei das harte Geschick in die Wiege gelegt worden, daß sie sich nie eine Gelegenheit entgehen lassen könne, die Vorzüge des Bauernstandes zu loben. Zwar sei sie selbst in der Stadt aufgewachsen, doch die Vorsehung habe gewollt, daß sie Bauersfrau würde. Und das, sagte sie, bereue sie wahrhaftig nicht, denn die Natur ist das Erhabenste, was Gott geschaffen hat, und das Leben, das in der Natur gelebt wird, ist das vollkommene Leben, und im Vergleich damit ist jedes andere Leben Schall und Rauch.
Die Städter, sagte die Frau, hätten keine Vorstellung von dem Frieden, den die Mutter Natur spendet, »und solange man diesen Frieden nicht gefunden hat, wird der Geist mit Augenblickserrungenschaften gesättigt. Was ist natürlicher, als daß so etwas unstete Augenblicksmenschen formt, die in erster Linie an das Aussehen des Körpers und der Kleider denken und eine Augenblicksbefriedigung in törichter Mode oder anderen wertlosen Abwechslungen finden? Doch der Landmensch, er tritt hinaus auf grasige Ebenen in eine reine und klare Atmosphäre, und indem er sie einatmet, durchströmt eine ungeahnte Lebenskraft Körper und Seele. Der Frieden, der in der Natur herrscht, stimmt das Gemüt unwillkürlich ruhig und heiter; das prächtiggrüne, von Blumen durchwirkte Gras ihm zu Füßen weckt das Schönheitsgefühl, ja fast Ehrfurcht. Angenehm ist es, sich darin auszuruhen, der Duft ist würzig, die Stille himmlisch. Die Hänge, Mulden, Wasserfälle und Berge werden zu Jugendfreunden, die man nie vergißt. Majestätisch und imposant sind manche unserer Berge. Wohl nichts hat einen so tiefen Eindruck auf unser Herz gemacht wie gerade ihr reiner und würdevoller Ausdruck. Sie geben uns Schutz in ihren Tälern und weisen uns zugleich an, auch allen denen Schutz zu gewähren, die kleiner und schwächer sind als wir selbst. Wo«, fragte die Dichterin, »kann man himmlischeren Frieden finden als in stillen blumenreichen Gebirgstälern, wo die Blumen, diese Engelsaugen, wenn ich mich so ausdrücken darf, zum Himmel weisen und den Menschen gebieten, niederzuknien vor der Allmacht, der Schönheit, der Weisheit und der Liebe?
Ja wahrlich, all dieses ist gewaltig und allumfassend.«
Die Frau sagte, es hätte durchaus seinen Wert, solche Einflüsse zu erfahren.
»Im Mittelalter war es ritterlich, den Schwachen zu beschützen«, sagte sie. Warum sollte es nicht heute auch so sein? Zu den Schwachen wollte sie alle die rechnen, »die weniger sind als wir selbst und die bei uns Schutz suchen müssen. Fütterung und Pflege des Viehs im Winter ist eine edle Arbeit. Und wenn ich diese Worte ausspreche, so sind sie begleitet von vielen Dankesworten an dich, Bjartur, von unseren Schafen auf Utiraudsmyri. Ein großes und edles Werk hast du als Hirt in unserem Haus vollbracht. Du sollst den Hirten lieben wie dein eigenes Blut, steht in einem alten Lehrgedicht.
Der Hirt steht frühmorgens auf und geht hinaus in die Kälte, um nach den Tieren in den Ställen zu sehen. Doch er klagt nicht«, sagte sie. »Das Mitleid treibt ihn. Der Schneesturm härtet und stählt ihn. Er fühlt eine Kraft in sich, die er früher nicht kannte. Im Kampf gegen den Sturm erwacht in ihm der Heldengeist; bei dem Gedanken, daß er sich zu Nutz und Frommen der hilflosen Kreatur Mühen auferlegt, wird ihm warm ums Herz. So schön ist das Landleben. Es ist die beste Einrichtung zur Erziehung der Nation. Und auf den Schultern der Bauern ruht die bäuerliche Kultur. Bei ihnen hat umsichtiger Ernst den Ehrenplatz inne, zum Segen für Land und Volk.«
Die Dichterin verlas ihre Rede mit Wärme und Überzeugungskraft, hinzu kam die Hitze im Zelt. Der Schweiß strömte ihr von der breiten Stirn die blühenden Wangen hinunter; sie zog ihr Taschentuch hervor und wischte sich das Gesicht. Dann fuhr sie fort: »Ich weiß nicht, ob ihr die Religion der Perser kennt.
Dieser Volksstamm glaubte, daß der Gott des Lichts und der Gott der Finsternis in ständigem Kampf lägen und daß die Menschen dem Gott des Lichts im Kampf beistehen müßten, indem sie Äcker bestellten und den Boden urbar machten. Genau das ist es, was die Bauern tun. Sie helfen Gott, wenn man sich so ausdrücken darf, sie arbeiten mit Gott an der Aufzucht von Pflanzen, Tieren und Menschen. Eine edlere Arbeit gibt es hier auf Erden nicht. Deswegen möchte ich diese Worte an alle Bauern richten, und zuallererst an unseren Bräutigam heute:
Ihr Bauern, ihr Mägde und Knechte, die ihr oft arbeitsreiche und rastlose Tage habt, seid euch dessen bewußt, ein wie gutes und edles Werk ihr vollbringt. Eure Landarbeit ist Mitarbeit mit dem Schöpfer selbst, und er hat Wohlgefallen an euch.
Und vergeßt nie, daß er es ist, der die Frucht schenkt.«
Danach wollte die Frau gern einige Worte an Rosa richten, »dieses wohlerzogene und stille Mädchen hier von Nidurkot, der wir alle so Gutes gönnten und die wir so hochschätzten diese zwei Jahre, in denen sie uns zu Hause auf Utiraudsmyri half – unsere Braut heute, die künftige Hausmutter in Sumarhus. Die Hausmutter – es war nicht von ungefähr, daß dieser Ehrenname der ersten Frau jedes Hauses gegeben wurde, denn unsere Väter und Vorväter haben empfunden, daß ihre mütterliche Sorge allen Hausangehörigen galt, daß sie sie nicht nur mit dem versorgte, was der Körper brauchte, sondern daß sie ihre Mütterlichkeit über die ganze Gemeinschaft leuchten ließ. Doch das sollte jede Frau, die die ehrenvolle Stellung einer Mutter der Kinder und des Heims erlangt, beachten, daß diese Pflichten so umfassend und so erhaben sind, daß sie Segen bringen bis ins dritte und vierte Glied, ja sogar bis ins tausendste Glied.
Es ist schwer, Frau und Hausmutter zu sein, es ist schwer, sich dem Los unterworfen zu sehen, die größte und höchste Aufgabe zu erfüllen, die es gibt.
Ich zweifle nicht daran, daß es wohl vielen Frauen ein undurchführbares Unterfangen zu sein scheint, ihr Heim so zu gestalten, daß, wohin man auch blickt, nur ein einziges lichtes Lächeln herrscht; jeder Kleinigkeit die Kraft zu verleihen, daß sie in die Brust derer, die zum Heim gehören, engelshaft einen hellen Schein trägt; solche Ruhe und solchen Frieden innerhalb der vier Wände zu verbreiten, daß aller Haß und alle Bitterkeit aus jedem Sinn entschwindet und jeder das Gefühl bekommt, er habe Kraft zu großen Taten; und daß es den Hausangehörigen so scheint, als ob Gott selbst sie durch die Frühlingsgefilde ewiger Ideale führe; daß alle das Gefühl haben, rein und frei und kühn zu sein, und daß sie ihre Verwandtschaft mit Gott und der Liebe fühlen. Gewiß ist das schwer und mühevoll. Doch das ist nun einmal deine Aufgabe, Hausmutter; die Aufgabe, die Gott selber dir zu vollbringen aufgetragen hat. Und du hast die Kraft dazu, auch wenn du es selbst nicht weißt. Das alles ist dir möglich, wenn es dir nur nicht am Glauben an die Liebe gebricht, die in dir wohnt. Nicht nur die Frau, die auf der Sonnenseite des Lebens wohnt und Bildung genossen hat, sondern auch die Frau, die wenig gelernt hat und auf der Schattenseite des Lebens sitzt und in einem niedrigen Haus in kleinen Verhältnissen lebt– in ihr wohnt sie auch, diese Kraft, denn euer aller Adel ist derselbe: Ihr seid Kinder Gottes. Die Kraft der Frau, die ihr Heim in die Herrlichkeit irdischen Glücks erheben kann, ist derart, daß sie die niedrigen Hütten und die hohen Häuser gleichmacht. Gleich hell. Gleich warm. Diese Kraft ist der wahre Sozialismus.
Denke daran, Rosa, daß du an jedem Tag eine Wellenbewegung erregst, die sich bis an die Grenzen des Daseins ausbreitet; du erregst Wellen, die sich an der Ewigkeit selbst brechen. Und viel hängt davon ab, ob es Wellen des Lichts sind, die gesendet werden und überallhin Wärme und Helligkeit tragen, oder aber Wellen der Finsternis, die Trostlosigkeit und Unglück bringen und jenen Gletscherrutsch verursachen, der die Eiszeit des Volksherzens hervorbringt.
Habe die Liebe vor Augen in ihrer vollkommensten Form, im bedingungslosen Opfer, in ihrer Beziehung zu allem Höchsten und Edelsten im Seelenleben der Menschen. Habe ihre Macht vor Augen über all das Niedrige und Schmutzige im Leben. Bedenke die Kraft der Liebe, die die Hütte in ein Schloß zu verwandeln vermag, die die Armut zum Rosenhain und die Kälte zum Sommerland macht.«
Das Brautpaar und die Hochzeitsgäste lauschten dieser Rede mit Schweigen, das nur von verstopftem, schnarchendem Schnupftabaksatem, zwei summenden Schmeißfliegen unter der Firststange und dem Gezwitscher der Sommervögel draußen unterbrochen wurde. Erst als die Frau sich gesetzt hatte, wagten die Leute, sich zu schneuzen. Einige Frauen flüsterten sich voller Bewunderung etwas über die Rede der Frau zu. Dann herrschte wieder Schweigen. Die Leute blickten vor sich hin, stumpf vor Hitze, schlapp von dem vielen Kaffee, den sie getrunken hatten, hypnotisiert von den schneeweißen Wänden des Zelts und dem Summen der Fliegen.
Endlich wurde das Schweigen erneut unterbrochen. Es war Hrollaugur auf Keldur, ein alter Bauer mit großer Nase und grauem Bart; er fragte aus der Stille heraus und richtete seine Worte an Bjartur: »Ist etwas wahr daran, Bjartur, daß dieses Frühjahr bei euch dort auf Utiraudsmyri die Drehkrankheit aufgetreten ist?«
Diese Frage zur rechten Zeit rüttelte die Hochzeitsgesellschaft aus Lethargie und Träumerei auf und erfüllte sie mit neuem Interesse am Leben. Man zählte gewissenhaft alle Fälle von Drehkrankheit auf, die in diesem Frühjahr in der Gemeinde bekannt geworden waren, und ließ einige weniger höfliche Bemerkungen über den Bandwurm vom Stapel. Alle waren der Meinung, daß in den vergangenen zwei Jahren die Hundepurgierung hier in der Gemeinde äußerst mangelhaft gewesen sei, und einige wollten die Schuld daran dem Bergkönig und Küster der Gemeinde geben, der dieses Amt mit Hilfe des Pfarrers an sich gerissen hatte.
»Zumindest bin ich dazu entschlossen, meinen Hund diesen Herbst auf eigene Faust zu reinigen« sagte der Bräutigam.
Alle waren sich darin einig, daß ein gesunder Hund zu den Lebensbedingungen der Menschen gehöre und daß es deshalb alle Grenzen übersteige, wie gedankenlos die Leute mit dem Drehwurm umgingen, und das sogar auf guten Höfen.
»Wenn die Leute mit dem Drehwurm umgehen könnten«, sagte Thorir auf Gilteigur, der durch Erfahrung klug geworden war, »dann wäre nichts zu befürchten. Aber es ist mit dem Drehwurm wie mit den Menschen, das meiste Unglück geht auf mangelnde Kontrolle zurück, und wenn man sich darüber klar würde, daß die Hauptursache ist, richtig mit dem Drehwurm umzugehen, dann brauchte einem um die Hunde nicht bange zu sein. Man hat es sich selber zuzuschreiben.«
Dann wurde darüber vorwärts und rückwärts debattiert, und dieser und jener hätte etwas dazu zu sagen. Einar in Undirhlid erklärte, er hätte kein Vertrauen zu menschlichen Maßnahmen in diesen Dingen, in erster Linie deshalb, weil die ganze Welt ihrem Untergang zustrebe, und keine Medizin und keine Ärzte und keine Wissenschaft etwas daran ändern können, wofür unsere Zeit den besten Beweis liefere, und außerdem wäre Hund Hund, Drehwurm Drehwurm und Schaf Schaf. Olafur in Ystidalur lehnte das ab und sagte, der Bandwurm beim Hund und demzufolge der Drehwurm bei den Schafen und die Drehkrankheit bei den Menschen wären nur ein Beweis dafür, daß die Dosis für die Hundepurgierung von Anfang an nicht wissenschaftlich sei – »denn«, sagte er, »das muß jeder einsehen: Wenn das Mittel von Anfang an wissenschaftlich wäre, dann müßten die Hunde sich laxieren.«
4. Drohende Wolken
Am Tag darauf führte Bjartur seine Frau auf Blesi heim; er hielt das Pferd am Zügel, denn es war schlecht zugeritten, widerspenstig und bäumte sich gern auf. Er trug ihr Federbett in einem Sack auf dem Rücken; sie hatte vor sich einige Hochzeitsgeschenke in zwei Säcken quer über den Sattelknopf, darunter eine Kelle und einen Topf, die klappernd aneinanderschlugen; deshalb scheute das Pferd immer wieder und wollte durchgehen, doch Bjartur lag in den Zügeln wie ein Ankerstein. Der Hund trottete hinterher mit jenem lässigen Schnüffeln, das Hunden an duftenden Frühlingstagen eigen ist; doch jedesmal, wenn das Pferd scheute, wurde der Hund wütend und fuhr ihm an die Beine und machte ihm noch mehr Angst, besonders aber der Frau. Der Mann konnte Hund und Pferd nicht genug ausschimpfen. Etwas anderes wurde auf dem Weg den Paß hinauf nicht gesprochen.