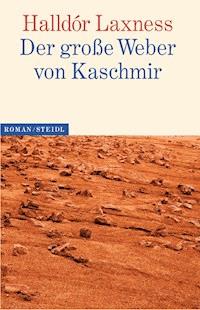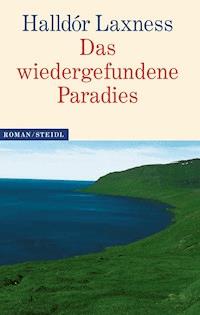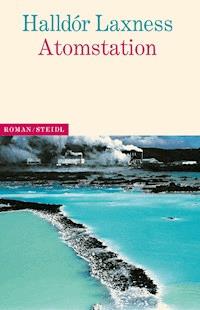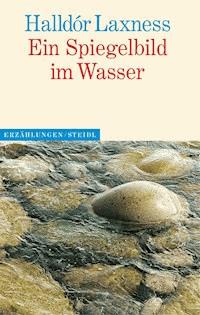Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das episch breit angelegte Romanschaffen des isländischen Autors Halldór Laxness (1902-1998) greift verschiedentlich autobiografische Erlebnisse auf oder befasst sich mit dem Lebensweg von Zeitgenossen -- so auch in diesem Fall: Das in dem tetralogisch konzipierten Roman Weltlicht Erzählte basiert auf den Tagebucheintragungen eines isländischen Volksdichters während der dreißiger Jahre in Reykjavik und Umgebung. Der Protagonist Olafur Karason pflegt eine leidenschaftliche Liebe zur Literatur, doch damit stößt er überall nur auf Ablehnung und Erniedrigung. Seine Mitmenschen empfinden ihn als einen jämmerlichen Menschen, der "auf der faulen Haut lag und jahrelang so tat, als sei er krank, und unschuldige Menschen in einer anderen Gemeinde sich für seinen Lebensunterhalt abrackern ließ". Auch sein Talent als Gelegenheitsdichter wird verkannt: "es ist schwer, im Norden am äußersten Meer Dichter zu sein." Olafur war, von seinen Eltern verstoßen, als Pflegekind aufgewachsen und hatte seine Jugend in einer Atmosphäre menschlicher Kälte auf einem Bauernhof verbracht, sein Leben dort bestand aus schwerer körperlicher Arbeit, Hunger und Schlägen. Ärmliche Verhältnisse prägen auch die Ehe an der Seite einer ungeliebten Frau, die gemeinsamen Kinder sterben, und wegen der Vergewaltigung einer Minderjährigen kommt Olafur schließlich ins Gefängnis. Hier entwickelt er Visionen, und nach seiner Entlassung erfüllt sich endlich sein Traum von Schönheit und Vollkommenheit -- "es liegt nicht in meiner Natur, von dem Glauben abzuweichen, daß es nur eine wahre Liebe zwischen Mann und Frau gibt".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1079
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Halldór Laxness Weltlicht
Roman
Der Klang der Offenbarung des Göttlichen
1
Er steht mit einer Seeschnepfe und einem Strandläufer am Ufer unterhalb des Hofes und sieht dem Spiel der Wellen zu. Vielleicht drückt er sich vor der Arbeit. Er ist ein Pflegekind, und deshalb ist das Leben in seiner Brust eine besondere Welt, ein anderes Blut, nicht mit den anderen verwandt, er ist nicht Teil von etwas, sondern steht außerhalb, und es ist oft leer um ihn herum und lange her, seitdem er sich nach einem unerklärlichen Trost zu sehnen begann. Diese enge Bucht mit den leichten Wellen auf dem Sand und kleinen blauen Muscheln und Felsen auf der einen Seite und einer grünen Landzunge auf der anderen, sie war seine Freundin. Sie hieß Ljosavik.
Hatte er denn niemanden, war denn außer dieser kleinen Bucht keiner gut zu ihm? Nein, keiner war gut zu ihm. Aber es war auch keiner wirklich böse zu ihm, so daß er um sein Leben hätte fürchten müssen, das war erst später. Wenn er gehänselt wurde, geschah das Hänseln meist zum Spaß, die Schwierigkeit bestand darin, es zu ertragen. Wenn er geschlagen wurde, so waren die Schläge notwendig, das war die Gerechtigkeit. Vieles war ihm dagegen gleichgültig, Gott sei Dank. Zum Beispiel warf der ältere Bruder, Nasi, Schafhalter und Fischer, seiner Mutter, der Hausfrau Kamarilla, eine volle Schüssel nach, als sie eines Abends die Treppe hinunterging; ihm war das gleichgültig. Doch wenn der jüngere Bruder, Just, der ebenfalls Schafhalter und Fischer war, sich damit vergnügte, ihn an den Ohren zu ziehen, weil es so lustig war, auszuprobieren, was der liebe Kleine aushalten konnte, dann war ihm das nicht gleichgültig, leider. Im Frühjahr gruben sie am Ufer des Flusses hinten im Tal Löcher, um dort Forellen zu fangen, warfen dann lebende Lachsforellen nach dem Jungen, der ahnungslos in der Nähe herumlief, und sagten: Er beißt. Da bekam er Angst. Das fanden sie dann lustig. Am Abend stellten sie einen Eimer mit einer gräßlichen Forelle genau neben sein Bett. Ihm kam es so vor, als sei der Teufel darin. Am Abend wollte er sich, in Todesangst, nach unten schleichen und bei seiner Pflegemutter Schutz suchen, da sagten sie: Jetzt springt die Forelle aus dem Eimer und beißt.
Sie schwindeln dich an, sagte die Witwe Karitas, die Mutter der Jungmagd Kristjana.
Da wußte der Junge nicht, wem er glauben sollte. Er konnte sich nämlich auf nichts verlassen, was diese Frau und ihre Tochter sagten. Sie hatten sehr hervorstehende Augen. Einmal hatte er vergessen, daß er ein Pferd holen sollte. Er hatte über Gott nachgedacht und zwei Vögeln zugesehen, die im Sand herumwateten. Es versteht sich natürlich von selbst, daß er geschlagen wurde, weil er sich vor der Arbeit drückte. Und während seine Pflegemutter die Rute unter dem Kopfkissen hervorholte, da mußte die Magd Karitas unbedingt sagen: Geschieht ihm ganz recht, diesem verfluchten kleinen Taugenichts. Und das Mädchen Jana fügte hinzu: Ja, sich immer vor der Arbeit drücken.
Aber wenn er geschlagen wurde, dann wurde er nie sehr kräftig geschlagen, nur ein klein wenig, weil die Gerechtigkeit Gottes unausweichlich ist. Gott bestraft alle, die sich vor der Arbeit drücken. Dann war sie fertig mit dem Schlagen, und er zog wieder seine Hose hinauf und wischte sich die Tränen ab und schniefte. Seine Pflegemutter war nach unten gegangen, um das Abendbrot herzurichten. Da kam die Witwe Karitas und strich ihm mit der Hand über die Wange und sagte: Ach, Gott ist das ganz egal, armes Kerlchen, wie sollte er Zeit haben, sich um so etwas zu kümmern. Das Mädchen Jana griff in ihre Bluse und holte einen warmen, halb aufgelösten Brocken Kandiszucker hervor, den sie am Morgen in der Speisekammer gestohlen hatte: Beeil dich, zerbeiß ihn, und dann hinunter damit, und ich bring dich um, wenn du es verrätst. So gut und liebevoll und gerecht waren sie, weil sie gesehen hatten, wie er geschlagen wurde, und wenn sie gut zu ihm waren, fand er, daß sie gar keine so hervorstehenden Augen hatten. Sie waren nie sehr böse zu ihm, wenn es keiner hörte.
Magnina, die Tochter des Hauses, brachte ihm das Lesen bei, es gab eine zerfledderte Fibel. Sie saß wie ein unförmiger Haufen neben ihm und zeigte mit einer Stricknadel auf die Buchstaben. Sie gab ihm eine Ohrfeige, wenn er dreimal denselben Buchstaben falsch las, aber nie kräftig und nie zornig, immer wie geistesabwesend, und ihm war es gleichgültig. Sie war dick und hart und hatte ein bläuliches Gesicht, und der Hund nieste, wenn er sie beschnupperte. Sie trug zwei Paar dicke Strümpfe, weil sie immer kalte Füße hatte, die äußeren Strümpfe hingen ihr immer herunter, die inneren hingen ihr manchmal ebenfalls herunter. Sie hänselte ihn nie zum Spaß und verleumdete ihn nie, um ihn in Schwierigkeiten zu bringen. Rächte sich nie vor allem an ihm, wenn sie schlechte Laune hatte, und wünschte ihn nie zur Hölle. Doch sie half ihm auch nie, wenn er gehänselt oder unverschuldet geschlagen wurde, trat nie für ihn ein, wenn er verleumdet wurde, und war nie fröhlich. Dagegen kam es vor, daß sie ihm ganz gedankenlos Gutes erwies. Nachmittags gab es gesalzenen Fisch zu essen und abends Brei mit saurem Quark und einem Stück Lunge; manchmal gab es abends nur sauren Quark und Milch. Aber die Tage waren sehr lang, und der Himmel über dem Meer war düster, und auf dem Berg auf der anderen Seite des Fjords lag Schnee; sie war allein mit dem Jungen in der Stube, und es schien, als wolle das Leben nie enden und nie etwas Besseres beginnen. Da ging sie rasch hinunter in die Speisekammer und holte sich ein Stück Filetwurst, saure Brust oder sauren Widderhoden. Der Junge sabberte auf die alte Fibel, und das Mädchen gab ihm eine Ohrfeige und fragte, ob er auf das Buch spucke. Dann gab sie ihm einen Bissen Brustfleisch, einfach nur so, ganz ohne Nächstenliebe, als ob es selbstverständlich sei. Für eine kurze Zeit fühlte er im Mund und in der Kehle und im ganzen Leib großes Wohlbehagen. Im Alter von acht Jahren las er Volkssagen, die Erzählungen Peturs und das Lukasevangelium, das ihn zum Weinen brachte, weil Jesus Christus so arm und verlassen war. Die Postille hatte er dagegen nie als Buch ansehen können. Er wollte unbedingt noch mehr lesen, aber es gab sonst keine Bücher mehr, bis auf eines, die Geschichten von der Insel Felsenburg, die Magnina, die Tochter des Hauses, von ihrem Vater geerbt hatte. Dieses Buch durfte außer ihr niemand lesen, es war ein Buch voller Geheimnisse. Er wollte unbedingt die Geschichten von der Insel Felsenburg lesen und alle Bücher auf der Welt, außer der Postille. Wenn du noch einmal die Geschichten von der Insel Felsenburg erwähnst, dann verprügle ich dich, sagte die Tochter des Hauses. Er ahnte schon früh, daß in Büchern überhaupt, und in den Geschichten von der Insel Felsenburg im besonderen, der unerklärliche Trost zu finden sei, nach dem er sich sehnte, den er jedoch nicht benennen konnte. Magnina schrieb ihm die Buchstaben vor, aber nur ein Mal, weil sie keine Zeit dazu hatte, sie brauchte so lange für jeden Buchstaben. Es gab auch kein Papier, und wenn es Papier gab, durfte man es nicht verwenden. Er kritzelte heimlich mit seinem Stecken in die Erde oder in den Schnee, doch das verbot man ihm und sagte, er verschreibe sich dem Teufel. So konnte er also nur in seine Seele schreiben. Der Hausfrau Kamarilla war alles, das mit Büchern zu tun hatte, verhaßt. Als sich bei dem Jungen eine unnatürliche Neigung zum Studieren von Buchstaben zeigte, erzählte sie ihm zur Warnung die Geschichte von G.Grimsson Grunnvikingur. Er schrieb sich nicht Gudmundur Grimsson, wie andere Leute, sondern kürzte seinen Vornamen ab und legte sich einen Beinamen zu, um es den Vornehmen gleichzutun. Das war eine fürchterliche Geschichte. G.Grimsson Grunnvikingur war ein verkommener Dichterling und schrieb hundert Bücher. Er war ein schlechter Mensch. Als er jung war, da wollte er nicht heiraten, setzte aber dreißig Kinder in die Welt. Er haßte die Menschen und schrieb über sie. Er hatte eine Menge Bücher über unschuldige Menschen geschrieben, die ihm nie etwas zuleide getan hatten. Niemand wollte etwas mit einem solchen Mann zu tun haben, abgesehen von häßlichen alten Weibern, die er sich auf seine alten Tage aufgehalst hatte. Die Leute bekommen auf ihre alten Tage das, was sie verdient haben. So geht es, wenn man an Bücher denkt. Ja, ich kannte ihn seinerzeit gut, den Gvendur, er saß immer über den Büchern, nie wollte er arbeiten, damit er und andere zu essen hätten, er war ein Schurke, und ich war nur ein dummes junges Ding. Er hauste dann in einer Hütte auf der anderen Seite des Gebirges, an einem anderen Fjord, und Gott strafte ihn mit einem undichten Dach und anderen Sachen. Da sieht er, was es ihm gebracht hat. Er saß in einer Lederjacke in seiner Stube, und das Wasser triefte auf ihn herab; es triefte und triefte, ein Tropfen nach dem anderen fiel auf seine Glatze, weil er nicht arbeiten wollte, damit er und andere zu essen hätten, zwei und zwei, liefen ihm am Hals hinunter, weil er immer über den Büchern gesessen hatte. Gott bestrafte ihn. Doch sein Herz war verhärtet und kannte keine Demut, und er schrieb weiter beim schwachen Schein einer trüben Lampe, hundert Bücher, zweihundert Bücher, und wenn er stirbt, dann kann man sich schon denken, wohin es mit ihm geht, denn Gott will nicht, daß Bücher über die Menschen geschrieben werden, Gott allein hat das Recht, über Menschen ein Urteil zu fällen, außerdem hat Gott selbst die Bibel geschrieben, das Buch, in dem alles steht, was geschrieben werden muß; die, die an andere Bücher denken, sitzen auf ihre alten Tage allein und arm unter einer trüben Lampe und werden vom Satan und seinen Teufeln bedrängt.
Doch die Geschichte hatte nicht die gewünschte Wirkung. Statt von dem Jungen als erbauliches Gleichnis aufgefaßt zu werden, begeisterte sie ihn als heimlicher Hinweis auf etwas Verbotenes und Verlockendes, seine Phantasie beschäftigte sich noch viel intensiver mit Büchern, nachdem er von der Strafe des einsamen Dichters und von seinen hundert Büchern gehört hatte. Oft überkam den Jungen das unbändige Verlangen, in hundert Büchern alles aufzuschreiben, was er sah, was die Leute sagten, in zweihundert Büchern, so dick wie Postillen, wie Bibeln, ganze Truhen voll. Er hieß Olafur Karason und wurde Oli oder Lafi genannt. Er steht an der Bucht. Dort waren auch eine Seeschnepfe und ein Strandläufer, sie trippelten einige Spannen weit den Sand hinauf, um den Wellen auszuweichen; wenn sich die Welle brach und wieder zurückströmte, legte sich ihre Franse um die dünnen Vogelbeinchen. Er trug immer Kleider, die die Brüder, die schon große Männer waren, abgelegt hatten. Der Hosenboden hing ihm bis unter die Kniekehlen herunter, und jedes Hosenbein war an die zehn Mal umgeschlagen, seine Jacke reichte bis weit über die Finger vor, er mußte ständig die Ärmel aufkrempeln. Er trug einen grünen Filzhut, der in seiner Jugend einmal ein Sonntagshut gewesen war, bevor Ratten sich über ihn hermachten; der ging ihm weit über die Ohren herunter, und die Krempe lag ihm auf den Schultern. Er beschloß, sich O.Karason Ljosvikingur zu nennen. Er redete sich selbst mit diesem Namen an und sprach viel mit sich selbst. O.Karason Ljosvikingur, da stehst du, sagte er. Ja, da stand er.
Seine Pflegemutter suchte in einer Kiste mit Krimskrams nach etwas, das vermißt wurde, und der Junge steht hinter ihr, als unter dem Plunder die Reste eines alten Buches zum Vorschein kommen.
Darf ich das haben? sagte O.Karason Ljosvikingur.
Nein, das darfst du nicht, sagte die Hausfrau Kamarilla. So etwas Abscheuliches.
Es gelang ihm aber trotzdem, an das Buch zu gelangen, ohne daß seine Pflegemutter es merkte, und er steckte es unter sein Hemd und verwahrte es an seiner Brust, dicht am Herzen. Er versuchte, heimlich darin zu lesen, doch es war in der alten Schrift gedruckt, und das Titelblatt fehlte. Jedesmal, wenn er glaubte, jetzt sei er drauf und dran, das Buch zu verstehen, kam jemand, so daß er das Buch schnell unter sein Hemd stecken mußte; er war oft in großer Gefahr. Was mochte in seinem Buch stehen? Er verwahrte sein eigenes Buch an seinem eigenen Herzen und wußte nicht, was darin stand. Er war dazu entschlossen, es zu verwahren, bis er groß geworden war. Aber dann fiel ein Blatt nach dem andern heraus, und es wurde um so schwieriger, es zu lesen, je länger er es auf der bloßen Haut mit sich herumschleppte, es war, als sei es in Fett gefallen. Oft juckte es ihn dort, wo er das Buch am Herzen trug, doch das machte nichts. Es war ein Geheimnis, ein solches Buch zu besitzen, es war im Grunde eine Art Zufluchtsort, auch wenn man nicht wußte, was in dem Buch stand. Er war davon überzeugt, daß es ein gutes Buch sei, und es machte Spaß, ein Geheimnis zu haben, wenn es nichts Böses ist, man hat tagsüber etwas, an das man denken kann, und nachts träumt man davon. Aber am ersten Sommertag wurde das Geheimnis entdeckt. Die Hausfrau Kamarilla ließ ihn frische Unterwäsche anziehen nach dem Winter, das geschah mitten am Tag im oberen Stockwerk, und er war nicht darauf vorbereitet. Er zog seine Kleidungsstücke aus, eines nach dem anderen, sein Herz schlug sehr heftig, schließlich zog er das Hemd aus. Da war es nicht mehr möglich, das Buch zu verbergen. Es fiel auf den Boden.
Hat man da noch Worte, sagte die Pflegemutter. Gott sei mir gnädig, was für ein Teufelszeug hat dieses Kind unter dem Hemd versteckt? Komm her, Magnina, und sieh dir dieses Unglück an.
Der Junge stand splitternackt und voller Angst vor ihnen, und sie untersuchten das Buch genau.
Wer hat dir dieses Buch gegeben?
Ich habe es eigentlich ge-gefunden.
Ja, das kann ich mir denken, nicht genug damit, daß man ein Buch hat, man hat es auch noch gestohlen. Magnina, wirf dieses gräßliche Zeug sofort ins Küchenfeuer.
2
Andere Kinder hatten Vater und Mutter und ehrten sie, und es ging ihnen gut, und sie lebten glücklich bis an ihr Ende, er jedoch war oft böse auf seinen Vater und seine Mutter und mißachtete sie in seinem Herzen. Seine Mutter hatte von einem anderen Mann ein Kind bekommen, und sein Vater hatte die Mutter verlassen, beide hatten den Jungen im Stich gelassen. Der einzige Trost war, daß er einen Vater im Himmel hatte. Und trotzdem; es wäre besser gewesen, einen Vater auf Erden zu haben.
Den ganzen Winter bis in den Frühling hinein wurde über seinen Vater im Himmel vorgelesen, abends aus den Erbauungsschriften, sonntags aus der Postille. Seine Pflegemutter setzte eine feierliche, eisige Miene auf und begann zu lesen; sie sprach schleppend und zog die letzte Silbe vor jeder Pause in die Länge, als ob eine Saite schlaff würde, es erinnerte an ein Lied, das als Weinen endete; so ging es immer wieder von neuem los; dann war die Andacht zu Ende. Das hatte nichts mit dem Alltag zu tun, und im übrigen schien niemand auf dem Hof Gott zu lieben oder sich etwas von ihm zu erwarten, nur O.Karason Ljosvikingur. Die Burschen legten sich hin während der Andacht, und manchmal traten sie einander mit den Füßen und zischten sich Flüche zu, denn jeder der beiden fand, daß ihm der andere im Weg sei; die Frauen starrten mit großen Augen ins Leere, als ob dieses ganze Gerede über Gott sie nichts anginge. Doch die Sehkraft der Pflegemutter ließ allmählich nach, und der kleine Oli war erst knapp neun Jahre alt, als man ihn bei der Andacht vorlesen ließ, wenn auch nicht an hohen Festtagen. Zum Teufel auch, was dieser verfluchte Bengel da zusammenstottert, sagten die Brüder mitten in der Andacht, als ob er dafür verantwortlich wäre, was der Mann in der Postille da hatte drucken lassen. Es stimmte allerdings, daß er nie den schleppenden Tonfall seiner Pflegemutter erreichte, geschweige denn die seltsame Miene, die sie dabei aufsetzte. Doch er verstand Gott, und außer ihm gab es hier auf dem Hof niemanden, der Gott verstand, und wenn die Erbauungsschriften langweilig waren und die Postille noch viel langweiliger, so machte das nichts, denn O.Karason Ljosvikingur lernte Gott nicht durch eine Erbauungsschrift oder Postille kennen, nicht durch ein Buch oder eine Lehre, sondern auf andere, merkwürdigere Weise.
Er war nämlich noch keine neun Jahre alt, als er seine ersten religiösen Erlebnisse hatte. Er steht vielleicht unten an der Bucht, und es wird allmählich Frühling, oder draußen auf der Landzunge westlich der Bucht, und dort ist ein Hügel und oben auf dem Hügel ein leuchtend grüner Grasbuckel, oder vielleicht droben am Berghang oberhalb der Hauswiese, und auf der Hauswiese stand üppiges Gras, bald würde es gemäht werden. Da ist ihm, als sehe er das Antlitz Gottes vor sich. Er spürt, wie sich das Göttliche mit einem unbeschreibbaren Klang in der Natur offenbart, das war der Klang der Offenbarung der Kraft des Göttlichen. Und mit einem Male ist er selbst zu einer zitternden Stimme in diesem herrlichen Klang der Allmacht geworden. Es ist, als wolle sich seine Seele über den Körper hinaus erheben, wie aufgeschäumte Magermilch über den Rand einer Schüssel; es war, als fließe seine Seele in das unermeßliche Meer eines höheren Lebens über den Worten, jenseits aller Wahrnehmung; der Körper durchdrungen von einem brandenden Licht, über allen Lichtern; seufzend machte er sich klar, wie klein er war inmitten dieses unendlichen herrlichen Klangs und Lichts; sein ganzes Bewußtsein mündete in eine einzige, heilige, tränenreiche Sehnsucht danach, in diesem Höchsten aufgehen zu dürfen, nichts mehr für sich selbst zu sein. Er lag lange im Sand, oder im Gras, und vergoß heftig schluchzend Tränen des Glücks im Angesicht des Unaussprechlichen. Gott, Gott, Gott sagte er zitternd vor Liebe und Ehrfurcht und küßte die Erde und bohrte seine Finger in die Grasnarbe. Er fühlte sich auch sehr wohl, nachdem er wieder zu sich gekommen war; er blieb liegen; er lag in stiller Verzückung, und es schien ihm, daß nie mehr ein Schatten auf sein Leben fallen könne; daß alles Unglück nur Staub sei; daß nichts mehr ihm je etwas anhaben könne; daß alles gut sei. Er hatte das Eine geschaut. Hier im Norden am äußersten Meer hatte sein Vater ihn an sein Herz genommen.
Niemand auf dem Hof ahnte, daß der Junge in direkter Verbindung zu Gott stand, und niemand auf dem Hof hätte es verstanden. Alle auf dem Hof hörten weiter das Wort Gottes aus einem Buch. Nur er wußte, daß diese Menschen Gott nie verstehen würden, selbst wenn sie tausend Jahre lang sein Wort hörten, und Gott würde vermutlich kaum darauf verfallen, sie an sein Herz zu nehmen. Der Junge las aus der Postille vor, und die Leute starrten vor sich hin und kratzten sich und nickten ein und hegten keinen Argwohn gegen ihn, sondern glaubten, er wisse nicht mehr über Gott als sie selbst.
Man pflegte ihm mehr Arbeit aufzubürden, als er bewältigen konnte. In dem Winter nach seinem zehnten Geburtstag mußte er das Wasser für das Haus und den Kuhstall tragen. Er war schmalbrüstig, schwächlich und blaß, hatte blaue Augen und rötliche Haare. Er bekam sehr selten genug zu essen, hatte aber nicht den Mut, aus der Speisekammer zu stehlen wie die Jungmagd Jana, die sich einiges erlauben konnte, weil sie eine Mutter hatte und außerdem schon den Brüdern heimlich Blicke zuwarf. O.Karason Ljosvikingur war sehr ehrlich, weil er niemanden hatte, der zu ihm hielt. Oft bekam er sein Essen erst, wenn die anderen schon gegessen hatten und wieder hinausgegangen waren, denn er gehörte zu niemandem, und alle, die einmal Kinder gewesen sind, wissen, daß es eine schwere Prüfung ist, warten zu müssen, bis die anderen fertig sind, und nichts sagen zu dürfen, denn er durfte nichts sagen, weil er niemanden hatte, der zu ihm hielt. Doch manchmal konnte es vorkommen, daß Magnina, die Tochter des Hauses, ihm das gab, was sie übriggelassen hatte, wenn alle hinausgegangen waren, und oft verbarg sich in ihrer Schüssel ein guter Bissen, auch wenn keiner gesehen hatte, wie er dort hineingelangt war. Im übrigen aßen die Leute, die etwas zu sagen hatten, meist heimlich zwischen den Mahlzeiten.
Das Wasserholen: Nach den beiden ersten Eimern ist der Junge schon sehr müde, aber das ist erst der Anfang. Er trägt und trägt. Er muß zwei Fässer füllen und außerdem zwei Eimer für die Schafböcke. Es dauert nicht lange, und er fängt an zu schwanken, die Knie und Arme zittern vor Schwäche. Oft ist schlechtes Wetter, Schneegestöber, eisiger Regen, Sturm. Der Wind reißt an den Eimern, es ist, als ob sie sich mit ihm in die Luft erheben wollten. Aber er erhebt sich nicht in die Luft. Er stellt die Eimer hin, während der Windstoß vorübergeht. Er versucht, mit seinen kalten Fingern, die ganz gefühllos sind von den Eimerhenkeln, den alten grünen Hut besser unter dem Kinn festzubinden. Er bittet Gott, ihm die Kraft der Allmacht zu verleihen, doch Gott hat keine Zeit, ihm zu antworten. Weiter, weiter, noch zwanzig Mal muß er den Weg gehen. Es schwappt aus den Eimern über seine Füße, bis zu den Knien hinauf, er ist ganz durchnäßt, und es herrscht Frost. Er fällt auf dem Glatteis hin und verschüttet das Wasser aus beiden Eimern. Es fließt unter ihn und über ihn. Er beginnt zu weinen, doch er weint nur für sich allein, es kümmert niemanden, was mit ihm geschieht, ihm kommt es vor, als ob die Welt sich an ihm rächen wollte für etwas, das er gar nicht getan hat, vielleicht dafür, daß seine Mutter außer der Reihe ein Kind geboren hat, oder dafür, daß sein Vater seiner Mutter davongelaufen ist. Und dann taucht zwischen Stall und Haus einer der Brüder auf und ruft: Hast du dich schlafen gelegt? Er steht auf, völlig durchnäßt im Frost, und rückt seinen alten grünen Hut zurecht, der verrutschte, als er hinfiel. So überstieg jeder Tag seine Kräfte. Morgens wachte er mit Angst in der Brust und Brechreiz im Hals auf, die göttliche Gnadenhand des Schlafs zog sich zurück, und der Tag lag vor ihm, mit erneutem Wasserholen, schlechtem Wetter, Hunger, Zittern vor Müdigkeit, Erschöpfung, Antreiben, Flüchen, Hieben, Tritten, Schlägen mit der Rute. Sein ganzes Leben als Kind war eine ununterbrochene Kraftprobe, wie im Märchen, wo Menschen mit Riesen und Drachen und Teufeln kämpften.
Manchmal wurde er sich ganz plötzlich dessen bewußt, gleichsam in einem tieferen Verständnis des Daseins, daß er nie eine Mutter hatte. Er hielt vielleicht mitten im Atemzug an, und es durchfuhr mit einem Schwindelgefühl sein Bewußtsein. Er war drauf und dran, alles, was er in Händen hielt, von sich zu werfen und loszulaufen, weg, weg, über Berge und Hochflächen, Fjorde und Täler, durch Landgemeinden und Fischerdörfer, bis er sie gefunden hätte. Doch seine Füße wollten sich nicht bewegen. Er mußte sich damit begnügen, sich an Gottes Brust zu lehnen. Und ganz unverhofft konnte es geschehen, daß Magnina ihm einen halben Brotfladen mit Butter gab. Manchmal, wenn er sich draußen abmühte und sie so dick und zufrieden im Haus in der Wärme der Stube saß, beschloß er, irgendwann einmal zu ihr zu gehen, sich an ihre Brust zu lehnen und zu weinen. Aber wenn er allein bei ihr in der Stube war, hatte er keine Lust dazu. Dann zweifelte er daran, daß sie eine menschliche Brust hatte. Sie hatte nämlich keinen Körper und schon gar keinen Leib, sie hatte einen Rumpf. Es ging ein Geruch von ihr aus. Sie war wie eine dreifache Mauer. Er sah sie an und dachte: Kann es sein, daß sich ganz, ganz innen eine Seele verbirgt?
Während der Fangsaison fischten die Brüder von den nächstgelegenen Fischerdörfern aus, manchmal einer, manchmal beide, und übernachteten dann auch dort. Die übrige Zeit gab es auf dem Hof Streit und Zwist, sie warfen einander Grobheiten an den Kopf, denn jeder der Brüder wollte allein das Sagen haben. Es wurde nie klar, wer der Hausherr auf dem Hof war, die Leute kamen und gingen, die einen halfen bei der Heuernte, die anderen bei den Arbeiten im Frühjahr, aber keiner wußte, wer der Hausherr war. Just fand, daß Jonas, der der ältere war, nicht genug Verstand habe, um die Wirtschaft zu führen, und Nasi fand, daß Just nicht alt genug sei, um die Wirtschaft zu führen. Der eine befahl, das nicht zu tun, was der andere angeordnet hatte. Zwar kam es im Beisein der anderen nur selten zu ernsten Handgreiflichkeiten zwischen den beiden, doch sie stießen oft Drohungen aus und warfen einander wenig liebevolle Blicke zu, so daß die christliche Bruderliebe durchaus größer hätte sein können. Die Hausfrau gab unklare Antworten, wenn von ihr eine Entscheidung verlangt wurde; sie hatte ihren Söhnen das väterliche Erbe nicht ausbezahlt; es geschah oft, daß Leute frühzeitig den Dienst quittierten. Die Magd Karitas und ihre Tochter waren die einzigen, die ohne Zusammenstöße mit der Hausfrau und ihren beiden Söhnen auskamen.
In dem Winter, als der Junge zehn Jahre alt war, geschah es eines Tages, daß er morgens die Pferde auf die Weide treiben sollte. Der Hund lief von hinten an eines der Pferde heran und biß es in die Ferse, das Pferd zuckte zusammen und schlug aus, und der Huf traf den Jungen, der schräg hinter ihm stand, am Kopf, an der Stirn oberhalb der Schläfe. Es war ein kräftiger Schlag, und der Junge ging bewußtlos zu Boden. Ein Mann von einem anderen Hof kam vorbei und fand den Jungen leblos auf dem Eis und glaubte, er sei tot, und trug ihn nach Hause. Doch er war leider nicht tot, sondern lebendig und kam wieder zu sich. Er war allerdings noch ganz benommen, sein Gedächtnis und sein Denken waren wie im Nebel, er wurde von schrecklichen Kopfschmerzen geplagt, war appetitlos und schwach. Er lag lange im Bett, und eine Zeitlang war niemand wirklich böse zu ihm. Die Brüder wünschten ihn über eine Woche lang nicht zum Teufel, die Pflegemutter nannte ihn armes Kerlchen. Eines Tages gab Magnina ihm einen Brotfladen mit Butter, einfach so zwischen den Mahlzeiten, als sei das ganz selbstverständlich, und setzte sich zu ihm und las ihm aus einem Buch vor, das sie sich irgendwo ausgeliehen hatte, es waren Gedichte. Er verstand es nicht, doch das machte nichts; wichtiger war, daß er jetzt wußte, was für ein Mensch dieses dicke, schwerfällige Mädchen eigentlich war.
Doch im Laufe der Zeit fiel man wieder in die gewohnte Sinnesart zurück, und die Leute äußerten sehr vernehmlich ihre Meinung über dieses Gemeindekind, das hier faul herumlag und krankspielte, während andere Leute sich für es abrackern mußten. Die Hausfrau Kamarilla schrieb dem Vater des Jungen, der in einem weit entfernten Fischerdorf wohnte, und verlangte mehr Geld für seinen Unterhalt. Dann konnte der Junge wieder aufstehen und begann aufs neue mit dem Wasserholen. Er hatte oft unerträgliche Schmerzen im Kopf, aber es hörte niemand mehr auf das Gefasel von einer Krankheit, es ging schon auf das Frühjahr zu, und man hatte viel Arbeit, mußte die Schafställe ausmisten, den Mist mit Pferden auf die Hauswiese transportieren und ihn zerkleinern. Er hatte fast nie Zeit, Verbindung mit Gott aufzunehmen.
Nun hatte Magnina Geburtstag, und O.Karason Ljosvikingur war fest dazu entschlossen, es ihr zu lohnen, daß sie im Winter so gut zu ihm gewesen war. Er verfaßte ein Gedicht über sie. Er nahm bekannte Strophen zum Vorbild und versuchte, sowohl schöne Umschreibungen als auch ein kunstvolles Versmaß zu verwenden. Unter anderem standen in dem Gedicht diese Zeilen:
Der Sonnenpaare Feenflügel,
feinster Span der Wonnehügel.
Er war so stolz, als er das Gedicht verfaßt hatte, daß ihm alles zwischen Himmel und Erde möglich schien. Er war davon überzeugt, daß sich in dem Gedicht ein dichterischer Sinn verbarg, auch wenn es an der Oberfläche schwer verständlich war. Er näherte sich Magnina mit klopfendem Herzen, als sie mit ihrer Mistharke draußen auf der Hauswiese stand, er fragte hastig, ob sie ein Geburtstagsgedicht hören wolle, und verschluckte sich dabei. Sie hörte auf mit dem Hacken und sah ihn verwundert an. Sag es noch einmal auf, sagte sie dann. Er sagte es noch einmal auf. Sie schniefte laut, drehte sich um und hackte weiter. Nein, sie dankte ihm nicht dafür. Er wollte gehen. Hör mal, sagte sie, sag es noch einmal auf. Er sagte es noch einmal auf. Ich glaube, du spinnst, sagte sie. Wer ist der Wonnehügel Span? Bin ich das? Man konnte sofort erkennen, daß sie nichts von Dichtung verstand. Sie war mehr als doppelzüngig. Wahrscheinlich hatte sie nur zu ihrem eigenen Vergnügen gelesen, als sie im Winter vorlas. Wahrscheinlich hatte sie ihm den übriggebliebenen Brotfladen mit Butter nur gegeben, weil sie ihn selber nicht mehr aufessen konnte. Eigentlich sollte ich dich verprügeln, sagte sie, tust so, als ob du dichtest, ohne zu wissen, was es bedeutet, wer weiß, womöglich hast du irgendeinen Fluch auf mich gedichtet. Er fing an zu weinen und antwortete: Du darfst es nicht meiner Pflegemutter sagen. Pfui, sagte sie.
Er war feuerrot vor Scham, und es war ihm, als könne er sein Leben lang nie mehr irgendeinem Menschen unter die Augen treten. Hätte er nicht schon längst wissen können, wie sie war? Brauchte es mehr, als sie anzusehen, wie sie auf der Hofwiese stand, das Kopftuch hinter die Ohren gerutscht, mit blauroten Wangen und verschwitzt, den Rock geschürzt und mit herabhängenden Strümpfen, und der kleine Hund nieste, wenn er in ihre Nähe kam. Wie um alles in der Welt konnte er darauf verfallen, sie der Wonnehügel Span zu nennen?
Am Abend hatten alle das Gedicht gehört. Alle waren sich einig gegen den Dichter, jeder auf seine Weise.
Dieser Bengel, führt schon unanständige Reden, sagten die Brüder.
Ja, und gotteslästerliche, sagte die Magd Karitas. Sie fangen wahrhaftig früh an, diese Unglücksraben.
Er tut nur so, als ob er es gedichtet hätte, sagte das Mädchen Jana, aber er hat es natürlich irgendwo gehört und gestohlen.
Wenn ich jemals wieder merke, daß du hier in meinem Haus den Verseschmied spielst, dann ist dir die Rute sicher, sagte seine Pflegemutter. Und jetzt bekommst du von mir eine Woche lang nichts zum Brei dazu, damit du lernst, daß alle Dichter verfluchte Schurken und Verbrecher sind, mit Ausnahme des seligen Hallgrimur Petursson.
Nur Magnina sagte nichts, sie war damit zufrieden, daß sie die Strophe auswendig gelernt und die ganze Sache ins Rollen gebracht hatte.
Am Abend ging Jana hinunter zum Melken; es wurde schon dunkel; der Junge saß fast unsichtbar vorn neben der Treppe und aß seinen dünnen Brei, und sie ging an ihm vorbei; seine Pflegemutter saß weiter innen an ihrem Fenster und strickte. Doch als Jana an ihm vorbei hinunterging, blieb sie auf der obersten Stufe stehen und beugte sich zu ihm hin.
Hör mal, Lafi, kannst du eine Strophe über mich dichten? flüsterte sie ihm heimlich zu.
Er gab keine Antwort.
Na? sagte sie. Nur eine?
Er beugte sich über seine Suppe und schwieg beharrlich.
Eine ganz kleine? flüsterte sie bittend und kam ganz dicht an ihn heran, als wollte sie in ihn hinein; sie hatte hervorstehende Augen.
Sei still, sagte er und fing an zu weinen.
3
So vergingen die Jahre, ohne daß sich das Verhältnis zwischen dem Alter des Pflegekindes und der Arbeit, die ihm aufgebürdet wurde, verändert hätte. Im Sommer wurde er mit den Erwachsenen um halb fünf geweckt und mußte genauso lange auf der Heuwiese arbeiten wie die kräftigsten Knechte. Er sagte, er habe schreckliche Kopfschmerzen, aber bei Leuten, die eine Entschuldigung für ihre Faulheit suchen, nimmt das Nörgeln kein Ende. Die Brüder gaben ihm abwechselnd entgegengesetzte Befehle, der eine drohte, ihn umzubringen, wenn er etwas ungetan lasse, der andere sagte, das Freundchen wisse, was ihn erwarte, wenn er es tue, und das Mädchen Jana lachte. Da nannten sie einander Lügner, Dieb und Schürzenjäger. Jana lachte und lachte und hielt zu keinem und zu beiden. Es konnte so enden, daß die Brüder sich gegenseitig verprügelten, statt O.Karason Ljosvikingur umzubringen; dann herrschte eine Zeitlang Ruhe. Im Winter wurde er nach dem Siebengestirn geweckt, um in den Kuhstall zu gehen. Für die Arbeit im Kuhstall brauchte er fast den ganzen Vormittag. Er hatte nämlich eine große Abneigung gegen Kuhmist und wollte weder selbst damit in Berührung kommen noch seine schlechten Kleider damit beschmutzen. Ständig ersann er neue Reinhaltungsmethoden, die ihn Zeit kosteten. Er erfand unter anderem eine Methode, den Mist in einem alten Eimer und mit Hilfe von Schnüren, die er an der Decke anbrachte, aus dem Stall hinauszubefördern; dabei schwebte der Misteimer unter das Dach des Stalls hinauf, doch entweder blieb er dort stecken, weil die Vorrichtung aus unerfindlichen Gründen nicht mehr funktionierte, und der Junge mußte viel Scharfsinn aufwenden, um den Eimer wieder herunterzuholen, oder die Schnur riß, und der Eimer plumpste mitten auf den Stallboden oder auf eine nichtsahnende Kuh oder auf den Erfinder selbst; seine Arbeitsweise im Stall wurde Faulheit, Bummelei, Herumtrödeln und ähnliches genannt.
Es kam immer seltener vor, daß Magnina, die Tochter des Hauses, ihm ein Stück Filetwurst oder saure Brust reichte, von Fladenbrot mit Butter ganz zu schweigen, denn er war kein Kind mehr. Ein großes Mädchen kann dies und das für ein Kind tun und vielleicht auch für einen erwachsenen Mann, doch mit einem heranwachsenden jungen Lümmel braucht man wahrhaftig kein Mitleid zu haben, weil er Magermilch, Brei mit Quark und saure Lungenstücke bekommt, von dem guten Fisch ganz zu schweigen, jedenfalls nicht mehr als mit anderen Leuten, die nicht zur Familie gehören. Und seine Pflegemutter, die Hausfrau Kamarilla, hatte fast ganz aufgehört, ihn zu schlagen, nachdem er dreizehn geworden war, und das war ein Zeichen dafür, daß er auch ihr gleichgültig war. Er wünschte sich oft, sie würde ihn ein bißchen schlagen, wie früher, und dann hinterher wieder ein bißchen gut zu ihm sein. Er wäre gestorben vor Verlassenheit und Elend, hätte das göttliche Allwesen ihn nicht gerufen, wann immer es Gelegenheit dazu hatte, und ihn gebeten, eins zu werden mit der strahlenden Herrlichkeit des Himmels und der Erde. Er versuchte, wann immer es möglich war, diesem Ruf zu folgen und seine Seele eins werden zu lassen mit höheren Welten, hinter der Welt. Er dichtete heimlich, seine erste Erfahrung mit dieser Betätigung hatte ihn klug gemacht, er nahm sich vor, erst dann öffentlich zu dichten, wenn er groß war und sich in Gesellschaft guter und edler Menschen befand, von denen er glaubte, daß es sie irgendwo geben müsse. Aber er hörte deswegen nicht auf zu dichten, sondern er dichtete für sich allein. Manchmal schrieb er eine ganze Strophe aufs Eis. Er lernte alles auswendig, was er an Gedichten um sich herum hörte, und prägte sich alles ein, was mit Wissen zu tun hatte, und war fest entschlossen, dies alles später in Bücher zu schreiben - er hatte nämlich die Vorstellung, daß es zu wenig Bücher gebe auf der Welt und daß irgendwo auf der Welt ungeduldige Menschen gespannt darauf warteten, daß mehr Bücher geschrieben wurden.
Bald war es an der Zeit, ihn einsegnen zu lassen, und man gab ihm den Katechismus und befahl ihm, ihn zu lernen. Er mußte sich droben an den Tisch vor dem Fenster setzen, und das Buch wurde vor ihn hingelegt. Auf der anderen Seite des Tisches saß seine Pflegemutter und paßte genau auf ihn auf; sie achtete darauf, daß er weder nach rechts noch nach links schaute, nicht nach oben und nicht nach unten, sondern genau geradeaus auf die Buchstaben. Versuchte er, ein klein wenig den Hals zu recken, um sich Erleichterung zu verschaffen, oder das Kopfweh abzuschütteln, wenn er das Gefühl hatte, er werde jetzt gleich in Ohnmacht fallen, dann hieß es, er lasse den Blick in alle Richtungen schweifen oder glotze überall herum wie ein Idiot, oder sieh nur einer an, wie er jetzt seine Augäpfel verdreht; er ist für alles gleich ungeeignet, geistige wie körperliche Arbeit.
Der Gott des Katechismus, das war nicht der Gott der Verzückung und Vision, sondern der alte Bekannte aus der Postille, und dem Jungen fiel es schwer, ihn zu verstehen und sich für ihn zu interessieren. Magnina sollte ihn abhören. Man mußte alles auswendig hersagen können. Es bestand die Gefahr, daß Gott ein Loch bekam, wenn man ein Wort ausließ. Man durfte auch nichts über Gott fragen, denn Gott mag kein Quengeln - ich bin dein Gott, sagt er, was willst du noch mehr?
Im Katechismus stand unter anderem: Schlechte Behandlung von Tieren zeugt von einem grausamen und gottlosen Herzen. Er glaubte, das isländische Wort Ill, Schlechte, sei die Zahl 111 und leierte herunter: Hundertelf Behandlung von Tieren zeugt von einem grausamen und gottlosen Herzen.
Und weiter? sagte sie.
Muß es nicht die hundertelfte Behandlung von Tieren heißen? fragte er.
Doch, sagte Magnina, die hundertelfte Behandlung von Tieren, das hast du doch schon gesagt. Mach weiter.
Wie ist die hundertelfte Behandlung von Tieren? fragte er.
Was? sagte sie. Hat man dir nicht schon oft gesagt, daß du nicht nach dem fragen sollst, was göttlich ist. Das tun nur Dummköpfe. Die hundertelfte Behandlung von Tieren. Also, mach weiter.
Aber die Sache kam ihr doch etwas verdächtig vor, sie runzelte die Stirn und schaute angestrengt in das Buch. Sie war nicht ganz zufrieden und achtete gar nicht darauf, daß er schon weitermachte mit dem Aufsagen, und unterbrach ihn sogar.
Die hundertelfte Behandlung ist natürlich eine grausame und gottlose Behandlung, sagte sie. Das hättest du dir selber sagen können.
Was für eine Behandlung ist das? sagte er.
Das brauche ich dir nicht zu sagen, sagte sie. Mach weiter.
Er fuhr mit dem Aufsagen fort und leierte lange weiter, und sie kümmerte sich nicht darum, was er hersagte, sondern unterbrach ihn schließlich noch einmal.
Die hundertelfte Behandlung von Tieren ist zum Beispiel, wenn man vergißt, dem Hund zu fressen zu geben, sagte sie.
Die Kirche stand weiter draußen am Fjord, und im Frühjahr kamen die Kinder aus zwei Richtungen zum Konfirmandenunterricht beim Pfarrer, von weiter draußen und von drinnen.
Er hatte oft Magenbeschwerden und Kopfschmerzen, war blaß und müde, und wenn um ihn herum gesprochen wurde, dann wußte er nicht, worüber gesprochen wurde. Es gab noch mehr Kinder, die so dumm waren wie er, und die, die schnell begriffen, lachten manchmal laut über die, die langsam begriffen; das war ein Stich, schnell und schmerzhaft. Die, die schnell begriffen, hielten zusammen und verstanden einander. Die, die blaß und müde und kränklich und schwer von Begriff waren, hielten nicht zusammen und verstanden einander nicht. Manche waren groß und stark und hatten rote Backen und wußten eine Menge und sprachen viel, er konnte nicht sprechen. Sie lachten, er hatte Angst. Er konnte nicht spielen und konnte keine Kunststücke machen. Aber wenn er wieder allein war, glaubte er, alles zu können, was sie konnten, und sogar noch mehr. Wenn er mit anderen zusammen war, kam ihm alles wie in einem Nebel vor, es war nur dann hell um ihn, wenn er allein war. Er mußte den Abschnitt über die Behandlung von Tieren aufsagen.
Die hundertelfte Behandlung von Tieren zeugt von einem grausamen und gottlosen Herzen.
Wie? sagte der Pfarrer. Was ist denn das?
Das ist, wenn man vergißt, dem Hund zu fressen zu geben, sagte er.
Da lachte sogar der Pfarrer und dann alle anderen Kinder. Sie lachten weiter, bis zum Ende der Konfirmandenstunde, es war ein krampfhaftes Kichern, das nicht aufhören wollte, und er mußte diese Demütigung über sich ergehen lassen, naß von Schweiß und rot vor Scham, in einem weißen Nebel; was waren alle Schläge der Kindheit im Vergleich hierzu? Schließlich fing er an zu weinen. Da stutzten die anderen Kinder, und manche von ihnen hörten auf zu lachen. Der Pfarrer kam zu ihm und streichelte ihm die Wange und sagte, daß es jedem passieren könne, eine Frage über das Wort Gottes falsch zu beantworten, er sagte, das mache nichts, er sagte, er wisse oft selbst nicht, wie er Fragen über das Wort Gottes beantworten solle. Es war schon spät am Tag, die Kinder durften nach Hause gehen. Als sie draußen auf dem Hofplatz standen, wollten einige von ihnen zu ihm kommen, um wiedergutzumachen, daß sie gelacht hatten, und nett zu ihm sein; andere kamen, um ihn genauer nach der hundertelften Behandlung von Tieren zu fragen. Er wickelte seinen Katechismus in ein Taschentuch, setzte seine alte Mütze auf und gab keine Antwort, sondern machte sich auf den Heimweg. Sie lachten weiter und liefen hinterher und hänselten ihn, denn es macht solchen Spaß, die zu verspotten, die eigenartig und allein sind. Die Schar holte ihn auf der Kiesfläche östlich des Pfarrhofs ein. Nein, sie konnten ihn nicht in Ruhe lassen, sie wollten mit ihm sprechen, im Spaß und im Ernst, weil er so komisch war und das Christentum falsch verstanden hatte. Er setzte sich auf einen Stein und hielt seinen in das Taschentuch eingewickelten Katechismus fest umklammert. Da sagte eine Stimme: Schämt euch, Kinder, ihn nicht in Ruhe lassen zu können. Was hat er euch getan? Geht weiter und laßt ihn in Frieden.
Nach einer Weile waren sie fort, sie waren schon ein Stück ins Tal hineingegangen. Er stand auf und trottete allein hinterher. Da bemerkte er, daß zwei Konfirmandinnen vor ihm her gingen. Sie gingen Arm in Arm und schienen keine Eile zu haben, er wünschte, sie würden schneller gehen, denn er wollte sie auf keinen Fall einholen. Schließlich blieben sie stehen, schauten zurück und warteten auf ihn. Er sah nur die eine von ihnen. Das war Gudrun von Graenholl. Sie war es, die vorhin die Kinder von ihm weggejagt hatte, als sie ihn nicht in Ruhe lassen wollten. Er näherte sich ihnen und wagte nicht aufzublicken, doch er spürte, daß sie ihn ansah.
Das machte nichts, sagte sie.
Was? sagte er.
Ich meine, daß du eine falsche Antwort gegeben hast, es geben viele falsche Antworten, sagte sie. Und das macht nichts.
Sie wohnte nur ein kleines Stück fjordeinwärts, sie war schon bald zu Hause. Es gibt also trotz allem auf der Welt Menschen, die anderen helfen wollen, ganz ohne Grund, nur deshalb, weil sie von Natur aus gut sind. Er konnte nichts sagen, aber es war, als ob sein Kummer von der Güte in ihren Augen ausgelöscht würde.
Wo wohnt dein Vater? fragte sie.
Ich weiß es nicht, sagte er.
Und hast du etwa auch keine Mutter? fragte sie.
Doch, sagte er.
Wo ist sie?
Da hätte er fast wieder zu weinen begonnen, weil sie ihn so etwas fragte. Er glaubte noch immer nicht, daß sich jemand Gedanken darüber machen konnte, ob er, das Pflegekind auf Fotur unter Fotarfotur, Mutter und Vater habe. Doch als sie sah, daß ihm wieder die Tränen kamen, sagte sie schnell: Wenn du zu uns nach Graenholl kommen willst, dann werde ich Mutter bitten, dir etwas Gutes zuzustecken.
Er war ihr sehr dankbar, aber er wagte nicht, es ohne weiteres anzunehmen, er durfte auch nicht trödeln.
Ich weiß, es ist schrecklich, so ganz allein dazustehen, sagte sie, aber ich und Lauga, wir meinen es gut mit dir. Stimmt es nicht, Lauga? Meinen wir es nicht gut mit ihm?
Doch, sagte die andere Konfirmandin.
Wir werden immer zu dir halten, wenn die Kinder dich hänseln. Wollen wir das nicht tun, Lauga?
Doch, sagte Lauga.
Du brauchst es nur uns zu sagen, sagte sie, wenn dich jemand ärgert. Ich werde auch mit den Jungen fertig, mit jedem von ihnen.
Kurz darauf gaben sie ihm zum Abschied die Hand, bogen vom Weg ab und gingen am Fluß entlang aufwärts, ihre Höfe lagen oben am Berg. Sie vergaß, ihn noch einmal einzuladen. Er blickte ihr nach, wie sie wegging, groß und hell, ohne Kopfbedeckung und mit roten Wangen, sicheren Schrittes wie ein erwachsenes Mädchen. Sie schaute sich nicht nach ihm um. Sie und Lauga gingen immer weiter am Fluß entlang aufwärts. In seiner Vorstellung war sie von da an immer mit fließendem Wasser verbunden, und er warf sich am Flußufer nieder und rief Gott an. Gott, Gott, Gott, sagte er. Lange Zeit dachte er an keinen anderen Menschen mehr. Beim Konfirmandenunterricht oder in der Kirche nahm er keinen anderen Menschen wahr, andere Leute waren Rauch. Er spürte es jedes Mal, wenn sie sich bewegte, auch wenn er ihr den Rücken zukehrte. Er sah sie mitten am Tag über einen kleinen Bach springen. Sie; und das klare, fließende Wasser des zeitigen Frühjahrs; Sonnenschein. Ein anderes Mal spielten sie am Flußufer, alle Kinder, die Berge himmelhoch über der Gegend, auf der einen Seite der Fjord; Abend. Sie war erhitzt und rot im Gesicht wie ein erwachsenes Mädchen und hatte einen Knopf aufgemacht, und der Fluß strömte breit und ruhig dahin, die blonden Zöpfe waren ihr nach vorn auf die Brust gefallen, einer war halb aufgegangen, ihre Augen blitzten. Von einem der Höfe rief man den Kindern zu, sie sollten aufhören. Er ging allein nach Hause und rief Gott an. Es stimmte zwar, daß er der Abschaum der menschlichen Gesellschaft und unter dem Sklavenjoch war, ein Pflegekind, das niemanden auf der Welt hatte, daß er das Christentum zum großen Teil falsch verstand, aber was machte es schon, daß man ihn schlug und beschimpfte: Gott hatte ihm vieles geoffenbart. Keiner hatte mächtigere Empfindungen empfunden als er. Gudrun von Graenholl. Dann wurden sie konfirmiert. Manche von ihnen sahen sich erst nach zwanzig oder dreißig Jahren wieder, manche nie mehr. Sie sprach nur dieses eine Mal mit ihm.
4
Einmal im Februar zog ein Schneesturm auf. Es war Ebbe. Die Schafe weideten weit verstreut am Strand und auf den Schären, und der Junge wurde losgeschickt, um sie zusammenzutreiben. Nun war dies nicht das erste Mal, daß er vom Herumlaufen im Tang naß wurde, und auch nicht das erste Mal, daß die Winterkälte durch seine zerschlissene, dünne Jacke drang, doch diesmal war der Sturm besonders heftig und der Frost besonders streng. Und er war schon den ganzen Winter hindurch erkältet gewesen und hatte manchmal vor Heiserkeit kein Wort herausgebracht. Als er am Abend dieses stürmischen Tages hereinkam, war er krank. Zumindest sagte er, er sei krank. Er behauptete, er habe einen stechenden Schmerz im Rücken und schwitze und friere abwechselnd.
Das sind Wachstumsschmerzen, sagte seine Pflegemutter Kamarilla.
Es ist erstaunlich, was sich das liebe Herzchen alles einfallen lassen kann, sagte der Bruder Just.
In der Nacht sagte der Junge, er habe Stiche in der Brust und könne kaum atmen und sei schweißgebadet, und rief Gott an.
Hübsch zu hören, wie das liebe Herzchen mitten in der Nacht singt, sagte der Bruder.
Am Morgen, als die Brüder aufstanden, sagte der ältere, dies sei die neueste Masche, um nicht in den Kuhstall gehen und Kuhmist anfassen zu müssen. Aus dem Bett mit dir, du Teufel, sagte er, was wirst du schon krank sein. Doch die Pflegemutter Kamarilla legte ihre Hand an seine Stirn und spürte, daß sie sehr heiß war. Sie meinte, es sei das beste, dem armen Kerl zu erlauben, noch etwas liegenzubleiben.
So lag er da und schwebte zwischen Leben und Tod, und die Zeit verging, oder besser gesagt, die Zeit hörte auf zu vergehen. Tag und Nacht, Werktag und Sonntag wechselten einander nicht mehr ab, wie es der offizielle Kalender vorschrieb, es gab keine Grenzen mehr zwischen eins und zwei, das Schmale wurde breit, und das Lange wurde kurz, ganz von selbst und ohne triftigen Grund, das eine bezog sich nicht auf das andere, das Fieber verschob Leben und Empfinden in einen anderen Bereich, in dem alle Zeiteinheiten ausgelöscht waren, in dem keiner wußte, was er werden würde oder was als nächstes folgen würde, man war eine Mischung aus den größten Gegensätzlichkeiten des Daseins, man war Gott, man war die Ewigkeit, man war roter Funkenflug oder ein seltsamer Rhythmus, man war der Bach oder der Fluß oder ein Mädchen, man war eine Bucht am Meer, und dort war ein Vogel, man war der Teil der Hauswiesenmauer, von dem aus man zum Berg hinaufschauen konnte. Es ereignete sich ungeheuer viel, immer wieder etwas Neues, ohne Gesetzmäßigkeit. Ganz selten einmal wurde er an den Strand der Wirklichkeit gespült, doch immer nur für eine kurze Weile, er hatte gerade Zeit, sich darüber zu wundern, wie ruhig und ereignislos alles in der Wirklichkeit war. Er konnte nicht verstehen, daß Leute ein ganzes Menschenleben lang auf dieser langweiligen Ebene des Bewußtseins, die man Wirklichkeit nennt, leben konnten, wo ein Ding dem andern entspricht und die Nacht die Tage voneinander trennt und alles nach Gesetzen verläuft, und dies ist so, und jenes folgt auf dieses. Aber glücklicherweise glitt er wieder in den Bereich der Unwahrscheinlichkeit hinüber, wo niemand wußte, was auf dies oder jenes folgte, wo nichts etwas anderem entsprach, doch alles möglich war, insbesondere und vor allem das Unglaubliche und Unverständliche. Unversehens war sein Dasein wieder schwebende Sinnestäuschung und Trost und Funkenflug und Gott und Erlösung von der Wirklichkeit und vom menschlichen Lebenskampf und von menschlicher Vernunft und vom Leben und vom Tod.
Doch dann machte er eines Tages die Augen auf, und es war vorbei. Es war, wie wenn man auf gewöhnliche Weise aufwacht, ein Tag wie jeder andere und an der Dachschräge über ihm ein winziger Sonnenstrahl. Magnina wendet ihm den Rücken zu, beugt sich über eine Waschschüssel und ist dabei, sich zu waschen und zu kämmen; ihre äußeren Strümpfe reichten nur bis unter die Knie, sie hatten keine Strumpfbänder, und deshalb hingen sie an ihr herunter. Er wollte sich aufrichten, wie er es gewohnt war, aber er hatte keine Kraft, er konnte nicht einmal den Arm bewegen, es kostete schon unglaubliche Mühe, auch nur einen Finger zu bewegen, am besten sich gar nicht bewegen, nur diesen kleinen, freundlichen Sonnenstrahl an der Dachschräge ansehen! Doch er meinte, er müsse etwas sagen, er konnte sich undeutlich daran erinnern, daß etwas geschehen war, wußte aber nicht richtig, was er sagen sollte, und hatte eigentlich keine Lust, darüber nachzudenken, er war so müde, und es war so schön. Was war eigentlich geschehen? Es ist am besten zu warten. Also wartete er. Endlich war sie fertig mit dem Waschen, jetzt muß sie sich umdrehen. Dann drehte sie sich um. Sie war erst halb fertig mit dem zweiten Zopf. Sie schaute ihn an und sah, daß seine Augen offen waren.
Bist du denn wach? fragte sie und flocht weiter an ihrem Zopf.
Ja, flüsterte er.
Geht es dir wieder besser? sagte sie und nahm einen Strang des Zopfes in den Mund, während sie die anderen auskämmte.
Ja, sagte er.
Er wollte etwas fragen, fand aber nicht die richtige Frage und sagte nichts, weil er fürchtete, falsch zu fragen.
Gott sei Dank, daß du nicht bei uns gestorben bist, sagte sie.
Was? sagte er. Sterbe ich nicht?
Nein, sagte sie.
Ich glaubte es nur, sagte er entschuldigend - jetzt hatte er also doch falsch gefragt, und er bedauerte es sehr.
Wir glaubten wirklich, du würdest sterben, aber jetzt sehe ich an deinen Augen, daß du lebst, sagte das Mädchen.
Er sagte nichts mehr und war nicht sonderlich gerührt darüber, daß er nicht gestorben war, in Wirklichkeit war er ein wenig enttäuscht, trotz des Sonnenstrahls an der Dachschräge; die Welt der Wahrnehmung war unglaublich arm im Vergleich zur Welt der Sinnestäuschung.
Vielleicht möchtest du eine Tasse Milch, sagte Magnina. Schrecklich, wie dürr du geworden bist.
Sie holte angewärmte frische Milch und beugte sich zu ihm herab und hob seinen Kopf vom Kissen; der Geruch, der dem Halsausschnitt ihres Kleides entströmte, war derselbe Geruch wie früher. Ja, er bedauerte, daß er nicht gestorben war.
Dann erholte er sich wieder. Die Genesung ging allerdings sehr langsam vor sich, er aß wenig, schlief viel, aber wenn er wachte, dann waren seine fünf Sinne in Ordnung. Er war wieder auf dem Weg zum Leben, um noch eine Weile hier zu bleiben, genauso einsam wie zuvor, an demselben Ort der Welt, am äußersten Meer. Eine Zeitlang herrschte Frieden um ihn herum, während er wieder zu Kräften kam; niemand drohte, ihn zu verprügeln. Wenn er den Sonnenstrahl über sich an der Dachschräge betrachtete, wurde er manchmal von einer unnatürlichen Zuversicht ergriffen; die liebe Sonne, dachte er und fand, das Leben sei es wert, gelebt zu werden, und war Gott dankbar dafür, daß er die Sonne geschaffen hatte, damit sie auf den Menschen schien; die Tage wurden rasch länger. Er setzte sich in seinem Bett auf und betrachtete verzückt den Sonnenstrahl des Lebens. Wieder regten sich in seiner Seele die Klänge von einst, die er aus der Zeit, als er noch kleiner war, kannte, die Harfe der Allmacht. Er starrte lange vor sich hin, alles um ihn herum verschwand für den Augenblick, seine Seele nahm teil an diesem Konzert Gottes, hingerissen von Dankbarkeit, höher als Worte, mit einem Mal glaubte er, die Liebe Gottes selbst zu erleben, alles war vollkommen und gut. Er kam erst wieder zu sich, als Magnina dreimal seinen Namen genannt hatte.
Bekommst du einen Anfall? fragte sie.
Nein, sagte er.
Er legte sich hin und zog die ärmliche Bettdecke bis über die Augen herauf. Dann vergingen einige Tage, und die Offenbarung der Kraft des Göttlichen erklang weiterhin in seiner Seele, wenn er allein war mit dem Sonnenstrahl an der Dachschräge. Er bekam unverfälschte frische Milch, bisweilen sogar Fladenbrot und Butter. Keiner sagte, geh dorthin, oder mach jenes bei schlechtem Wetter, und der eine widerspricht dem andern, und ich werde dir alle Knochen im Leib brechen, wenn du dich davor drückst. Er wünschte sich und hoffte, daß er nicht allzu schnell gesund würde.
Doch nicht alle Tage waren Sonnentage, ganz und gar nicht, es gab auch Tage ohne Sonnenschein, ohne göttlichen Gesang, ohne Begeisterung, ohne tröstliche Erinnerung, ohne versöhnende Hoffnung, nur mit farbloser, alltäglicher Wahrnehmung, einer trübseligen Selbsteinschätzung, die sich am allermeisten vor dem ewigen Leben fürchtete, einem dumpfen Sehnen, das wie ein tiefer Schmerz war, nach etwas, das seine Seele vor der schrecklichen Unsterblichkeit retten könnte, die unausweichlich schien.
Er hatte schon längst die wenigen Bücher gelesen, in ihnen gab es nichts Neues mehr, mit Ausnahme der Geschichten von der Insel Felsenburg, die er seit Jahren nicht mehr zu erwähnen gewagt hatte, aus Angst vor Schlägen. Dieses Buch wurde in der Kleidertruhe der Tochter des Hauses aufbewahrt, und er hatte nur einige wenige Male den Einband des Buches sehen dürfen, nie aber das Innere. Und es war ein geheimnisvolles Buch, er hatte gehört, wie die Hausfrau Kamarilla ihre Tochter zurechtwies, weil sie nachts Licht brennen ließ, um darin zu lesen.
Ich möchte so gern ein Buch lesen, sagte er.
Hier gibt es keine Bücher, sagte sie. Keine solchen Bücher. Keine zum Lesen.
Aber die Felsenburggeschichten, sagte er, hoffend, daß sie einen einsamen Kranken, der dazuhin schon konfirmiert war, nicht in seinem Bett verprügeln würde.
Da wurde sie feierlich, legte den Kopf auf die Seite, kniff die Lippen zusammen und schaute streng auf ihre Stopfarbeit nieder- die Felsenburggeschichten, sagte sie. Ich kann dir nur sagen, daß das kein Unterhaltungsbuch ist. Das ist ein christliches Buch.
Das macht nichts, sagte er.
Macht das nichts? Natürlich macht das etwas. Es ist ein Buch über das Leben der Menschen auf Erden. Du bist so jung und könntest sündigen.
Ich bin konfirmiert, sagte er.
Ja, man kann ohne weiteres alle möglichen Leute konfirmieren, sagte sie. Aber ob das Verständnis für Jesus im Leben der Menschen in gleicher Weise wächst? Ich weiß nicht, welche Sünden ich möglicherweise begangen hätte, wenn ich ein solches Buch gelesen hätte, bevor ich es verstehen konnte. Wenn du größer bist, dann vielleicht.
Dennoch kam sie tags darauf mit den Felsenburggeschichten, mitten am Tag, als niemand in der Stube war. Die Erwartung in seinen Augen war wie ein Meer. Sie lächelte fast ein wenig über diese großen, sehnsuchtsvollen Augen, setzte sich auf seine Bettkante, öffnete das Buch. Schon an der Dicke war leicht zu erkennen, daß es ein überaus christliches Buch war, und trotzdem ging davon etwas aus, das das Herz mit Unruhe erfüllte und einen gespannt und ungeduldig machte.
»Ich, Eberhard Julius, erblickte das Licht dieser Welt im Mai 1706, während der großen Sonnenfinsternis, die damals eintrat und die meinen Vater, der ein wohlbemittelter Kaufmann war, wie andere in große Bestürzung versetzte.«
Unten ging jemand herum, und sie hörte sofort wieder auf mit dem Vorlesen, kaum daß sie richtig angefangen hatte. Ihr Gesicht hatte die dicken Backen und die unpersönlichen Augen eines Menschen, der äußerst selten versucht zu denken und äußerst selten versucht zu wagen und in dessen Seele ein Despot verborgen ist, der den Weg versperrt und jeden Erfolg verhindert, wenn es darauf ankommt und die Dumpfheit bemächtigt sich wieder des Fleisches, alltäglich und hoffnungslos.
Gott steh mir bei, ich glaube, ich bin verrückt, sagte sie, schlug das Buch zu und starrte einen Augenblick lang entsetzt auf den Einband, als ob dies ein Zauberbuch wäre, steckte es dann hastig unter die Schürze und ging.
Als er tags darauf das Buch erwähnte, wurde sie zornig:
Sei still, oder ich erzähle meiner Mutter davon, sagte sie.
Er wußte nicht, was er getan hatte, zweifelte jedoch nicht daran, daß es etwas Häßliches sei, und hatte Angst. Aber bald konnte er über andere Dinge nachdenken. Seine Pflegemutter, die Hausfrau Kamarilla, brachte ihm am nächsten Tag seine zerschlissenen Kleider, man hatte sie gewaschen und die Strümpfe gestopft, und als er in Ohnmacht fiel, legte sie ihm einen kalten Lappen an die Stirn und richtete ihn auf. Die Brüder waren auf Fischfang gegangen, da konnte er nicht mehr liegenbleiben. Ein paar Tage später wurde er schon wieder für die morgendliche Arbeit im Stall geweckt. Das Wasserholen fing wieder an, und er bekam wieder nasse Füße. Zu Ostern schneite es wieder. Jana und Karitas erzählten seiner Pflegemutter, er würde sich vor der Arbeit drücken. Doch manchmal gab Jana ihm ein lauwarmes Stückchen Zucker aus ihrer Bluse.
Magnina sagte lange Zeit nichts.