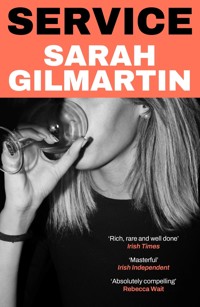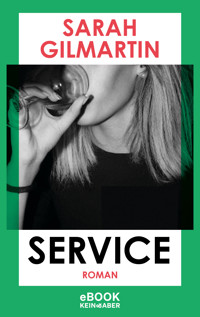
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Hannah von ihrer früheren Kellnerkollegin Mel gebeten wird, als Zeugin in einem Gerichtsverfahren gegen ihren ehemaligen Chef Daniel Costello aufzutreten, lehnt sie zunächst ab. Dem renommierten Sternekoch werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Trotz ihrer anfänglichen Weigerung, auszusagen, kann Hannah sich ihrer Vergangenheit nicht entziehen und entscheidet sich um.
Währenddessen ist Daniel fassungslos: Sein Restaurant wird geschlossen, die Anwälte sitzen ihm im Nacken, im Internet und vor der Haustür wird er attackiert. Jahrzehntelange harte Arbeit und all die Bemühungen, Anerkennung für sein Talent zu erlangen, sollen umsonst gewesen sein – wegen eines Vorfalls, an den er sich kaum erinnert.
Zugleich muss seine Frau Julie, bedrängt von Journalisten und Paparazzi, der Verunsicherung nachgeben und sieht sich gezwungen, ihre Ehe und ihr ganzes Leben infrage zu stellen. All die Jahre, in denen sie versuchte, eine unterstützende Ehefrau und eine gute Mutter zu sein, geraten plötzlich ins Wanken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
SARAHGILMARTIN ist Autorin und Journalistin. Ihre Kurzgeschichten wurden unter anderem bei The Dublin Review, New Irish Writing und The Tangerine veröffentlicht. Ihr Debütroman Dinner Party war auf der Shortlist für den Irish Book Award und den Kate O’Brian Award 2022. Mit Service erscheint bei Kein & Aber ihr erstes Buch in deutscher Übersetzung. Sarah Gilmartin lebt in Dublin.
Über das Buch
Eigentlich möchte Hannah nicht im Gerichtsverfahren gegen ihren früheren Chef Daniel aussagen. Dem renommierten Sternekoch werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Bisher hatte Hannah die Erinnerungen an ihre Zeit im Restaurant sorgfältig verdrängt und will zehn Jahre später die scheinbare Stabilität ihres Lebens nicht gefährden.
Während Hannah von der Vergangenheit eingeholt wird, ist der Angeklagte fassungslos. Wegen eines Vorfalls, dem Daniel kaum Bedeutung beimisst, ist er gezwungen, sein Restaurant im Zentrum Dublins zu schließen. Er sieht sich als Opfer von Rufmord durch eine Kellnerin, die es auf Schmerzensgeld abgesehen hat.
Zugleich muss sich seine Frau Julie, bedrängt von Paparazzi und dem drohenden Zusammenbruch der gemeinsamen familiären Existenz, der Frage stellen, ob Daniel der Mann ist, den sie zu kennen glaubte. Kann man einen Menschen, den man liebt, auf einmal verurteilen?
Sarah Gilmartin
Service
ROMAN
Aus dem irischen Englisch von Anna-Christin Kramer
What a trash To annihilate each decade.
Sylvia Plath, Lady Lazarus
HANNAH
Noch nie hatte ich mich so lebendig gefühlt wie in jenem Sommer. Lebendig, unentbehrlich, vollkommen abgehetzt. Jeden Abend bildete sich eine Schlange vor der Tür, manche Gäste reservierten ein Jahr im Voraus. Trendig nannten uns Leute in einem bestimmten Alter, worüber wir die Augen verdrehten, unauffällig natürlich, weil wir unser Trinkgeld nicht gefährden wollten.
Damals, als das Land noch dachte, es wäre reich, verlangte ständig irgendein dreister Gast mitten im Abendansturm einen Tisch, und die Diskussionen am Empfang trugen zur hitzigen Atmosphäre bei, zur glutheißen Energie, die durch den Laden fegte und uns sechs von sieben Abende die Woche auf Trab hielt.
Das Restaurant, nennen wir es T, befand sich in einem großen efeubedeckten Gebäude zwei Straßen entfernt vom Dáil, dem Unterhaus des irischen Parlaments. Wir bedienten Geschäftsleute, Politiker, Lobbyisten; Männer, die zu Steak und französischem Rotwein gerne eine Portion Neckereien serviert bekamen. Wir lernten schnell, Blödsinn über den Immobilienmarkt und den Boom zu schwafeln, obwohl wir eigentlich keine Ahnung davon hatten. Wir wussten bloß, dass wir einigermaßen gut bezahlt wurden, die Gäste Anzug trugen und manchmal unanständig viel Trinkgeld liegenließen.
Wir stellen nur Studentinnen ein.
Ihr seid nicht hirnlos.
Ihr seid nicht neugierig.
Ihr seid taktvoll.
Ihr wisst, worüber ihr redet.
Ihr könnt Châteauneuf von Côtes du Rhône unterscheiden.
Bouillon von Bouillabaisse.
Aus eigener Erfahrung lernten wir das jedenfalls nicht. Jeden Tag, bevor es losging, bekamen wir den gleichen Nudelauflauf mit zusammengefallenem Salat. Er war köstlich – er war umsonst.
Ich erinnere mich noch an die Hitze in der Küche, die riesigen Pfannen, in denen ab Mittag Butter brutzelte, wobei ich zum Glück hauptsächlich abends arbeitete, wenn die größeren Gruppen kamen. Flynn, der Barkeeper, erklärte fies grinsend: Du kriegst mit Sicherheit Cocktails und Abendschicht, und dann raunte er seinem kichernden Kollegen irgendwas mit Arsch zu. So war es damals in Irland, Ärsche statt Hintern, Cocktails statt Pints, schnelle Deals und leichtes Geld, Chancen, die Jahrzehnte – Jahrhunderte – gebraucht hatten, um nach unten durchzusickern.
In der Küche war es in diesem Sommer so heiß, dass man es schon im Durchgang auf der Bluse spürte, dem kleinen Bereich abseits des Speiseraums, der den Gästebereich mit dem hinteren Teil des Restaurants verband. Das hier war die Kommandozentrale, hier jagten wir Bestellungen durch die Computer, lästerten über Gäste und beschwerten uns über die Barleute, bei denen sich unsere Getränkebestellungen stapelten, weil sie sich lieber um ihr eigenes Trinkgeld kümmerten. Die Schwingtüren flogen auf, wenn Hilfspersonal mit vier Tellern – der erlaubten Höchstzahl – vorbeikam, und die Hitze schlug uns in kurzen, glorreichen Salven entgegen, die oft von Rufen der Köche begleitet wurden, die uns wiederum daran erinnerten, wer hier eigentlich das Sagen hatte, und schon rannten wir wieder zu den Tischen. Ja, Sir. Nein, Sir. Dürfte ich Ihnen Folgendes empfehlen, Sir. Die Abende glichen einer Show, vibrierten wie eine Liveaufführung.
Alles, was in Dublin Rang und Namen hatte, ging im T ein und aus, die Männer trugen Anzüge und offenen Hemdknopf, die Frauen steife Kleider und Fönfrisuren. Mit unseren geklammerten Pferdeschwänzen und flachen Gummisohlen konnten wir da nicht mithalten. Trotzdem blieben wir nicht unbemerkt.
Ein paar der Angestellten waren selbst berühmt. Jeder kannte Christopher, den Manager mit dem Londoner Gesicht, den hohen Wangenknochen und dem mühelosen Charme, der knapp an kriecherisch vorbeischrammte. Christopher-aber-Chris-reicht war ein angenehmer Chef, direkt und humorvoll, es sei denn, man war offensichtlich verkatert oder kam gewohnheitsmäßig zu spät. Es sei denn, man trat einem Gast zu nahe. Im T galt dieselbe eiserne Regel wie in allen besseren Restaurants: Der Gast hat immer recht.
Die Gäste kamen wegen der Atmosphäre, und selbstverständlich auch wegen der Küche. Dabei sahen sie allerdings nie die Wirklichkeit hinter den Schwingtüren, die vielgerühmten Männer in Weiß, unnatürlich konzentriert, mit erhitzten Gesichtern und durchnässten Haaransätzen, die zum Vorschein kamen, wenn sie am Ende der Schicht die Mützen abnahmen. Die einzigen Frauen in der Küche waren die polnischen Tellerwäscherinnen, die bei Hochbetrieb als Baristas einsprangen und sich weigerten, mit den Kellnern, die sie nicht leiden konnten, Englisch zu sprechen.
Die meisten Gäste kamen wegen des Küchenchefs Daniel Costello, der so begabt war, dass er keine Sterne nötig hatte (kurz nachdem ich dort aufhörte, bekam er allerdings seinen ersten, was sich anfühlte wie ein Schlag ins Gesicht). Er hatte zwei miteinander verfeindete Souschefs, die ihre Abneigung herunterschluckten, um mit ihm arbeiten zu dürfen, und dann kam der Rest des Teams – sechs, sieben Männer Mitte zwanzig, von denen jeder einen eigenen Posten an der durchgehenden Edelstahlarbeitsfläche hatte, die sich durch die gesamte Küche erstreckte. Sie bereiteten vor und kochten, brüllten und fluchten. In Sekundenschnelle richteten sie delikate Gerichte an, hörten Popklassiker im Radio oder ließen die prähistorische Stereoanlage über den Spülbecken auf voller Lautstärke laufen. Sie tranken literweise Cola aus Plastikbechern mit Eis, das innerhalb weniger Minuten schmolz. Eine von uns Kellnerinnen füllte nach, wenn gerade wenig los war. Wir kümmerten uns um sie, und sie kümmerten sich um uns – theoretisch zumindest. Aber eigentlich hielten wir uns von ihnen fern und betraten die Küche nur, wenn wir per Buzzer gerufen wurden. Sie lebten in einer anderen Welt, die man roch, sobald man nach hinten ging, sogar über Gewürze und Saucen und Abfalleimer hinweg. Talent und Testosteron. Wir hatten keine Chance. Wir waren kleine Fische – eine Hilfe, ein Hindernis, ein Nichts.
Das Servicepersonal stand am Ende der Nahrungskette, attraktive Barkeeper und Kellnerinnen, die den Gästen ein gutes Gefühl geben sollten, damit sie mehr Geld daließen. Optisch ansprechend. Diesen Ausdruck benutzten die Inhaber, ein Konsortium reicher Männer, die das Restaurant wie eine Nobelkantine behandelten und kamen und gingen, wie es ihnen passte. Optisch ansprechend. Das war ausdrücklicher Teil der Personalpolitik. In der Branche war das kein Geheimnis – man bewarb sich nur, wenn man die passende Figur und das passende Gesicht hatte. Eine Kellnerin Mitte dreißig wurde abgelehnt, obwohl sie jahrelange Michelin-Erfahrung vorweisen konnte. Angeblich würde sie nicht mithalten können. Nicht hier, nicht in diesem unfassbar angesagten Restaurant.
Bei meiner Bewerbung war ich mir also schon bewusst, dass ich optisch nicht gerade unansprechend war, aber ich dachte nicht groß darüber nach. Und im Anschluss an diesen Sommer, nachdem ich nicht mehr dort arbeitete, das heißt, nachdem ich gefeuert wurde, wollte ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken.
Noch bevor ich die Stelle bekam, war mir klar, dass die Arbeit im T Spaß machen würde. In der Stadt kursierten Gerüchte über großzügige Feierabenddrinks, einen Hilfskellner, der nebenbei Drogen vertickte, Sex auf den Toiletten, Privatpartys mit DJ Soundso. Wir fanden das unglaublich aufregend. Für Irland war es der reinste Wahnsinn.
Mein Vorstellungsgespräch fand mitten im Restaurant statt, an Tisch vier, wie ich später erfahren sollte, und dauerte etwa zehn Minuten. Zwei Männer mittleren Alters musterten meinen Lebenslauf und meinen Körper – so schamlos wie diese Maschinen am Flughafen –, während ich den Kellnerinnen an der Bar beim Serviettenfalten zusah. Ein stämmiger Barkeeper neckte ein Mädchen, das etwas jünger aussah als ich, indem er so tat, als wollte er den Stapel aus Stoffdreiecken mit seinem tätowierten Arm umstoßen. Damit war sofort Schluss, als Daniel Costello höchstpersönlich mit einer Schüssel Chips und einem Dip auftauchte, den anscheinend alle liebten. Mir fiel es schwer, seinen Bewegungen nicht zu folgen – dieses unheimliche Gefühl, wenn man Prominente im echten Leben sieht. Er war groß, fast schon hünenhaft, hatte beeindruckende Oberarme und zerzaustes Haar. Durch seine Anwesenheit schien die Luft im Raum dünner zu werden, die niedrige Decke wich ein Stück zurück.
Auf dem Weg zurück blieb er an unserem Tisch stehen, und ich mied seinen düsteren, umherstreifenden Blick, der nicht sonderlich an mir interessiert schien. Ich starrte auf die makellos weiße zweireihige Jacke, den akkuraten Stehkragen an seinem kräftigen, gebräunten Hals. »Lauter kleine Blondchen«, sagte er zu den Inhabern. Sie lachten und betrachteten mich dann kurz schweigend. Mir kam es vor, als würde ich jeden Moment zerfließen. »Seid nicht so streng mit ihr«, sagte Daniel und ging davon.
Nach ein paar oberflächlichen Fragen (Tipperary, einundzwanzig, BWL) bot der eine von ihnen mir die Stelle an, und ich sagte sofort zu, ohne mich nach dem Gehalt zu erkundigen, woraufhin der andere lachend auf den Tisch schlug und versprach, mir ein paar Sachen über das wahre Leben beizubringen.
Am darauffolgenden Dienstag hatte ich meine erste Anfängerschicht, bei der man erfahrenen Kellnern oder Kellnerinnen folgt und ihnen bei kleinen Aufgaben hilft, die sie einer Neuen für würdig halten. Fünf Stunden lang lief ich Tracy hinterher, einer schlanken, scharfzüngigen Rothaarigen aus Drogheda, wich ihr den ganzen Abend nicht von der Seite. Leicht war es nicht, auf all ihre Handgriffe zu achten, ohne die Gäste zu stören. Von Anfang an genoss ich das Gefühl der Zugehörigkeit, das die Uniform mir gab, die eng anliegende Bluse und der Bleistiftrock, die eleganten schwarzen Schürzen, die wir uns um die Hüfte banden und an denen wir die Buzzer befestigten.
Mir erschien es wie ein Privileg, an einem so offensichtlich luxuriösen Ort zu arbeiten. Die Leute, und damit meine ich die normalen Leute, kamen ein, zwei Mal im Jahr zu besonderen Anlässen ins Restaurant, aber ich hatte das Glück, sechs Abende die Woche dort zu verbringen. Der Laden war so schick, dass er fast schon heilig wirkte. Damals gaben sich Restaurants noch Mühe, und der Blick auf nackte Glühbirnen und frei liegende Ziegelmauern war Bauarbeitern vorbehalten. Alles war vornehm und poliert. Buntglasfenster in den Waschräumen, mit Samtkordeln abgesperrtes Elitengehabe im oberen Stockwerk. In einem fort wurde der Parkettboden am Empfang von den Gästen kommentiert, wie sehr er glänze, wie außergewöhnlich das Kirschholz doch sei. Ich lernte daraufhin zu erwidern, dass es sich bei dem Parkett um eine echte Antiquität handele, über hundert Jahre alt, Teil des ursprünglichen Gebäudes, einer ehemaligen Handelsbank, was bedeute, dass man hier nicht nur zu Abend aß, sondern auf historischem Boden speiste.
Der Gastraum erstreckte sich über zwei Etagen, Erdgeschoss und Galerie, und war mit weichem grauem Teppichboden ausgelegt – wunderschön und grauenhaft zum Cocktailstragen. Die Wände waren in einem helleren Grauton gestrichen und zeigten Gemälde irischer Künstler, von denen ich noch nie gehört hatte – Nano Reid, Robert Ballagh, eine riesige Leinwand mit eckigen Flächen in Herbstfarben von Sean Scully, von der jeder behauptete, sie sei ein Meisterwerk. Ich hatte keine Ahnung von Kunst. Ich hatte zwar drei Jahre in Dublin studiert, stammte aber aus Thurles, einer Stadt im Landesinneren, deren einziges Museum ein besseres Touristenzentrum war und eine nette Ausstellung zur Hungersnot beherbergte. Oft belauschte ich heimlich die Gespräche der Gäste, da mich die unterschiedlichen Reaktionen der reichen Geschäftsfuzzis interessierten, die Kunst anscheinend als Wettbewerb betrachteten. Wir haben einen Scully auf der Veranda, sagten sie zum Beispiel. Ich habe kürzlich einen fantastischen Le Brocquy ersteigert. Man wusste immer schon, was solche Leute bestellen würden – irgendein Teil vom Rind und eine Flasche mit Grand auf dem Etikett. Die Art Gast, dem die Herkunft des Gemüses wichtig und das Personal scheißegal war.
Die Bar aus Walnussholz bildete ein weiteres Gesprächsthema, Gläser und Flaschen, die von hinten in kühlem Rosarot beleuchtet wurden, und ein gigantischer getönter Spiegel, der dem Raum eine täuschende Tiefe verlieh. Oben gab es kleinere Bereiche, die ähnlich eingerichtet waren wie der Hauptgastraum, grauer Teppich, Leinentischdecken, eine lange Sitzbank an der Wand. Ich fand es toll, wie sich die Räumlichkeiten veränderten, während sich das Restaurant füllte, der Nachmittag in den Abend überging, das leise Summen der Vorbereitungen, das allmählich nachließ, bis man mittendrin steckte – bis wir am Rotieren waren, wie wir es nannten –, und der Lärm und die Hektik waren unglaublich.
Service!
Hinter dir!
Einmal durch!
Sieben anheizen!
Tisch zwei abräumen!
Tisch zehn eindecken!
Jeden Tag in der Pause zwischen Mittag- und Abendessen gab es eine Teambesprechung. Punkt halb fünf, Service und Küche, das Personal stand stramm. Je nach Daniels Laune kam entweder eine Weinverkostung auf uns zu, eine Besprechung der Tagesangebote oder ein Kreuzverhör über die aktuelle Karte. Welche Vorspeise enthält Nüsse? Wie viele Austern auf der Meeresfrüchteplatte? Was ist der Unterschied zwischen Scampi und Garnelen? Zwischen Jus und Velouté? Artischocken und Chayoten? Je nach Antwort bestanden oder Anschiss kassieren.
Während meiner ersten Besprechungen blieb ich als niedere Hilfskellnerin noch unbemerkt, doch ab Samstagnachmittag in meiner zweiten Woche fühlte ich mich nicht mehr sicher. Der Mittagstisch war chaotisch verlaufen. Die Gäste ließen sich nach dem Essen zu viel Zeit, die Bonmaschine klemmte, eine Flasche Montepulciano zerschellte auf der Theke. Daniel schimpfte, schaute allen nacheinander auf der Suche nach Ahnungslosigkeit in die Augen. Die Kellner verkaufen nichts, sagte er. Ein T-Bone-Steak. Ein tolles Stück. Was Besonderes. Was stimmte nicht mit uns? Er blitzte uns böse an, und nur Mel, die stilvolle Chefkellnerin, erwiderte seinen Blick mit klaren, ausdrucksstarken Augen.
»Es ist zu groß«, sagte sie, nachdem er sich abgeregt hatte.
Daniel wandte sich ihr zu. Er trug ein Polohemd, hielt die muskulösen Unterarme vor der Brust verschränkt. Mel fuhr fort, und seine Knöchel traten hervor, seine Haut spannte am Bizeps.
»Niemand will ein halbes Kilo Steak«, sagte sie. »Am besten bietest du es für zwei an.«
»Bist du jetzt unter die Köche gegangen?«, fragte Daniel. »Christopher, hast du noch eine weiße Jacke?« Dann wandte er sich an seine Untergebenen, die sich unter dem Bogen zum Durchgang aneinanderdrängten und darauf warteten, zu ihren Vorbereitungen in die Küche zurückzukehren, der wahren Aufgabe des Restaurants. »Weiß steht ihr bestimmt gut, oder, Jungs?«
Höhnisches Gejohle ertönte, verstummte unter Mels Blick jedoch rasch.
»Wie du meinst, Daniel«, sagte sie. »Deine Entscheidung. Aber du hast recht, das verkauft sich nicht. Nicht mal an den Bankertischen. Die haben alle das Filet genommen.«
»Wir könnten immer noch den Preis senken«, meinte Christopher.
»Auf gar keinen Fall!«, schoss Daniel zurück. »Bist du verrückt geworden? Dieses Stück Fleisch. Dieses wunderschöne Stück.« Wieder blitzten seine Augen. Seine schmelzbraunen Augen, wie Tracy sie am Vorabend nach vier, fünf Gläsern Wein bezeichnet hatte. Wir waren nach unserer Schicht mit einer anderen Kellnerin, Eve, in einer Absturzkneipe in der Montague Lane gelandet, in der Gastroleute durch den Nebeneingang reindurften. Ich war kurz vor der Arbeit mit einem Höllenkater aufgewacht und hatte nicht mal mehr Zeit zum Duschen gehabt.
Christopher hob die Hände.
»Verkauft es einfach, Mädels«, mahnte Daniel nicht allzu schroff. »Und zwar so, als würde euer Job davon abhängen.«
»Wie viele müssen wir absetzen?«, fragte Christopher.
»Acht. Und zwar heute Abend. Okay?« Daniel nickte Mel respektvoll zu.
Sie nickte ebenfalls, und wir machten es ihr nach.
Daniel wandte sich der Tafel zu, um den Rest der Tageskarte durchzugehen. Er erzählte gerade was von Tiefe und Sauce und Milchkälbern, da fingen auf einmal meine Beine an zu zittern. Ich wollte mich einfach nur hinsetzen, mich mit dem Personalessen trösten, das immer auf die Teambesprechung folgte – die sahnige Nudelsauce, das Salz.
»Du«, sagte Daniel. »Verkauf mir das Kalb.«
Es dauerte eine ganze Weile, bis mir klar wurde, dass damit leider ich gemeint war. Ich schaute auf den Teppichboden und hoffte, er würde jemand anderen aufrufen. Ich war noch nicht mal Kellnerin. Ich konnte niemandem irgendwas verkaufen.
»Du!« Er winkte mit beiden Händen.
Ich spürte, wie mir der Mageninhalt aufstieg.
»Kalb«, sagte ich nutzlos.
»Und?«
Alle Blicke waren auf mich gerichtet. Christopher wirkte nicht im Geringsten, als wollte er mich retten. Tracy zuckte mit den Schultern und studierte ihre Fingernägel.
»Die Tiefe«, sagte ich. »In der Sauce.«
»Scheiße, wollt ihr mich eigentlich verarschen?« Daniel ging in die Luft, stieß eine lange Reihe Schimpfwörter aus, die für sich genommen beeindruckend gewesen wären, sich aber nicht sonderlich gut anfühlten, wenn sie einem wie Schrotkugeln ins Gesicht geschossen wurden.
Mel stellte sich vor mich. »Schon gut, Daniel, wir haben es ja verstanden.«
Daniel stürmte davon Richtung Küche, gefolgt von seiner Mannschaft.
»Danke«, sagte ich zu Mel. »Vielen Dank.«
Kopfschüttelnd zeigte sie auf die Toiletten. »Geh dich frisch machen«, sagte sie.
Manchmal machte es auch Spaß im Restaurant – alles andere wäre gelogen –, und es gab zahlreiche nette Menschen.
Mel, meine Retterin mit dem wissenden Blick und den langen schwarzen Haaren. Aus mir unerfindlichen Gründen hatte sie Christopher-Chris in ihrer Macht und konnte sagen, was immer sie wollte. Es lag nicht nur an ihrem Dienstalter – zwischen den beiden herrschte ein rätselhafter Code, den sie manchmal anwandte, um den Stress und den ruppigen Umgang im Service zu entschärfen.
Rashini am Empfang, ein ehemaliges Model aus Sri Lanka, die vier Sprachen beherrschte und unablässig lächelte. Sie arbeitete sich in ihrer Freizeit durch eine Liste von Romanklassikern, die sie früher immer in dem vergoldeten Stand am Empfang versteckt hatte, bis sie eines Abends von einem Gast angebrüllt wurde, weil sie seinen Mantel nicht schnell genug holte. Wenn er eine Bibliothekarin bräuchte, würde er in die scheiß – er war so betrunken, dass er den Satz nicht zu Ende brachte.
Vincent, der sarkastische Sommelier, der den Ausdruck Teambesprechung nicht leiden konnte, weil es Geschäftsjargon sei, und wir sollten es beim Namen nennen, nämlich tägliches Zusammenstauchen für die Fehler vom Vorabend vor versammelter Mannschaft.
Da war Jack aus Cork, mein Lieblingsbarkeeper, der die Drinks immer rechtzeitig fertig hatte und unseren furchtbar dringenden Forderungen humorvoll und mit seelenruhiger Anmut begegnete. Er erzählte schlechte Witze in Singstimme und flirtete schamlos mit den älteren Damen auf der anderen Seite der Theke, obwohl er ungemein und ausdrücklich schwul war.
Thiago, der brasilianische Hilfsbarkeeper, der von São Paulo nach Gort und dann von Gort nach Dublin gezogen war, nachdem seine Freundin Zwillinge zur Welt gebracht hatte. Sie hatten den beiden irische Namen gegeben, damit sie unter ihren zukünftigen Klassenkameradinnen nicht weiter auffallen würden, und niemand brachte es übers Herz, ihm zu sagen, dass 2007 war und Máire und Gráinne ihm vermutlich nicht dankbar sein würden, wenn sie in einem Meer aus Chloes, Nicoles und Isabelles aufwuchsen.
Tracy und Eve, so wie ich Studentinnen am Trinity College kurz vorm vierten Jahr und ähnlich geblendet von der protzigen Erwachsenenwelt des Restaurants. Wir waren eine Gruppe. Zugezogene. Tracy aus Drogheda, Eve aus Galway. Wir passten in Teambesprechungen genau auf, nickten bei Speisen und Getränken, von denen wir noch nie gehört hatten, und flüchteten dann in die Gasse neben dem Restaurant, um stangenweise Marlboro Lights zu rauchen und Wörter wie Beluga und Tempranillo auf Eves Nobelhandy nachzuschlagen. Fast das gesamte Personal rauchte, auch die Leute, die sich für Nichtraucher hielten. Zigaretten waren Zauberstäbchen, die die Anspannung während der Schicht aufsaugten, eine Pause von dem Wahnsinn und der Hitze boten.
Und dann natürlich Daniel. Wir alle bewunderten ihn, sein Können, sein selbstbewusstes Auftreten, sein Haar, sogar das bescheuerte rote Tuch, das er manchmal während der Vorbereitungen auf dem Kopf trug. Wir hatten Ehrfurcht vor ihm, vor der Tatsache, dass ihn nichts zu interessieren schien bis auf das Essen. Seriöse Küche und Spaß dabei, diesen Traum verkauften wir im T, immer und immer wieder.
Drei zum Anrichten!
Service!
Hauptgang anheizen!
Daniel war ein menschliches Ausrufezeichen.
Service!
Testen!
Achtundfünfzig, verdammte Scheiße!
Schimpfwörter am laufenden Band.
Idiot!
Service!
Weib!
Scheißweib!
Die Beschimpfungen fielen im Laufe einer Schicht so häufig, dass sie fast an Bedeutung verloren hatten. (Siehe auch: Tut mir leid, Süße, Eifer des Gefechts.) Es war seine Küche. Er konnte praktisch tun und lassen, was er wollte, wobei ich glaube, dass mir das erst zum Ende hin richtig klarwurde.
Unter der Woche ging die Bewirtung früher los. Ältere Paare und Kulturfreaks bestellten von der Theaterkarte, mit der Punkt halb sieben Schluss war und keine Minute später, wie wir alle an dem Abend lernten, als Daniel einen Teller gedünsteten Spinat Richtung Eve schleuderte. (Sie duckte sich rechtzeitig – schnelle Reflexe sind in der Branche Pflicht.) Gegen halb zehn, zehn verabschiedeten sich die Gäste allmählich, und Christopher war in der Hinsicht ein Geschenk des Himmels, legte sanft die Rechnung ab, während er sich nach dem Wohlbefinden der Gäste erkundigte, und ohne unser Trinkgeld zu gefährden, schmiss er sie mit einer stillen Autorität raus, die uns völlig abging.
Am Wochenende war es andersrum, in den frühen Abendstunden noch ruhig – ab und zu ein Tisch für zwei, ein verspätetes Mittagessen, bei dem sich mit Kaffee und Drinks Zeit gelassen wurde –, und dann fielen so viele Leute auf einmal ein, dass man stundenlang nicht mehr auf die Uhr schaute.
Ein Trick bestand darin, die Tische zu staffeln, sodass sie einen nie gleichzeitig brauchten, aber in der Praxis funktionierte das nie – die Leute brauchen einen ständig, und unsere Aufgabe war es, zu allem Ja und Amen zu sagen. Ich lernte schnell, dass es am besten klappte, wenn alle Tische beim gleichen Gang waren. Weniger Wege in die Küche, zum Computer, sogar zur Bar, wenn man mit einem Tablett umgehen konnte. Ich hatte eine ruhige Hand und einen guten Gleichgewichtssinn. Während meiner Zeit dort verschüttete ich kein einziges Getränk, nicht mal einen von diesen in mühevoller Kleinarbeit zusammengemischten sonnenuntergangsfarbenen Cocktails. Am Wochenende flossen die Drinks in Strömen, und aus der Küche wurde unablässig Essen gefeuert, Teller um Teller, und wenn alles rundlief, glich es einem Ballett. Fünf Stunden Adrenalinrausch, und hinterher zählte man sein Trinkgeld und trat saftige zwanzig Prozent an die Hilfskellner, Tellerwäscher und Barkeeper ab. Anschließend ging man für eine dringend nötige Zigarette in die Gasse, setzte sich dann mit halb abgestreiften Schuhen an die Theke und kippte den Feierabenddrink runter, als wäre er Wasser.
Unser einziger freier Tag war Montag, wenn das Restaurant geschlossen hatte. Lichter aus, türkisfarbene Fensterläden zu, und sonntags bedeutete das normalerweise Feiern nach Dienstschluss. Wir bedienten uns am Alkohol, bis Christopher uns rausschmiss, zogen dann in die Absturzkneipe in der Montague Lane, tranken und tanzten bis in die frühen Morgenstunden und rissen alkoholisierte Männer auf, an deren Namen wir uns am Morgen nicht mehr erinnerten. Verschwommene Erinnerungen an Würstchen im Teigmantel und Energydrinks und lange, lichtdurchflutete Nachmittage auf der Couch in meiner Studentenbude in Islandbridge. Wenn meine Mitbewohner von ihren Sommerpraktika nach Hause kamen, saß ich im Schlafanzug vor einer Wiederholung von Nachbarn,konnte die Dialoge zur allgemeinen Erheiterung auswendig mitsprechen.
Egal wie stressig das Wochenende gewesen war, dienstags waren wir immer bereit für die neue Woche. Das war das Beste am Restaurant. Man konnte seine Tische auf null setzen, sein Trinkgeld, seine Fehler. Man konnte den Marinarasaucenfleck auf der Bluse auf null setzen. Man konnte die Blasen an den Füßen auf null setzen. Man konnte sein Leben auf null setzen. Alles, was in der vergangenen Woche passiert war, war vorbei. Niemand erinnerte sich an irgendetwas. Dafür gab es einfach zu viel zu tun, es war zu viel los.
Seit dem Anruf von Mel – ihre kühle, forsche Stimme, die sich mit der Zeit nicht verändert hatte – sind meine Sinne wieder wach, genau wie in jenem Sommer. Alles ist intensiver. Die Geschmacksnoten im Kaffee, der Duft von regennassem Gras, das Pochen in meinem Finger, den ich mir heute Morgen am Badezimmerschränkchen eingeklemmt, der Schmerzensschrei, den ich im leeren Haus ausgestoßen habe.
Ich frage mich, ob ich mein Leben die letzten zehn Jahre auf Stummschaltung verbracht habe. Der Gedanke ist mir nicht neu. Mein Ex-Mann Sam wollte das wissen, zum Ende hin immer öfter, wobei er nicht in der Lage war, es so wohlwollend zu formulieren. Wieso wollte ich nie irgendetwas? Damit meinte er eigentlich, wieso wollte ich ihn nicht? Letzten November trennten wir uns nach drei Ehejahren. Mein schlechtes Gewissen hat sich größtenteils gelegt. Wir sind Mitte dreißig, genug Zeit für einen Neustart. Wir haben keine Kinder, was entweder ein Segen ist oder der Grund für unsere Trennung, je nachdem, mit wem man darüber spricht.
Auf dem Weg zu meinem Treffen mit Mel im Café letzte Woche wurden mir auf einmal all die Dinge bewusst, die in meinem Leben fehlten, und es fühlte sich an, als würde ich bis in mein tiefstes Inneres durchleuchtet, so wie vor einem Klassentreffen, wenn man damit rechnet, sich für größere Zeiträume seines Lebens rechtfertigen zu müssen.
Ich ging von Harold’s Cross aus zu Fuß, von unserem liebevoll restaurierten Cottage aus, das bald wieder auf dem Markt sein wird, weil keiner von uns es sich leisten kann, es dem anderen abzukaufen. Während ich mir innerlich Vorwürfe für das selbst verschuldete Fiasko machte, verdunkelte sich der Himmel unter den hohen Bäumen entlang des Kanals, und ich schloss den Reißverschluss meiner Steppjacke, um mich vor dem Wind zu schützen.
Ich wusste, wieso sich Mel mit mir treffen wollte – sie hatte es am Telefon zwar nicht erwähnt, aber es bestand kein Zweifel, die sozialen Medien waren voll davon –, und ich wusste, dass ich ihr nicht würde helfen können, dass mir nach wie vor die nötigen Eigenschaften fehlten, um die richtige Entscheidung zu treffen, genau wie in jenem Sommer. Ich würde sie erneut enttäuschen.
Am Hafen von Portobello mischte ich mich unter eine Gruppe spanischer Studierender und tat so, als würde ich einen Schwan beobachten, der engelsgleich aus dem Wasser auftauchte. Mel saß im Café an der Brücke an einem Tisch im Freien. Leuchtend rosa Baskenmütze, die Haare immer noch schwarz, aber kürzer.
Sie stand auf, als ich mich näherte, also hatte sie mich vermutlich auch entdeckt. Aus der Ferne sah ich wahrscheinlich noch genauso aus wie damals – dasselbe bleiche Gesicht und dasselbe straßenköterblonde Haar –, ich trug sogar die gleiche Kleidung wie früher nach Feierabend. Ich wünschte, ich hätte hohe Schuhe angezogen, Ankle Boots oder Halbschuhe, bloß nicht die abgenutzten Chucks, die nun lauthals verkündeten, wie wenig ich mich weiterentwickelt hatte.
Ich winkte ihr zu.
»Hannah«, sagte sie. »Wie schön, dich zu sehen.«
Wir umarmten uns halbherzig und ungeschickt. Sie setzte sich und zog ihre Tasse näher zu sich. Überrascht stellte ich fest, wie gut ich mich noch an ihr Gesicht erinnerte, die nüchterne Schönheit ihrer Züge.
»Danke, dass du da bist«, sagte sie. »Möchtest du einen Kaffee? Kuchen?« Sie deutete auf eine Karte im Fenster.
»Willst du mir nicht die Tagesangebote verraten?«
Wir lachten.
»Du meintest das vielleicht als Witz«, sagte sie. »Aber ich bin immer noch im Geschäft.«
»Echt?«
Sie winkte dem Typ hinter der Theke durchs Fenster zu.
Wir warteten ewig auf den Kaffee, unterhielten uns gezwungen über unwichtige Themen. Ich erzählte ihr, dass ich die Buchhaltung einer Marketingfirma in der Stadt machte, freiberuflich und hauptsächlich von zu Hause aus. Sie schien das für einen tollen Job zu halten, und ich schaffte es nicht, sie zu korrigieren.
»Und bei dir?«, fragte ich.
»Gerade in einer Übergangsphase.«
»Verstehe.«
»Ich war zwei Jahre im Glasshouse, als Managerin.« Sie zuckte die Schultern. »Du weißt ja, wie so was läuft.«
Das stimmte, aber jetzt musste ich an Christopher denken. Sie schaute zur Brücke, und ich hatte den Eindruck, sie stellte sich ihn vielleicht auch vor. Ich wollte sie nicht fragen, nicht diejenige sein, die die Sprache auf das Restaurant brachte.
Unser Kaffee kam, und wir bedankten uns.
»Erinnerst du dich noch an Chris?«, fragte Mel.
»Klar«, sagte ich. »Christopher-aber-Chris-reicht.«
»Er ist wieder in London. Führt jetzt das Claridge’s.«
Ich lächelte. »Er war schon immer sehr von sich überzeugt.«
Sie prustete in ihren Latte, wobei kleine Schaumsprenkel auf ihrer Lippe landeten. Nachdem sie sich den Mund abgewischt hatte, war ihre Miene ernst, und sie zog eine Zeitung aus der Tasche. Noch bevor sie sie aufschlug, wusste ich, was als Nächstes kommen würde. Die Irish Daily Mail, auf deren Titelseite rechts eine schmale Spalte über einen Vergewaltigungsprozess abgedruckt war, der nächsten Monat im Central Criminal Court stattfinden würde. Der Aufmacher war ein Artikel über Wartelisten im Krankenhaus. SCHANDE stand dort in beunruhigendem schwarzem Fettdruck.
»Ach, Hannah«, sagte Mel. »Tut mir leid. Ich weiß, wie schwierig das sein muss.«
»Das hat nichts mit mir zu tun.« Ich umklammerte meine Tasse.
»Das stimmt nicht«, erwiderte sie sanft.
Sie sprach leise und bedächtig weiter, während ich meinen Kaffee trank. Sie redete über den Fall, erwähnte Einzelheiten, die ich nicht hören wollte. Wie die anderen Zeugen eingeschüchtert worden waren, wie diese einzelne Frau ihm jetzt allein gegenüberstehen musste. Ihm allein gegenüber. Das versetzte mich unmittelbar zurück ins Restaurant – in die leichenhallenartige Kammer mit dem klebrigen Boden und den Fleischhaken an der Decke.
»Hannah.« Sie berührte mich an der Hand. »Ist alles in Ordnung?«
Ich nickte. »Mel, ich kann dir nicht helfen. Oder ihr. Sag ihr, dass es mir leidtut, aber ich kann einfach nicht.«
»Ich hab dich doch noch um gar nichts gebeten.« Sie lehnte sich zurück und warf mir den eiskalten, hartherzigen Blick zu, an den ich mich noch gut erinnerte und mit dem sie selbst den reichsten Banker zum Verstummen brachte.
»Er kommt wahrscheinlich damit davon, Hannah. Seine Anwälte werden sie vernichten. Das machen die immer so. Holen sich Fotos von Facebook, quetschen Freunde nach schmutzigen Geschichten aus, finden nachtragende Expartner.« Sie erwähnte den Fall einer Frau, von der ich noch nie gehört hatte. »Während der Verhandlung haben sie ihre Unterwäsche beschrieben und behauptet, sie wäre sturzbetrunken gewesen. Haben sie als Nutte dargestellt.«
Das Wort prallte von unserem Tisch ab und landete im trüben Kanalwasser.
»Furchtbar«, sagte ich.
Sie wartete.
Ich sagte: »Hör zu, Mel, jetzt ist es zu spät. Das ist zehn Jahre her. Mir würde doch niemand mehr zuhören.«
Was ich nicht sagte: Ich will nicht, dass das mit mir passiert. Ich will nicht auf eine halbe Stunde im Zeugenstand reduziert werden, nach der sich alle nur an die Vorwürfe von losen Sitten, Alkohol und Drogen erinnern. Denn wenn man zu einer Sache Ja sagt, muss man wohl zu allem bereit sein.
»Bitte, Hannah«, sagte sie. »Denk wenigstens darüber nach. Die müssen wissen, wie es damals war.«
Wie sollte man einem Geschworenengericht das Restaurant erklären? Wie sollte man es sich selbst erklären? Rashini am Empfang wurde am schlimmsten von den Gästen belästigt. Männergruppen, die nach ein paar Pints bei O’Donoghue’s oder Doheny’s bemuttert, zugedeckt und geliebt werden wollten. Den Mantel abnehmen? Nimm mir ruhig gleich alles ab, Baby. Wie sie kicherten wie Schuljungs, wenn sie davonging. Wie sie einander für irgendeine langweilige, anzügliche Bemerkung auf den Rücken klopften, die Rashini schon hundert Mal gehört hatte. Wie sie ihr Verhalten mit ihrem Alkoholkonsum rechtfertigten. Vielleicht wurde ein Geburtstag gefeiert, ein massiver Deal, das Quartalsende. Solchen Männern standen ganze Kalender voller Ausreden zur Verfügung, und sie genossen das Privileg, sich aufzuführen, wie sie wollten, ohne dass jemand genauer hinsah.
Und die Barkeeper griffen ihnen dabei unter die Arme, was ihre Aufgabe war. Wie wärs mit einer Runde, während Ihr Tisch eingedeckt wird? Einmal musste ich einem Generalsekretär die Karte vorlesen, weil er es nicht über die Suppen hinausschaffte. Die schlimmsten Barkeeper – Flynn und Paulie – spornten sie auch noch an. Sie zwinkerten uns zu und taten so, als würden wir für sie arbeiten, obwohl es eigentlich genau andersherum war. Mel hatte ihren bösen Blick, mit dem sie sie in die Schranken wies, ohne dass die Gäste etwas mitbekamen, aber ich und die anderen Mädchen wussten uns nicht zu helfen. Wir nahmen es einfach hin, weil wir keine Zeit für Diskussionen hatten. Für viel Wirbel. Wir konnten es uns nicht leisten, dass sich unsere Getränkebestellungen stapelten, und Flynn war in der Hinsicht äußerst nachtragend – nach einer Beschwerde bei Christopher »vergaß« er immer wieder Eves Bons.
Rückblickend wirkt so viel von dem, was im Restaurant passierte, falsch, aber damals kam es einem in Ordnung vor, erträglich, zu schwammig, um sich Gedanken darüber zu machen. An einem beliebigen Abend bezeichneten die Gäste einen wahlweise als tolles Mädchen, Hingucker oder Hingucker mit Köpfchen, falls sie herausfanden, dass man studierte. BWL! Da müssen wir wohl bald aufpassen. Har-har-har. Wenn man höflichst und mit dem Trinkgeld im Hinterkopf versuchte, ihre Avancen abzuwehren, reichten die Reaktionen von harmlos über herausfordernd bis aggressiv.
Ein Mädchen wie du.
Dieser Satz fiel in allen möglichen Tonfällen.
Eines Abends, der Rest des Restaurants war schon leer, fragte Eve ihren Investmentbankertisch nach drei Runden Dessertwein, ob sie ihnen noch etwas anbieten könne. Vielleicht wirkte sie dabei freundlich. Vielleicht schwang Ungeduld in ihrer Stimme mit. Vielleicht klang sie sarkastisch, wie Christopher später befand, doch in jedem Fall hatte sie die Antwort nicht verdient. Du kannst mir einen blasen. Eve, meine Freundin mit den kurzen blonden Ringellocken und dem eigenartigen Gang, den die Barkeeper so gerne nachäfften. Sie war eins fünfundfünfzig und sah aus wie jemandes kleine Schwester.
Natürlich gab es auch nette Gäste, zahlreiche sogar, ernsthafte, rücksichtsvolle Leute, die essen und trinken und sich dann wieder dem Alltag zuwenden wollten, die einen menschlich behandelten, aber an die erinnere ich mich heute nicht mehr. Stattdessen ist mir der Mann im Gedächtnis geblieben, der sich zwischen seinen Sätzen die Lippen leckte und den leeren Brotkorb immer ans andere Ende des Tisches stellte. Der Mann, der meinte, ich solle für mein Trinkgeld singen. Der Mann, der mir das Hinterteil tätschelte, während seine Freunde schweigend zusahen.
Niemals werde ich den Schrank von einem Mann vergessen, der an einem hektischen Samstagabend – mein drittes Wochenende, ich hatte gerade erst mein eigenes Revier bekommen – aufstand, um mir zu sagen, ich sei hübsch, und mich auf den Mund zu küssen.
Du bist einfach so hübsch.
Seine warmen Hände hielten mein Gesicht in einem fleischigen Klammergriff. Er vollführte den Akt mit spaßhaftem Wagemut, und es dauerte nur wenige Sekunden, aber wenn ich einen Vorfall im T bestimmen, meine Zeit dort in Vorher und Nachher unterteilen müsste, in ein Geh-jetzt-oder-bereue-es-auf-ewig, dann wäre es dieser Kuss. So schmerzhaft klar nach so vielen Jahren: Bis dahin war ich unsichtbar gewesen, danach war ich es nicht mehr.
Was passierte als Nächstes? Nichts. Ich stürzte nicht aus dem Restaurant. Ich kündigte nicht. Ich forderte nicht einmal eine Entschuldigung. Ich hörte, wie an den Nebentischen gelacht wurde, als er losließ, und blieb wie angewurzelt stehen, knallrot vor Demütigung, bis Christopher wie von Zauberhand auftauchte, seine Nummer abspulte und mich davonführte.
Erst hinterher, als sich die Tische langsam auflösten, fühlte ich mich, als wäre mir Unrecht getan worden. Anscheinend stand es mir ins Gesicht geschrieben, als ich ein Tablett mit Espresso Martinis von der Bar holte, denn Flynn meinte, ich solle lieber mal lächeln. Ich fuhr ihn an, er solle sich um seinen eigenen Scheiß kümmern, woraufhin er erwiderte – ich erinnere mich noch ganz genau – Jetzt tu mal nicht so, als wärst du vergewaltigt worden. Die hässliche tätowierte Rose auf seinem linken Unterarm glänzte feucht. Ich schob das Tablett mit den Martinigläsern von der Theke und trug es zitternd durch das Restaurant zu Bank sechs. Eine Frau in einem hellblauen Kleid fragte, ob alles in Ordnung sei, und ich wusste, dass ich ihr nicht noch einmal in das liebenswürdige Gesicht sehen konnte, da ich sonst sämtliche Getränke verschütten würde. Die cremigen Kronen und der dunkle Alkohol würden sich über die Gäste ergießen, die Tischdecke, den teuren Teppichboden, vielleicht sogar die Wände. Der Schaden wäre unermesslich. Alles gut, antwortete ich und konzentrierte mich auf mein Tablett. Nachdem die Getränke verteilt und keine Wünsche mehr offen waren, ging ich zu den Toiletten, schloss mich in einer Kabine ein, sank auf den Boden und ließ mir den Rücken von der gefliesten Wand kühlen.
Als ich später mit meinem Feierabenddrink an der Bar saß, bemühte sich Flynn um eine Entschuldigung. Du bist noch neu, sagte er. So läuft es eben. Du musst dir das Trinkgeld verdienen. Er beugte sich über die Walnusstheke und raunte mir vertraulich zu, es wäre schlimmer, wenn die Gäste mich nicht mögen würden, und er schnitt hinter Mels Rücken eine Grimasse, die arme wunderschöne Mel, die nach seinem Ermessen langsam ein bisschen zu alt wurde.
Mel war diejenige, von der ich mir am meisten wünschte, sie hätte den Kuss gesehen, aber die anderen Kellnerinnen hatten nichts mitbekommen (oder gaben es zumindest nicht zu). Sie bemitleideten mich zwar nach Feierabend – wie ekelhaft, wie furchtbar usw. –, verstanden es aber nicht.
Am nächsten Tag brachte Mel es in der Teambesprechung zur Sprache, und Christopher pflichtete ihr bei, es sei nicht in Ordnung gewesen. Diese Typen, sagte er kopfschüttelnd. Flynn stieß einen bewundernden Pfiff aus, und Christopher meinte, er solle sich zusammenreißen, und zu mir sagte er, er würde versuchen, dafür zu sorgen, dass es nie wieder vorkäme. Mein Gesicht lief in irgendeiner heißen Farbe an, ich murmelte ein Dankeschön und ignorierte den schneeweißen Haufen grinsender Köche. Der Salattyp zwinkerte Daniel zu, der daraufhin Kurven mit den Händen beschrieb. Christopher sah es auch, schwieg diesmal jedoch.
Nach der Besprechung ging ich nicht mit den anderen zum Personalessen in die Küche. Stattdessen nahm ich die Servietten mit an Tisch dreizehn und faltete sie zu Dreiecken, suchte Trost in der monotonen Tätigkeit.
Ich war gerade zur Hälfte fertig, da stand plötzlich Daniel vor mir. Ich sah rasch auf, war immer noch nicht daran gewöhnt, ihn aus solcher Nähe zu sehen, obwohl seine Strahlkraft mittlerweile etwas nachgelassen hatte. Mit herausfordernder Miene wartete er darauf, dass ich sein Mitbringsel bemerken würde.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Für dich.« Er stellte einen Teller mit einem Stück glänzender Schokoladentorte auf den Tisch. Bei unseren Mahlzeiten gab es nie Nachtisch, und ich wertete es als eine Art Entschuldigung.
»Und jetzt lach mal wieder«, sagte er.
Ich strahlte ihn an, schob die Servietten beiseite und griff nach der Gabel. Denn damals war ich ein sehr fügsames Mädchen.
DANIEL
Grob gesagt, lassen sich Köche in drei Kategorien einteilen – Arbeiter, Künstler und Junkie –, und die besten von uns sind die perfekte Kombination aller drei. Wir fürchten den Tag, an dem das Adrenalin versiegt. Wir machen weiter, bis wir ausbrennen. Wir bleiben in der Branche, bis wir so alt sind, dass unsere Körper den Kick nicht mehr brauchen. Bis wir alte Männer sind, und so weit bin ich noch nicht.
Was soll ich jetzt mit mir anfangen?
Wohin soll ich gehen?
Was wird aus mir werden?
Julie hat mich nicht rausgeschmissen – in Krisensituationen war sie schon immer gefasst und verständnisvoll –, aber sie geht aus dem Zimmer, wenn ich reinkomme, und sie nimmt die Jungs überallhin mit. Ich sitze in meinem Sessel im Wohnzimmer, die Jalousien zur Hälfte heruntergelassen, und lausche den Reifen ihres Jeeps auf dem Kies, wie er meine Familie aus dem Haus bringt, das sich für sie nicht mehr wie ein Zuhause anfühlt.
Vier Schlafzimmer in Dalkey mit Blick aufs Meer, vor ein paar Jahren grundsaniert, nachdem Julies Mutter einen beiläufigen Kommentar zur Sauberkeit unserer Teppichböden fallengelassen hatte. Ihre Mutter, die seit Jahrzehnten in einer Sozialwohnung in der Bishop Street wohnt und uns nur besucht, um das Leben ihrer Tochter zu bemängeln. Jetzt habe ich ihr endlich einen Grund geliefert.
Julie erwähnte ihre Mutter nicht, als sie meinte, wir sollten das Haus wieder renovieren. Sie sagte, ihr sei langweilig und sie brauche ein Projekt, die Jungs seien nicht mehr so sehr auf sie angewiesen wie früher. Und es stimmt, je älter sie werden, desto weniger scheinen sie uns zu vertrauen. Unserem Rat, unserer Hilfe, egal was, abgesehen von unserem Geld. Siebzehn und fünfzehn, obwohl der Unterschied kaum wahrnehmbar ist, und ich mache mir Sorgen, dass Oscar zu früh erwachsen wird. Ich selbst war genauso, behauptete, ich stünde auf bestimmte Mädchen, um meine Brüder zu beeindrucken.
Kevin spricht nicht mehr mit mir. Er hörte von der Anklage, bevor wir es ihm selbst erzählen konnten. Ihm klarmachen konnten, dass dieser Hashtagblödsinn amerikanischer Scheißdreck ist, der sich nicht unter gewöhnlichen, anständigen Menschen ausbreiten wird. Er kam an einem Freitagnachmittag von der Schule nach Hause, ließ die Spurs-Tasche auf den Boden fallen und nannte mich einen Vergewaltiger. Das Gefühl werde ich nie erklären können. Als ich wieder atmen konnte, als der Schmerz in meiner Brust nachließ, setzte ich mich an den Küchentisch und versuchte, ihm alles zu erklären. Aber was soll man zu einem Teenager sagen? Irgendwann wird er die Wahrheit wahrscheinlich selbst herausfinden, wenn es nicht schon längst passiert ist – seit Menschengedenken fühlen sich Frauen zu einflussreichen Männern hingezogen.
Während ich ihm das auseinandersetzte, stand Julie an der Spüle; stocksteif und unbeirrt starrte sie aus dem Fenster aufs Meer.
Heute Morgen traf ich mich mit meinem beratenden Anwalt Roland in seiner Kanzlei am Fitzwilliam Square, und er stellte mir die Strafverteidigerin vor, die uns im Prozess vertreten wird, eine Ms Claire Crosby, ein bisschen zu jung für meinen Geschmack – kurzes Haar und schlanker, dürftiger Körper –, aber angeblich soll uns das vor Gericht nutzen. Bei Roland steht der äußere Anschein an erster Stelle. Er hatte vorgeschlagen, ich solle das Restaurant nicht schließen, das Geschäft weiterlaufen lassen und meiner Kundschaft weiter als Dublins bester Koch zur Verfügung stehen. Er erwartet, dass ich die Stellung halte, das süffisante Grinsen, die Blicke und Kommentare nicht beachte, denen ich jetzt schon ausgesetzt bin. Belassen wir es bei dem Befund, dass Roland Kinsella & Söhne nicht die geringste Ahnung haben, wie man ein Restaurant führt. Unser Reservierungsbuch sieht aus wie der Aufsatz eines Klassentrottels, seitenweise Streichungen und Absagen. Seit die Gerüchte in den sozialen Medien aufgekommen sind, bleiben achtzig Prozent der Gäste aus. Ein Herr von einem Hedgefonds, dessen Namen ich aus Rücksicht auf die mehreren tausend Euro verschweigen werde, die seine Firma im Laufe der Zeit in meinem Restaurant gelassen hat, wollte wissen, ob er seine Reservierung um vier Monate verschieben könne. Risikofreudig. Fast schon könnte man darin eine Unterstützungserklärung sehen.
Heute Morgen erklärte ich Roland, das Restaurant sei offiziell geschlossen. Der Anrufbeantworter, den niemand kontrollieren wird, ist eingeschaltet, die Kühlschränke geleert, die Geräte verstaut, die Messer ein letztes Mal gewetzt und die Fensterläden geschlossen.
Roland nahm die Neuigkeiten schweigend auf, faltete die Hände in seiner geistlichen Art und kippte mit dem Stuhl nach hinten, um den verschlossenen Park auf dem Platz zu mustern. Ein kalter Märztag, dichte Wolken jagten über den Himmel. Das Büro war zugig, die hohen Decken karg verziert.
»Dan, ich finde wirklich, du solltest den Laden offen lassen«, meinte er. »Ich kann dir am Wochenende einen Tisch bringen. Vier, vielleicht sechs Personen?«
Darauf folgten ein paar strenge Ratschläge, und die Falten seines alternden Gesichts troffen vor Ernsthaftigkeit. Ich schaltete auf Durchzug, während er eintönig vor sich hin näselte, und inspizierte das Mädchen, diese Claire, ihren beiseitegestrichenen Pony, das teure Kostüm, die aufrechte Haltung auf dem unbequemen Besucherstuhl. Eine solide sieben, unter entspannten Umständen womöglich eine acht. Mein Blick wanderte hinauf und traf ihren, und kurz blitzte ein verletzter Ausdruck in ihren Augen auf, bevor sie sich wieder fing. Ein knappes Lächeln auf den dünnen Lippen.
Nachdem ich die Aquarelle hinter Roland betrachtet hatte, die befriedigende Ordnung auf seinem Schreibtisch und den leuchtend grünen Lampenschirm, wurde ich von seinen Schuhen abgelenkt. Sehr zu meiner Beunruhigung erinnerten sie mich an meinen Vater, an den ich schon seit Jahren nicht mehr gedacht hatte. Er besaß nur ein Paar gute Schuhe – schwarze Halbschuhe, die er zu Hochzeiten und Beerdigungen trug, auch zu seiner eigenen. Ich weiß noch, wie ich nach seinem Tod danach suchte und mir dumm vorkam, als mein Bruder Rory erklärte, sie seien mit ihm verschwunden, wohin auch immer. Der Rest seiner Kleidung hing noch im Schrank meiner Eltern in unserem engen Reihenhaus, und in den Monaten nach seinem Tod rochen sie irgendwann nicht mehr nach ihm, sondern merkwürdigerweise nach meinem Großvater – dem Vater meiner Mutter –, was überhaupt keinen Sinn ergab. Ich war zehn, als mein Vater starb, und niemand sprach mit mir darüber; es hieß bloß, er sei jetzt bei den Engeln, an einem besseren Ort. Irgendwie ahnte ich, dass er sich diesen besseren Ort selbst ausgesucht hatte, weil es die einzige Möglichkeit war, unseren schäbigen Verhältnissen zu entkommen, und von da an verachtete ich unser Zuhause. Ich erfuhr erst Jahre später, mit fast zwanzig, wie er es angestellt hatte, und die Fragen und Erklärungsversuche meines jüngeren Ichs kamen mir müßig vor. Manchmal sterben Männer, weil sie es so wollen.
»Wenn Sie mich fragen«, sagte die Frau, »ich bin Rolands Meinung.« Ihre Stimme holte mich zurück ins Büro. Sie hatte verführerische Augenbrauen, natürlich hell und geschwungen.
»Das verstehe ich«, erwiderte ich. »Aber das Geld rinnt uns durch die Finger. Letzten Freitag hatten wir zwei Tische. Davon kann man keine Lieferanten und kein Personal bezahlen.« Von halsabschneiderischen Anwaltskosten ganz zu schweigen.
»Was ist mit Touristen?«, fragte sie. »Sie wissen schon – Foodies?«
Ich verzog kopfschüttelnd das Gesicht. Mir war klar, wie widerspenstig ich wirkte, aber ich konnte nichts dagegen tun. Völlig egal, ob die Gäste aus Ranelagh oder Reykjavík kamen, sobald sie das Restaurant googelten – um einen Tisch zu reservieren, die Adresse rauszufinden, Bewertungen zu lesen, was auch immer –, sprang ihnen sofort irgendein Mist aus den sozialen Medien entgegen und bestrafte mich dafür, dass ich es umbenannt hatte. Restaurant Daniel Costello. Hätte ich damals lieber auf Julie gehört und es bei T belassen.
»Das klingt nicht gut«, meinte Claire.