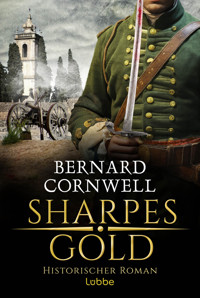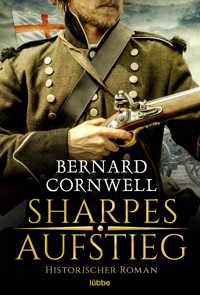
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Auch in Spanien sind die Winter kalt ...
1809. Bitterer Winter lässt den Norden Spaniens erstarren, und die britischen Truppen ziehen sich nach La Coruña zurück. Lieutenant Richard Sharpe und eine versprengte Abteilung erstklassiger Schützen sind auf sich allein gestellt, eingekreist von der siegreichen Armee Napoleons. Sie haben nur eine Chance, wenn sie sich Major Blas Vivar und seinen spanischen Aufständischen anschließen. Doch das hat seinen Preis, denn Vivar will die heilige Stadt Santiago de Compostela befreien, die von französischen Truppen besetzt ist. Sharpe und seinen Männern bleibt nichts anderes übrig, als einmal mehr ihren unbeugsamen Willen zu beweisen, um sich gegen die Übermacht durchzusetzen ...
Knisternd vor Spannung - meisterhaft schickt Bernard Cornwell seinen Helden in ein weiteres Abenteuer auf der iberischen Halbinsel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Weitere Titel des Autors bei Bastei Lübbe
Titel
Impressum
Widmung
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
HISTORISCHE ANMERKUNG
Über dieses Buch
1809. Bitterer Winter lässt den Norden Spaniens erstarren, und die britischen Truppen ziehen sich nach La Coruña zurück. Lieutenant Richard Sharpe und eine versprengte Abteilung erstklassiger Schützen sind auf sich allein gestellt, eingekreist von der siegreichen Armee Napoleons. Sie haben nur eine Chance, wenn sie sich Major Blas Vivar und seinen spanischen Aufständischen anschließen. Doch das hat seinen Preis, denn Vivar will die heilige Stadt Santiago de Compostela befreien, die von französischen Truppen besetzt ist. Sharpe und seinen Männern bleibt nichts anderes übrig, als einmal mehr ihren unbeugsamen Willen zu beweisen, um sich gegen die Übermacht durchzusetzen …
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist der Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 1980er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt. Im Herbst 2022 hat er nach mehr als fünfzehn Jahren Wartezeit für die Fans endlich ein neues Abenteuer von Richard Sharpe vorgelegt: Sharpes Mörder.
Weitere Titel des Autors bei Bastei Lübbe
Sharpes Feuerprobe
Sharpes Sieg
Sharpes Festung
Sharpes Trafalgar
Sharpes Beute
Sharpes Mission
Sharpes Trophäe
Sharpes Gold
Sharpes Flucht
Sharpes Weihnacht
Sharpes Zorn
Sharpes Gefecht
Sharpes Rivalen
Sharpes Degen
Sharpes Abenteuer
Sharpes Feind
Sharpes Ehre
Sharpes Geheimnis
Sharpes Triumph
Sharpes Rache
Sharpes Waterloo
Sharpes Teufel
Sharpes Mörder
Bernard Cornwell
SHARPESAUFSTIEG
Historischer Roman
Aus dem Englischen vonBernd Müller
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1988 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Rifles«
Originalverlag: Macmillan, London/Dutton, New York
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2011/2023 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven von © Collaboration JS/arcangel; © Formatoriginal/shutterstock
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-4821-6
luebbe.de
lesejury.de
Für Carolyn Ryan
PROLOG
Der Preis war eine Schatztruhe.
Ein spanischer Major bemühte sich, die Truhe zu retten, während ein berittener Jäger, Oberst der Kaiserlichen Garde Napoleons, Befehl erhalten hatte, sie zu erbeuten. Der Franzose war zu diesem Zweck von der Leine gelassen worden. Man hatte ihm zu verstehen gegeben, er dürfe töten oder vernichten, wen oder was immer sich ihm in den Weg stelle.
Die Schatztruhe war ein Behältnis aus Holz, so alt, dass es kohlschwarz glänzte. Das Holz wurde von zwei Eisenbändern gehalten, die trotz ihrer antiken Rostflecke noch recht robust waren. Die alte Truhe war zwei Fuß lang, achtzehn Zoll breit und ebenso hoch. Zwei Haspen waren mit Vorhängeschlössern aus Messing versehen. Die Öffnung zwischen gewölbtem Deckel und Unterteil war mit roten Siegeln verschlossen, einige davon so alt, dass sie inzwischen kaum mehr waren als Wachsspuren in der Maserung des uralten Holzes. Die Truhe war in ein Öltuch eingenäht, um sie vor der Witterung zu schützen, oder vielmehr, um das Schicksal Spaniens zu schützen, das darin verborgen lag.
Am zweiten Tag des Jahres 1809 wäre es dem französischen Oberst beinahe gelungen, die Truhe zu erbeuten. Man hatte ihm ein Regiment Dragoner unterstellt, und diese Reiter trafen nahe der Stadt Leon auf die Spanier. Die Spanier entkamen nur, weil sie sich hoch in die Berge flüchteten. Dort mussten sie ihre Pferde zurücklassen, denn keinem Pferd waren die steilen, eisglatten Pfade zuzumuten, auf denen Major Blas Vivar Zuflucht suchte.
Es war Winter, der kälteste spanische Winter seit Menschengedenken und der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, sich in den Bergen Nordspaniens aufzuhalten, doch die Franzosen hatten Major Vivar keine Wahl gelassen. Im Dezember hatte Napoleons Streitmacht Madrid eingenommen und Blas Vivar war knapp eine Stunde vor Ankunft der feindlichen Reiter mit der Truhe aus der Hauptstadt geflohen. Er wurde von einhundertzehn Cazadores begleitet, berittenen Jägern mit Kavalleriesäbeln und kurzläufigen Karabinern. Doch aus den Jägern wurden Gejagte, als Vivar auf seinem albtraumhaften Ritt durch Spanien eine Finte nach der anderen schlug, um seinen französischen Verfolgern zu entkommen. Er hatte gehofft, sich bei General Romanas Armee im Norden in Sicherheit bringen zu können, doch Romana wurde vernichtend geschlagen, zwei Tage ehe die Dragoner Vivar zur Flucht in die Berge zwangen. Nun war er auf sich allein gestellt, von aller Hilfe abgeschnitten. Er verfügte nur noch über neunzig Männer. Die anderen waren gefallen.
Sie waren für die Truhe gestorben, die die Überlebenden nun durch die gefrorene Landschaft trugen. Auf den Pässen sammelte sich der Schnee an. Wenn Tauwetter einsetzte, dann immer von Regen begleitet, einem alles durchdringenden, unablässigen Regen, der die Gebirgspfade in einen Morast verwandelte und in den langen Nächten beinhart gefror. Erfrierungen dezimierten die Cazadores weiter. In der schlimmsten Kälte suchten die Übriggebliebenen in Höhlen oder verlassenen Bauernhütten Unterschlupf.
An einem solchen Tag – der Westwind trieb bitterkalte Schneeflocken vor sich her – kauerten Vivars Männer im unzureichenden Schutz eines schmalen Geländeeinschnitts hoch droben auf einem Gebirgskamm. Blas Vivar selbst lag am Rand der Senke und starrte durch ein ausgezogenes Fernrohr ins Tal hinab. Dort unten lauerte der Feind.
Braune Umhänge verbargen die dunkelgrünen Uniformröcke der französischen Dragoner. Die Franzosen hatten Vivar jede Meile seines beschwerlichen Weges verfolgt, doch während er sich im Hochland abmühte, ritten sie durch die Täler, wo es Straßen gab, Brücken und Unterkünfte. An manchen Tagen hatte das Wetter die Franzosen aufgehalten, und er hatte gehofft, sie hinter sich gelassen zu haben, aber wenn der Schneefall für ein paar Stunden nachließ, tauchten die verhassten Gestalten jedes Mal wieder auf. Nun lag Vivar im bitterkalten Wind und beobachtete die feindlichen Reiter, wie sie in einem kleinen Dorf drunten im Tal absattelten. Die Franzosen würden im Dorf Herdfeuer und Nahrung vorfinden, ihre Pferde würden trockene Unterstände und Heu bekommen, während seine Männer am Berghang vor Kälte wimmerten.
»Sind sie da?« Vivars stellvertretender Kommandeur, Leutnant Davila, kam aus der Senke heraufgekrochen.
»Sie sind da.«
»Der Gardist?«
»Ja.« Vivar blickte unverwandt auf zwei Reiter auf der Dorfstraße hinab. Einer der beiden war der Oberst der Kaiserlichen Gardejäger. Er trug eine pelzbesetzte Pelisse, eine dunkelgrüne verschnürte Uniformjacke und einen Kolpak, eine runde Mütze aus dickem schwarzem Pelz.
Sein Begleiter war nicht uniformiert. Stattdessen trug er über seinen hellen Stiefeln einen schwarzen taillierten Reitermantel. Vivar fürchtete diesen schwarz gekleideten Reiter mehr als den Oberst, denn er war es, der die Dragoner führte. Dieser Mann wusste, wohin Blas Vivar unterwegs war, er wusste, wo er aufzuhalten sein würde, und er wusste auch von der Macht dessen, was sich in der eisenverstärkten Truhe verbarg.
Leutnant Davila kauerte sich neben Vivar in den Schnee. Wie Soldaten sahen sie beide nicht mehr aus. Sie waren in Umhänge aus gemeinem Sackleinen gehüllt. Gesichter, Stiefel und Hände waren mit Lumpen umwickelt. Doch unter ihren zusammengeflickten Mänteln trugen sie die grünen Uniformen einer Cazador-Eliteeinheit, und sie waren zäh und tüchtig wie kaum ein anderer, der in den Napoleonischen Kriegen kämpfte.
Davila lieh sich Vivars Fernrohr und starrte ins Tal hinab. Schneegestöber erschwerte die Sicht, doch er konnte den scharlachroten Farbfleck der Pelzjacke über der rechten Schulter des Jägers erkennen. »Warum zieht er sich keinen Mantel an?«, brummte er.
»Er will zeigen, wie hart er ist«, erwiderte Vivar schroff.
Davila schwenkte das Fernrohr herum und erblickte weitere Dragoner auf dem Weg ins Dorf. Einige der Franzosen führten lahmende Pferde. Alle trugen Säbel und Musketen. »Ich dachte, wir wären ihnen entkommen«, sagte er niedergeschlagen.
»Die werden wir erst los, wenn wir den Letzten von ihnen begraben haben.« Vivar zog sich hinter die Sichtlinie zurück. Sein Gesicht war von Sonne und Wind gezeichnet, ein kämpferisches Gesicht, dessen Grobheit von dunklen Augen gemildert wurde, die voller Humor und Verständnis funkeln konnten. Nun, da er seine Männer in der schmalen Senke zittern sah, waren sie rot gerändert. »Wie viel Proviant haben wir noch?«
»Genug für zwei Tage.«
»Wenn ich es nicht besser wüsste«, sagte Vivar mit einer Stimme, die im Heulen des Windes kaum zu vernehmen war, »würde ich meinen, Gott hätte Spanien im Stich gelassen.«
Leutnant Davila wusste darauf nichts zu erwidern. Ein Windstoß wirbelte den Schnee vom Bergkamm in einer glitzernden Wolke über ihren Köpfen auf. Die Franzosen, dachte er verbittert, würden sich unten im Tal an Nahrung, Brennholz und Frauen vergreifen. Kinder würden schreien. Die Männer des Dorfes würde man foltern, um ihnen zu entlocken, ob sie einen abgerissenen Trupp Cazadores mit einer Truhe gesehen hatten. Sie würden wahrheitsgemäß verneinen, doch die Franzosen würden sie trotzdem töten, und der Mann in Schwarz mit den hellen Stiefeln würde ohne das geringste Zeichen von Anteilnahme dabei zusehen. Davila schloss die Augen. Bis zum Beginn dieses Krieges hatte er nicht gewusst, was Hass bedeutet, und nun wusste er nicht, ob es ihm jemals gelingen würde, den Hass wieder aus seiner Seele zu verbannen.
»Wir teilen uns auf«, sagte Vivar unvermittelt.
»Don Blas?« Davila, dessen Gedanken weit fort waren, hatte nicht richtig verstanden.
»Ich nehme die Truhe und achtzig Mann«, sagte Vivar bedächtig. »Du wartest hier mit den restlichen Männern. Wenn wir fort sind und die Franzosen ebenfalls, wendest du dich nach Süden. Der Oberst ist klug und hat vielleicht längst erraten, was ich vorhabe. Deshalb musst du abwarten, Diego! Warte, bis du dir ganz sicher bist, dann warte noch einen Tag. Verstehst du mich?«
»Ich verstehe.«
Trotz seiner abgrundtiefen Müdigkeit und der Kälte, die ihm bis in die Knochen drang, brachte Vivar einen Rest von Enthusiasmus auf, der seinen Worten einen hoffnungsvollen Klang verlieh. »Geh nach Orense, Diego, und sieh zu, ob dort noch spanische Soldaten sind. Sag ihnen, dass ich sie brauche! Sag ihnen, dass ich Pferde und Männer brauche. Führe diese Männer und Pferde nach Santiago, und wenn du mich dort nicht antriffst, reite ostwärts, bis du mich findest.«
Davila nickte. Eine Frage drängte sich auf, aber er konnte sich nicht überwinden, sie zu stellen.
Vivar verstand trotzdem. »Sollten die Franzosen die Truhe erbeuten«, sagte er freudlos, »wirst du davon hören. Sie werden ihren Erfolg in ganz Spanien hinausposaunen, Diego, und du wirst davon hören, denn dann ist der Krieg verloren.«
Davila erschauerte unter seinen zerlumpten Umhängen. »Könnte es sein, Don Blas, dass Sie, wenn Sie sich nach Westen wenden, auf die Briten treffen?«
Vivar spuckte aus, um kundzutun, wie er über das britische Heer dachte.
»Würden sie Ihnen nicht helfen?«, beharrte Davila.
»Würdest du den Engländern anvertrauen, was in der Truhe ist?«
Davila überlegte sich seine Antwort, dann zuckte er mit den Schultern. »Nein.«
Vivar schob sich noch einmal hinauf, um ins Dorf hinabzustarren. »Vielleicht treffen diese Teufel auf die Briten. Dann kann ein Barbarenpack das andere umbringen.« Die Kälte ließ ihn erschaudern. »Wenn ich genug Männer hätte, Diego, würde ich die Hölle mit den Seelen dieser Franzosen füllen. Aber ich habe nicht genug Männer. Also hol sie für mich herbei!«
»Ich werde mein Bestes tun, Don Blas.« Mehr wagte Davila nicht zu versprechen, denn in diesen ersten Tagen des Jahres 1809 hatte kein Spanier Grund zur Hoffnung. Der spanische König befand sich in französischer Gefangenschaft, und in Madrid saß der Bruder des Franzosenkaisers auf dem Thron. Die spanischen Armeen, die sich im vergangenen Jahr so tapfer geschlagen hatten, waren von Napoleon vernichtend besiegt worden, und das britische Heer, das man ihnen zur Hilfe geschickt hatte, wurde schmählich in Richtung Küste zurückgedrängt. Spanien war nichts geblieben als die Überreste seiner aufgeriebenen Armeen, der Widerstandsgeist seines stolzen Volkes und die Truhe.
Am nächsten Morgen brachen Vivars Männer mit der Truhe gen Westen auf. Leutnant Davila sah zu, wie die französischen Dragoner ihre Pferde sattelten und ein geplündertes Dorf hinter sich ließen, aus dem Rauch in den kalten Himmel stieg. Die Dragoner wussten vielleicht nicht, wo sich Blas Vivar befand, aber der Mann im schwarzen Mantel mit den hellen Stiefeln wusste bestimmt, wohin der Major unterwegs war, und darum lenkten die Franzosen ihre Pferde in westliche Richtung.
Davila wartete einen ganzen Tag ab, dann machte er sich nach Süden auf, inmitten eines Regengusses, der den Schnee zu Matsch und jeden Pfad in einen zähen Morast verwandelte.
Jäger und Gejagte hatten sich erneut in Bewegung gesetzt und schlichen auf verschlungenen Pfaden durch ein winterliches Land. Die Gejagten hofften auf ein Wunder, das Spanien retten und aus der sicheren Niederlage noch einen glorreichen Sieg machen würde.
KAPITEL 1
Über einhundert Männer wurden im Dorf zurückgelassen. Ihnen war nicht zu helfen. Sie waren betrunken. An die zwanzig Frauen blieben bei ihnen. Auch sie waren betrunken.
Nicht nur betrunken, sondern regelrecht bewusstlos. Die Männer waren in den Lagerraum einer Taverne eingebrochen und hatten dort große Fässer mit neuem Wein vorgefunden, mit dem sie ihr Elend ertränkten. Nun, in der grauen Morgendämmerung, lagen sie im Dorf verstreut wie die Opfer einer Seuche.
Die Betrunkenen waren Rotröcke. Sie waren in die britische Armee eingetreten, weil sie verzweifelt oder auf der Flucht vor dem Gesetz waren und weil es dort einen Fünftel Liter Rum pro Tag gab. Am Vorabend hatten sie den Himmel auf Erden entdeckt, in einer elenden Taverne in einem elenden spanischen Dorf an einer elenden steinigen Straße, die zum Meer führte. Sie hatten maßlos gezecht, deshalb wollte man sie nun der Gnade der Franzosen überlassen.
Lieutenant Richard Sharpe, im grünen Uniformrock der 95th Rifles, des Schützenkorps, ging zwischen den Bewusstlosen hin und her, die im Innenhof der geplünderten Taverne lagen. Sein Interesse galt nicht den Betrunkenen, sondern einigen Holzkisten, die man von einem Ochsenkarren geworfen hatte, um Platz für Verwundete und an Erfrierungen leidende Männer zu schaffen. Wie so vieles, was das geschwächte Heer nicht mehr mitschleppen konnte, wären auch die Kisten den nachfolgenden Franzosen in die Hände gefallen, wenn Sharpe nicht entdeckt hätte, dass sie Gewehrmunition enthielten. Und die wollte er nun bergen. Die Tornister und Taschen seines Bataillons hatte er bereits mit so vielen der wertvollen Patronen anfüllen lassen, wie die Männer tragen konnten. Jetzt luden er und einer der Schützen noch mehr davon in die Packkörbe des letzten Maultiers der Einheit.
Schütze Cooper beendete seine Arbeit, dann starrte er die übrig gebliebenen Kisten an. »Was machen wir mit denen, Sir?«
»Verbrennen.«
»Donnerwetter!« Cooper lachte auf, dann zeigte er auf die herumliegenden Betrunkenen. »Damit bringen Sie die da todsicher um!«
»Wenn wir’s nicht tun, tun’s die Franzosen.« Sharpe hatte eine tiefe Narbe auf der linken Wange, die ihm ein finster grimmiges Aussehen verlieh. »Willst du, dass die Franzosen uns mit unserer eigenen Munition abknallen?«
Cooper war es eigentlich gleichgültig, was die Franzosen taten. Im Moment interessierte ihn ein alkoholumnebeltes Mädchen, das in einer Ecke des Hofs schlummerte. »Wär doch schade, die da umzubringen, Sir. So ein nettes kleines Ding.«
»Überlass sie den Franzosen.«
Cooper bückte sich, um der jungen Frau das Mieder zu lösen und ihre Brüste freizulegen. Sie regte sich in der Kälte, wachte jedoch nicht auf. Ihr Haar war mit Erbrochenem beschmiert, das Kleid hatte Weinflecken, und doch war sie hübsch. Sie mochte fünfzehn oder sechzehn Jahre alt sein. Sie hatte einen Soldaten geheiratet und war ihm in den Krieg gefolgt. Nun war sie betrunken und würde es mit den Franzosen zu tun bekommen. »Wach auf!«, sagte er.
»Lass sie!« Sharpe konnte der Versuchung nicht widerstehen, den Hof zu überqueren, um sich das nackte Mädchen anzusehen. »Dumme Kuh«, brummte er übel gelaunt.
Ein Major erschien im Durchgang zum Hof. »Quartiermeister?«
Sharpe drehte sich um. »Sir?«
Der Major hatte einen schmalen, drahtigen Schnurrbart und einen bösartigen Gesichtsausdruck. »Wenn Sie damit fertig sind, Frauen auszuziehen, könnten Sie sich dann vielleicht bequemen, sich uns anzuschließen?«
»Ich wollte erst noch diese Kisten verbrennen, Sir.«
»Vergessen Sie die Kisten, Quartiermeister. Beeilung!«
»Zu Befehl.«
»Oder ziehen Sie es vor, hierzubleiben? Ich bezweifle, dass die Armee Sie vermissen würde.«
Sharpe antwortete nicht. Normalerweise hätte kein Offizier in Gegenwart einfacher Soldaten diesen Umgangston angeschlagen, doch der Rückzug war allen an die Nerven gegangen und hatte unterschwellige Ressentiments freigesetzt. Männer, die sich normalerweise mit vorsichtigem Respekt oder einer gewissen gezwungenen Freundlichkeit begegnet wären, knurrten sich jetzt an wie räudige Hunde. Und Major Warren Dunnett hasste den Quartiermeister schon seit Langem. Es war ein wütender, irrationaler und alles verzehrender Hass, auf den Sharpe mit Nichtachtung reagierte. Dass der Quartiermeister obendrein noch großen Sachverstand ausstrahlte, provozierte den Major immer wieder zu aufbrausenden Wutanfällen. Das war schon vor zwei Jahren vor Kopenhagen so gewesen, als Sharpe plötzlich mit einem geheimen Auftrag in der dänischen Hauptstadt aufgetaucht war, während Dunnett, damals noch Captain, ihn zu Hause in Shorncliffe vermutet hatte.
»Wofür, zum Teufel, hält er sich eigentlich?«, machte er sich vor der Taverne gegenüber Captain Murray Luft. »Denkt er, das ganze verdammte Heer würde auf ihn warten?«
»Er tut doch nur seine Pflicht, oder?« John Murray war ein milder und gerechter Mann.
»Er tut keineswegs seine Pflicht. Er begafft die Titten irgendeiner Hure.« Dunnett spuckte verächtlich aus. »Ich habe ihn, verdammt noch mal, nicht im Bataillon gewollt, und ich will ihn, verdammt noch mal, immer noch nicht im Bataillon haben. Der Colonel hat ihn doch bloß genommen, um Willie Lawford einen Gefallen zu tun. Was, zum Teufel, ist nur aus diesem Heer geworden? Er ist ein Emporkömmling, ein ehemaliger Sergeant, Johnny! Nicht mal ein echter Offizier! Und das bei den Rifles!«
Murray hatte den Verdacht, dass Dunnett auf den Quartiermeister neidisch war. Es kam höchst selten vor, dass ein Mann als gemeiner Soldat ins britische Heer eintrat und es zum Offizier brachte. Richard Sharpe war es gelungen. Er hatte in den Reihen der Rotröcke eine Muskete getragen, war zum Sergeant befördert und dann als Belohnung für geradezu selbstmörderischen Mut auf einem Schlachtfeld in Indien zum Offizier ernannt worden. Die übrigen Offiziere betrachteten seine Vergangenheit mit zwiespältigen Gefühlen, weil sie Angst hatten, dass seine Kampferfahrung ihre eigene Unerfahrenheit offenkundig werden ließ. Aber eigentlich hätten sie sich keine Sorgen machen müssen, denn der Colonel hatte Sharpe von der Kampflinie ferngehalten, indem er ihn zum Quartiermeister des Bataillons ernannte. Dieser Entscheidung lag die Einsicht zugrunde, dass einer, der als einfacher Soldat und Sergeant gedient hatte, alle kriminellen Tricks kannte, die die Tätigkeit eines Quartiermeisters verlangte. Sharpe gab die Betrunkenen und die restliche Munition auf und verließ den Hof der Taverne. Ein nasskalter Regen fegte von Osten her über die Rifles hinweg, die auf der Dorfstraße warteten. Diese Schützen bildeten die Nachhut der Armee. In ihren zerlumpten Uniformen wirkten sie wie Karikaturen des Soldatenlebens – ein schauriges Heer von Bettlern, Mannschaften und Offizieren, gleichermaßen in Stofffetzen gehüllt, die sie auf dem Marsch erbettelt oder gestohlen hatten. Die Sohlen ihrer Stiefel wurden von verknotetem Zwirn gehalten. Die unrasierten Gesichter waren zum Schutz gegen den bitterkalten Wind in schmutzige Schals gehüllt. Ihre Augen waren rot gerändert, ihre Mienen ausdruckslos, ihre Wangen eingefallen, ihre Augenbrauen vom Frost weiß gefärbt. Einige der Männer hatten ihre Tschakos verloren und trugen stattdessen Bauernhüte mit breiter Krempe. Sie mochten aussehen wie Lumpengesindel, aber sie waren immer noch Schützen, und jede ihrer Baker-Büchsen hatte ein gut geöltes Zündschloss mit scharfkantigem Feuerstein im Hahn.
Major Dunnett, der dieses halbe Bataillon befehligte, führte sie gen Westen. Sie waren seit Heiligabend unterwegs, und inzwischen war die erste Januarwoche vorüber. Immer ging es in westlicher Richtung, fort von den siegreichen Franzosen, deren überlegene Heerscharen Spanien überfluteten, und jeder Tag war eine qualvolle Abfolge von Kälte, Hunger und Schmerz. In einigen Bataillonen war die Disziplin vollständig zusammengebrochen. Diese Einheiten, die die Hoffnung aufgegeben hatten, hinterließen eine Spur von Leichen. Unter den Toten fanden sich Frauen, Ehefrauen, denen man gestattet hatte, mit dem Heer nach Spanien zu ziehen, aber auch Kinder. Und die Überlebenden waren gegen diese Schrecken inzwischen so abgestumpft, dass sie am erfrorenen Leichnam eines Kindes vorbeimarschieren konnten, ohne das Geringste zu empfinden.
Obwohl das Heer moralisch gebrochen war, gab es nach wie vor einige Männer, die unter der Folter der Eisstürme und des schneidend kalten Windes in geordneter Formation marschierten, und die, wenn man es ihnen befahl, den französischen Verfolgern Widerstand entgegensetzten. Dies waren die guten Männer, die harten Kämpfer: die Guards und die leichte Infanterie, die Elite von Sir John Moores Armee, die ins Innere Spaniens vorgedrungen war, um Napoleon die Nachschubwege abzuschneiden. Sie waren in Erwartung eines Sieges marschiert, doch der Kaiser der Franzosen hatte sich mit unbarmherziger Schnelligkeit und überlegener Streitmacht auf sie gestürzt. Nun zog sich das kleine britische Heer zu den Schiffen zurück, die es nach Hause bringen würden.
Dunnetts dreihundert Schützen schienen in der eisigen Wildnis allein zu sein. Irgendwo vor ihnen war die Armee auf dem Rückzug und irgendwo hinter ihnen waren die Franzosen auf dem Vormarsch, doch die Welt der Schützen bestand aus dem Tornister des Vordermannes, dem Schneeregen, der Erschöpfung und dem Schmerz in den vor Hunger verkrampften Mägen.
Eine Stunde nachdem sie das Dorf verlassen hatten, erreichten sie einen Bach, über den eine steinerne Brücke führte. Dort erwartete sie britische Kavallerie mit der Nachricht, dass zwei Meilen vor ihnen Artillerieeinheiten an einem Hang stecken geblieben seien. Der Kavalleriekommandeur schlug vor, Dunnetts Schützen sollten an der Brücke warten. »Geben Sie uns etwas Zeit, den Kanonieren den Hang hinauf zu helfen, dann kommen wir zurück, um Sie zu holen.«
»Wie lange?«, fragte Dunnett gereizt.
»Eine Stunde. Sicher nicht länger.«
Die Schützen warteten. Sie hatten das in den vergangenen zwei Wochen bestimmt zwanzigmal getan, und sicher würden sie es noch weitere zwanzigmal tun müssen. Sie waren der Stachel im Schwanz der Armee. Wenn sie heute Glück hatten, würde kein Franzose sie belästigen, doch wahrscheinlicher war, dass irgendwann im Lauf der nächsten Stunde die feindliche Vorhut erscheinen würde. Diese Vorhut würde aus Kavallerie auf müden Pferden bestehen. Die Franzosen würden pflichtschuldigst angreifen, die Schützen würden einige Schüsse abfeuern. Und weil keine Partei einen Vorteil gewinnen konnte, würden die Franzosen die Grünjacken abziehen lassen. Das war Soldatenalltag, langweilig, kalt, entmutigend. Und ein oder zwei Schützen und ein oder zwei Franzosen mussten dabei ihr Leben lassen.
Die Schützen formierten sich zu Kompanien, um die Straße westlich der Brücke abzuriegeln. Sie starrten frierend nach Osten. Die Sergeants schritten hinter den Reihen ihrer Einheiten auf und ab. Die Offiziere, deren Pferde allesamt der Kälte zum Opfer gefallen waren, stellten sich vor ihren Kompanien auf. Niemand sagte etwas. Möglicherweise träumten einige der Männer von den Schiffen der Navy, die sie am Ende dieser langen Straße erwarten sollten, doch wahrscheinlicher war, dass sie nichts anderes im Kopf hatten als Kälte und Hunger.
Lieutenant Richard Sharpe, den man zum Quartiermeister des Bataillons gemacht hatte, schlenderte auf die steinerne Brücke hinaus und spähte in den eisigen Schneeregen. Er war jetzt dem Feind am nächsten, zwanzig Schritt vor der Linie der Grünjacken, und das ärgerte Major Dunnett, der dahinter eine unausgesprochene Arroganz zu entdecken vermeinte. »Zur Hölle mit ihm.« Dunnett gesellte sich zu Captain Murray.
»Er ist harmlos.« Murray sprach mit seiner üblichen Milde.
»Er ist ein verdammter Emporkömmling.«
Murray lächelte. »Er ist ein verflucht tüchtiger Quartiermeister, Warren. Wann haben die Männer zuletzt so viel Munition gehabt?«
»Seine Aufgabe ist, mir ein Bett für die Nacht zu besorgen, nicht hier herumzulungern, um vielleicht beweisen zu können, wie gut er kämpfen kann. Schau ihn dir an!« Es erging Dunnett wie einem Mann mit einer juckenden Wunde, die er ständig kratzen muss. Er starrte den Quartiermeister an. »Der glaubt wohl, er gehört immer noch zur kämpfenden Truppe, wie? Einmal ein Bauer, immer ein Bauer, so ist es doch. Warum trägt er eigentlich ein Gewehr?«
»Keine Ahnung.«
Das Gewehr war eine Schrulle des Quartiermeisters, und zwar eine ungebührliche. Der Quartiermeister hatte sich mit Listen, Tinte, Feder und Kerbholz herumzuschlagen, nicht mit einer Waffe. Er musste imstande sein, Lebensmittel aufzutreiben oder in scheinbar überbelegten Quartieren Schlafplätze ausfindig zu machen. Er musste einen Riecher für verdorbenes Rindfleisch haben, eine Waage zum Auswiegen von Mehlrationen und die nötige Sturheit, um die Übergriffe anderer Quartiermeister abzuwehren. Was er nicht brauchte, waren Waffen. Sharpe aber trug sowohl ein Gewehr als auch den vorschriftsmäßigen Säbel. Die beiden Waffen wirkten wie eine Absichtserklärung: Ich will lieber kämpfen, als Quartiermeister spielen. Die meisten Grünjacken sahen darin jedoch nur die bemitleidenswerte Anmaßung eines Mannes, der ungeachtet seiner Vergangenheit nichts war als ein alternder Lieutenant.
Dunnett stampfte mit den kalten Füßen auf der Straße. »Ich schicke die Kompanien an der Flanke zurück, Johnny. Du kannst ihnen Feuerschutz geben.«
»Jawohl. Warten wir auf die Berittenen?«
»Verdammte Kavallerie.« Dunnett äußerte die gewohnheitsmäßige Verachtung des Infanteristen für die Reitertruppe. »Ich warte noch fünf Minuten. Es kann doch nicht so lange dauern, ein paar lächerliche Kanonen aus dem Weg zu räumen. Können Sie was erkennen, Quartiermeister?« Die Frage war ironisch gemeint.
»Nichts, Sir.« Sharpe nahm seinen Tschako ab und fuhr sich mit der Hand durchs lange schwarze Haar, das von den vielen im Feld verbrachten Tagen fettig war. Sein Mantel stand offen, und er trug weder Schal noch Handschuhe. Entweder konnte er sich die nicht leisten, oder er wollte damit prahlen, so abgehärtet zu sein, dass er sie nicht brauchte. Seine vermeintliche Arroganz veranlasste den Major, sich zu wünschen, dass Sharpe, den es so nach Kampf gelüstete, von feindlichen Reitern niedergemäht würde.
Nur waren keine feindlichen Reiter in Sicht. Vielleicht hatten Regen und Wind und die gottverdammte Kälte die Franzosen dazu getrieben, im letzten Dorf Zuflucht zu suchen. Oder die betrunkenen Frauen hatten eine allzu große Anziehungskraft auf sie ausgeübt. Wie auch immer, jedenfalls waren keine Franzosen zu sehen, nur Schneeregen und tief hängende Wolken, die im auffrischenden Wind heranrollten.
Major Dunnett fluchte nervös. Die vier Kompanien schienen in einer Wildnis voller Regen und Frost allein zu sein, vier Kompanien vergessener Soldaten in einem vergessenen Krieg. Dunnett beschloss, nicht länger abzuwarten. »Wir machen uns auf den Weg.«
Pfiffe gellten. Die beiden Kompanien an der Flanke machten kehrt, und die Soldaten schlurften wie wandelnde Leichen die Straßen hinauf. Die mittleren Kompanien blieben unter dem Kommando von Captain Murray an der Brücke zurück. In etwa fünf Minuten, wenn die ersten beiden Kompanien angehalten hatten, um ihren Rückzug zu decken, sollten Murrays Männer an der Reihe sein, sich zurückzuziehen.
Die Schützen mochten Captain Murray. Er sei ein echter Gentleman, pflegten sie zu sagen. Wer ihn hinters Licht führen wolle, müsse schon ein ganz gerissener Hundesohn sein. Aber wenn man ihm Respekt erweise, behandle der Captain einen auch fair.
Murray hatte ein hageres Gesicht, dessen Ausdruck Humor verriet, lächelte gern und hatte immer einen Scherz parat. Offiziere wie er waren dafür verantwortlich, dass diese Schützen immer noch mit einem Hauch jenes Elans, den sie auf dem Paradeplatz in Shorncliffe gelernt hatten, die Waffe schultern und losmarschieren konnten.
»Sir!« Sharpe, der immer noch auf der Brücke stand, lenkte Murrays Aufmerksamkeit gen Osten, wo sich eine Gestalt durch den Schneeregen kämpfte. »Einer der Unseren!«, rief er kurz darauf.
Die einsame Gestalt, die da torkelnd heranstolperte, war ein Rotrock. Er hatte keine Muskete, keinen Tschako, keine Stiefel. Seine nackten Füße hinterließen Blutspuren auf dem Schotter der steinigen Straße.
»Das soll ihm eine Lehre sein«, sagte Captain Murray. »Da seht ihr die Folgen des Suffs, Jungs.«
Das war kein besonders gelungener Witz. Murray äffte bloß einen Prediger nach, der dem Bataillon einmal eine Ansprache über die Schrecken des Alkohols gehalten hatte, brachte damit jedoch die Schützen zum Lachen. Ihre Lippen mochten von der Kälte aufgesprungen und blutig sein, aber ein Grinsen war immer noch besser als stumme Verzweiflung.
Der Rotrock, einer der Trunkenbolde, die sie im letzten Dorf zurückgelassen hatten, winkte der Nachhut mit schlaffer Hand zu. Eine Art Instinkt hatte ihn geweckt und veranlasst, in westlicher Richtung die Straße entlangzugehen, um sich in Sicherheit zu bringen. Er taumelte am ausgeweideten, gefrorenen Kadaver eines Pferdes vorbei und versuchte, seine Schritte zu beschleunigen.
»Achtung, Kavallerie!«, brüllte Sharpe.
»Rifles!«, rief Captain Murray. »Legt an!«
Lumpen wurden von den Gewehrschlössern entfernt. Obwohl ihre Hände von der Kälte steif waren, führten die Männer die nötigen Handgriffe rasch aus.
Denn in dem weißen Dunst aus Schneeregen und Eis waren neue Gestalten zu erkennen. Reiter.
Grotesk anmutende Gestalten im grauen Regen. Aus Säbelscheiden, Umhängen, Federbüschen und Bandeliers setzte sich die zackige Silhouette französischer Kavallerie zusammen. Dragoner.
»Immer mit der Ruhe, Jungs!« Captain Murrays Stimme klang ruhig.
Sharpe hatte sich an die linke Flanke der Kompanie begeben, wo sein Maultier angebunden war.
Der Rotrock verließ die Straße, übersprang einen zugefrorenen Graben. Dann schrie er auf wie ein Schwein im Schlachthaus. Ein Dragoner hatte zu dem Mann aufgeholt. Sein langer Säbel sauste herab und schlitzte das Gesicht des Rotrocks von der Stirn bis zum Kinn auf. Blut sprenkelte die gefrorene Erde. Ein weiterer Reiter, der von der anderen Seite kam, ließ seine stählerne Klinge durch die Luft zischen und versenkte sie in der Schädeldecke des Flüchtenden. Der betrunkene Rotrock ging stumm in die Knie und die Dragoner ritten über ihn hinweg und spornten ihre Tiere in Richtung der beiden Kompanien an, die die Straße versperrten. Der schmale Bach war kein ernst zu nehmendes Hindernis für ihren Angriff.
»Serrez! Serrez!« Das französische Befehlswort schallte deutlich zu den Schützen hinüber. Es bedeutete »Aufschließen!«
Die Dragoner rückten zusammen, ein gestiefeltes Knie neben dem anderen, und Sharpe konnte ihre buschigen Schnauzbärte erkennen, ehe Captain Murray den Feuerbefehl gab.
Ungefähr achtzig Büchsen feuerten. Die restlichen waren zu feucht geworden, doch achtzig Kugeln auf weniger als hundert Yards Entfernung ließen die feindliche Schwadron zu einem Getümmel aus stolpernden Pferden, stürzenden Männern und allgemeiner Panik auseinanderbrechen. Der Schrei eines verendenden Pferdes durchschnitt die Kälte des Tages.
Sergeant Williams stand an der rechten Flanke von Murrays Kompanie. Er griff nach einem der feucht gewordenen Gewehre, wischte das nasse Pulver aus der Zündpfanne und lud mit trockenem aus seinem Pulverhorn nach. »Wählt euer Ziel! Feuer frei!«
Sharpe hielt durch den schmutzig grauen Rauch nach einem feindlichen Offizier Ausschau. Er erspähte einen Berittenen, der die durcheinandergeratene Kavallerie anbrüllte, und zielte auf ihn. Das Gewehr schlug gegen seine Schulter, als er schoss. Er meinte, den Franzosen fallen zu sehen, war sich jedoch nicht ganz sicher. Ein reiterloses Pferd entfernte sich im Galopp von der Straße. Von seiner Satteldecke tropfte Blut.
Weitere Büchsen wurden abgefeuert. Die Stichflammen sprühten einen halben Yard weit aus den Mündungen. Die Franzosen hatten sich zerstreut und nutzten den Schneeregen als Schutz, um den Schützen das Zielen zu erschweren. Ihr erster Angriff, der nur dazu dienen sollte festzustellen, wie gut die Nachhut standhielt, auf die sie getroffen waren, war gescheitert. Nun gaben sie sich damit zufrieden, die Grünjacken aus sicherer Entfernung zu zermürben.
Die beiden Kompanien, die unter Major Dunnetts Oberbefehl nach Westen zurückgewichen waren, hatten sich inzwischen neu formiert. Ein Pfeifton erklang, um Murray mitzuteilen, dass er sich ungefährdet zurückziehen könne.
Die Franzosen jenseits der Brücke eröffneten ein unregelmäßiges und wahlloses Feuer aus ihren langen Musketen. Sie schossen aus dem Sattel, was es noch unwahrscheinlicher machte, dass ihre Kugeln ein Ziel fanden.
»Rückzug!«, rief Murray.
Ein paar Büchsen spuckten ein letztes Mal Feuer, dann drehten sich die Männer um und liefen die Straße hinauf. Sie vergaßen Hunger und Verzweiflung. Die Angst machte ihnen Beine. Sie rannten auf die beiden in Formation stehenden Kompanien zu, die einen weiteren französischen Angriff abwehren würden. In den nächsten paar Minuten war mit einem Katz-und-Maus-Spiel zwischen müder Kavallerie und frierenden Schützen zu rechnen, bis entweder die Franzosen ihre Angriffsversuche aufgaben oder die britische Kavallerie eintraf, um den Feind zu vertreiben.
Schütze Cooper durchschnitt die Fußfessel an Lieutenant Sharpes Maultier und zog das störrische Tier die Straße entlang. Murray versetzte dem Tier mit seinem Degen einen Hieb aufs Hinterteil, dass es einen Satz vorwärts tat.
»Warum lassen Sie es nicht laufen?«, rief er Sharpe zu.
»Weil ich es, verdammt noch mal, nötig brauche.« Sharpe wies Cooper an, das Maultier von der Straße weg den nördlichen Hügel hinauf zu führen, um das Schussfeld für Dunnetts Kompanien frei zu machen.
Die Grünjacken waren auf Schützenlinie gedrillt, eine lockere Formation, die den Männern ermöglichte, in Deckung zu gehen, oder sich als Scharfschützen dem Feind zu stellen. Doch auf diesem Rückzug bildeten die Männer in Grün ebenso dichte Reihen wie die Rotröcke und benutzten ihre Gewehre, um Salven abzuschießen.
»Formiert euch! Formiert euch!«, brüllte Sergeant Williams den Leuten aus Murrays Kompanie zu.
Die Franzosen rückten vorsichtig bis zur Brücke vor. Sie waren vielleicht hundert Mann stark, eine berittene Vorhut, die entsetzlich müde und schwach aussah. An sich hätte bei diesem Wetter und auf diesen steinigen Gebirgsstraßen kein Pferd in den Kampf geführt werden dürfen, doch der Kaiser hatte diese Franzosen ausgeschickt, um das britische Heer endgültig zu vernichten, daher würde man die Pferde notfalls zu Tode reiten, wenn das zum Sieg verhelfen konnte. Ihre Hufe waren in Lumpen gewickelt, damit sie auf den eisglatten Straßen besseren Halt fanden.
»Schützen! Schwerter aufgepflanzt!«, befahl Dunnett. Die langen Schwertbajonette wurden aus den Scheiden gezogen und auf die Mündungen der geladenen Gewehre aufgesetzt. Der Befehl war wahrscheinlich unnötig. Die Franzosen machten nicht den Eindruck, als hätten sie einen weiteren Angriff vor, doch aufgepflanzte Bajonette waren Vorschrift, wenn man Kavallerie gegenüberstand, also erteilte der Major den Befehl.
Sharpe lud seine Büchse. Captain Murray wischte Feuchtigkeit von der Klinge seines schweren Kavalleriedegens, der ebenso wie das Gewehr des Lieutenants eine Schrulle war. Offiziere der Rifles hatten eigentlich einen leichten Säbel zu tragen, doch Murray zog den Reiterdegen mit der geraden Klinge vor, der allein mit seinem Eigengewicht einem Mann den Schädel spalten konnte.
Die feindlichen Dragoner saßen ab. Sie ließen ihre Pferde an der Brücke zurück und bildeten eine Gefechtsreihe, die sich zu beiden Seiten der Straße ausbreitete.
»Die wollen nicht mitspielen«, sagte Murray vorwurfsvoll, dann drehte er sich in der Hoffnung um, einen Blick auf die britische Kavallerie zu erhaschen. Doch es war nichts zu sehen.
»Rückzug nach Kompanien!«, rief Major Dunnett. »Johnny! Führen Sie Ihre beiden zurück!«
»Fünfzig Schritt, los!« Murrays beiden Kompanien zogen sich stolpernd die vierzig Yards zurück, begleitet von Lieutenant Sharpe und seinem Maultier. Dann bildeten sie eine neue Linie quer über die Straße. »Vordere Reihe auf die Knie!«, brüllte Murray.
»Immer laufen wir davon.« Der das sagte, war Schütze Harper, ein hünenhafter Mann. Er war ein Riese von einem Iren in einem Heer klein gewachsener Männer und ein berüchtigter Unruhestifter. Er hatte ein breites, flaches Gesicht mit sandfarbenen Brauen, die jetzt vom gefrorenen Schneeregen weiß waren. »Warum kehren wir nicht um und erwürgen die Hundesöhne? Die müssen, verdammt noch mal, was zu essen in ihren verdammten Tornistern haben.« Er drehte sich um und hielt Ausschau nach Westen. »Und wo zum Teufel bleibt unsere verdammte Kavallerie?«
»Schnauze! Augen geradeaus!« Es war Sharpe, der den Befehl gab.
Harper bedachte ihn mit einem frechen, verächtlichen Blick, ehe er sich wieder umdrehte, um zu beobachten, wie sich Major Dunnetts Kompanien zurückzogen. Die Dragoner waren als dunkle Schemen in einiger Entfernung zu erkennen. Ab und zu wurde eine Muskete abgefeuert, und der Wind wehte einen Streifen grauen Rauchs herüber. Ein Schütze wurde ins Bein getroffen und fluchte auf den Feind.
Sharpe schätzte, dass noch etwa zwei Stunden bis Mit tag blieben. Der Rückzug unter Feuer würde am frühen Nachmittag ein Ende nehmen. Dann musste er vorauseilen, um einen Viehstall oder eine Kirche zu finden, wo die Männer die Nacht verbringen konnten. Er hoffte, dass ein Verpflegungsoffizier mit einem Sack Mehl auftauchen würde, das mit Wasser vermischt und über einem Feuer aus Kuhfladen geröstet als Abendmahlzeit und Frühstück herhalten musste. Mit etwas Glück würde ein Pferdekadaver sie mit Fleisch versorgen. Am nächsten Morgen würden die Männer mit Magenkrämpfen aufwachen. Wieder würden sie sich zu Kolonnen formieren. Sie würden losmarschieren, dann würden sie kehrtmachen, um sich dieselben Dragoner vom Leib zu halten. Dragoner, denen es im Augenblick wenig auszumachen schien, die Schützen ziehen zu lassen.
»Die sind heute nicht besonders tatendurstig«, murrte Sharpe.
»Sie träumen von daheim«, sagte Murray wehmütig. »Von Eintopf mit Huhn und Knoblauch, herbem Rotwein und einem drallen Mädchen im Bett. Wer will schon in einer elenden Einöde wie dieser verrecken, wenn das alles zu Hause auf ihn wartet?«
»Wir ziehen uns in Kolonnen von halber Kompaniestärke zurück!« Überzeugt, dass der Feind es nicht riskieren würde, näher heranzukommen, schickte Major Dunnett sich an, seinem Gesprächspartner einfach den Rücken zu kehren und davonzumarschieren. »Captain Murray, Ihre Männer zuerst, wenn ich bitten dürfte.«
Doch ehe Murray noch einen Befehl erteilen konnte, rief Sharpe eine eindringliche Warnung aus: »Achtung, Kavallerie von hinten!«
»Das sind doch unsere, Sie Dummkopf!« Dunnett verbarg seine Verachtung für den Quartiermeister nicht
.»O mein Gott!« Murray hatte sich umgedreht, um die Straße zu überblicken, auf der die vier Kompanien ihren Rückzug bewerkstelligen mussten. »Hintere Reihe kehrt! Major Dunnett! Das sind Froschfresser!«
Gott allein wusste, wie das geschehen konnte, aber hinter ihnen war ein neuer Feind aufgetaucht. Es blieb keine Zeit, sich zu fragen, woher er gekommen sein mochte, es galt nur noch, kehrtzumachen und sich den drei Schwadronen zu stellen. Die französischen Kavalleristen ritten mit offenen Mänteln heran, unter denen die mit rosa Aufschlägen versehenen grünen Röcke zu erkennen waren. Sie hatten die Säbel gezogen. Angeführt wurden sie seltsamerweise von einem berittenen Jäger, einem Offizier, der die grüne Jacke, die scharlachrote Pelisse und die schwarze Pelzmütze der kaiserlichen Garde trug. Neben ihm ritt auf einem großen Rotschimmel eine ebenso merkwürdige Gestalt: ein Mann in einem schwarzen Reitmantel und glänzend hellen Stiefeln.
Dunnett starrte den neuen Feind entgeistert an. Einzelne Schützen luden hastig ihre Büchsen. Sharpe kniete nieder, stützte seine Büchse ab, indem er den Tragriemen um den linken Ellbogen schlang, und gab einen Schuss auf den Gardeoffizier ab.
Er verfehlte ihn. Schütze Harper lachte höhnisch.
In den feindlichen Reihen ertönte eine Trompete. Ihr schriller Klang verhieß den Tod.
Der Gardeoffizier hob den Säbel. Der Mann im Zivilmantel neben ihm zog einen langen schlanken Degen. Die Kavallerie beschleunigte zum Trab und Sharpe konnte das Trommeln der Hufe auf dem gefrorenen Boden hören.
Das Dragonerregiment ritt immer noch in Schwadronen, die nach der Farbe ihrer Pferde zu unterscheiden waren. Die erste Schwadron saß auf Rappen, die zweite auf Braunen, die dritte auf Füchsen. Ein solches Arrangement war zu Friedenszeiten durchaus üblich, doch äußerst selten im Feld, wo sich die Vorschrift wegen der Remonten bald nicht mehr einhalten ließ. Die Trompeter saßen auf Grauschimmeln, ebenso der Mann, der die Standarte mit dem kaiserlichen Adler auf der Stange mitführte. Das kleine Fahnentuch hob sich farbenfroh vor den tief hängenden Wolken ab. Noch heller glänzten die Säbel der Dragoner, wie Klingen aus fahlem Eis.
Major Dunnett erkannte, dass seinen Schützen der Untergang drohte. »Zum Karree! Sammeln! Sammeln!«
Die Grünjacken sammelten sich zum Karree, einer dicht geschlossenen rechteckigen Formation, in der die Männer auf engstem Raum Schutz gegen einen Kavallerieangriff suchten. Wer sich in der vorderen Reihe wiederfand, kniete nieder und stemmte den Gewehrkolben in den Boden, um der Klinge seines Schwertbajonetts festen Halt zu geben. Andere luden ihre Gewehre und rieben sich die steif gefrorenen Fingerknöchel an den aufgepflanzten Schwertbajonetten wund, wenn sie den Ladestock in den Lauf rammten. Schütze Cooper und sein Maultier suchten in der Mitte des Vierecks Zuflucht.
Die auf Füchsen reitende Schwadron löste sich nun weiter hinten aus dem französischen Gefechtsverbund, nahm die Musketen zur Hand und saß ab. Die anderen beiden Schwadronen ließen ihre Pferde kantern. Sie waren hundert Schritt weit entfernt und würden sie erst kurz vor dem Ziel zum Galopp anspornen.
»Feuer!«, brüllte Dunnett.
Die Schützen, die es geschafft hatten zu laden, gaben ihren Schuss ab.
Ein Dutzend Sättel wurde leer gefegt. Die Schützen rempelten sich gegenseitig an und richteten sich zu Reihen aus, um das Karree zu vergrößern und jeder Waffe Gelegenheit zum Feuern zu geben.
»Feuer!« Weitere Büchsen spien ihre Geschosse aus, weitere Reiter fielen, dann riss der Gardeoffizier, statt den Angriff fortzusetzen, sein Pferd herum. Die beiden Schwadronen scherten aus und gaben das Feld für die Abgesessenen frei, die hinter ihnen herangekommen waren und nun mit ihren Musketen das Feuer eröffneten. Die Dragonerkompanie, die an der Brücke gewartet hatte, näherte sich währenddessen der Ostseite des Karrees.
Die enge Formation gab eine perfekte Zielscheibe ab für die von ihren Pferden abgestiegenen Dragoner. Doch wenn die Schützen sich in Kampflinie formiert hätten, um die improvisierte Infanterie zu vernichten, hätten die Berittenen wieder ihre Pferde angespornt und die Grünjacken einfach niedergeritten. Der Gardeoffizier, überlegte Sharpe, war ein gerissener Hundesohn, ein gerissener französischer Hundesohn, dem heute einige brave Schützen zum Opfer fallen würden.
Die Schützen fielen, einer nach dem anderen. Das Innere des Karrees verwandelte sich in ein Leichenhaus – überall Verwundete, Blut, Schreie, verzweifelte Gebete. Der eisige Regen hatte zugenommen und ließ die Pulverpfannen der Büchsen feucht werden. Aber zum überwiegenden Teil zündete das Schwarzpulver noch, sodass sie dem Feind ihre Kugeln entgegenspeien konnten, einem Feind, der im Gras kauerte und daher nur kleine, schwer zu treffende Ziele bot.
Die beiden berittenen Schwadronen waren nach Westen ausgeschert und formierten sich jetzt neu. Ihr Angriff würde sich am Straßenverlauf ausrichten, und der eisige Stahl ihrer schweren Kavalleriesäbel würde brennen wie Feuer, wenn er seine Opfer traf. Solange die Schützen zusammenblieben und ihre gelichteten Reihen noch die fahlen Klingen hochhielten, würden ihnen die Reiter nichts anhaben können. Aber die feindlichen Musketen forderten einen furchtbaren Blutzoll. Und wenn erst genug Schützen gefallen waren, würde der Kavallerieangriff das geschwächte Karree durchdringen wie ein Schwert, das einen faulen Apfel zerteilt.
Dunnett wusste das und suchte nach einem Ausweg. Er fand ihn in den tief hängenden Wolken, die knapp zweihundert Yards nördlich den Hang in Nebel hüllten. Falls es den Grünjacken gelang, in die alles verdeckende Nebelwand hinaufzuklettern, waren sie in Sicherheit. Er zögerte die Entscheidung hinaus. Ein Sergeant fiel mit einem sauberen Kopfschuss rücklings ins Karree. Ein Schütze schrie auf, als eine Kugel ihn in den Unterleib traf. Ein anderer, der am Fuß getroffen war, unterdrückte ein schmerzliches Stöhnen und lud seine Waffe.
Dunnett blickte zu der wolkenverhangenen Zuflucht am Hang hinauf. Er strich sich über den schmalen, struppigen Schnurrbart, in dem sich die Regentropfen fingen. Dann fällte er seine Entscheidung. »Den Hügel hinauf! Den Hügel hinauf! Haltet die Formation!«
Das Karree rückte im Schneckentempo den Hang hinauf. Die Verwundeten schrien, als man sie aufhob. Immer noch fanden französische Kugeln ihr Ziel, und die Formation der Grünjacken drohte aufzubrechen, sobald die Männer haltmachten, um das Feuer zu erwidern oder den Verwundeten zu helfen. Sie kam entsetzlich langsam voran, zu langsam für die überlasteten Nerven von Major Dunnett. »Im Eilschritt! Jeder für sich!«
»Nein!« Sharpe brüllte den Gegenbefehl, doch er wurde ignoriert. Dunnett hatte seinen Befehl ausgegeben. Der Rückzug wurde zum Wettrennen. Wenn es den Grünjacken gelang, in Deckung zu gehen, ehe die Kavallerie sie einholte, würden sie am Leben bleiben. Wenn allerdings der Gardeoffizier die Entfernung richtig berechnet hatte, würde er den Sieg davontragen.
Der Oberst im roten Pelz hatte allzu gut kalkuliert.
Die Grünjacken rannten los, doch ihr heiseres Atmen und das Stampfen ihrer Stiefel wurde vom Hufgetrappel übertönt.
Ein Mann drehte sich um und sah vor sich das gebleckte Gebiss eines Pferdes. Über dem Klang der Trompete hörte er das Zischen einer Klinge. Der Schütze schrie auf.
Es folgten Chaos und Gemetzel.
Die Reiter rieben die Grünjacken auf und schwenkten dann herum, um ihnen den Todesstoß zu versetzen. Ihre massiven Säbel hieben und stachen um sich.
Sharpe wurde auf einen Mann aufmerksam, der mit erhobener Klinge auf ihn zukam. Er wich seitlich aus und spürte den Luftzug des Dragonersäbels im Gesicht. Ein anderer Kavallerist ritt auf ihn zu, doch er schwang sein Gewehr am Lauf herum und versetzte dem Pferd einen Hieb aufs Maul. Das Pferd wieherte, bäumte sich auf, und Sharpe rannte weiter. Er brüllte den Männern zu, sich um ihn zu sammeln, doch die Grünjacken waren in alle Winde zerstreut und rannten um ihr Leben. Das Bataillonsmaultier ging in östliche Richtung durch. Cooper, der sich verbissen abmühte, seine Habe aus den Tragekörben des Tiers zu retten, wurde von einem Säbelstreich getötet.
Major Dunnett wurde einfach niedergeritten. Ein siebzehnjähriger Lieutenant wurde von zwei Dragonern eingeholt. Der erste raubte ihm mit einem rückhändigen Säbelhieb das Augenlicht, der zweite durchbohrte ihm die Brust.
Immer mehr Berittene strömten heran. Ihre Pferde stanken nach offenen Sattelwunden. Man hatte sie zuschanden geritten, aber zu diesem Zweck waren sie nun einmal abgerichtet.
Einem Schützen wurde förmlich die Wange vom Gesicht herabgeschlagen, Blut und Speichel schossen ihm aus dem Mund. Die Franzosen grunzten beim Zuschlagen. Was für ein Paradies für jeden Kavalleristen: fliehende Infanterie und fester Boden unter den Hufen.
Sharpe brüllte im Laufen immer noch: »Schützen zu mir! Zu mir! Zu mir!« Der Gardeoffizier musste ihn gehört haben, denn er zog seinen großen Rappen herum und trieb ihn auf den Engländer zu.
Sharpe sah ihn kommen, hängte sich das ungeladene Gewehr um und zog den Säbel. »Komm nur, du Hundesohn!«
Der Oberst der Kaiserlichen Garde hielt seinen Säbel in der Rechten und lenkte sein Pferd auf die linke Seite des Schützen, um sich den Todesstoß leicht zu machen. Sharpe wartete darauf, die gebogene Klinge dem Pferd übers Maul zu ziehen. Der Hieb würde ihm auf der Stelle Einhalt gebieten, es würde sich aufbäumen und abdrehen. Mit diesem Trick hatte er schon mehr Reiter abgewehrt, als er zählen konnte. Dabei kam es vor allem darauf an, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Sharpe hoffte, das panikartige Ausweichmanöver des Pferdes werde den Reiter abschütteln. Er wollte den gerissenen Gardeoffizier tot am Boden sehen.
Der Franzose gab seinem Rappen die Sporen, als wolle er zum Todesstoß ansetzen. Sharpe schwang den Säbel und erkannte, dass er überlistet worden war. Das Pferd verhielt und wich zur Seite. Dieses Manöver zeugte von stundenlanger, geduldiger Ausbildung. Sharpes Säbel zischte durch die Luft und verfehlte sein Ziel. Der Oberst aber war nicht rechts-, sondern linkshändig. Als sein Pferd nach rechts ausbrach, hatte er die Säbelhand gewechselt. Seine Klinge glitzerte, als sie nun herabsauste, gezielt auf den Hals des Schützen.
Sharpe hatte sich überlisten lassen. Er hatte zu früh zugeschlagen, hatte ins Nichts getroffen und war dabei aus dem Gleichgewicht geraten. Der Oberst suchte sich in dem Bewusstsein, dass dieser Engländer so gut wie tot war, bereits sein nächstes Opfer aus, noch ehe die Klinge ihr Ziel gefunden hatte. Er hatte mit diesem einfachen Kunstgriff schon zahllose Männer ins Jenseits befördert. Nun konnte er einen englischen Schützen zu all den Österreichern, Preußen, Russen und Spaniern hinzuzählen, die ebenfalls nicht findig genug gewesen waren.
Aber auch der Säbel des Gardeoffiziers verfehlte sein Ziel. Mit verblüffender Schnelligkeit war es dem Schützen gelungen, seine Waffe hochzureißen und zu parieren. Ihre Klingen trafen so heftig aufeinander, dass beiden Männern die Arme schmerzten. Sharpes billiger Säbel brach mittendurch, doch immerhin war es ihm gelungen, dem tödlichen Hieb des Franzosen die Kraft zu nehmen.
Der Oberst wurde vom Schwung seines Pferdes an dem Engländer vorbeigetragen. Der Franzose drehte sich um, verblüfft über die unvermutete Gegenwehr, und sah, wie der andere sich den Hügel hinauf davonmachte. Einen Augenblick lang war er versucht, ihm zu folgen, doch am Fuß des Hügels erwartete ihn andere, leichtere Beute. Er ritt in entgegengesetzter Richtung fort.
Sharpe hatte seinen zerbrochenen Säbel fortgeschleudert und strebte den tief hängenden Wolken zu. »Schützen! Schützen!« Einige hörten ihn und schlossen zu ihm auf. Wie sie so gemeinsam den Hang erklommen, bildeten sie eine Gruppe, die groß genug war, um den Feind abzuschrecken. Die Dragoner konzentrierten sich auf vereinzelte Männer, die leicht abzuschlachten waren, und nahmen mit großem Vergnügen Rache für die vielen Kavalleristen, die von Gewehrkugeln dahingerafft worden waren, für all die Franzosen, die im Laufe der langen Verfolgungsjagd zuckend und blutend ihr Leben ausgehaucht hatten, für die vielen Schmähungen, mit denen die Schützen sie in den letzten bitterkalten Wochen bedacht hatten.
Captain Murray gesellte sich zu Sharpe. »Übertölpelt hat er uns, bei Gott!«, sagte er, und es klang ebenso entsetzt wie überrascht.
Der kleine Trupp von Schützen erreichte noch vor dem Wolkenband sicheren Boden, wo verstreute Felsen das Gelände unwegsam werden ließen und den Dragonern nicht erlaubten, die Jagd fortzusetzen. Dort angekommen, ließ Murray seine Männer haltmachen und beobachtete mit ohnmächtiger Wut das Gemetzel, das sich unter ihm abspielte.
Die Dragoner ritten zwischen den Toten und Besiegten umher. Dazwischen taumelten Schützen mit aufgeschlitzten Gesichtern, andere lagen reglos da, bis gierige Hände ihre toten Leiber herumwälzten und sich an Tornistern und Taschen zu schaffen machten.
Sharpe sah mit an, wie Major Dunnett hochgezerrt und seine Uniform nach Beute durchsucht wurde. Dunnett hatte Glück gehabt. Er war am Leben geblieben und wurde gefangen genommen. Ein Schütze rannte am Fuß des Hanges entlang, immer noch auf der Flucht. Doch der Mann mit dem schwarzen Mantel und den hellen Stiefeln ritt ihm nach und führte mit erschreckendem Geschick einen einzigen Hieb aus.
»Diese Schweinehunde.« Murray steckte den schweren Kavalleriedegen weg. Er wusste, dass es nichts mehr zu kämpfen gab. »Gottverdammte Froschfresser und Schweinehunde!«
Fünfzig Schützen, die Überlebenden aller vier Kompanien, hatten sich aus dem Getümmel retten können. Sergeant Williams war unter ihnen, ebenso Schütze Harper. Einige der Männer bluteten. Ein Sergeant bemühte sich, eine heftig blutende Wunde in seiner Schulter zu stillen. Ein ganz junger Mann war kreidebleich und zitterte. Captain Murray und Lieutenant Sharpe waren die einzigen Offiziere, die dem Massaker entkommen waren
.»Wir schlagen uns irgendwie durch«, sagte Murray ruhig. »Vielleicht schaffen wir es, nach Einbruch der Dunkelheit das Heer zu erreichen.«
Ein übel gelaunter Fluch entfuhr dem hünenhaften Iren. Darauf blickten die beiden Offiziere ins Tal hinab, wo sie endlich die britische Kavallerie im Regen auftauchen sahen. Der französische Gardeoffizier entdeckte sie im selben Moment, und eine Trompete rief die Dragoner zusammen. Die Briten erkannten, dass der Feind auf sie vorbereitet war, und zogen sich zurück, da von ihrer Infanterie weit und breit nichts zu sehen war.
Die Schützen am Rand der Wolkenbank riefen ihrer zurückweichenden Kavallerie Verwünschungen nach. Murray fuhr herum. »Ruhe!«
Aber die Rufe hatten die Aufmerksamkeit der unberittenen Dragoner am Fuß des Hangs erregt. Sie nahmen an, der Lärm habe ihnen gegolten. Einige von ihnen nahmen ihre Musketen, andere griffen nach fallen gelassenen Gewehren. Dann feuerten sie eine unregelmäßige Salve auf die kleine Gruppe der Überlebenden ab.
Die Kugeln zischten und pfiffen an den Grünjacken vorbei. Die Salve verfehlte ihr Ziel, bis auf eine verhängnisvolle Kugel, die von einem Felsen abprallte und Captain Murray in die Seite drang. Die Wucht des Treffers ließ ihn herumwirbeln und warf ihn mit dem Gesicht nach unten zu Boden. Seine linke Hand suchte im dünnen Gras nach Halt, während er die Rechte gegen seine blutende Hüfte presste.
»Weiter! Lasst mich hier!« Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
Schütze Harper rannte den Hang hinab und nahm Murray in seine kräftigen Arme. Als er angehoben wurde, entfuhr dem Captain ein furchtbares, schmerzliches Stöhnen. Weiter unten kamen die Franzosen den Hang herauf. Sie gedachten, ihren Sieg komplett zu machen, indem sie die letzten Schützen gefangen nahmen.
»Mir nach!« Sharpe führte die kleine Schar in die Wolkenbank hinein. Die Franzosen feuerten ein zweites Mal und die Kugeln schwirrten, doch die Schützen waren jetzt in der weißen Nebelwand verborgen. Für den Moment waren sie jedenfalls in Sicherheit.
Sharpe fand eine Höhlung zwischen den Felsen, die ein wenig Schutz vor der Kälte bot. Die Verwundeten wurden niedergelegt und Posten ausgesandt, um das Umfeld zu bewachen. Murray war weiß wie ein Laken. »Ich hätte nicht geglaubt, dass sie uns schlagen könnten, Dick.«
»Ich verstehe nicht, wo die hergekommen sind.« Das narbige Gesicht des Lieutenants, fand Murray, verlieh ihm einen Ausdruck, als würde er einer Hinrichtung beiwohnen. »Die sind nicht an uns vorbeigekommen. Unmöglich!«
»Irgendwie müssen sie es geschafft haben.« Murray seufzte, dann winkte er Harper heran. Der schnallte mit einer Sanftheit, die bei einem derart riesigen Mann seltsam anmutete, den Degengurt des Captains ab und legte seine Wunde frei. Es war Harper anzusehen, dass er wusste, was er tat, daher entfernte sich Sharpe, um den nebligen Hang nach dem Feind abzusuchen.
Er konnte weder etwas sehen noch hören. Die Dragoner hielten die Schar der Überlebenden wohl für zu klein, um sich mit ihnen abzugeben. Die fünfzig Schützen waren zum Treibgut des Krieges geworden, eine Splittergruppe, Überrest eines Feldzugs, der dem Untergang geweiht war. Hätten die Franzosen gewusst, dass die Flüchtenden von einem Quartiermeister angeführt wurden, hätte sie das in ihrer Geringschätzung sicher noch bestärkt.
Aber dieser Quartiermeister hatte schon vor fünfzehn Jahren als einfacher Soldat des 33. Regiments in Flandern gegen die Franzosen gekämpft, allerdings hatte er dort nichts anderes getan, als ein paar Schüsse auf vom Nebel umhüllte Franzosen abzugeben. Doch fünf Jahre später in Indien hatte er an mörderischen Schlachten teilgenommen, und er hatte seither nichts anderes getan, als zu kämpfen.
Die gestrandeten Schützen mochten den Lieutenant ihren Quartiermeister nennen und dabei das Wort mit der ganzen Verachtung altgedienter Soldaten aussprechen, aber der Grund war, dass sie den Mann nicht kannten. Sie hielten ihn für nichts weiter als einen Emporkömmling, einen ehemaligen Sergeant, und darin irrten sie sich. Richard Sharpe war ein hervorragender Soldat, und er war als Kämpfer erfahrener als jeder in seiner Kompanie.
KAPITEL 2
In derselben Nacht führte Lieutenant Sharpe eine Patrouille über den Hügelkamm nach Westen. Er hatte gehofft, feststellen zu können, ob die Franzosen jene Stelle besetzt hielten, wo die Straße die Hügelkette durchquerte, doch in der eisigen Dunkelheit verlor er inmitten des Felsengewirrs die Orientierung und kehrte widerstrebend zu der Höhlung zurück, in der die Schützen Unterschlupf gefunden hatten.
Die Wolken verzogen sich noch vor Morgengrauen, sodass im ersten fahlen Licht der Hauptverband der französischen Verfolger im südlich gelegenen Tal zu erkennen war. Die feindliche Kavallerie war bereits gen Westen davongeritten. Was Sharpe zu sehen bekam, war Marschall Soults Infanterie, die sich hartnäckig an die Fersen von Sir John Moores Heer geheftet hatte.
»Himmeldonnerwetter, wir sind abgeschnitten.« Sergeant Williams äußerte diese pessimistische Einschätzung gegenüber Sharpe, der, statt ihm zu antworten, zu den Verwundeten trat.
Captain Murray lag zitternd unter einem halben Dutzend Mänteln in unruhigem Schlaf. Der Sergeant mit den Wunden an Hals und Schulter war in der Nacht gestorben. Sharpe bedeckte das Gesicht des Mannes mit einem Tschako.
»Das is’ ein nichtsnutziger Emporkömmling.« Williams warf einen abschätzigen Blick auf Lieutenant Sharpes Rücken. »Das is’ kein Offizier, Harps. Jedenfalls kein richtiger.«
Schütze Harper war dabei, sein Schwertbajonett zu schärfen, und er tat das mit der besessenen Konzentration eines Mannes, der weiß, dass sein Leben vom Zustand seiner Waffen abhängt.
»Kein echter Offizier«, fuhr Williams fort. »Kein Gentleman. Bloß ein Emporkömmling von einem Sergeant, stimmt’s?«
»Das ist er.« Harper sah den Lieutenant an und bemerkte die Narben im Gesicht des Offiziers und das entschlossene Kinn.
»Wenn der meint, er könnte mir befehlen, hat er sich verrechnet. Er is’ doch nicht besser als ich, oder?«
Harper antwortete bloß mit einem Grunzen und blieb dem Sergeant so die ersehnte Ermunterung schuldig. Williams wartete auf Harpers Unterstützung, doch der Ire beschränkte sich darauf, die Schneide seines Schwertbajonetts in Augenschein zu nehmen und dann die lange Klinge sorgfältig wegzustecken.
Williams spuckte aus. »Man braucht denen bloß eine verdammte Schärpe und einen Säbel umzuhängen, und schon halten sie sich für den lieben Gott persönlich. Der is’ nicht mal ein richtiger Schütze, bloß ein verdammter Quartiermeister, Harps!«
»Das ist er«, stimmte Harper zu.
»Ein Emporkömmling von einem Erbsenzähler, stimmt’s?«
Sharpe drehte sich rasch nach ihm um, und obwohl das völlig unmöglich war, hatte Williams das Gefühl, belauscht worden zu sein. Der Blick des Lieutenants war stahlhart. »Sergeant Williams!«
»Sir.« Obwohl er soeben verkündet hatte, er werde ihm nicht gehorchen, trat Williams eilfertig zu Lieutenant Sharpe.
»Wetterschutz.« Sharpe deutete ins nördliche Tal hinab, wo weit unter ihnen die Steinbauten eines Gehöfts allmählich aus dem abziehenden Nebel auftauchten. »Schafft die Verwundeten dorthinunter.«
Williams sog wie zweifelnd die Luft durch seine gelben Zähne ein. »Ich weiß nich’ recht, ob die Leute bewegt werden dürfen, Sir. Der Captain is’ …«
»Ich habe gesagt, Sie sollen die Verwundeten dort runterschaffen, Sergeant.« Sharpe hatte sich bereits entfernt, doch nun drehte er sich noch einmal um. »Von einer gottverdammten Diskussion war nicht die Rede. Also los.«
Sie brauchten einen Großteil des Morgens, aber dann war es ihnen gelungen, die Verwundeten zu dem verlassenen Gehöft hinunterzutragen. Das trockenste Gebäude war die steinerne Scheune, die auf Pfeilern errichtet war, um Ungeziefer fernzuhalten. Auf dem Dachfirst befanden sich Kreuze, sodass die Scheune aus der Entfernung wie eine kleine schmucklose Kirche aussah. Das eingefallene Wohnhaus und die Viehställe boten feuchtes, wurmstichiges Holz, das sich, klein gehackt und mit Schwarzpulver versetzt, zu einem Feuer entfachen ließ, an dem sich die Verwundeten wieder aufwärmen konnten. Schütze Hagman, ein zahnloser Mann im mittleren Alter, der aus der Grafschaft Cheshire stammte, machte sich auf die Suche nach Nahrung, während Sharpe auf den nach Osten und Westen verlaufenden Ziegenpfaden Posten aufstellte.
»Captain Murray geht’s nicht gut, Sir.« Sergeant Williams trat Sharpe in den Weg, als dieser zur Scheune zurückkehrte. »Er braucht einen Arzt, Sir.«
»Das wird sich kaum machen lassen, oder?«
»Es sei denn, wir – will sagen …« Der Sergeant, ein gedrungener, rotgesichtiger Mann, schaffte es nicht zu sagen, was er auf dem Herzen hatte.
»Es sei denn, wir ergeben uns den Franzosen?«, fragte Sharpe mit bitterer Stimme.
Williams blickte dem Lieutenant in die Augen. Es waren seltsame Augen, deren eisiger Blick in diesem Moment geradezu etwas Reptilhaftes hatte. Der Sergeant brachte genug Widerstandsgeist auf, seine Argumentation fortzuführen. »Die Froschfresser haben immerhin Feldärzte dabei, Sir.«
»In einer Stunde …«, Sharpes Stimme ließ erkennen, dass er Williams’ Worte überhört hatte, »… werde ich die Gewehre der Männer inspizieren. Stellen Sie sicher, dass sie bereit sind.«
Williams starrte den Offizier streitlustig an, brachte jedoch nicht den Mut auf, sich ihm zu widersetzen. Er nickte knapp und wandte sich ab.
Captain Murray saß in der Scheune, den Rücken an einen Haufen Säcke gelehnt. Er schenkte Sharpe ein schwaches Lächeln. »Was haben Sie vor?«
»Sergeant Williams meint, ich sollte Sie einem französischen Feldarzt übergeben.«
Murray schnitt eine Grimasse. »Ich habe gefragt, was Sie vorhaben.«
Sharpe ließ sich neben dem Captain nieder. »Den Anschluss suchen.«
Murray nickte. Er hatte einen Becher Tee in der Hand, das kostbare Geschenk eines der Schützen, der die Teeblätter in den Tiefen seiner Munitionstasche gehortet hatte. »Sie können mich hier zurücklassen.«
»Ich kann doch nicht einfach …«
»Ich werde sterben.« Murray zuckte mit den Schultern, um anzudeuten, dass er auf Sympathiebezeugungen verzichten konnte. Seine Wunde blutete nicht allzu stark, aber sein Bauch war inzwischen blau angeschwollen, was bedeutete, dass der Captain innere Blutungen hatte. Er wies mit dem Kopf auf die anderen drei Schwerverwundeten, alle mit tiefen Säbelverletzungen an Gesicht oder Rumpf. »Lassen Sie die ebenfalls zurück. Wohin werden Sie sich wenden? In Richtung Küste?«
Sharpe schüttelte den Kopf. »Wir können das Heer jetzt nicht mehr einholen.«
»Wahrscheinlich nicht.« Murray schloss die Augen.
Sharpe wartete. Es hatte wieder zu regnen begonnen, und durch ein Loch im Dach tropfte es unaufhörlich ins Feuer. Er überlegte, welche Möglichkeiten ihm noch blieben. Am Erfolg versprechendsten erschien ihm der Versuch, Sir John Moores Heer zu folgen, aber das zog sich in aller Eile zurück, und die Franzosen kontrollierten inzwischen die Straße, die Sharpe hätte nehmen müssen. Er war sich darüber im Klaren, dass er dieser Versuchung widerstehen musste, weil sie nur in Gefangenschaft enden konnte. Stattdessen musste er sich nach Süden wenden. Sir John war aus Lissabon aufgebrochen und hatte einige Einheiten zurückgelassen, um die portugiesische Hauptstadt zu beschützen. Vielleicht gab es diese Garnison noch, und vielleicht konnte Sharpe sie erreichen.
»Wie weit ist es nach Lissabon?«, fragte er Murray.
Der Captain öffnete die Augen und runzelte die Stirn. »Keine Ahnung. Vier-, fünfhundert Meilen?« Er zuckte zusammen, als ihn der Schmerz durchfuhr. »Wahrscheinlich sind es auf diesen Straßen eher sechshundert. Meinen Sie, wir haben da noch Soldaten?«
»Schlimmstenfalls könnten wir dort ein Schiff finden.«
»Wenn die Franzosen nicht vor Ihnen ankommen. Was halten Sie von Vigo?«
»Die Wahrscheinlichkeit, dass die Franzosen schon dort sind, ist größer als bei Lissabon.«
»Stimmt.« Die leichte Division war auf einer südlicher gelegenen Straße nach Vigo entsandt worden. Nur ein Teil der Truppe, darunter auch die Schützen, war zurückgeblieben, um Sir John Moores Rückzug abzusichern. »Vielleicht ist Lissabon doch am geeignetsten.« Murray blickte an Sharpe vorbei und sah, wie die Männer ihre Gewehrschlösser säuberten und ölten. Er seufzte. »Gehen Sie nicht zu hart mit ihnen um.«
»Tu ich nicht.« Sofort ging Sharpe in die Defensive.
Ein Lächeln huschte über Murrays Gesicht. »Haben Sie jemals unter dem Kommando eines Offiziers gestanden, der aus den Mannschaftsdienstgraden hervorgegangen war?«