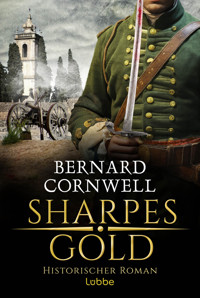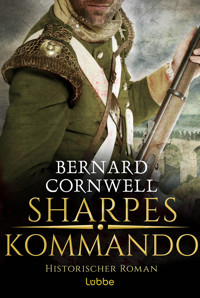
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
Richard Sharpe ist zurück auf dem Schlachtfeld - ein brandneues Abenteuer für Englands bekanntesten Haudegen!
Spanien, 1812. Erneut verlangen die Generäle von Major Sharpe das Unmögliche: Undercover soll er sich mit einer kleinen Truppe verwegener Kämpfer in ein Dorf weit hinter den feindlichen Linien begeben. Hier, hoch über der Almaraz-Brücke, wird sich die Zukunft Europas entscheiden. Zwei französische Armeen marschieren auf die Brücke zu - eine aus dem Norden, eine aus dem Süden. Können sie sich zu einer Streitmacht vereinen, sind die Briten verloren. Allein Sharpe und seine Männer stehen ihnen im Weg. Doch sie sind deutlich in der Unterzahl. Weitere, unbekannte Feinde agieren aus dem Verborgenen, und während die Franzosen immer näher an die Frontlinie heranrücken, wird die Zeit knapp ...
Band 23 der beliebten SHARPE-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10HISTORISCHE ANMERKUNGÜber dieses Buch
Richard Sharpe ist zurück auf dem Schlachtfeld – ein brandneues Abenteuer für Englands bekanntesten Haudegen! Spanien, 1812. Erneut verlangen die Generäle von Captain Sharpe das Unmögliche: Undercover soll er sich mit einer kleinen Truppe verwegener Kämpfer in ein Dorf weit hinter den feindlichen Linien begeben. Hier, hoch über der Almaraz-Brücke, wird sich die Zukunft Europas entscheiden. Zwei französische Armeen marschieren auf die Brücke zu – eine aus dem Norden, eine aus dem Süden. Können sie sich zu einer Streitmacht vereinen, sind die Briten verloren. Allein Sharpe und seine Männer stehen ihnen im Weg. Doch sie sind deutlich in der Unterzahl. Weitere, unbekannte Feinde agieren aus dem Verborgenen, und während die Franzosen immer näher an die Frontlinie heranrücken, wird die Zeit knapp …
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Reihe, die er in den 80er Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
HISTORISCHER ROMAN
Übersetzung aus dem Englischen vonRainer Schumacher
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der englischen Originalausgabe:
»Sharpes Command«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2023 by Bernard Cornwell
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- undData-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Rainer Delfs, Scheeßel
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © LianeM /shutterstock.com; Oskar Orsag /shutterstock.com; © Nik Keevil/arcangel
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-5604-4
luebbe.de
lesejury.de
Sharpes Kommandoist Clemens Amann gewidmetmit tausend Dank fürseine Großzügigkeit.
KAPITEL 1
Sharpe dachte gerade an Frühstück, als er getroffen wurde.
Er hatte die Wahl zwischen gepökeltem Schweine- und Rindfleisch, beides ohne Brot und so zäh wie Stiefelleder. Sharpe wollte gerade das Schweinefleisch nehmen, als er den Schuss hörte, doch von so weit weg, dass es nicht weiter wichtig schien. Er tat das noch als Schuss eines Jägers in den entfernten Hügeln ab, doch kaum hatte er das gedacht, da schlug die Kugel ein.
Sie traf Sharpe am linken Oberschenkel, prallte harmlos an der Metallscheide seines schweren Kavalleriesäbels ab und fiel zu Boden. Der Aufprall ließ Sharpe wanken. Er fluchte und rieb sich das Bein. Mit Sicherheit hatte er einen Bluterguss.
Sergeant Harper beugte sich über die Kugel. »Verdammt guter Schuss, Sir«, sagte er.
»Verdammt dämlicher Schuss«, knurrte Sharpe. Er schaute nach Nordosten und sah eine winzige Rauchfahne in der nahezu windstillen Luft. Der Rauch kam von einer Felsenkuppe, fast eine halbe Meile weit entfernt.
Sharpe rieb sich weiter das Bein. Er wusste, dass er Glück gehabt hatte – tatsächlich nannten seine Männer ihn »Lucky Sharpe« –, trotzdem war es einfach nur dumm, mit einer Muskete auf ein Ziel zu schießen, das eine halbe Meile weit entfernt war. Auf diese Entfernung verlor die Kugel so viel Energie, dass sie beim Aufprall fast keine Kraft mehr hatte und noch nicht einmal den Stoff von Sharpes Uniform durchdringen konnte. Ja, ein Bluterguss war geblieben, doch das war immer noch besser als ein Bleiklumpen tief im Fleisch. »Verdammte Froschfresser«, knurrte Sharpe wütend. »Schwein ist mir lieber.«
»Das war kein Franzmann«, erwiderte Harper und warf Sharpe die Musketenkugel zu, der sie mit einer Hand fing. »Das ist eine von unseren.«
Die Kugel war noch immer warm. Sie war kleiner als eine Gewehrkugel, aber größer als die aus einer französischen Muskete. Der Größenunterschied war zwar nur minimal, doch nach neunzehn Jahren im Dienste Seiner Majestät erkannte Sharpe das sofort. Mit sechzehn Jahren hatte er sich beim 33rd eingeschrieben, und seitdem hatte er in Flandern, Indien, Portugal und jetzt in Spanien gekämpft. 1799 hatte man ihn zum Sergeant befördert, und vier Jahre später hatte er sein Offizierspatent erhalten. Jetzt, im Frühling 1812, war er Major und trug das grüne Jackett eines Rifleman. Neunzehn Jahre voller Schlachten und jede einzelne davon als Infanterist. Deshalb wusste Sharpe auch, dass Harper recht hatte: Die auf eine lächerliche Entfernung abgefeuerte Kugel war britischen Ursprungs.
»Und da kommt Cupido«, warnte Harper.
»Nenn ihn nicht so«, tadelte ihn Sharpe.
»Warum nicht? So nennt ihn doch jeder«, erwiderte Harper. »Sie auch!«
»Sir! Sir!« Lieutenant Love stolperte vor lauter Eile. »Sind Sie verwundet, Sir? Ist es ernst?«
»Nichts passiert, Lieutenant.« Sharpe winkte ab. »Die Kugel hatte keine Kraft mehr.«
»Dann versperren die Franzosen also die Straße«, sagte Lieutenant Love und schaute in die Ferne. »Das sind schlechte Neuigkeiten, Sir.«
»Das sind nicht die verdammten Froschfresser«, erwiderte Sharpe. »Die Kugel kam von einem Partida.« Er benutzte das spanische Wort für die Guerillakämpfer, die den Franzosen in ganz Spanien das Leben zur Hölle machten. Er warf die Kugel weg und drehte sich zu den Bäumen um, wo seine Männer die Nacht verbracht hatten. »Dan! Siehst du da oben was?«
Daniel Hagman schaute zu der Hügelkuppe, wo sich die Rauchfahne langsam nach Osten verzog. Dann stiegen entlang des Felskamms plötzlich ein Dutzend weitere Rauchfahnen auf. Die Kugeln flogen Gott weiß wohin, und einen Augenblick später war auch das Knallen der Salve zu hören. »Die mögen uns wohl nicht, Mister Harper«, bemerkte Hagman amüsiert.
»Herrgott im Himmel!« Lieutenant Love war hinter den nächstbesten Baum gesprungen. »Partidas? Wirklich?«
»Wirklich«, bestätigte Sharpe in gleichmütigem Ton und schaute wieder zu Hagman. »Sag ihnen mal Hallo, Dan.«
»Mit Vergnügen.« Hagman grinste. Er legte sich auf den Rücken, klemmte das Gewehr zwischen die Füße und zielte über den Lauf hinweg. Sharpe sah, wie Dan die Waffe ein Stück nach links verschob, und er wusste, dass Hagman damit den leichten Wind ausgleichen wollte. »Soll ich einen abknallen, Mister Sharpe?«
»Mach ihnen nur ein wenig Angst.«
»Angst machen, jawohl«, sagte Hagman und drückte ab.
Der Knall des Gewehrs war klarer als der einer Muskete, und im Gegensatz zu einer Muskete war die Kugel eines Gewehrs auch noch auf eine halbe Meile tödlich. »Ich denke, der Kerl braucht eine frische Unterhose, Mister Sharpe«, sagte Hagman. Er stand auf und fischte eine neue Patrone aus seiner Tasche.
»Aber sind die Partidas nicht auf unserer Seite?« Lieutenant Love hatte den Schutz des Baums wieder verlassen. »Das sind doch unsere Verbündeten, oder?«
»Ja, das sind sie, Lieutenant, aber die Kerle da oben wissen nicht, dass wir Briten sind.«
Nervös schaute Lieutenant Love den Hügel hinauf, wo noch immer kleine Rauchfahnen zu sehen waren. »Sie halten uns für Franzosen?« Love klang ungläubig.
»Ja, davon gehe ich aus, Lieutenant.«
»Aber …«, begann Love.
»Sie glauben, alle Briten tragen Rot«, unterbrach Sharpe ihn. Er führte sechzehn Männer, und das waren Riflemen in den grünen Uniformen der 95th Rifles mit Ausnahme von Lieutenant Love, doch der trug auch nicht Rot, sondern die dunkelblaue Uniform der Royal Artillery. »Sie halten Sie für einen Offizier der Froschfresser und den Rest von uns für französische Dragoner.«
»Aber Dragoner haben doch Pferde, Sir!«
»Dragoner sind berittene Infanterie«, erklärte Sharpe, »oder zumindest sollen sie das sein.«
»Dann haben wir ein Problem, Sir«, sagte Love. Er straffte die Schultern und starrte kampflustig die lange Straße hinunter, die den Hügel hinaufführte. »Zwischen hier und dem Hügelkamm gibt es keine Deckung. Wie sollen wir da näher kommen, ohne massakriert zu werden. Ach, wenn ich doch nur einen Neunpfünder hätte!«
»Haben Sie aber nicht«, sagte Sharpe schroffer, als er beabsichtigt hatte, doch langsam hatte er keine Geduld mehr mit Lieutenant Courtney deVere Love, zumal auch diese Reise tief ins feindliche Spanien an seinen Nerven nagte. Eine weitere Musketensalve hallte durch die Luft, doch keine Kugel kam auch nur in die Nähe von Sharpe und seinen Männern.
»Mir kommt da ein Gedanke, Sir«, sagte Love eifrig und klammerte sich ans Heft seines leichten Kavalleriesäbels.
»Ach ja?«, erwiderte Sharpe.
»Ich habe noch ein weißes Ersatzhemd, Sir«, erklärte Love. »Bitte, gestatten Sie mir, es an meine Säbelspitze zu binden, als Parlamentärsfahne.«
»Und Sie glauben, die Partidas werden die weiße Fahne anerkennen?«
»Das sind doch Christen!«, entgegnete Love entrüstet. »Na ja, Papisten.«
»Lieutenant«, Sharpe zwang sich, ruhig zu bleiben, »mir ist egal, was sie sind, Papisten oder gottverdammte Methodisten. Wenn Sie da rausgehen und mit einer weißen Fahne wedeln, dann werden sie das als Zeichen der Schwäche deuten, warten, bis Sie in Reichweite sind und Sie dann abknallen.«
»Doch sicher nicht, Sir! Sind das nicht die, mit denen wir uns treffen sollen?«
»Vermutlich«, räumte Sharpe ein. »Aber das wissen die nicht. Und wenn sie eine blaue Uniform sehen, dann werden sie Sie als Zielscheibe benutzen. Und Sie sind ein großer Kerl.« Lieutenant Love war mindestens einen halben Fuß größer als Sharpe, allerdings nicht annähernd so breit. Tatsächlich war er so dünn wie ein Ladestock. »Und ich würde es hassen, Sie zu verlieren«, fügte Sharpe wenig überzeugend hinzu.
Lieutenant Love wirkte enttäuscht. »Und was machen wir dann?«
»Was auch immer Mister Sharpe vorschlägt«, erklärte Harper in festem Ton.
»Wir werden um die Scheißer herumgehen«, antwortete Sharpe. »Aber zuerst werden wir uns zwischen die Bäume zurückziehen.«
»Aber ich muss diese Straße inspizieren«, jammerte Love und deutete zu der Stelle, wo die Straße den Hügel hinaufführte. Dort feuerten noch immer die Musketen, doch die Kugeln schlugen entweder viel zu weit vorn ein, oder aber sie flogen in die kleinen, verkrüppelten Bäume, die in dem kleinen Tal wuchsen, wo ein ausgetrocknetes Bachbett nach Osten führte.
»Sie werden die verdammte Straße auch inspizieren«, sagte Sharpe und befahl seinen Männern, sich in den Schutz der Bäume zurückzuziehen. Mit ihrem Verschwinden verstummte auch das sinnlose Musketenfeuer.
»Werden Sie uns folgen?«, fragte Lieutenant Love nervös.
»Nicht, wenn sie auch nur einen Hauch von Verstand haben«, antwortete Sharpe. »Sie glauben, dass sie uns verjagt haben, und jetzt werden sie erst einmal warten, um sicherzugehen, dass wir nicht zurückkommen. Außerdem gehen sie davon aus, dass sie eine perfekte Verteidigungsposition haben, und das stimmt.«
»Und …«, begann Lieutenant Love.
»Und wir werden sie vom Hügelkamm vertreiben«, sagte Sharpe. Er führte seine Männer durch das ausgetrocknete Bachbett nach Osten. Versteckt hinter den Bäumen, führte es in ein deutlich breiteres und tieferes Tal, das sich von Süd nach Nord erstreckte. Sharpe wendete sich nach Norden. Zuerst marschierte er zum Talboden, wo Wasser über Felsen schäumte. »Halten Sie den Kopf unten, Lieutenant«, ermahnte er Love.
»Den Kopf unten?«
Sharpe folgte dem Wasser nach Norden, was hieß, dass sich der Hügelkamm mit den Schützen nun links von ihm befand. Das Tal war tief genug, sodass man es vom Hügel aus nicht sehen konnte, und genau das wollte Sharpe. »Sie sind ziemlich groß«, erklärte er Love. »Wenn Sie den Hügelkamm sehen können, dann können die Männer dort Sie auch sehen.«
»Ah!« Lieutenant Love duckte sich. »Sie wollen sie umgehen, korrekt, Sir?«
»Ich will die kleinen Scheißer lehren, dass sie ihre Munition nicht verschwenden sollen«, knurrte Sharpe. Die Tatsache, dass die Narren mit britischer Munition geschossen hatten, hatte ihn davon überzeugt, dass es sich um Spanier handeln musste, und zwar vermutlich genau um die, mit denen sie sich treffen sollten. Aber natürlich war es auch möglich, dass sie Franzosen gegenüberstanden. Dabei hatte man Sharpe versichert, dass er in diesen verlassenen Hügeln keine Froschfresser finden würde. Zwar gab es hier jede Menge französische Infanterie, doch die befand sich in Forts, sechs, sieben Meilen weit entfernt, und laut den Partidas verließen die Franzosen ihre Festungen nur, um Proviant zu requirieren, was nur selten der Fall war. Doch ein französischer Furagiertrupp wäre wohl kaum mit britischen Musketen bewaffnet. Also mussten die Schüsse von Guerilleros stammen, den spanischen Widerstandskämpfern, die die Franzosen hassten und einen grausamen Zermürbungskrieg gegen die Besatzer führten. »Wir müssen die Kerle nur finden und sie davon überzeugen, dass wir auf ihrer Seite sind«, sagte Sharpe.
Er führte seine Männer eine halbe Meile nach Norden. »Ich habe noch nicht gefrühstückt«, sagte er zu Sergeant Harper.
»Ich dafür für zwei«, erwiderte der große Ire. »Deshalb bin ich ja zur Armee gegangen. Hier gibt es immer genug zu essen.«
»Ich hoffe, du erstickst daran.«
»Es liegen zu lassen wäre Verschwendung gewesen.« Harper grinste.
Sharpe schaute zu seinen Männern zurück, die sich am Ufer ausruhten. »Dan! Komm her!«
Daniel Hagman, ein Wilderer aus Cheshire, trat neben Sharpe. »Mister Sharpe?«
»Der Hügelkamm ist da.« Sharpe deutete nach Westen. »Ich möchte, dass du ihn dir einmal ansiehst, Dan.«
»Mit Vergnügen, Mister Sharpe.«
»Willst du mein Fernrohr?«
»Nicht nötig.«
»Dann los.«
Hagman kletterte den steilen Hang des Hügels hinauf. »Darf ich ihn begleiten, Sir?«, fragte Lieutenant Love.
»Warten Sie lieber hier, Lieutenant. Ruhen Sie sich aus.«
»Ich muss mir wirklich diese Straße ansehen, Sir«, erklärte Love.
»Sie werden sie schon noch zu sehen bekommen. In einer Stunde werden Sie über sie laufen.«
»Dafür bete ich, Sir.«
»Dann beten Sie weiter, Lieutenant«, sagte Sharpe knapp und schaute nach oben, wo Daniel Hagman sich an einen Felsen gehockt hatte und konzentriert nach oben starrte.
»Wartet hier, Pat. Ich bin gleich wieder zurück«, sagte Sharpe und blickte zu Love. »Bleiben Sie bei Sergeant Harper, Lieutenant.«
»Natürlich, Sir«, antwortete der junge Artillerist.
Sharpe kletterte den Hang hinauf und blieb dabei auf dem Gras, damit er mit seinem schweren Säbel nicht an einen Felsen kam. Die letzten paar Yards wurde er immer langsamer und vorsichtiger. Dann hockte er sich neben Hagman und legte sein Gewehr auf einen Laubhaufen.
»Dreiundvierzig Pferde, Mister Sharpe«, berichtete Hagman, »und die Kerle sind immer noch auf dem Kamm.«
Sharpe konnte sie deutlich sehen, eine lange Reihe von Männern hoch oben auf dem Kamm, der von ihm wegführte. Die Männer waren zerlumpt und trugen größtenteils alte spanische Uniformen, die meisten geflickt und von der Sonne ausgebleicht. Nördlich von ihnen, hinter dem Kamm, waren die Pferde angebunden. Sharpe schaute wieder zu den Männern, die allesamt mit Musketen bewaffnet waren. »Sie glauben noch immer, wir seien südlich von ihnen.«
»Jedenfalls schauen sie da hin«, sagte Hagman. »Spanier.«
»Aye, das sind Guerilleros, vermutlich die, mit denen wir uns treffen sollen.«
»Soll ich noch mal auf sie schießen?«
»Besser nicht, Dan.«
Sharpe starrte noch ein paar Minuten den Hügel hinauf und schätzte, dass er problemlos am Südende des Hangs hinaufklettern könnte, ohne gesehen zu werden. »Ich will erst mal warten«, sagte er zu Dan. »Vielleicht verpissen sie sich ja.«
»Ich glaube, die sind halb eingeschlafen, Mister Sharpe.«
»Ein paar Minuten gebe ich ihnen noch.« Sharpe ging nach wie vor davon aus, dass er es mit den Männern zu tun hatte, mit denen er sich treffen sollte, doch anstatt sie zu erschrecken und weiteres Musketenfeuer zu provozieren, zog er es vor zu warten, bis sie sich zurückzogen. Wenn er dann den Kontakt herstellte, würde es hoffentlich friedlicher laufen. »Leg dich was hin, Dan«, sagte er. »Ich halte solange Wache. Aber schnarch nicht.«
Und Sharpe wartete.
»Worauf wartet er denn?«, fragte Lieutenant Love.
»Er wartet darauf, dass sie einschlafen, Sir«, antwortete Harper.
»Dass sie einschlafen?«
»Wenn sie einschlafen, kann man sie leichter um die Ecke bringen.«
»Sie um die Ecke bringen?« Love klang entsetzt. »Bei diesen Männern handelt es sich vermutlich um unsere Verbündeten!«
»Aye, Sir, aber sie haben auf Mister Sharpe geschossen, und niemand schießt auf Mister Sharpe, ohne dafür einen Tritt in den Arsch zu bekommen.«
»Er muss ihnen ihren Fehler verzeihen!«
»Mister Sharpe verzeiht nur ungern, Sir.«
»Wenn Major Sharpe unseren Verbündeten etwas antut, dann werde ich gezwungen sein, das zu melden.«
»Das wird nichts nützen, Sir.«
»Sergeant …«, begann Love.
»Tatsache ist«, unterbrach Harper ihn, »dass Mister Sharpe bei Nosey einen Stein im Brett hat.«
»Nosey …? Oh, Sie meinen Lord Wellington.«
»Wenn Nosey Ärger hat, Sir, dann schickt er Mister Sharpe, denn Mister Sharpe ist ein wahrer Teufel.«
»Ein Teufel?« Love klang schockiert.
»Sie haben ihn noch nicht kämpfen gesehen, Sir. Im Kampf ist er ein verdammter Wilder.«
Lieutenant Love blickte besorgt drein. »Ich hege keinerlei Zweifel an seiner Effizienz, Sergeant, aber das hier ist im Grunde eine Aufklärungs- und eine diplomatische Mission zu unseren Verbündeten. Da ist subtiles Vorgehen gefragt.«
»Aber sie haben uns geschickt, Sir, und das heißt im Grunde, dass sie wollen, dass irgendjemandem ordentlich der Arsch aufgerissen wird.«
»Achten Sie auf Ihre Wortwahl, Sergeant.«
»Natürlich, Sir. Verzeihung, verdammt, Sir.«
»Wir kommen, schauen uns um und gehen wieder«, erklärte Love. »Es besteht absolut kein Grund dafür, uns auf einen Kampf einzulassen.«
»Wir haben genug Aufklärungsoffiziere, deren Aufgabe es ist, sich umzuschauen, Sir, aber Nosey hat sich Mister Sharpe ausgesucht, und das heißt, dass er davon ausgeht, dass irgendwer verletzt werden wird. Vermutlich will er das sogar.«
»Aber unsere Befehle lauten herzukommen, uns umzuschauen und wieder zu gehen, ohne dass der Feind bemerkt, dass wir da waren.«
»Wir werden schon kundschaften, Sir. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Aber Mister Sharpe wird den Feind durchaus wissen lassen, dass wir hier sind.«
»Er wird den Befehl verweigern?« Love klang ungläubig.
»Wir reden hier von Mister Sharpe, Sir, und das ist, was er tut. Er ist der beste Soldat in der Armee, Sir, und deshalb mag Nosey ihn ja auch.«
Love schüttelte den Kopf. »Unser Nachrichtendienst hat berichtet, dass nicht weit von hier mindestens tausend Franzosen sind, und wir sind sechzehn. Major Sharpe ist doch kein Narr.«
»Das ist er in der Tat nicht, Sir«, stimmte Harper ihm zu. »Und die Froschfresser tun mir wirklich leid, denn sie haben nicht die geringste Ahnung, was da auf sie zukommt. Und er kommt, Sir. Jetzt.« Harper nickte den Hügel hinauf, wo Sharpe gerade in Richtung Bach kroch. »Wellingtons Teufel höchstpersönlich, Sir.«
Sharpe versammelte seine Männer am Bachufer. »Habt ihr eure Feldflaschen gefüllt?«, fragte er, und als alle nickten, schaute er den Hang hinauf zu Hagman. »Wir werden da raufgehen, Jungs«, erklärte er. »Einer nach dem anderen. Sergeant Harper und ich werden vorausgehen, und Sergeant Latimer und Lieutenant Love werden die Nachhut bilden.« Aus dem Augenwinkel heraus sah Sharpe, dass Love protestieren wollte, also sprach er rasch weiter. »Und wir werden uns anschleichen«, betonte er. »Achtet darauf, dass ihr mit dem Gewehrkolben nicht an einen Felsen kommt, und vor allem spannt nicht den Hahn. Die Idioten da oben sollten eigentlich auf unserer Seite sein. Also werden wir sie am Leben lassen.«
»Schade«, murmelte jemand.
»Gehen wir«, sagte Sharpe, doch bevor er wieder den Hang hinaufmarschieren konnte, fing Lieutenant Love ihn ab.
»Sollte ich nicht bei Ihnen sein, Sir?«
»Und was passiert, wenn einer der Kerle mich abknallt, Lieutenant?«
»So weit wird es doch nicht kommen, Sir.«
»Sie haben das doch schon mal versucht. Wenn ich sterbe, dann haben Sie das Kommando.« Und dann stehe Gott meinen Männern bei, ergänzte Sharpe im Geiste. »Einer von uns muss überleben. Deshalb werden Sie auch auf der sichersten Position marschieren. Und sollten die Scheißer mir tatsächlich eine Kugel in den Kopf jagen, Lieutenant, dann werden Sie auf Sergeant Harper hören. Er wird wissen, was zu tun ist.«
»Wir werden unsere Pflicht erfüllen, Sir!«, entgegnete Love.
»Und begraben Sie mich mit meinem Säbel, Lieutenant. Da, wo ich hingehe, werde ich eine gute Waffe brauchen.« Er ließ den schockierten Love zurück und stieg zu Harper hinauf. »Dieser verdammte Cupido«, knurrte Sharpe. »Ich habe ihm gesagt, er soll auf dich hören, wenn ich ins Gras beiße, aber an deiner Stelle würde ich ihm den dürren Hals durchschneiden, bevor er euch alle umbringt.«
»Mit Vergnügen, Sir«, erwiderte Harper.
Die beiden Männer stiegen langsam und so leise wie möglich den Hang hinauf. »Wer ist eigentlich der Kerl, mit dem wir uns treffen sollen?«, fragte Harper.
»Er nennt sich selbst El Héroe.«
»Der Held? Wirklich? Er ist aber nicht sehr gut.«
»Angeblich ist er einer der besten Guerillakämpfer in ganz Spanien.«
»Also ein echter Held, ja?«
»Woher soll ich das wissen, Pat? Vermutlich nicht.«
»Dann also nur Wunschdenken.« Harper trug sein Gewehr in der rechten Hand. Die monströse siebenläufige Flinte, die für die Royal Navy entwickelt worden war, hatte er sich über die linke Schulter geworfen. Ein einziges Steinschloss erzeugte eine gewaltige Explosion, die gleichzeitig sieben halbzollgroße Pistolenkugeln aus den sieben Läufen schleuderte. Die Navy hatte damit feindliche Scharfschützen aus der Takelage holen wollen, doch der Rückstoß der Waffe hatte vielen Männern die Schulter gebrochen. Nur wenige konnten sie wirklich nutzen. Harper war riesig, fast so groß wie Lieutenant Love und doppelt so breit. Deshalb konnte er die massive Waffe auch einsetzen.
»Ist dein Spielzeug geladen?«, fragte Sharpe.
»Natürlich.«
»Mal sehen. Vielleicht werden wir die Bastarde damit ja wecken.«
El Héroe mochte ja den Ruf haben, einer der besten Guerillaführer in Spanien zu sein, aber er hatte keine Wachen an seinen Flanken aufgestellt. Hätte Sharpe eine Kompanie französischer Voltigeure geführt, wären El Héroes Männer leichte Beute für ihn gewesen.
Sie stiegen immer höher, und als Sharpe nach rechts blickte, sah er weit im Norden ein silbernes Funkeln. Das musste der Fluss Tajo sein, dachte er, der sich auf seinem Weg zum Meer westwärts durch die Hügel wand. »Da müssen wir hin«, flüsterte Sharpe zu Harper und deutete zu dem weit entfernten Fluss.
»Dann also noch ein Tagesmarsch«, erwiderte der Ire.
»Weniger.« Sharpe kletterte weiter und vorbei an der Stelle, wo er die Guerilleros mit Hagman ausgespäht hatte. Dann bewegte er sich vorsichtig weiter auf die Flanke des Kamms, auf dem die Guerilleros warteten. Zwischen den großen grauen Felsen hielt Sharpe an. Von hier konnte er den ganzen Kamm überblicken und die Guerilleros sehen, die dort noch immer auf der Lauer lagen. Der nächste von ihnen war etwa zwanzig Yards entfernt, ein junger Mann mit langem schwarzen Haar und einer ausgeblichenen roten Jacke. Der junge Mann hielt eine britische Muskete in den Händen. Sie war gespannt.
Sharpe duckte sich wieder zurück und wartete, während sich seine Männer versammelten. Dann spannte er demonstrativ sein Gewehr. Die beiden Klicks kamen ihm unnatürlich laut vor, und sofort klickten auch die Waffen seiner Männer, doch von den Guerilleros kam kein Ton. Die Blicke der Spanier waren noch immer auf das Land im Süden fixiert.
»Dann weck sie mal, Pat«, sagte Sharpe.
Harper tauschte seine Baker Rifle gegen das Salvengewehr, drückte es in die Hüfte, spannte den Hahn und drückte ab. Die Waffe klang wie eine kleine Kanone, und sie spie im selben Augenblick eine dicke Wolke Pulverdampf aus, während sieben Kugeln in den Himmel flogen.
»Rauf da, Jungs!«, rief Sharpe und führte seine Männer auf den Kamm, wo sie mit den Gewehren im Anschlag eine Linie bildeten. Die Guerilleros sprangen rasch zurück. Das Geräusch des Salvengewehrs hatte sie erschreckt, und jetzt drehten sie sich zu den Riflemen um.
»Somos Ingleses!«, brüllte Sharpe. »Ingleses!«
»E Irlandés, ihr verpennten Bastarde!«, bellte Harper.
»Gewehre runter, Jungs, und sichern«, befahl Sharpe und rief dann noch einmal: »Somos Ingleses! Somos amigos!«
Ein Mann geriet in Panik und feuerte mit seiner Muskete, doch er war über hundert Yards entfernt, und die Kugel flog viel zu hoch. »Amigos!«, bellte Sharpe. »Ingleses!«
Irgendjemand rief etwas auf dem Kamm, und die Guerilleros senkten die Musketen. Allerdings starrten die meisten die Männer in den grünen Jacken weiter misstrauisch an, die so plötzlich in ihrer Flanke erschienen waren. Der Mann, der den Befehl gegeben hatte, ermahnte seine Männer noch einmal, das Feuer einzustellen, dann ging er in Begleitung von vier Gefährten auf Sharpe zu.
»Das muss dieser Held sein«, bemerkte Harper amüsiert.
Der Mann war eine außergewöhnliche Gestalt. Er trug eine makellose, leuchtend gelbe Uniform mit zwei gekreuzten weißen Schärpen. Seine Beine steckten in hohen Schaftstiefeln, und in einer Gürtelscheide steckte ein Säbel mit einem Knauf, der aus Gold zu sein schien, das man zu einem Löwenkopf geformt hatte. An der Hüfte war ein scharlachroter Streifen mit Goldkante zu sehen, und auf seinem schwarzen Zweispitz prangte ein weißer Federbusch, der mit jedem Yard wippte. »Das ist die Uniform eines Dragoners«, bemerkte Harper.
»Also gleicht er mehr einem Harlekin«, grunzte Sharpe.
Der gelbe Mantel hatte ein scharlachrotes Innenfutter und war üppig bestickt, alles in Silber. Ein goldener Stern hing dem Mann an einer blauen Schleife um den Hals, und die breiten weißen Seidenschärpen waren scharlachrot abgesetzt. Auch seine Kavalleriehose hatte auf beiden Seiten einen scharlachroten Streifen, und die hohen schwarzen Stiefel waren blankpoliert, die Sporen golden. Und der Spanier war ein großer Mann, nicht jung zwar, aber auch nicht alt. Sharpe schätzte, dass El Héroe so um die vierzig Jahre alt sein musste – wenn es denn wirklich El Héroe war.
»Hübscher Kerl«, flüsterte Harper, und das stimmte. El Héroe war genauso groß wie Sharpe und kräftig gebaut. Sein Gesicht mit den hellen blauen Augen und dem kantigen Kinn strahlte Selbstvertrauen aus. Knapp fünf Schritte von Sharpe entfernt blieb er stehen.
»Quién eres?«, verlangte er brüsk zu wissen.
»Major Sharpe, 95th Rifles«, antwortete Sharpe. »Und Sie sind?«
»Yo soy El Héroe«, verkündete der Spanier großspurig. »Hablas español?«
»Kein Wort«, log Sharpe.
»Glück für Sie«, sagte El Héroe langsam. »Ich spreche Englisch. Sie bringen Gewehre?« Sein Englisch war gut, aber schlicht.
»Ich bringe Ihnen Riflemen.«
»Ich verlange Gewehre!«
»Und die haben Sie jetzt«, sagte Sharpe, »zusammen mit Männern, die auch damit umgehen können.«
»Sie sind Major?«
»Ja, das bin ich.«
»Ich bin General. Sie gehorchen mir.«
»Ja, für gewöhnlich funktioniert das so«, sagte Sharpe.
»Sie geben mir Gewehre, Major.«
»Nein«, widersprach Sharpe.
El Héroe lachte, und tatsächlich wirkte er amüsiert. »Sie verweigern den ersten Befehl, Major. Ich mag Sie. Sie bringen auch Geld?«
»Gold«, antwortete Sharpe.
»Sie geben es mir jetzt«, verlangte El Héroe.
»Ich werde es Ihnen geben, wenn ich dazu bereit bin«, sagte Sharpe. Instinktiv mochte er El Héroe nicht. Natürlich wusste er, dass ein Teil dieses Missfallens vom Misstrauen eines Sergeants gegenüber Offizieren herrührte. Sergeants waren Männer, die etwas von ihrem Geschäft verstanden, und doch wurden sie oft von jungen Kerlen befehligt, die zwar sofortigen Gehorsam verlangten, aber weit weniger Ahnung vom Krieg hatten. Und Sharpe war eben einst Sergeant gewesen. »Sie werden Ihr Gold schon bekommen«, sagte er zu El Héroe, »und zwar, sobald Sie mir gesagt haben, was Sie von mir wollen.«
»Ich will, dass Sie Franzosen töten!« El Héroe hielt kurz inne und schaute erstaunt zu der großen, schlaksigen Gestalt von Lieutenant Love. »Wer sind Sie?«
»Lieutenant Love, Sir, Royal Artillery.«
»Sie bringen Kanonen?«
»Nein, Sir.«
»Dann warum sind Sie gekommen?« El Héroe winkte ab und drehte sich wieder zu Sharpe um. »Wir werden gehen, Franzosen töten, Major. Sie haben Pferde?«
»Wir sind Infanterie«, antwortete Sharpe gereizt. »Wir haben Schuhe.«
»Dann folgen Sie mir!«
Und Sharpe folgte ihm.
Alles hatte vor zehn Tagen begonnen, in Badajoz, der spanischen Grenzstadt, die die Briten erobert hatten. Sharpe hatte noch immer Albträume von diesem Angriff, von dem Graben voller qualmender Leichen, von den Feuern in dieser Nacht und von den Schreien der Sterbenden. Das South Essex, das Rotrock-Bataillon, zu dem auch Sharpes Riflemen gehörten, hatte den Befehl erhalten, in Badajoz zu bleiben, und dort war Sharpe dann zum Rapport bei Major-General Sir Rowland Hill bestellt worden.
»Daddy Hill« nannten die Männer ihn, ein Spitzname, der auf der Zuneigung seiner Soldaten gründete. Sharpe hatte Hill einmal getroffen, und es hatte ihn überrascht, wie jung Daddy Hill war, nicht älter als Sharpe selbst, und er schätzte sich auf fünfunddreißig. Mit Sicherheit wusste er das jedoch nicht, denn er war der Sohn einer Londoner Hure, die schon vor langer Zeit gestorben war, und er war in einem Arbeitshaus aufgewachsen, wo man keine Geburtstage kannte, geschweige denn feierte. Es hieß immer, man könne das Alter eines Pferdes an seinen Zähnen sehen, und Sharpe kamen seine Zähne eigentlich noch recht jung vor. Also könnte fünfunddreißig durchaus stimmen.
An einem kleinen Platz hatte General Hill Quartier in einem Haus bezogen. Es wurde von drei Männern in roten Röcken bewacht. Sie hatten die gelben Kragenspiegel des 29th, eines Regiments aus Worcestershire. Einer von ihnen, ein Sergeant, schaute Sharpe schief an. Er bemerkte zwar die rote Offiziersschärpe, aber auch die ausgeblichene, geflickte Jacke und das Gewehr an Sharpes rechter Schulter. Sharpe mochte ja auch einen Säbel tragen, doch eine Langwaffe gehörte nicht zu einem Offizier. »Was habt ihr hier zu suchen?«, verlangte der Sergeant brüsk zu wissen.
»Der zerlumpte Schuft hat sogar sehr viel hier zu suchen, Sergeant!«, rief eine Stimme von oben. »Major Sharpe! Willkommen!«
Sharpe schaute zum Fenster hinauf und grinste. Das war Major Michael Hogan, der da rief. »Himmel!«, sagte Sharpe. »Wenn Sie hier sind, dann haben wir wirklich Ärger!«
»Ich versuche nur, den Krieg zu gewinnen, Major! Und erstaunlicherweise brauche ich dafür Ihre Hilfe. Kommen Sie rauf.«
»Tut mir leid, Sir«, sagte der Sergeant leise. »Ich habe Sie nicht erkannt. Hätte ich gewusst, dass Sie Major Sharpe sind …« Und er ließ es darauf beruhen.
»Ich erkenne mich manchmal selbst nicht, Sergeant«, erwiderte Sharpe. »Geradeaus durch?«, fragte er und deutete aufs Haus.
»Und die Treppe rauf, Sir.«
Die Stufen führten zu einem großen Salon. An der Wand hing ein Kreuz. Dunkle Holzbalken stützten die Decke, und der Boden bestand aus poliertem Parkett. Ein großer runder Tisch stand zwischen den Fenstern, durch die man auf den Platz sehen konnte. Er war mit Karten bedeckt, und davor stand ein grinsender Major Hogan. »Ah, es ist wahrlich schön, Sie zu sehen, Richard! Sie sehen gut aus, wenn auch ein wenig dünn. Füttert die Armee Sie nicht richtig?«
»Eher friert die Hölle zu, als dass die Armee ihre Männer ernährt.« Fast hätte Sharpe sogar ein ›Sir‹ hinzugefügt. »Und Sie? Geht es Ihnen gut?«
»Bösen Menschen geht es immer gut«, antwortete Hogan fröhlich. »Ein Glas Wein? Er gehört General Hill. Also ist es mir egal.« Er goss Sharpe ein Glas ein. »Der General ist noch auf dem Abort. Er hat etwas gegessen, was er nicht hätte essen sollen.«
»Und Sie gehören jetzt zu seinem Stab?«
»Oh Gott, nein! Der Peer hat mich geschickt.« Damit meinte er Viscount Wellington. »Ich bin nur ein Handlanger, kein Held wie Sie.« Hogan brachte Sharpe das Glas. »Es tut wirklich gut, Sie zu sehen. Und ich war gestern in Elvas. Da habe ich Ihre Teresa gesehen. Sie sah fantastisch aus, und Ihre Tochter blüht und gedeiht. Was für ein strahlendes Kind! Sie sind wahrlich ein glücklicher Mann, Richard.«
»Ja, das bin ich«, erwiderte Sharpe. Sein Herz hatte einen Sprung gemacht, als Hogan Teresa erwähnt hatte. Sharpe hatte sie geheiratet und ihr eine Tochter geschenkt, doch nach den Schrecken von Badajoz war sie zu Verwandten in der portugiesischen Stadt Elvas gezogen. »Ich habe Teresa schon seit zwei Wochen nicht mehr gesehen«, sagte Sharpe verlegen. »Wir hatten viel zu tun.«
»Gottes Werk?«
»Das Begraben und Verbrennen von Toten scheint mir mehr das Werk des Teufels zu sein.«
»Und dafür sind Sie ideal«, erwiderte Hogan. »Und Sie könnten Teresa früher wiedersehen, als Sie glauben. Ich habe Arbeit für Sie beide.«
»Arbeit?«
»Lassen wir das den General erklären«, sagte Hogan und strich eine der Landkarten auf dem großen Tisch glatt. »Ein Kerl mit Namen Lopez hat die meisten dieser Karten angefertigt, und was hat der Mann für eine Vorstellungskraft! Er fügt genau dort Straßen hinzu, wo er glaubt, dass dort welche sein müssten. Trotzdem sind das die besten Karten, die wir haben, bis wir unsere eigenen erstellen.« Als er draußen Schritte hörte, berührte er Sharpe am Ellbogen. »Vergessen Sie nicht: Daddy mag kein Fluchen.« Hogan drehte sich um, als die Tür aufschwang und General Hill hereinkam, gefolgt von einem Adjutanten. »Sie sehen schon besser aus, Sir«, begrüßte Hogan ihn.
»Sie lügen wirklich, ohne rot zu werden, Hogan«, sagte Hill. Er sah blass aus. Daddy Hill war ein kräftiger, liebenswerter Mann, der sowohl für seine Güte als auch für die Ruhe bekannt war, die er in der Schlacht ausstrahlte. Er lächelte Sharpe an. »Sie müssen Major Sharpe sein. Wir haben uns doch schon mal getroffen, nicht wahr?«
»Vor Talavera, Sir. Ja.«
»Ich erinnere mich. Schön, Sie wiederzusehen, Major. Das hier ist Captain Pearce, einer meiner Adjutanten.« Der Captain nickte Sharpe respektvoll zu, auch wenn Sharpes zerlumptes Äußeres ihn zu erschrecken schien. Hill grinste. »Sie sind schon ein seltsamer Kerl, Major.«
»Bin ich das, Sir?«
»Ein Rifleman, der in einem County-Regiment dient? Wie ist das denn passiert?«
»Zufall, Sir. Wir wurden dem South Essex nur vorübergehend zugeteilt, sind dann jedoch geblieben.«
»Nun, dann teile ich Sie und Ihre Männer jetzt anderweitig ein. Wie viele Grünröcke haben Sie?«
»Fünfzehn, Sir.«
Hill verzog das Gesicht. »Reicht das?« Die Frage war an Hogan gerichtet.
»Wenn Major Sharpe sie führt, Sir, dann sind das mehr als genug. Und wir können ihn immer noch mit Señora Morenos Guerilleros verstärken.«
»Ich bin nicht sicher, ob mir die Idee gefällt, eine Frau in den Krieg zu schicken, Hogan.«
»Die Frau würde Ihnen da widersprechen, Sir. Teresa ist tödlich.«
»Die Welt verändert sich«, sagte Hill. »Ja, das tut sie. Aber lassen Sie uns sie trotzdem noch ein wenig mehr verändern.« Er ging zum Tisch und schaute auf die Landkarte, die ganz Portugal und den größten Teil von Westspanien zeigte. Die Karte war überwiegend leer. Nur die wichtigsten Städte waren als schwarze Punkte vermerkt, dazu ein Spinnennetz von Straßen. »Spanien und Portugal«, sagte Hill so stolz, als würden ihm die beiden Länder gehören.
»Für mich sieht das ziemlich leer aus«, bemerkte Sharpe.
»Das ist alles voller übler Franzmänner«, sagte Hill, »und Sie werden mir dabei helfen, sie rauszuwerfen.« Er nahm sich ein Stück Zeichenkohle und deutete damit auf die dünne Linie aus Punkten, die die Grenze zwischen Portugal und Spanien darstellte. »Uns gehört Portugal, und die Froschfresser haben Spanien. Wir müssen es ihnen abnehmen.«
»In der Tat, Sir«, sagte Sharpe, doch nur, weil Hill offensichtlich eine Antwort erwartete.
Der General beugte sich über die Karte und zeichnete mit der Kohle eine Linie von der portugiesischen Atlantikküste bis ins Herz Spaniens. »Das ist der Tajo, Sharpe. Er ist der längste Fluss Spaniens. Er teilt die Westhälfte der Halbinsel, und er ist ein verdammt breiter Fluss!«
»Ich habe ihn schon gesehen, Sir«, sagte Sharpe.
»Dann wissen Sie ja, dass man ihn nicht so leicht überqueren kann«, fuhr Hill fort. »Man braucht entweder eine Brücke oder eine Flotte von Booten, und zum Glück für die Froschfresser haben die Römer viele gute Brücken hinterlassen. Hier in Toledo …«, er stach mit der Kohle nach dem Ort, »… hier in Almaraz und hier in Alcántara.«
»Die Brücke in Almaraz ist nicht von den Römern errichtet worden, Sir«, warf Captain Pearce ein. »Sie stammt aus viel späterer Zeit.«
»Sie sind wahrlich eine stete Quelle des Wissens, Horace«, sagte Hill gutgelaunt. Mit seiner Holzkohle zeichnete er Kreise um die Brücken. »Diese Brücken sind wichtig, Major. Sie verbinden die französischen Armeen im Norden Spaniens mit ihren Streitkräften im Süden. Alcántara können sie vergessen. Die ist kaputt. Gleiches gilt zwar auch für die Brücke in Almaraz, doch die Kerle haben direkt daneben eine Pontonbrücke gebaut. Toledo wiederum können sie erst einmal behalten.« Er zeichnete einen weiteren Ring um die zentrale Brücke, also um den Ort mit Namen Almaraz. Dann zog er mehrere Linien in Richtung Süden. »Maréchal Soult ist hier unten, Major, zusammen mit 50 000 Mann. Hier oben …«, er zeichnete weitere Linien in das Land im Norden, »… hier haben wir es mit Général Marmont zu tun, der ebenfalls über 50 000 dieser ungewaschenen Schurken verfügt. Wenn der Peer …«, damit meinte er Viscount Wellington, »… beschließt, Monsieur Marmont anzugreifen, was wird Maréchal Soult dann tun?«
»Er wird losmarschieren, um Marmont zu helfen«, vermutete Sharpe.
»Und dann werden die Dreckskerle uns drei zu eins überlegen sein, und uns alle erwartet ein frühes Grab!«, rief Hill fröhlich. »Und wenn der Peer beschließt, Soult in den Hintern zu treten? Dann marschiert Marmont nach Süden. Unsere Aufgabe ist also, es den beiden so schwer wie möglich zu machen, einander zu helfen.«
»Indem wir den Fluss absperren.«
»Genau. Der Peer hat mir schon erzählt, was für ein kluger Kerl Sie sind.«
Hatte Wellington das wirklich gesagt?, fragte sich Sharpe. Doch dann vergaß er die Frage wieder, als Hill einen weiteren Kreis um die Brücke in Alcántara zeichnete. »Wie schon gesagt, können sie diese Brücke nicht verwenden. Sie ist zerstört. Wenn sie in Toledo übersetzen, ist uns das hingegen egal, denn von dort ist es ein verdammt langer Marsch ins Landesinnere, und sie würden mindestens zwei Wochen brauchen, um eine Armee von einem Ufer des Flusses ans andere zu bringen. Und wenn sie Truppen durch Talavera schicken, würde das sogar noch länger dauern.« Der General zeichnete einen weiteren Kreis weiter landeinwärts von Toledo. »Da haben Sie doch einen Adler erbeutet. Stimmt das?«
»Ja, das habe ich, Sir.«
»Dann sind Sie wahrlich ein toller Kerl, Sharpe! Die Dreckskerle haben also die Brücken in Toledo und Talavera, aber wir müssen ihnen nur die Pontonbrücke in Almaraz abnehmen.« Er stach so fest mit der Zeichenkohle zu, dass sie zerbrach und sich schwarze Splitter auf der schneeweißen Karte verteilten. »Das Problem ist nur, dass die Froschfresser keine Narren sind. Sie wissen genau, wie wertvoll die Brücke von Almaraz für sie ist. Deshalb schützen sie sie auch mit zwei Forts und vorgelagerten Bastionen. Die kleinen Dinger sind verdammt hart zu knacken, und sie haben Geschütze. Horace?«
Gehorsam holte Pearce eine weitere Karte hervor, diesmal eine eher grob gezeichnete mit dem Fluss in der Mitte. Die Brücke von Almaraz war als eine Linie von kleinen Booten dargestellt, während ein Stück flussaufwärts eine weitere Brücke mit einem klaffenden Loch zu sehen war. »Die alte Steinbrücke«, erklärte Hill, »ist ebenfalls zerstört. Allerdings haben wir Informationen, dass die Franzosen versuchen, sie zu reparieren.« Er deutete mit seiner Zeichenkohle auf die Pontonbrücke und dann auf ein mit Tinte gemaltes Quadrat südlich davon. »Das ist Fort Napoléon«, sagte er. »Es verfügt vermutlich über sieben oder acht Kanonen, und es hat eine Garnison von drei-, vierhundert Mann.« Er tippte auf ein weiteres Quadrat nördlich des Flusses. »Und das ist Fort Ragusa mit einer ähnlichen Garnison. Beide Forts sichern die Pontonbrücke. Also können wir nicht zu den Booten, ohne unter Beschuss zu geraten. Außerdem gibt es noch zwei kleinere Befestigungen auf beiden Seiten der Brücke, eine im Süden und eine im Norden.«
»Têtes de pont-Bastionen«, murmelte der Adjutant.
»Danke, Horace«, sagte Hill mit einem Hauch von Sarkasmus in der Stimme. »Wir werden uns ihnen von Westen nähern.« Das war wieder an Sharpe gerichtet. »Aber oben in den Hügeln gibt es eine alte Burg mit Namen …« Er zögerte.
»Miravete«, half der Adjutant.
»Miravete«, fuhr Hill fort, als hätte er die Hilfe gar nicht gebraucht. »Die Froschfresser haben sie neu befestigt und Kanonen dort stationiert, damit niemand sich der Brücke von Westen nähern kann. Und Burg Miravete ist eine verdammt harte Nuss, nicht wahr, Hogan?«
»Dafür brauchen wir Belagerungsartillerie«, sagte Hogan.
»Und die müssen wir über hundert Meilen heranbringen. Aber man hat mir nun einmal befohlen, die Pontonbrücke zu zerstören«, fuhr Hill fort. »Und um zur Brücke zu gelangen, muss ich zuerst Burg Miravete in Schutt und Asche legen, was den Franzmännern genügend Zeit geben wird, die Forts am Fluss zu verstärken. In einer idealen Welt – und Gott weiß, dass diese hier das nicht ist – müsste ich die Geschütze einfach nur an der Burg vorbeibringen, um dann zuerst die Forts auszuschalten. Und? Irgendeine Idee, Sharpe?«
Sharpe starrte auf die Karte. »Es muss doch einen Weg um die Burg herum geben, Sir.«
»Ja, den gibt es. In diesen Hügeln treibt sich ein Kerl herum, der sich selbst El Héroe nennt und behauptet, es gebe einen Pfad, auf dem man ungesehen an der Burg vorbeikommen kann. Er geht davon aus, dass wir über diesen Pfad schleichen und Fort Napoléon angreifen können, bevor die Froschfresser in Miravete überhaupt nur aufgewacht sind.«
»Und ist dieser El Héroe vertrauenswürdig?«, fragte Sharpe.
»Er behauptet, der beste Guerillaführer in ganz Spanien zu sein«, antwortete Hogan. Sharpe hörte deutlich den Zweifel in der Stimme seines alten Freundes.
»Wirklich?«
»Das hat er uns selbst gesagt«, erklärte Hogan. »Aber die Wahrheit ist, dass wir nur sehr wenig über El Héroe wissen. Einer unserer Kundschafter hat ihn getroffen, und er berichtet, dass El Héroe eine äußerst hohe Meinung von sich hat. Ob das nun berechtigt ist oder nicht, das weiß man nicht. In jedem Fall liebt El Héroe Geld – so viel wissen wir –, und wir bezahlen ihn gut für die Informationen, die er uns zukommen lässt und die sich bis jetzt als durchaus nützlich erwiesen haben. Er hat versprochen, uns zu helfen.«
»Zu einem Preis«, warf Horace trocken ein.
»In der Tat. Zu einem Preis«, bestätigte Hogan. »Unser Held will britische Gewehre und tausend Guineas in Gold. Dafür wird er die Arbeiten an der alten Brücke zerstören.«
»Die Arbeiten, Sir?«
Hill bewegte seinen von der Holzkohle schwarzen Finger zu der alten Brücke, die von der Pontonbrücke aus gesehen ein Stück flussaufwärts lag. »Das ist die alte Brücke. Die Spanier haben den Nordbogen vor drei Jahren gesprengt, um zu verhindern, dass die Froschfresser den Fluss überqueren. Jetzt sagt uns El Héroe, dass die Franzosen dort ein Lager mit Pionieren haben, die versuchen, die Brücke wieder instand zu setzen. Deshalb müssen wir auch mehr über dieses Lager herausfinden, vor allem, wie gut es verteidigt ist.«
»Wie weit ist die alte Brücke von der neuen entfernt?«, hakte Sharpe nach.
Hill schaute zu Captain Pearce. »Etwas mehr als eine halbe Meile«, sagte der Adjutant.
»Wenn wir die Forts einnehmen«, überlegte Sharpe laut, »dann ist die alte Brücke doch nicht mehr zu verteidigen.«
»Und um die Forts zu erobern«, fügte Hill ernst hinzu, »brauche ich Artillerie. Schwere Artillerie, und ich muss sie über hundert Meilen transportieren, vorbei an Burg Miravete und zum Fluss. Deshalb muss ich im Vorfeld wissen, ob das überhaupt möglich ist.«
»Also bis Burg Miravete geht das in jedem Fall«, sagte Hogan. »Die letzten Meilen zum Fluss sind das Problem, und darüber wissen wir so gut wie nichts. Wenn wir die Burg nicht im Handstreich nehmen, dann können wir die Hauptstraße zur Brücke nicht nutzen, und das wiederum heißt, dass wir die Geschütze durch die Hügel ziehen müssen, und das ist vielleicht nicht möglich.«
»Sie wollen also meine Meinung dazu hören. Korrekt, Sir?«, fragte Sharpe.
»Ja, und deshalb wird Sie auch ein Artillerieoffizier begleiten. Lieutenant Love.«
»Cupido«, warf Hogan schelmisch ein.
»Lieutenant Love«, korrigierte Hill ihn streng, »wird sich als Experte eine Meinung darüber bilden, ob es möglich ist, schwere Geschütze heranzuführen, um damit Fort Napoléon anzugreifen. Ihre Aufgabe, Major, ist es, den Lieutenant zu beschützen und die Fähigkeit der Forts einzuschätzen, unserem Angriff zu widerstehen. Dabei wäre es das Beste, wenn die Franzosen nichts von Ihrer Gegenwart erfahren würden.«
»Und Sie müssen abschätzen, ob El Héroes Männer für uns von Nutzen sein können«, fügte Hogan hinzu.
»Und ich fürchte, er wird nicht glücklich mit Ihnen sein«, warf Hills Adjutant ein. »Er hat tausend Guineas in Gold verlangt, aber wir werden ihm nur hundert schicken. Außerdem hat er fünfzig Baker Rifles gefordert, doch stattdessen schicken wir fünfzehn Riflemen.«
»Und eines noch, Richard«, sagte Hogan leise. »Wir haben El Héroe nichts davon erzählt, dass wir die Brücke angreifen wollen, und wir wollen auch nicht, dass er davon erfährt. Lassen Sie ihn in dem Glauben, dass Sie sich auf einer Aufklärungsmission befinden, mehr nicht. Wenn er weiß, dass wir mit einer Streitmacht kommen, dann wird er seinen Männern davon erzählen, und solche Nachrichten verbreiten sich rasch.«
»Und irgendwann erreichen sie dann ohne Zweifel auch den Feind«, fügte Hill säuerlich hinzu.
»Ich werde den Mund halten, Sir«, versprach Sharpe. »Aber für mich klingt das, als würden Sie El Héroe nicht wirklich vertrauen.«
»Wir kennen ihn schlicht nicht«, gab Hogan zu. »Aber wenn er nichts taugt, dann haben Sie immer noch La Agujas Männer.«
»Und La Aguja selbst?«, fragte Sharpe. Der Spitzname bedeutete ›Die Nadel‹.
»Wenn es Franzmänner zu töten gilt, dann werde ich Teresa nicht zurückhalten können. Es ist ganz einfach, Richard. Marschieren Sie hundert Meilen hinter die feindlichen Linien, schnüffeln Sie ein wenig an den Forts herum, und dann kommen Sie wieder zurück und erzählen uns, was Sie herausgefunden haben. Was kann da schon schiefgehen?«
Sharpe schwieg.
El Héroe schwang sich auf einen schönen weißen Hengst. Selbst für jemanden, der so wenig Ahnung von Pferden hatte wie Sharpe, war das ein wunderbares Tier. Der Sattel sah neu aus, und das Zaumzeug war mit Silber beschlagen. Der Rest von El Héroes Männern ritt zerzauste Klepper, doch der Held hatte ein Pferd, das dem Kampfnamen seines Reiters würdig war. »Schönes Tier«, bemerkte Sharpe.
»Ich habe vier davon! Erbeutet von den Franzosen, Major. Das hier wurde von einem Colonel geritten, wie ich.«
»Sie sind jetzt Colonel?«
»Ich war Colonel der de la Reina-Dragoner, Major. Jetzt bin ich General. Sie können mich Señor nennen.«
Viele Guerilleros hatten in der spanischen Armee gedient, bevor sie von den französischen Invasoren zerschlagen worden war. Tatsächlich trugen die meisten von El Héroes Männern noch immer die zerlumpten Überreste ihrer alten Uniformen, vielfach geflickt mit schlichtem braunen Tuch. »Und wo sind die de la Reina-Dragoner jetzt?«, fragte Sharpe und verzichtete absichtlich auf das Señor.
»Ich hoffe, sie kämpfen gegen den Feind«, antwortete El Héroe sorglos. »Ein paar von ihnen sehen Sie hier. Aber wenn ich mit dem Finger schnippe, werden mehr kommen. Ich habe Männer in jeder Stadt und jedem Dorf! Wie hätte ich sonst wohl gewusst, dass Sie kommen? Meine Männer in Jaraicejo haben Sie gesehen und mir eine Warnung geschickt.«
Letzteres erklärte, warum El Héroe den Hinterhalt auf der Hauptstraße gelegt hatte, doch es überzeugte Sharpe nicht im Mindesten davon, dass der Mann tatsächlich Hunderte von Kämpfern mobilisieren konnte. Sharpe wollte den Kerl noch mehr fragen, doch Lieutenant Love trat an ihm vorbei.
»Señor!« Lieutenant Love stand dicht an El Héroes Pferd. »Sie müssen mir die Straße zeigen, die um Burg Miravete herumführt. Es ist äußerst dringend!«
»Warum dringend?«, fragte El Héroe.
»Weil mein General mir das befohlen hat, Señor«, antwortete Love offensichtlich bemüht, General Hills Plan nicht zu verraten.
»Und warum will er das wissen?«, hakte El Héroe nach. »Er plant hierherzukommen?«
»Nein, nein«, sagte Love rasch und lief rot an.
»Der General muss über jeden Übergang über den Tajo informiert sein«, sagte Sharpe und hoffte, dass Lieutenant Loves Übereifer General Hills Absichten nicht schon verraten hatte. »Und wir brauchen Karten, akkurate Karten. Das machen wir im gesamten Grenzgebiet.«
»Ich werde Ihnen die Straße um Miravete zeigen«, sagte El Héroe, »aber zuerst geben Sie mir Gold und Gewehre. Jetzt kommen Sie.« Er gab seinem Pferd die Sporen, und die Briten folgten ihm auf einem Pfad, der in Richtung Nordost und um einen hohen Hügel führte, von dem Sharpe annahm, dass man von dort den Tajo sehen konnte. El Héroe hatte keine Kundschafter vorausgeschickt. Offenbar war er fest davon überzeugt, dass die Franzosen keine Patrouillen im Hochland hatten.
Sharpe war sich da jedoch nicht so sicher. Der Morgen hatte mit einer Musketensalve von El Héroes Männern begonnen, und dieses Geräusch war mit Sicherheit bis zu den Forts am Fluss gehallt. Ein einzelner Schuss konnte auch von einem Jäger stammen, doch eine Salve bedeutete Soldaten, und hätte Sharpe den Befehl über die Wachen an der Pontonbrücke gehabt, dann hätte er Männer losgeschickt, um die Quelle des Geräuschs zu erkunden. El Héroe hingegen winkte einfach ab. »Sie fürchten mich!«, versicherte er Sharpe. »Sie bleiben in ihren Forts, und ich beherrsche das Land!«
»Verdammt selbstbewusst, der Kerl«, sagte Harper zu Sharpe.
»Er ist ja auch ein Held, Pat.«
»Aye. Und wer hat ihm den Namen gegeben?«
»Seine Männer?«
»Eher er selbst«, sagte Harper. Er suchte den Horizont im Norden nach Hinweisen auf Franzosen ab. »Und er ist ein verdammter Angeber. Er versucht ja noch nicht einmal, sich zu verstecken.«
»Er sagt, das müsse er nicht. Er sagt, er würde das Land beherrschen.«
»Aye. Und ich bin der König von Donegal!«
»Er könnte durchaus recht haben«, sagte Sharpe vorsichtig. Falls General Hill recht hatte und die Franzosen tatsächlich gut eintausend Mann in den Forts um die Brücken zusammengezogen hatten, die meisten davon an der Pontonbrücke und eine kleinere Garnison in Burg Miravete, dann handelte es sich vermutlich entweder um Infanterie, Artillerie oder Pioniere. »Rechnen wir mal mit sechs- bis siebenhundert Froschfresser-Infanteristen«, sagte Sharpe, »und um in diesen Hügeln zu patrouillieren, braucht man mindestens zwei Kompanien. Dann ist El Héroe ihnen vermutlich zweifach überlegen. Auf die Art würden sie jeden Tag Männer verlieren, und dabei haben sie von Anfang an nicht genug. Wie es aussieht, sitzen die Froschfresser fest.«
»Wenn El Héroe so gegen sie kämpft wie heute Morgen«, sagte Harper bissig, »dann können die Froschfresser ihn getrost ignorieren.«
»Das waren nur Warnschüsse«, erwiderte Sharpe. »Er hat gehofft, dass wir umkehren würden.«
»Dann fehlen ihm also die Nerven zum Kampf.«
»Wir werden sehen«, sagte Sharpe. In Wahrheit teilte er Harpers Misstrauen El Héroe gegenüber, doch er wusste, dass er sich auf die Guerilleros verlassen musste, um die Forts auszukundschaften, und er wollte die Männer nicht mit seinem Misstrauen anstecken.
El Héroe führte sie in ein Hochlanddorf, an einen Ort mit kleinen Häusern und ummauerten Schafpferchen. »Hier bleiben wir«, verkündete El Héroe. »Und jetzt das Gold, Major.«
Die Guineas waren unter Sharpes Riflemen verteilt, und Sharpe hegte keinerlei Zweifel daran, dass ein paar seiner Männer sich daran bedient hatten. Tatsächlich hatte auch er ein paar Münzen in seiner Patronentasche verschwinden lassen. Dennoch war ein funkelnder Haufen davon übrig geblieben, der nun auf den schlichten Tisch in dem Haus geschüttet wurde, das El Héroe ihnen als Quartier zugeteilt hatte. Der Haufen war groß genug, um El Héroe zufriedenzustellen, der sofort eine der Münzen zwischen den Fingern rieb und dann hineinbiss. »Ich nehme das jetzt«, verkündete er großspurig und deutete auf die Münzen, »und kaufe Kanonen.«