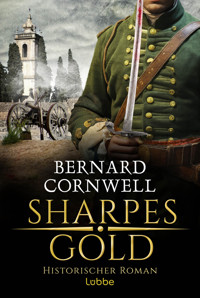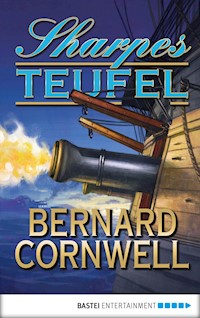
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sharpe-Serie
- Sprache: Deutsch
1820. Fünf Jahre ist es her, dass Richard Sharpe den Säbel ablegte. Seither führt er mit seiner Frau ein beschauliches Leben in der Normandie. Doch sein Ruhestand nimmt ein jähes Ende, als er nach Chile gerufen wird, wo er den vermissten Don Blas Vivar ausfindig machen soll. Der Verschwundene ist nicht nur ein alter Freund Sharpes, sondern auch der Generalkapitän von Chile. Sharpe zögert keine Sekunde und begibt sich auf die gefährliche Reise. An seiner Seite: Patrick Harper. Doch ehe er und Harper Südamerika erreichen, kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Vorwort
Prolog
TEIL I – BAUTISTA
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
TEIL II – COCHRANE
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
TEIL III – VIVAR
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
Epilog
Historische Anmerkung
Über den Autor
Bernard Cornwell wurde 1944 in London geboren. Er arbeitete lange für die BBC, unter anderem in Nordirland, wo er seine Frau kennenlernte. Heute lebt er die meiste Zeit in den USA. Er ist Autor zahlreicher international erfolgreicher historischer Romane und Thriller. Die Sharpe-Serie, die er in den 80er-Jahren zu schreiben begann, hat Kultstatus erreicht und wurde von der BBC mit Sean Bean in der Hauptrolle verfilmt.
BERNARDCORNWELL
SHARPESTEUFEL
Aus dem Englischen von Rainer Schumacher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Vollständige Taschenbuchausgabe
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1993 by Bernard Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe: »Sharpe’s Devil«
Published by arrangement with Marco Vigevani & Associati Agenzia Letteraria, on behalf of Toby Eady Associates Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Rainer Delfs
Titelillustration: © Bao Pham
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
eBook-Erstellung: Olders DTP.company, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5590-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Vorwort
In der Nacht zum 6. März 1815 floh ein Mann aus dem King’s-Bench-Gefängnis in London. Er kletterte aus dem Fenster seiner Zelle und aufs Dach. Von dort warf er ein Seil, das er aus kleinen, ins Gefängnis geschmuggelten Kordeln geflochten hatte, über die Eisendornen auf der Außenmauer des Gefängnisses. Das andere Ende des Seils vertäute er auf dem Dach. Dann hangelte er sich daran entlang zur Mauer. Vorsichtig balancierte er um die Eisendornen herum und ließ ein zweites Seil zur Straße hinab. Dieses Seil riss jedoch, als er daran hing, und er stürzte. Allerdings war er nur leicht benommen und nicht schwer verletzt. Rasch verschwand er in der Dunkelheit. Am nächsten Tag erschienen Plakate mit der Beschreibung des Flüchtigen an den Mauern Londons: »Ungefähr fünf Fuß, elf Inch groß, schlank mit schmaler Brust, sandfarbenem Haar und runden Augen, rotem Schnurrbart und roten Augenbrauen.« Auf den Kopf des Mannes wurde eine Belohnung von dreihundert Guineas ausgesetzt.
Der schmalbrüstige Mann mit dem sandfarbenen Haar war einer der größten Helden der Napoleonischen Kriege, ein Mann, der sowohl Horatio Hornblower als auch Captain Jack Aubrey inspiriert hat. Es handelte sich um Admiral Thomas Cochrane, den Earl of Dundonald und den Teufel im Titel dieses Buches. Die nackten Tatsachen seines Lebens werden im Roman erklärt, also werde ich sie hier nicht wiederholen. Es sei nur erwähnt, dass seine Haft etwas mit einem Börsenskandal zu tun hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren Cochranes Feinde dafür verantwortlich, und davon hatte er viele. Er kämpfte sein ganzes Leben lang für seine Rehabilitierung, und tatsächlich wurde er fünfundachtzig Jahre alt. Es existiert sogar ein Foto von ihm. Es zeigt ihn in hohem Alter. Trotzdem ist er noch eine beeindruckende Gestalt. Auf dem Bild trägt er eine mit Orden behangene Uniform, doch es ist vor allem sein von einer wilden weißen Mähne eingerahmtes Gesicht, was den Betrachter beeindruckt. Es ist irgendwie seltsam, sich das Foto eines Mannes anzusehen, von dem man weiß, dass er einst feindliche Fregatten geentert hat. Auf Seite 74 von Philip Haythornthwaites Who Was Who in the Napoleonic Wars ist es abgedruckt.
Cochrane war ein großartiger Seemann und Kämpfer, doch besonnen war er nie. Nach den Napoleonischen Kriegen begab er sich auf die Suche nach neuen Schlachtfeldern, und so nahm er an den chilenischen, brasilianischen und griechischen Unabhängigkeitskämpfen teil. Diese Geschichte erzählt von seinen Siegen beim ersten dieser Kämpfe. Doch noch während er gegen die spanischen Imperialisten kämpfte, verschwor er sich gegen seine chilenischen Arbeitgeber und plante das Unmögliche: die Vereinigten Staaten von Südamerika. Solch ein Gebilde hätte natürlich auch einen Herrscher gebraucht, und Cochrane kannte genau den richtigen Mann dafür, und das war niemand anderer als Napoleon Bonaparte, der zu diesem Zeitpunkt sein Leben auf Sankt Helena fristete.
Wir schreiben das Jahr 1821, und Napoleon ist schon seit sechs Jahren auf Sankt Helena, dabei ist er erst fünfzig Jahre alt. In diesen sechs Jahren hat er vor allem an seiner eigenen Legende gearbeitet. Er schrieb die Geschichte um und erklärte Opportunismus zu Ruhm. Es gab eine ganze Reihe wilder Ideen, wie man ihn befreien könnte, doch keine war so wild wie Cochranes. Dennoch war es ausgerechnet die, die man fast verwirklicht hätte. Aber warum wollte Cochrane seinen einstigen Feind überhaupt retten? Ich nehme an, der Grund dafür war, dass sie beide Abenteurer waren, und nach Waterloo konnte man in Europa nur noch wenige Abenteuer erleben. Tausende Männer wie Cochrane waren nun überflüssig, und sie langweilten sich. Sie sehnten sich nach der Aufregung der langen Kriege gegen die Franzosen.
Sharpe hat sich jedoch in der Normandie niedergelassen. Ich nehme an, er hatte genug Aufregung für ein Leben, und ich stelle mir gern vor, wie er in seinem selbst gewählten Exil in hohem Alter stirbt. Ohne Zweifel hätte er genauso beeindruckend ausgesehen wie Cochrane, hätte man auch ihn in seinen letzten Jahren fotografiert. Und es gab viele wie ihn: alte Soldaten und Seemänner, die die Erinnerungen an Waterloo und Trafalgar, an Salamanca und Badajoz bis ins Viktorianische Zeitalter trugen. Irgendwann in dieser Zeit muss auch Sharpe, unsichtbar für uns, seinen letzten Atemzug getan haben.
Prolog
Da waren sechzehn Männer und nur zwölf Maultiere. Doch keiner der Männer war bereit, die Reise abzubrechen, und dementsprechend gereizt war die Stimmung. Dass es auch noch unerträglich schwül war, machte es nicht besser. Die sechzehn Männer warteten am Ufer, wo die schwarzen Basaltklippen den kleinen Hafen umrahmten und wo der Wind einem wenigstens etwas Erleichterung verschaffte. Irgendwo in den Hügeln grollte der Donner.
Von den sechzehn Männern waren fünfzehn in Uniform, nur einer trug einen braunen Wollmantel. Verschwitzt und ungeduldig standen sie im Schatten dichter immergrüner Bäume, während sich die zwölf Maultiere, die von schwarzen Sklaven versorgt wurden, im Schatten einer Dornenhecke niedergelassen hatten, an der weiße Rosen blühten. Die Sonne hatte fast den Zenit erreicht und ließ eine Luft flimmern, die nach Rosen, Granatäpfeln, Seetang, Myrte und Jauche roch.
Vor der Küste patrouillierten zwei Kriegsschiffe, die viereckigen Segel vom langen Einsatz in Wind und Wetter schmutziggrau. In der Bucht hatte eine spanische Fregatte beide Anker geworfen. Es war jedoch kein guter Ankerplatz. Die Brandung wurde vom Ufer kaum gebrochen, und am Kai war das Wasser nicht tief genug für große Schiffe. Deshalb hatte man die sechzehn Männer auch mit den Schaluppen der Fregatte an Land rudern müssen. Und jetzt warteten sie in der drückenden Hitze. In einem der Häuser unmittelbar hinter der Rosenhecke schrie ein Baby.
»Wir holen weitere Maultiere. Sie müssen sich nur noch ein wenig gedulden, Gentlemen. Bitte, akzeptieren Sie unsere tief empfundene Entschuldigung.« Der Sprecher, ein wirklich sehr junger britischer Lieutenant in rotem Rock und mit verschwitztem Gesicht, zeigte sich schon ein wenig zu reumütig. »Sie müssen verstehen, dass wir keine sechzehn Gentlemen erwartet haben, sondern nur vierzehn. Leider hätten wir selbst für diese Zahl nicht genügend Transportmittel zur Verfügung gehabt, doch ich habe mit dem Adjutanten gesprochen, und der hat mir versprochen, sofort weitere Maultiere zu besorgen. Bitte, entschuldigen Sie die Verwirrung. Wir …« Die Worte waren nur so aus dem Lieutenant hervorgesprudelt, doch dann hielt er inne, als ihm dämmerte, dass die meisten der sechzehn Reisenden ihn ohnehin nicht verstanden. Der Lieutenant errötete und drehte sich zu dem großen, vernarbten, dunkelhaarigen Mann in der ausgeblichenen Uniform der britischen 95th Rifles um. »Könnten Sie das bitte für mich übersetzen, Sir?«
»Sie holen noch Maultiere«, sagte der Rifleman in lakonischem, aber fließendem Spanisch. Es war nun sechs Jahre her, seit er diese Sprache regelmäßig benutzt hatte, und er hatte viel verlernt, doch nach achtunddreißig Tagen auf einem spanischen Schiff sprach er sie wieder perfekt. Erneut drehte er sich zu dem Lieutenant um. »Warum können wir nicht einfach zu dem Haus laufen?«
»Das sind fünf Meilen, Sir, bergauf und ziemlich steil.« Der Lieutenant deutete zu dem Hügel jenseits der Bäume, wo sich ein Pfad im Zickzack über den von Flachs bewachsenen Hang wand. »Es ist wirklich besser, wenn wir auf die Maultiere warten, Sir.«
Der große Rifleoffizier grunzte. Der junge Lieutenant deutete das als Annahme seines weisen Rats. »Sir?« Ermutigt trat der Lieutenant einen Schritt auf den Rifleman zu.
»Was ist?«
»Ich habe mich gefragt …« Überwältigt vom Stirnrunzeln des Rifleman wich der Lieutenant wieder zurück. »Nichts, Sir. Es ist nicht wichtig.«
»Um Gottes willen, Junge! Spuck es aus! Ich werde dich schon nicht fressen.«
»Es geht um meinen Vater, Sir. Er hat oft von Ihnen gesprochen, und ich habe mich gefragt, ob Sie sich vielleicht an ihn erinnern. Er war in Salamanca, Sir. Hardacre? Roland Hardacre?«
»Nein.«
»Er ist bei San Sebastián gefallen«, fügte Lieutenant Hardacre kläglich hinzu, als könne dieses letzte Detail das Bild seines Vaters in der Erinnerung des Rifleman wieder heraufbeschwören.
Der vernarbte Rifleman stieß erneut ein Grunzen aus, das man durchaus als Mitgefühl deuten konnte, doch tatsächlich zeigte es nur die Verlegenheit eines Mannes, der noch nie gewusst hatte, wie er mit solchen Offenbarungen umgehen sollte. So viele Männer waren gefallen, so viele Witwen weinten noch immer, und so viele Kinder würden ohne Vater aufwachsen, sodass der Rifleman daran zweifelte, dass es je genug Mitgefühl für all das geben würde, was der Krieg verursacht hatte. »Ich habe ihn nicht gekannt, Lieutenant. Tut mir leid.«
»Trotzdem – es ist mir wahrlich eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir«, sagte Lieutenant Hardacre und ging dann vorsichtig rückwärts, als habe er Angst, der große Mann mit der weißen Strähne in seinem schwarzen Haar und der gezackten Narbe im Gesicht könne sich plötzlich auf ihn stürzen.
Der Rifleman, der sich wünschte, lockerer und mitfühlender auf solche Appelle an sein Gedächtnis reagieren zu können, hieß Richard Sharpe. Auf seiner Uniform, die bei einem Bettler schäbig gewirkt hätte, waren die Rangabzeichen eines Majors zu sehen, obwohl er bei Kriegsende, als er auf dem größten Witwenmacherfeld von allen gekämpft hatte, schon Lieutenant Colonel gewesen war. Jetzt trug er zwar seine Uniform und den schweren Säbel an seiner Seite, aber er war nur noch ein Mister und kein Sir mehr, ein Bauer.
Sharpe wandte sich von dem verlegenen Lieutenant ab und ließ seinen Blick mürrisch über das in der Sonne funkelnde Meer zu den Schiffen schweifen, die diese einsame, gottverlassene Küste bewachten. Seine Narbe verlieh Sharpe einen sardonischen, zynischen Gesichtsausdruck. Im Gegensatz dazu wirkte sein Gefährte gut gelaunt und freundlich. Dabei handelte es sich um einen ungewöhnlich großen Mann. Er war sogar noch größer als Sharpe und der einzige der sechzehn Reisenden, der keine Uniform trug. Stattdessen hatte er sich seinen braunen Wollmantel übergezogen und trug eine schwarze Hose, beides viel zu dick für die tropische Hitze, und als Folge davon schwitzte der große Mann aus allen Poren, zumal er auch noch ziemlich fett war. Doch diese Unannehmlichkeiten taten seiner Fröhlichkeit offenbar keinen Abbruch, denn er ließ seinen Blick glücklich über die dunklen Felsen schweifen, die Banyan-Feigenbäume, die schwarzen Vulkangipfel, das Meer und die kleine Stadt. Schließlich fällte er ein wohlüberlegtes Urteil über das, was er sah.
»Ein richtiges Drecksloch, meinst du nicht?«
Der fette Mann mit Namen Patrick Harper, der Sharpe auf dieser Reise begleitete, hatte genau das schon bei Sonnenaufgang gesagt, als ihr Schiff bei schwachem Wind zu seinem Ankerplatz gesegelt war und man am Horizont die wenig einladende Landschaft sehen konnte.
»Und das ist schon mehr, als der Bastard verdient hat«, erwiderte Sharpe, allerdings nicht gerade überzeugend. Sein Ton war schlicht der eines Mannes, der sich ein wenig unterhalten wollte.
»Wie auch immer, Drecksloch bleibt Drecksloch. Wie haben sie diesen Misthaufen von einer Insel überhaupt gefunden? Das würde ich gerne wissen. Herr im Himmel, ich schwöre, wir sind eine Million Meilen im Nirgendwo!«
»Ich nehme an, irgendein Schiff ist vom Kurs abgekommen, und plötzlich war da dieses verdammte Land.«
Harper wedelte sich mit seinem breitkrempigen Hut frische Luft ins Gesicht. »Ich wünschte, sie würden langsam mal die Mulis bringen. Die verdammte Hitze bringt mich noch um. Oben in den Hügeln ist es sicher kühler.«
»Wenn du nicht so fett wärst«, sagte Sharpe in sanftem Ton, »dann könnten wir auch zu Fuß gehen.«
»Fett? Ich bin einfach nur kräftig gebaut.« Die entrüstete Antwort kam wie aus der Pistole geschossen, und sie klang eingeübt, sodass jeder, der den beiden zuhörte, sofort erkannte, dass sie dieses verbale Spielchen öfter trieben. »Was ist auch falsch daran, wenn man gut gebaut ist?«, fuhr Harper fort. »Bei der Mutter unseres Herrn, nur weil ein Mann gut lebt, muss man doch nicht über seine Gesundheit lästern! Außerdem, schau dich mal selbst an! Der Heilige Geist hat mehr Fleisch auf den Knochen als du. Würde ich dich auskochen, bekäme ich höchstens ein Pfund Schmalz für meine Mühen. Du solltest essen wie ich!« Stolz klopfte Patrick Harper auf seinen Bauch und ließ das Fett beben.
»Das ist nicht das Essen«, erwiderte Sharpe. »Das ist das Bier.«
»Von Stout wird man nicht fett!« Patrick Harper war zutiefst beleidigt. Den größten Teil der Franzosenkriege über war Harper Sharpes Sergeant gewesen, und auch jetzt noch hatte Sharpe im Kampf niemanden lieber an seiner Seite als ihn. Doch in den Jahren nach dem Krieg hatte der Ire einen Gasthof in Dublin geführt.
»Die Gäste müssen sehen, dass der Wirt seine eigenen Waren trinkt«, erklärte Harper stets zu seiner Verteidigung, »denn nur so haben sie Vertrauen in das, was der Wirt verkauft. Außerdem mag es Isabella, wenn ich ein wenig Fleisch auf den Rippen habe. Das zeigt, dass ich gesund bin, sagt sie immer.«
»Dann bist du wohl der gesündeste Kerl in ganz Dublin!«, neckte Sharpe ihn. Er hatte seinen Freund seit drei Jahren nicht mehr gesehen, und er war entsetzt gewesen, als Harper mit einem Schwabbelbauch, einem Vollmondgesicht und Beinen so dick wie Haubitzenrohre in Frankreich aufgetaucht war.
Sharpe wiederum passte auch fünf Jahre nach der Schlacht bei Waterloo noch immer in seine alte Uniform. Tatsächlich hatte er heute Morgen, als er die Uniform aus seiner Seekiste geholt hatte, sogar ein weiteres Loch in seinen Gürtel stechen müssen, um zu verhindern, dass ihm die Hose auf die Knöchel rutschte. Er trug zwar noch einen weiteren Gürtel über der Jacke, doch der hielt nur den Säbel.
Sharpe war den größten Teil seines Lebens über Soldat gewesen, von seinem sechzehnten bis zu seinem achtunddreißigsten Lebensjahr, doch in den letzten paar Jahren hatte er sich an das Landleben gewöhnt. Von Zeit zu Zeit griff er zwar noch zum Gewehr, um die Krähen aus Lucilles Obsthain zu vertreiben, doch den schweren Säbel hatte er schon lange über den Kaminsims des alten Châteaus verbannt, wo er den Rest seines Lebens zu verbringen hoffte. Aber jetzt trug er den Säbel wieder und auch die Uniform, und erneut war er in Gesellschaft von Soldaten.
Schließlich brachte man vier weitere Maultiere, und die Wartenden versuchten, so würdevoll wie möglich auf die klapprigen Tiere zu klettern. Dabei konnten die schwarzen Sklaven, die die Tiere führten, ihre Belustigung nicht verbergen, als auch Harper sich unbeholfen auf ein Tier wuchtete, das nur halb so kräftig gebaut aussah wie er. Trotzdem trug es sein Gewicht.
Ein englischer Major, ein cholerisch aussehender Mann auf einer schwarzen Stute, ritt an der Spitze des Zugs aus der kleinen Stadt und auf die schmale Straße, die sich quälend den Berg hinauf und ins Landesinnere wand. Zu beiden Seiten der Straße war der Hang mit grünem Flachs bewachsen. Eine Echse, deren Schuppen im Sonnenschein funkelten, huschte quer vor Sharpe über den Weg, und einer der Sklaven, die den Berittenen folgten, lief dem Tier hinterher.
»Ich dachte, die Sklaverei wäre abgeschafft«, bemerkte Harper, der Sharpe inzwischen den Spott ob seiner Fettleibigkeit verziehen hatte.
»In Großbritannien, ja«, sagte Sharpe. »Aber das hier ist kein britisches Territorium.«
»Nicht? Was zum Teufel ist es dann?«, fragte Harper entrüstet, und in der Tat: Dafür, dass die Insel nicht zu Großbritannien gehörte, wimmelte es hier von geradezu lächerlich vielen britischen Soldaten. Links von ihnen stand eine Kaserne, wo gerade drei Kompanien Rotröcke exerzierten, und rechts trainierte eine Gruppe Offiziere in Scharlachrot mit ihren Pferden am Hang, während man weiter vorn, wo der Flachs dem kahlen Hochland wich, einen Wachtposten neben einer alten Signalstation errichtet hatte. Und über dem Posten wehte der Union Jack. »Willst du mir etwa sagen, dass das hier Irland sein könnte?«, fragte Harper mit unverhohlenem Spott.
»Die Insel gehört der Ostindien-Kompanie«, erklärte Sharpe geduldig. »Sie nutzen sie als Versorgungsstation für ihre Schiffe.«
»Also für mich sieht es hier verdammt englisch aus. Abgesehen von den Schwarzen natürlich. Erinnerst du dich noch an den Schwarzen in der Grenadierkompanie? Den großen Kerl, der bei Toulouse gefallen ist?«
Sharpe nickte. Der Schwarze war einer der wenigen Gefallenen der Kompanie bei Toulouse gewesen. Er war eine Woche nach Unterzeichnung des Friedensvertrags ums Leben gekommen, nur dass in Toulouse offenbar niemand davon gewusst hatte.
»Ich erinnere mich noch gut daran, wie er sich bei Burgos besoffen hat«, erzählte Harper. »Wir haben ihn in den Bau geworfen, und als wir ihn am nächsten Morgen zu seiner Bestrafung geführt haben, konnte er noch immer nicht aufrecht gehen. Wie zum Teufel hieß der noch mal? Groß war er. Riesig. Du musst dich doch an ihn erinnern. Er hat Corporal Roes Witwe geheiratet, und sie ist schwanger geworden, und Sergeant Finlayson hat Wetten angenommen, ob der Balg nun schwarz oder weiß werden würde. Wie hieß der noch mal, verdammt?« Harper runzelte frustriert die Stirn. Seit er sich in Frankreich mit Sharpe getroffen hatte, führten sie solche Gespräche, um die Geister der Vergangenheit wieder heraufzubeschwören, die rasch verblassten.
»Bastable.« Plötzlich fiel Sharpe der Name wieder ein. »Thomas Bastable.«
»Bastable! Ja, genau. Er hat immer die Augen zugemacht, wenn er geschossen hat, und das konnte ich ihm auch nicht abgewöhnen. Vermutlich hat er mehr Kugeln zu den Engeln gejagt als jeder andere Soldat in der Geschichte der Menschheit. Gott schenke seiner Seele Frieden. Aber mit dem Bajonett war er der Schrecken des Schlachtfelds. Himmel, was hätte er erst mit der Pike anrichten können!«
»Und? Welche Farbe hatte sein Kind denn nun?«, fragte Sharpe.
»Ein wenig von beidem, soweit ich mich erinnern kann. Wie Tee mit Milch. Finlayson wollte nicht zahlen, bis wir mal hinter den Linien ein ernstes Wort mit ihm geredet haben. Aber Finlayson war ja schon immer ein schmieriger Kerl, der Arsch. Ich habe nie verstanden, warum man ihm die Streifen gegeben hat.«
Harper verstummte, als sich die kleine Gruppe Uniformierter einem verrammelten Haus näherte, das von einer ordentlich gestutzten Hecke umgeben war. Bunte Blumen wuchsen am Rand eines Weges aus zerstoßenen Muschelschalen, und ein chinesisch aussehender Gärtner grub in einem Gemüsebeet neben dem Haus, während eine junge blonde Frau in weißem Kleid in einem Pavillon neben der vorderen Hecke saß und las. Sie hob den Blick und lächelte den rotgesichtigen Major zur Begrüßung an, der die Muli-Karawane anführte. Dann starrte sie die Neuankömmlinge mit unverhohlener Neugier an.
Die spanischen Offiziere verneigten sich ernst. Sharpe tippte mit dem Finger an seinen altmodischen braunen Dreispitz, und Harper sagte fröhlich lächelnd: »Was für ein schöner Morgen, Miss!«
»Mir ist er ein wenig zu heiß.« Sie sprach mit englischem Akzent, und ihre Stimme klang sanft. »Aber heute Nachmittag wird es regnen.«
»Besser Regen als Kälte. Daheim ist es eisig.«
Die junge Frau lächelte, erwiderte aber nichts weiter. Dann schaute sie wieder in ihr Buch und blätterte langsam um. Irgendwo im Haus schlug eine Uhr Mittag. Auf der Fensterbank schlief eine Katze.
Die Maultiere kletterten langsam zum Wachtposten hinauf. Die Reisenden ließen den Flachs und die Feigenbäume hinter sich und betraten ein Plateau, wo nur noch spärlich Gras und ein paar Bäume wuchsen. Jenseits des öden Graslandes waren Gipfel wie Sägezähne zu sehen, schwarz und bedrohlich, und auf einer dieser Felsspitzen konnte man ein weißes Haus erkennen. Auf dem Dach hatte man eine Signalstation eingerichtet. Dank der dunklen Regenwolken im Hintergrund strahlten die weißen Wände unnatürlich hell.
Plötzlich erwachte die Signalanlage zum Leben, und die langen, dünnen Arme bewegten sich knarrend auf und ab.
»Sie geben allen Bescheid, dass wir kommen«, sagte Harper vergnügt. Aus irgendeinem Grund fand er an diesem heißen Tag jedes noch so banale Ereignis amüsant.
»Wahrscheinlich«, erwiderte Sharpe.
Die diensthabenden Rotröcke am Wachtposten salutierten, als die spanischen Offiziere an ihnen vorbeiritten. Einige lächelten beim Anblick des riesigen Harper, der darum kämpfte, sich auf dem viel zu kleinen Maultier zu halten, doch ihre Gesichter verwandelten sich zu Stein, als Sharpe sie anfunkelte.
Himmel, dachte Sharpe, müssen die gelangweilt sein. Sie stecken hier viertausend Meilen von daheim fest und haben nichts anderes zu tun, als das Meer und die Berge im Auge zu behalten und sich den Kopf über das kleine Haus fünf Meilen landeinwärts zu zerbrechen.
»Ist dir eigentlich klar«, wandte sich Sharpe plötzlich an Harper und verzog das Gesicht, »dass wir hier vermutlich nur unsere Zeit verschwenden?«
»Aye, könnte sein«, erwiderte Harper gleichmütig. Er war Sharpes plötzliche Stimmungswechsel gewohnt. »Aber es ist einen Versuch wert. Das hast du doch auch gesagt. Oder würdest du lieber in deiner Kabine hocken, nachdem du so weit gereist bist? Du kannst immer noch umkehren.«
Sharpe ritt schweigend weiter. Die Hufe der Maultiere wirbelten Staub auf. Hinter Sharpe klapperte die Signalstation ein letztes Mal und verstummte dann. In einem flachen Tal zu Sharpes Linker befand sich ein weiteres britisches Lager, und zu seiner Rechten, eine gute Meile entfernt, übte eine Gruppe Berittener. Als sie die näher kommenden Spanier sahen, galoppierten sie zu einem Haus, das isoliert mitten auf dem Plateau lag und von Rotröcken und einer Mauer geschützt wurde.
Die davongaloppierenden Reiter, die von einem einzelnen britischen Offizier begleitet wurden, trugen nicht die allgegenwärtigen roten Röcke der Inselgarnison, sondern dunkelblaue Uniformen. Es war nun fünf Jahre her, seit Sharpe solche Uniformen zuletzt gesehen hatte. Männer in diesem Blau hatten einst Europa von Moskau bis Madrid beherrscht, doch jetzt war ihr Stern gesunken, und ihr Herrschaftsgebiet beschränkte sich auf die gelben Stuckwände des einsamen Hauses am Ende der Straße.
Das gelbe Haus war niedrig, aber ausgedehnt und von dunklen Bäumen mit glänzenden Blättern umgeben. Der Garten war verwildert. Es war ein trostloser Ort. Das Haus war ursprünglich ein Kuhstall gewesen, dann hatte man es zur Sommerresidenz des Lieutenant Governor ausgebaut. Doch jetzt, in den letzten Tagen des Jahres 1820, beherbergte das Haus fünfzig Gefangene, zehn Pferde und unzählige Ratten.
Das Haus hieß Longwood. Es lag genau im Zentrum der Insel Sankt Helena, und sein wichtigster Gefangener war einst Kaiser von Frankreich gewesen.
Napoleon Bonaparte.
Zu guter Letzt verschwendeten sie doch nicht ihre Zeit.
Offenbar hatte General Bonaparte großen Appetit auf Besucher, die ihm Neuigkeiten aus der Welt jenseits der siebzig Quadratmeilen großen Insel bringen konnten. Solche Gäste empfing er nach dem Mittagessen, und da er stets um elf Uhr aß und es nun zwanzig Minuten nach Mittag war, bat man die spanischen Offiziere, noch ein wenig im Garten spazieren zu gehen. Seine Majestät würde sie empfangen, sobald er bereit sei.
Nicht General Bonaparte, was die größte Ehre war, die seine britischen Wärter ihm zugestanden, sondern Seine Majestät, der Kaiser, würde die Besucher empfangen, und jeder, der sich weigerte, Seine Majestät mit Votre Majesté anzureden, wurde sofort aufgefordert, sich wieder auf sein Maultier zu schwingen und den langen Weg die Berge hinunter nach Jamestown zu reiten.
Der Kapitän der spanischen Fregatte, ein verschlossener Mann mit Namen Ardiles, war unwillkürlich zusammengezuckt, als er von dieser Forderung gehört hatte, doch er hatte nicht protestiert, während die anderen Spanier, allesamt Armeeoffiziere, gleichmütig zugestimmt hatten, Seine Majestät so majestätisch anzusprechen, wie er es verlangte.
Jetzt, während Seine Majestät sein Mittagessen beendete, schlenderten seine folgsamen Besucher durch den Garten, wo Giftpilze auf dem Rasen wucherten. Im Westen zogen Wolken auf, die sich im verschlammten Wasser frisch ausgehobener Teiche spiegelten. Der englische Major, der die Karawane aufs Plateau geführt hatte und der offensichtlich nicht die geringste Absicht hatte, General Bonaparte irgendwelchen Respekt zu erweisen, war aus Versehen in den Schlamm am Ufer eines der Teiche getreten und versuchte nun, mit der Reitgerte den Dreck von seinen Stiefeln zu kratzen. In den düsteren Wolken über der weiß gestrichenen Signalstation grollte der Donner.
»Das ist wirklich schwer zu glauben.« Harper war so aufgeregt wie ein Kind auf dem Jahrmarkt. »Erinnerst du dich noch daran, als wir ihn zum ersten Mal gesehen haben? Jesus! Damals hat es geregnet.«
Diesen ersten Blick auf den französischen Kaiser hatten sie auf dem Schlachtfeld von Quatre-Bras erhascht, zwei Tage vor Waterloo. Sie hatten ihn jedoch nur aus großer Ferne gesehen, umgeben von seinen Ulanen. Zwei Tage später, kurz vor Beginn des größten Gemetzels, hatten sie Bonaparte auf einem weißen Pferd die französischen Linien entlangreiten sehen. Und jetzt waren sie in sein Gefängnis gekommen, und es war, wie Harper gesagt hatte: Sie konnten kaum glauben, dass sie dem Monster so nahe waren, der Bestie, dem Tyrannen, der Geißel Europas. Seltsamer war nur noch, dass Bonaparte bereit war, sie zu empfangen. Ein paar Augenblicke lang würden zwei alte britische Soldaten an diesem feuchten Tag im selben stickigen Raum stehen wie Bonaparte, und sie würden seine Stimme hören und seine Augen sehen, und wenn sie wieder zurückfuhren, dann würden sie ihren Kindern und Enkeln erzählen, dass sie das Schreckgespenst Europas gesehen hatten. Sie würden ihnen erzählen, dass sie nicht nur ein bitteres Jahr nach dem anderen gegen ihn gekämpft hatten, sie hatten auch nervös wie Schuljungen auf dem Teppich seines Gefängnisses gestanden, auf einer Insel mitten im Südatlantik.
Noch während er wartete, konnte Sharpe schwer glauben, dass Bonaparte sie tatsächlich empfangen würde. Er war den ganzen weiten Weg von Jamestown hierher in dem Glauben geritten, dass man diese Expedition verächtlich abweisen würde, doch er hatte sich mit dem Gedanken getröstet, dass es ihm schon reichen würde, das Nest des Mannes zu sehen, der einst ganz Europa in Angst und Schrecken versetzt hatte und mit dessen Namen Mütter noch immer ihren Kindern drohten, um sie zum Gehorsam zu bewegen.
Doch die Uniformierten, die die Tore von Longwood House geöffnet hatten, hatten sie willkommen geheißen, und jetzt brachte ihnen ein Diener ein Tablett mit dünner Limonade. Der Diener entschuldigte sich für die armselige Erfrischung und erklärte, dass Seine Majestät seine verehrten Besucher gern mit Wein bewirtet hätte, doch seine britischen Wärter verweigerten ihm boshafterweise, ihn damit angemessen zu versorgen. Also würde die selbst gemachte Limonade reichen müssen. Die spanischen Offiziere funkelten Sharpe tadelnd an, doch der zuckte nur mit den Schultern. Und der englische Major, der sich nicht unter die spanischen Besucher mischen wollte, lief auf und ab und schlug mit der Gerte nach den Büschen.
Nach einer halben Stunde wurden die sechzehn Besucher ins Haus geholt. Es roch feucht und schimmelig. Die Tapeten im Flur und im Billardzimmer waren fleckig von Feuchtigkeit, und die Bilder an den Wänden, schwarz-weiße Kupferstiche, waren ebenso mitgenommen. Das Haus erinnerte Sharpe an ein armes Landpfarrhaus, dessen Bewohner sich verzweifelt, aber vergeblich bemühten, mehr darzustellen, als sie waren. Auf jeden Fall war es Welten von den Marmorwänden und Spiegelfluren in Paris entfernt, die Sharpe und Harper sich nach der Kapitulation 1815 mit anderen Soldaten aus ganz Europa in den Palästen des besiegten und gedemütigten Kaiserreichs angeschaut hatten.
Damals war Sharpe die gewaltigen Treppen hinaufgegangen, wo einst unzählige Höflinge dem Herrscher Frankreichs ihren Respekt erwiesen hatten. Jetzt wartete Sharpe auf genau diesen Mann, allerdings in einem Foyer, wo drei Eimer davon zeugten, dass das Dach undicht war, und wo der Bezug des Billardtischs genauso ausgeblichen und zerschlissen war wie die grüne Riflejacke, die Sharpe extra zu dieser Gelegenheit angezogen hatte.
Sie warteten weitere zwanzig Minuten. Eine Uhr tickte laut und surrte, als sie sich aufzog, um die Stunde zu schlagen. Im selben Augenblick, als die Uhr schlug, betraten zwei Offiziere in französischen Uniformen und mit verschlissenen Rangabzeichen das Billardzimmer. Einer von ihnen erteilte Anweisungen auf Französisch, und der andere übersetzte das mehr schlecht als recht ins Spanische.
Die Besucher wurden eingeladen, sich mit dem Kaiser zu treffen, und man ermahnte sie, nicht zu vergessen, in Gegenwart Seiner Majestät die Hüte abzunehmen.
Und die Besucher mussten stehen, während der Kaiser saß. Niemandem war gestattet, in Gegenwart Seiner Kaiserlichen Majestät zu sitzen.
Außerdem durfte niemand sprechen, es sei denn, Seine Majestät forderte ihn dazu auf.
Und man ermahnte die Besucher noch einmal, den Kaiser in solch einem Fall mit Votre Majesté anzureden. Tue man das nicht, werde das Gespräch sofort beendet. Ardiles, der Kapitän der Fregatte, verzog ob dieser wiederholten Ermahnung verärgert das Gesicht, protestierte aber nicht.
Sharpe war von dem großen, spindeldürren Ardiles fasziniert, der große Mühen auf sich nahm, um seinen Passagieren aus dem Weg zu gehen. Ardiles aß stets allein, und es hieß, er erscheine nur bei schlechtem Wetter an Deck oder tief in der Nacht, wenn seine Passagiere schliefen oder in ihren Kabinen mit der Seekrankheit kämpften. Sharpe hatte den Kapitän nur einmal kurz getroffen, als er in Cádiz an Bord der Espiritu Santo gegangen war, doch einige der spanischen Offiziere sahen ihren geheimnisvollen Kapitän bei dieser Expedition nach Longwood House tatsächlich zum ersten Mal.
Der französische Offizier, der die Hofetikette unbeholfen für sie ins Spanische übersetzt hatte, schaute nun herablassend zu Sharpe und Harper. »Haben Sie überhaupt etwas verstanden?«, verlangte er mit starkem Akzent auf Englisch zu wissen.
»Wir haben Sie sogar ganz hervorragend verstanden. Vielen Dank. Und wir werden Ihren Anweisungen selbstverständlich Folge leisten«, antwortete Sharpe in perfektem Französisch. Der Offizier wirkte überrascht. Dann nickte er.
»Seine Majestät wird gleich bereit sein«, verkündete der erste Franzose, und die Gruppe wartete in verlegenem Schweigen. Die spanischen Offiziere, die in ihren Uniformen einfach prachtvoll aussahen, hatten zur Vorbereitung auf die kaiserliche Audienz bereits ihre Zweispitze abgenommen. Ihre Stiefel knirschten, als sie das Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerten, und eine Säbelscheide schlug gegen das Bein des Billardtischs. Der mürrische Kapitän Ardiles schaute so wütend drein wie ein Bischof, den man in einem Puff erwischt hatte. Säuerlich starrte er zum Fenster hinaus auf die schwarzen Berge, über denen sich das Gewitter zusammenbraute. Harper ließ eine Billardkugel über den Tisch rollen. Sie prallte an der gegenüberliegenden Bande ab und blieb liegen.
Dann öffnete sich die große Doppeltür am Ende des Raums, und ein in grün-goldene Livree gekleideter Diener kam herein. »Seine Majestät wird Sie jetzt empfangen«, verkündete er und trat zur Seite .
Und Sharpe, dessen Herz so aufgeregt schlug wie vor einer Schlacht, ging, um sich mit seinem alten Feind zu treffen.
Alles war vollkommen anders, als Sharpe es sich vorgestellt hatte. Als er später versuchte, seine Vorstellungen mit der Realität in Einklang zu bringen, fragte er sich, was er eigentlich in dem gelb gestrichenen Haus zu finden geglaubt hatte. Einen Oger? Einen kleinen, krötenhaften Mann, dem Rauch aus der Nase quoll? Einen gehörnten Teufel mit blutigen Klauen? Tatsächlich stand nur ein kleiner, stämmiger Mann vor dem kalten Kamin. Er trug einen schlichten grünen Reitmantel mit Samtkragen, eine schwarze Kniebundhose und grobe weiße Strümpfe. Am Mantelkragen steckte eine Miniaturversion des Ordens der Ehrenlegion.
All diese Details fielen Sharpe jedoch erst später auf, als das Gespräch schon längst begonnen hatte, doch sein erster Eindruck, als er durch die Tür kam, war ein Gefühl von erschreckender Vertrautheit. Das hier war das berühmteste Gesicht der Welt, ein Gesicht, das auf einer Million Gemälde zu sehen war, einer Million Kupferstiche und einer Million Münzen. Das hier war ein derart vertrautes Gesicht, dass es Sharpe zutiefst verwirrte, es nun in echt zu sehen. Unwillkürlich schnappte er nach Luft und blieb wie angewurzelt stehen, sodass Harper ihn vorwärtsschieben musste. Der Kaiser, für den Sharpes Reaktion nichts Ungewöhnliches war, schien zu lächeln.
Das Zweite, was Sharpe auffiel, waren die Augen des Kaisers. Ihr Blick wirkte amüsiert, als verstünde Bonaparte als Einziger im Raum, dass das alles hier nur ein Scherz war. Und die Augen straften den Rest des Gesichts Lügen, das feist und seltsam trotzig wirkte. Dieser Trotz überraschte Sharpe wie auch das Haar des Kaisers, das ganz und gar nicht so war wie auf den Porträts. Das Haar war ausgesprochen fein wie das eines Kindes. Es hatte etwas Feminines an sich und machte Sharpe irgendwie nervös, und er wünschte sich, Bonaparte würde den Hut aufsetzen, den er unter den Arm geklemmt bei sich trug.
»Seien Sie willkommen, Messieurs«, begrüßte der Kaiser die spanischen Offiziere. Sein gelangweilt dreinblickender Adjutant übersetzte die Höflichkeit ins Spanische, und die Gäste antworteten ebenso höflich darauf mit Ausnahme des verächtlich dreinblickenden Ardiles.
Nachdem sich die sechzehn Besucher im Raum verteilt hatten, setzte sich der Kaiser auf einen zerbrechlich wirkenden vergoldeten Stuhl. Bei dem Raum handelte es sich offensichtlich um einen Salon. Überall standen hübsche Möbel, doch es war hier genauso feucht wie im Eingangsbereich und im Billardzimmer. Die Fußleisten unter der fleckigen Tapete waren mit Zinnplatten repariert worden, wo Ratten Löcher in die Wand genagt hatten, und in der Stille, die der Begrüßung durch den Kaiser folgte, konnte Sharpe das Kratzen von Rattenfüßen hinter der Wand hören. Das Haus war offenbar genauso verseucht wie ein Schiff.
»Bitte, sagen Sie mir, was führt Sie hierher?«, fragte der Kaiser den spanischen Offizier mit dem höchsten Rang. Das war ein Coronel der Artillerie mit Namen Ruiz, und der erklärte nun mit gedämpfter Stimme, dass ihr Schiff, die spanische Fregatte Espiritu Santo, aus Cádiz komme und ihre Passagiere zur spanischen Garnison in Valdivia, Chile, bringe. Dann stellte Ruiz den Kapitän der Espiritu Santo vor, Ardiles, der sich mit kaum verhohlener Feindseligkeit nur knapp vor dem Kaiser verneigte. Die Adjutanten des Kaisers, die ausgesprochen empfindlich auf jedes noch so kleine Zeichen von mangelndem Respekt reagierten, versteiften sich unwillkürlich und traten nervös von einem Fuß auf den anderen, doch Bonaparte schien das nicht zu bemerken – oder falls doch, dann kümmerte es ihn zumindest nicht. Als der Kaiser Ardiles fragte, wie lange er schon zur See fahre, antwortete der Spanier so knapp wie möglich. Offenbar hatte die Neugier auf den Tyrannen zwar über Ardiles’ Widerwillen gegen seine Passagiere gesiegt, doch er wollte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass er sich in irgendeiner Form durch den Empfang geehrt fühlte.
Bonaparte, der nie sonderlich an der Seefahrt interessiert gewesen war, wandte sich wieder an Coronel Ruiz, der ihm daraufhin die anderen Offiziere seines Artillerie-Regiments vorstellte. Nacheinander verneigten sie sich elegant vor dem kleinen Mann auf dem vergoldeten Stuhl.
Bonaparte hatte für jeden ein freundliches Wort, dann richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf Ruiz. Er wollte wissen, warum Ruiz in Sankt Helena hatte anlegen lassen.
Der Coronel erklärte, dass die Espiritu Santo dank der überlegenen Segelkunst der spanischen Marine auf ihrer Reise nach Süden gut vorangekommen sei, und da sie nur wenige Tagesreisen von Sankt Helena entfernt gewesen seien, hätten die Offiziere an Bord es für angemessen erachtet, Seiner Majestät, dem Kaiser, ihren Respekt zu erweisen.
Mit anderen Worten: Sie hatten der Versuchung nicht widerstehen können, sich die inzwischen zahnlose Bestie auf ihrem Felsen anzusehen, doch Bonaparte nahm Ruiz beim Wort.
»Dann vertraue ich darauf, dass Sie auch Sir Hudson Lowe Ihren Respekt bezeugen werden«, sagte er trocken. »Sir Hudson ist mein Gefängniswärter. Er und seine fünftausend Mann, sieben Schiffe, acht Batterien und das Meer, das Sie, meine Herren, überquert haben, um mir diese große Ehre zu erweisen.«
Während der Spanisch sprechende Franzose die Mischung des Kaisers aus Verachtung für seine Wärter und unernster Schmeichelei für seine Besucher übersetzte, wanderte Bonapartes Blick zu Sharpe und Harper, die man ihm als Einzige im Raum nicht vorgestellt hatte. Eine Sekunde lang trafen sich die Blicke des Rifleman und des Kaisers. Dann schaute Bonaparte wieder zu Coronel Ruiz. »Sie sind also die Verstärkung für die spanische Armee in Chile, ja?«
»In der Tat, Eure Majestät«, bestätigte der Coronel.
»Und Ihr Schiff transportiert auch Ihre Geschütze? Und die Kanoniere?«, fragte Bonaparte.
»Nein, nur die Offiziere des Regiments«, antwortete Ruiz. »Kapitän Ardiles’ Schiff ist nur für den Transport von Passagieren gedacht. Ein ganzes Regiment kann es leider nicht beherbergen, besonders kein Artillerie-Regiment.«
»Wo ist dann der Rest Ihrer Männer?«, hakte der Kaiser nach.
»Sie folgen uns auf zwei Transportschiffen«, erzählte Ruiz sorglos, »mit den Geschützen.«
»Ah!« Die Reaktion des Kaisers war scheinbar eine höfliche Anerkennung dieser trivialen Erklärung, doch das Schweigen, das darauf folgte, und das festgefrorene Lächeln auf Bonapartes Gesicht zeigten deutlich, was er davon hielt, dass diese Spanier die Bequemlichkeit von Ardiles’ Fregatte vorgezogen hatten, anstatt mit ihren Männern in den stinkenden Frachtschiffen zu reisen, die mindestens einen Monat länger bis nach Südamerika brauchen würden, wo die Spanier gerade versuchten, Chile von den Rebellen zurückzuerobern.
»Lassen Sie uns nur hoffen, dass der Rest Ihres Regiments mir nicht auch noch den Respekt erweisen will«, durchbrach Bonaparte die peinliche Stille, die seine unausgesprochene Kritik heraufbeschworen hatte. »Sonst wird Sir Hudson noch glauben, sie seien gekommen, um mich zu befreien!«
Ruiz lachte, die anderen Offiziere lächelten, und Ardiles runzelte die Stirn. Vielleicht hatte er ja eine unterschwellige Sehnsucht in der Stimme des Kaisers gehört, die den anderen entgangen war.
»Sagen Sie mir«, Bonaparte sprach noch immer mit Ruiz, »was erwarten Sie in Chile?«
Coronel Ruiz strotzte nur so vor Selbstvertrauen, als er seiner festen Überzeugung Ausdruck verlieh, dass die chilenische Rebellenarmee und ihre Regierung schon bald zusammenbrechen würden. Gleiches gelte für alle Aufständischen in den spanischen Kolonien in Südamerika. Dann würde Seine Majestät, König Ferdinand VII., wieder die volle Herrschaftsgewalt über seine Besitztümer in der Neuen Welt ausüben. Die Ankunft seines Regiments, versicherte der Coronel dem Kaiser, würde diesen Prozess nur beschleunigen.
»In der Tat«, stimmte der Kaiser ihm höflich zu, dann wechselte er das Thema. Er sprach über Europa und besonders über die Probleme in Spanien. Höflich glaubte er dem Coronel dessen Versicherung, dass die Liberalen es nicht wagen würden, offen gegen den König zu rebellieren. Und es stimme auch nicht, fuhr er fort, dass die Armee in Südamerika das Blutvergießen leid sei und kurz vor der Meuterei stünde. Tatsächlich sei er voller Hoffnung für Spaniens Zukunft, eine Zukunft mit einer immer stärker werdenden Monarchie, die sich von den Reichtümern ihrer kolonialen Besitzungen nährt. Begierig darauf, sich bei ihrem prahlerischen Coronel einzuschmeicheln, nickten die anderen Offiziere. Nur Kapitän Ardiles verzog angewidert das Gesicht und zeigte seinen Zweifel, indem er demonstrativ aus dem Fenster starrte und sich gleichzeitig mit dem Hut Luft zufächelte.
Wie alle Besucher schwitzte auch Sharpe furchtbar. Der Raum war beengt, die Luft schwül, und sämtliche Fenster waren geschlossen. Inzwischen hatte es außerdem zu regnen begonnen, und Wasser tropfte in einen Zinneimer, nicht weit entfernt vom Stuhl des Kaisers. Der Kaiser runzelte ob des Geräuschs die Stirn, richtete seine Aufmerksamkeit aber weiter höflich auf Coronel Ruiz, der wieder über eines seiner Lieblingsthemen referierte: die Rebellen in Chile, Venezuela und Peru, die sich weit übernommen hatten, sodass ihre Bewegung schon bald scheitern würde.
Sharpe, der den Prahlereien des Coronel schon an Bord viel zu viele Stunden hatte zuhören müssen, beobachtete nun stattdessen den Kaiser. Inzwischen hatte er auch seinen Verstand wiedererlangt. Er war nicht länger wie benommen, nur weil er sich in demselben kleinen Raum aufhielt wie Bonaparte, und so musterte er den Mann, um ihn sich für alle Zeiten ins Gedächtnis einzubrennen. Bonaparte war wesentlich fetter, als Sharpe erwartet hatte. Er war zwar nicht so fett wie Harper, der es mit jedem Zuchteber aufnehmen konnte, aber er war ungesund aufgequollen wie ein totes Tier, in dem sich giftige Dämpfe sammelten. Sein monströser Bierbauch ruhte auf den gespreizten Schenkeln. Sein Gesicht war fahl und sein feines Haar stumpf. Schweißperlen sammelten sich auf seiner Stirn. Seine Nase war schmal und gerade, sein Kinn gespalten, sein Mund fest, und seine Augen waren außergewöhnlich.
Sharpe wusste, dass Bonaparte fünfzig Jahre alt war, doch das Gesicht des Kaisers sah viel jünger aus. Sein Körper jedoch war der eines kranken, alten Mannes. Das musste das Klima sein, nahm Sharpe an, denn in einer derart schwülen Hitze konnte ein Weißer unmöglich gesund bleiben.
Mittlerweile regnete es so heftig, dass die Tropfen gegen die gelben Stuckmauern und die Fenster prasselten und nervend in den Zinneimer platschten. Der Ritt zurück zum Hafen würde feucht werden, wo die Boote darauf warteten, die sechzehn Männer zu Ardiles’ Schiff zurückzurudern.
Sharpe schaute sich aufmerksam im Raum um. Er wusste, wenn er wieder nach Hause kam, würde Lucille ihm Löcher in den Bauch fragen. Ihm fiel auf, wie niedrig die Decke war. Der Putz war vergilbt und wölbte sich an vielen Stellen, als könne jeden Augenblick das Dach einstürzen. Erneut hörte Sharpe das Scharren der Ratten, und er sah auch andere Zeichen des Verfalls. Auf den grünen Samtvorhängen sammelte sich der Schimmel, und auf dem Spiegel waren dunkle Flecken zu erkennen. Gleichzeitig löste sich das Gold vom Rahmen. Unter dem Spiegel lag ein achtlos hingeworfener Haufen alter Spielkarten auf einem kleinen Tisch neben dem in Silber eingerahmten Porträt eines Kindes in einer prachtvollen Uniform. An einem Haken neben der Tür hing ein zerschlissener Mantel.
»Und Sie, Monsieur? Sie sind kein Spanier. Was führt Sie hierher?«
Die auf Französisch gestellte Frage des Kaisers war an Sharpe gerichtet, doch der war so überrascht davon, dass er zunächst einmal gar nichts sagte. Da der Dolmetscher annahm, Sharpe habe den Akzent des Kaisers nicht verstanden, begann er zu übersetzen, doch dann fand Sharpe die Sprache wieder, obwohl sein Mund schrecklich ausgetrocknet war. »Ich … äh … ich bin auch ein Passagier auf der Espiritu Santo, Eure Majestät. Ich reise mit meinem Freund aus Irland, Mister Patrick Harper.«
Der Kaiser lächelte. »Mit Ihrem sehr gewichtigen Freund, wie ich sehe.«
»Als er noch der Sergeant Major meines Regiments gewesen ist, da war er weit weniger gewichtig, aber mindestens genauso beeindruckend.« Sharpe spürte, wie sein rechtes Bein vor Erregung zu zucken begann. Aber warum zum Teufel? Bonaparte war doch nur ein Mensch und noch dazu ein besiegter. Der Kaiser hatte keinerlei Bedeutung mehr, versuchte Sharpe sich einzureden. Selbst der Präfekt des kleinsten französischen Départements verfügte über mehr Macht als Bonaparte. Trotzdem war Sharpe schrecklich nervös.
»Sie sind Passagiere?«, hakte der Kaiser verwundert nach. »Und Sie segeln nach Chile?«
»Eine alte Freundin hat mich gebeten, in Chile nach ihrem vermissten Mann zu suchen. Das ist eine Ehrenschuld, Eure Majestät.«
»Und Sie, Monsieur?« Die Frage, auf Französisch, richtete sich an Harper. »Sie sind aus dem gleichen Grund unterwegs nach Südamerika?«
Sharpe übersetzte die beiden Fragen und Harpers Antwort. »Er sagt, das Leben nach dem Krieg sei viel zu langweilig für ihn, und als ich ihn gebeten habe, mich zu begleiten, da hat er sofort ja gesagt.«
»Ah! Langeweile. Das kann ich nur allzu gut nachvollziehen. Nichts zu tun, außer an Gewicht zuzulegen.« Der Kaiser klopfte sich auf den Bauch und richtete seinen Blick wieder auf Sharpe. »Für einen Engländer sprechen Sie sehr gut Französisch.«
»Ich habe die Ehre, in Frankreich zu leben, Eure Majestät.«
»Wirklich?« Der Kaiser klang verletzt, und zum ersten Mal, seit die Besucher den kleinen Raum betreten hatten, zeigten sich echte Gefühle auf Bonapartes Gesicht. Doch er riss sich rasch wieder zusammen und verbarg seinen Neid hinter einem Lächeln. »Dann genießen Sie ein Privileg, das mir verwehrt wird. Und wo in Frankreich leben Sie?«
»In der Normandie, Eure Majestät.«
»Warum?«
Sharpe zögerte einen Moment, dann zuckte er mit den Schultern. »Une femme.«
Der Kaiser lachte so natürlich, dass eine große Spannung aus dem Raum zu weichen schien. Selbst Bonapartes mürrische Adjutanten lächelten. »Ja, das ist ein guter Grund«, sagte der Kaiser, »ein sehr guter sogar! Tatsächlich ist es sogar der einzige Grund, denn ein Mann hat nie die Kontrolle über eine Frau. Wie heißen Sie, Monsieur?«
»Sharpe, Eure Majestät.« Sharpe hielt kurz inne. Dann beschloss er, sein Glück zu versuchen und Bonaparte etwas Privates zu erzählen. »Ich war ein Freund von Général Calvet von der Armee Eurer Majestät. Ich habe Général Calvet in Neapel einen kleinen Gefallen erwiesen. Das war noch vor …« Sharpe brachte es einfach nicht über sich, den Namen Waterloo auszusprechen oder seine Flucht von Elba zu erwähnen und die fünfzigtausend Toten, die von dort bis zu diesem feuchten, rattenverseuchten Zimmer inmitten von nichts geführt hatten. »Das – das war im Sommer vierzehn«, sagte Sharpe verlegen.
Bonaparte legte das Kinn in die rechte Hand und starrte den Rifleman lange an. Die Spanier, denen es nicht gefiel, dass Sharpe ihre Audienz bei dem verbannten Tyrannen an sich gerissen hatte, funkelten ihn wütend an. Niemand sagte ein Wort. Eine Ratte huschte hinter die Wandtäfelung. Regen tropfte in den Eimer, und Wind heulte im Kamin.
»Sie bleiben hier, Monsieur«, sagte Bonaparte abrupt zu Sharpe. »Dann reden wir.«
Der Kaiser, dem das Missfallen der Spanier nicht entgangen war, machte ihnen Komplimente für ihr kriegerisches Aussehen und drückte sein Mitleid mit ihren chilenischen Feinden aus, denn sobald sie eintrafen, würden Ruiz’ Kanonen sicherlich den Sieg bringen. Mit Ausnahme des mürrischen Ardiles strotzten die Spanier nur so vor Stolz. Bonaparte dankte ihnen für ihren Besuch, wünschte ihnen eine gute Reise und entließ sie dann.
Als sie verschwunden waren und sich nur noch Sharpe, Harper, der Adjutant und der livrierte Diener im Raum befanden, deutete Bonaparte auf einen Stuhl. »Bitte, setzen Sie sich doch.«
Und Sharpe setzte sich. Hinter den Fenstern fegte der Regen über das Hochland und ließ die frisch ausgehobenen Teiche im Garten überlaufen. Die spanischen Offiziere warteten im Billardzimmer. Ein Diener brachte Wein in den Salon, und Bonaparte plauderte mit einem Rifleman.
Der Kaiser hatte nichts als Verachtung für Coronel Ruiz und seinen Glauben an einen raschen Sieg in Chile übrig. »Sie haben diesen Krieg schon längst verloren, genau wie sie auch schon all die anderen Kolonien in Südamerika verloren haben. Je schneller sie ihre Truppen abziehen, desto besser. Dieser Mann …«, Bonaparte winkte abschätzig in Richtung der Tür, durch die Ruiz verschwunden war, »… dieser Mann ist wie jemand, dessen Haus in Flammen steht, doch er spart sich die Pisse auf, um seine Pfeife zu löschen. Soweit ich gehört habe, wird es noch in diesem Jahr zu einer Revolution in Spanien kommen.« Erneut machte Bonaparte eine abfällige Geste in Richtung Billardzimmer. Dann richtete er seine dunklen Augen auf Sharpe. »Aber wen kümmert schon Spanien? Erzählen Sie mir von Frankreich.«
So gut er konnte, beschrieb Sharpe das nervöse Misstrauen, das in Frankreich herrschte. Er erzählte, dass die Royalisten die Liberalen hassten, die wiederum den Republikanern misstrauten, und die wiederum verabscheuten die Ultra-Royalisten, die in ständiger Angst vor den verbliebenen Bonapartisten lebten, die ihrerseits den Klerus verabscheuten, der gegen die Orleanisten predigte. Kurz gesagt, das Land war wie ein riesiger Eintopf, in den jeder warf, was er wollte.
Dem Kaiser gefiel Sharpes Diagnose. »Vielleicht wäre ein Pulverfass ja das bessere Bild. Ein Funke, und alles fliegt in die Luft.«
»Nur dass das Pulver nass ist«, erwiderte Sharpe rundheraus.
Napoleon zuckte mit den Schultern. »Und der Funke ist schwach. Ich fühle mich so alt. Das bin ich natürlich nicht, aber ich fühle mich so. Schmeckt Ihnen der Wein?«
»Ja, das tut er, Sir.« Sharpe hatte vergessen, Bonaparte mit Eure Majestät anzusprechen, doch dem Kaiser schien das nichts auszumachen.
»Er kommt aus Südafrika«, erklärte Napoleon staunend. »Französischer Wein wäre mir zwar lieber, aber natürlich genehmigen mir diese Bastarde in London keinen. Und wenn meine Freunde in Frankreich mir welchen schicken, dann konfisziert dieser Mistkäfer unten ihn. Allerdings kann man auch diesen afrikanischen Wein gut trinken, meinen Sie nicht? Er nennt sich Vin de Constance. Ich nehme an, man hat ihm einen französischen Namen gegeben, um eine herausragende Qualität zu suggerieren.« Er drehte das Glas in der Hand und lächelte Sharpe schief an. »Manchmal träume ich davon, noch einmal ein Glas meines Chambertin zu trinken. Haben Sie gewusst, dass ich meine Truppen salutieren ließ, wann immer wir an einem der Weinberge vorbeigekommen sind?«
»Ich habe davon gehört, Sir.«
Bonaparte fragte Sharpe aus. Wo war er geboren? In welchen Regimentern hatte er gedient? Wie lange? Wie oft war er befördert worden? Als er hörte, dass Sharpe vom einfachen Soldaten zum Offizier befördert worden war, machte der Kaiser aus seiner Überraschung keinen Hehl, und er schien nicht glauben zu wollen, dass das auf jeden zwanzigsten britischen Offizier zutraf. »In meiner Armee«, erklärte Bonaparte leidenschaftlich, »wären Sie General geworden, glauben Sie mir!«
Aber Ihre Armee hat verloren, dachte Sharpe, doch er war viel zu höflich, als dass er das laut ausgesprochen hätte. Stattdessen lächelte er und dankte dem Kaiser für das Kompliment.
»Allerdings wären Sie in meiner Armee natürlich kein Rifleman gewesen«, provozierte der Kaiser Sharpe. »Ich habe Gewehre nie gemocht. Sie sind viel zu empfindlich, viel zu unberechenbar. Genau wie eine Frau!«
»Aber Soldaten lieben Frauen, Sir.«
Der Kaiser lachte. Der Adjutant, dem es gar nicht gefiel, dass Sharpe den Kaiser ständig falsch ansprach, verzog das Gesicht, doch der Kaiser wirkte entspannt. Er neckte Harper ob seines Bauchs und befahl, eine weitere Flasche südafrikanischen Wein zu bringen. Dann fragte er Sharpe, wen genau er eigentlich in Südamerika suche.
»Er heißt Blas Vivar, Sir. Er ist ein spanischer Offizier, und zwar ein guter, aber er ist verschwunden. Vor vielen Jahren habe ich einmal an seiner Seite gekämpft, und wir sind Freunde geworden. Seine Frau hat mich gebeten, nach ihm zu suchen.« Sharpe hielt kurz inne. Dann zuckte er mit den Schultern. »Sie bezahlt mich allerdings auch dafür. Ihre eigene Regierung hat ihr nicht geholfen und auch nicht die spanische Armee.«
»Die war schon immer schlecht. Die Truppen waren zwar nicht übel – wenn man sie denn mal ans Kämpfen bekommen hat –, aber es gab viel zu viele Offiziere.«
Der Kaiser stand auf, stapfte steif zum Fenster und starrte düster in den prasselnden Regen hinaus. Aus Höflichkeit erhob Sharpe sich ebenfalls, doch Bonaparte winkte ihm, sich wieder zu setzen.
»Sie kennen also Calvet, ja?« Der Kaiser drehte sich wieder zu ihm um.
»Ja, Sir.«
»Kennen Sie denn auch seinen Taufnamen?«
Sharpe nahm an, damit wollte der Kaiser feststellen, ob er die Wahrheit sprach. Er nickte. »Jean.«
»Jean!« Der Kaiser lachte. »Das erzählt er allen, aber in Wahrheit heißt er Jean-Baptiste! Ha! Ausgerechnet den so kampflustigen Calvet haben sie nach dem Täufer benannt.« Bonaparte lachte leise und kehrte wieder zu seinem Stuhl zurück. »Er lebt jetzt in Louisiana.«
»In Louisiana?« Sharpe konnte sich Calvet nicht in Amerika vorstellen.
»Viele meiner Soldaten sind dort hingegangen.« Bonaparte klang wehmütig. »Sie können diesen fetten Sack einfach nicht ertragen, der sich jetzt König von Frankreich nennt. Deshalb leben sie lieber in der Neuen Welt.« Der Kaiser schauderte plötzlich, obwohl es in dem Raum nicht wirklich kalt war. Dann drehte er sich erneut zu Sharpe um. »Stellen Sie sich nur einmal all die Soldaten vor, die jetzt auf der ganzen Welt verstreut sind! Wie Glut, die aufstiebt, wenn man in ein Feuer tritt. Die Advokaten und ihre Zuhälter, die jetzt Europa beherrschen, hätten es gern, wenn die Glut verlöschen würde, doch solch ein Feuer lässt sich nicht so einfach löschen. Diese Glut sind Männer wie unser Freund Calvet und vielleicht auch wie Sie und Ihr stämmiger Ire hier. Sie sind Abenteurer und Kämpfer! Sie wollen keinen Frieden. Sie gieren nach Aufregung. Und wenn diese dreckigen Advokaten eines fürchten, Monsieur, dann, dass irgendjemand diese Glut sammelt, denn dann würde ein Feuer auflodern, das die ganze Welt in Schutt und Asche legt!« Bonapartes Stimme war immer leidenschaftlicher geworden, doch nun senkte er sie wehmütig wieder. »Ich hasse Advokaten so sehr. Advokaten sind keine Männer. Ich kenne Männer, und ich sage Ihnen, ich habe noch nie einen Advokaten mit dem Mut eines Soldaten kennengelernt, mit dem Mut eines Mannes.« Der Kaiser schloss kurz die Augen, und als er sie wieder öffnete, war sein Gesichtsausdruck freundlich und seine Stimme klang entspannt. »Sie segeln also nach Chile, ja?«
»Ja, Sir.«
»Chile …« Er klang, als würde ihn der Name an irgendwas erinnern. »Ich erinnere mich noch gut an den Dienst, den Sie mir in Neapel erwiesen haben«, fuhr der Kaiser nach einer kurzen Pause fort. »Calvet hat mir davon erzählt. Würden Sie mir noch einen Gefallen erweisen?«
»Natürlich, Sir.« Später sollte Sharpe darüber staunen, wie schnell er eingewilligt hatte, obwohl er noch nicht einmal gewusst hatte, was das für ein Gefallen war, doch er stand unter dem Bann eines korsischen Magiers, der einst den gesamten Kontinent verhext hatte. Und dieser Magier liebte auch noch Soldaten mehr als alles andere auf der Welt, und der Kaiser hatte sofort gewusst, was der Rifleman war, kaum dass er den Raum betreten hatte. Sharpe war ein Soldat, einer der geliebten Bastarde des Kaisers, ein Mann, der durch Scheiße, Hitze und Kälte marschieren und am nächsten Tag halb verhungert kämpfen konnte wie der Teufel. Und der Kaiser konnte Soldaten um den kleinen Finger wickeln.
»Ein Mann hat mir geschrieben. Ein Siedler in Chile. Er ist ein Landsmann von Ihnen und war ebenfalls Offizier in Ihrer Armee, doch nach dem Krieg hat er eine gewisse Bewunderung für mich entwickelt.« Der Kaiser lächelte, als wolle er sich für diese Unbescheidenheit entschuldigen. »Er hat mich gebeten, ihm ein Andenken zu schicken, und ich bin geneigt, dieser Bitte zu entsprechen. Würden Sie das Geschenk für mich überbringen?«
»Natürlich, Sir.« Sharpe war erleichtert, dass es nur um so einen trivialen Gefallen ging, doch ein anderer Teil von ihm stand so sehr unter dem Bann von Bonapartes Genie, dass er für den Kaiser einen blutigen Weg den Hügel hinunter und in die Freiheit gebahnt hätte, hätte dieser ihn darum gebeten. Harper, der neben Sharpe saß, hatte den gleichen ehrfurchtsvollen Blick.
»Wie ich gehört habe, lebt dieser Mann – ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern – im von den Rebellen kontrollierten Teil des Landes«, führte der Kaiser weiter aus. »Aber er hat mir geschrieben, wenn man etwas für ihn an den amerikanischen Konsul in Valdivia übergibt, dann würde ihn das auch erreichen. Es macht Ihnen doch nichts aus, mir zu helfen, oder?«
»Natürlich nicht, Sir.«
Der Kaiser lächelte dankbar. »Es wird eine Zeit lang brauchen, das Geschenk auszusuchen und vorzubereiten, aber Sie haben doch sicher zwei Stunden Zeit, Monsieur, oder?«
Sharpe antwortete, das sei kein Problem, und sofort wurde ein Adjutant losgeschickt, um ein passendes Geschenk zu finden. Dann wandte sich Napoleon wieder an Sharpe. »Sie waren doch sicher auch bei Waterloo?«
»Ja, Sir, das war ich.«
»Dann erzählen Sie«, begann der Kaiser, und so redeten sie miteinander von Soldat zu Soldat, während die Spanier warteten, der Regen fiel, die Sonne unterging und die Rotrockwachen den Ring um Longwood House für die Nacht schlossen.
Es war fast vollständig dunkel, als Sharpe und Harper völlig durchnässt den Hafen von Jamestown erreichten, wo die Boote der Espiritu Santo darauf warteten, die Passagiere wieder auf Ardiles’ Schiff zu bringen.
Am Kai wartete ein britischer Offizier im Regen. »Mister Sharpe?« Er trat zu Sharpe, kaum dass der Rifleman vom Muli gestiegen war.
»Lieutenant Colonel Sharpe für Sie.« Der Tonfall des Mannes ärgerte Sharpe.
»Natürlich, Sir. Dürfte ich Ihnen wohl einen Augenblick Ihrer Zeit stehlen?« Der Mann, ein großer, dürrer Major, lächelte und führte Sharpe ein Stück von den neugierigen Spaniern weg. »Sir, entspricht es der Wahrheit, dass General Bonaparte Ihnen mit einem Geschenk seine Gunst erwiesen hat?«
»Er hat jeden von uns mit einem Geschenk bedacht.« Jeder Spanier, mit Ausnahme von Ardiles, der gar nichts erhalten hatte, hatte einen silbernen Teelöffel mit den Initialen Napoleons bekommen und Harper einen Messbecher mit dem Symbol des Kaisers, der Honigbiene.
Sharpe, der offenbar die Zuneigung des Kaisers geweckt hatte, hatte sogar ein silbernes Medaillon mit einer Locke des Kaisers erhalten.
»Bitte, entschuldigen Sie, Sir, aber Sie haben doch ein ganz besonderes Geschenk bekommen, nicht wahr?«, hakte der Major nach.
»Habe ich?«, forderte Sharpe den Rotrock heraus, und er fragte sich, welcher der Diener des Kaisers wohl der Spion war.
»Sir Hudson Lowe würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie ihm gestatten würden, dieses Geschenk zu sehen.« Hinter dem Major stand eine ganze Reihe von Rotröcken.
Sharpe holte das Medaillon aus der Tasche, drückte den Knopf, und es klappte auf. Dann zeigte er dem Major die Haarlocke. »Übermitteln Sie Sir Hudson Lowe bitte meine besten Grüße, und sagen Sie ihm, dass sein Hund, seine Frau oder sein Barbier ihm das gleiche Geschenk machen können.«
Der Major ließ seinen Blick über die spanischen Offiziere wandern, die ihn der Reihe nach anfunkelten. Ihr Unmut gründete schlicht auf der Tatsache, dass der Major ihren Aufbruch verzögerte. Sie sehnten sich nach den Bequemlichkeiten an Bord der Espiritu Santo, doch der groß gewachsene Offizier deutete ihre Feindseligkeit auf eine Art, die ohne Weiteres zu einem diplomatischen Zwischenfall hätte führen können.
»Und ansonsten hat der General Ihnen keine Geschenke mitgegeben?«, fragte der Major Sharpe.