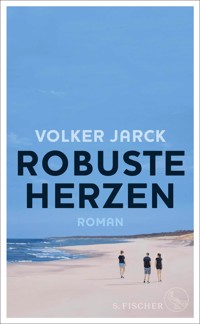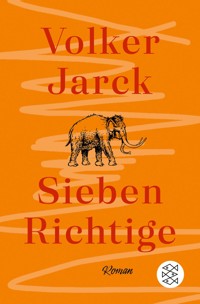
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
»So inspirierend, so lustig, so traurig, so schön. Lesen! Ob im Strandkorb oder vorm Kamin.« Münchner Merkur »Jarcks große Kunst besteht darin, das Große und Schwere des Lebens ganz leicht erzählen zu können und das Leichte ganz großartig.« Frankfurter Neue Presse »Dieser Roman bietet genug Tiefgang für Philosophen, genug fantastische Sätze für Literaten und genug Eigenleben, um ihn so schnell nicht mehr aus der Hand zu legen.« Aachener Zeitung »Man wischt sich die Augen: vor Rührung, vor Freude, vor Lachen und vor Staunen, welche Wucht dieser Text hat.« Christoph Maria Herbst Ein kleines Mädchen, zur falschen Zeit an der falschen Kreuzung. Ein Umzugswagen, der nicht an sein Ziel kommt. Eine viel zu traurige E-Mail, eine Frau, die auf ihre Möbel wartet, und ein Abend in Rom mit zu viel Gin im Tonic. Nur ein paar Sekunden verändern und verbinden die Lebenswege von Greta, Victor, Eva und all den anderen. Irgendwo zwischen Bochum und Boston glauben sie an ihre Träume, an die Zukunft oder an das Glück, einmal die Hauptrolle im Leben eines anderen zu spielen, bevor die Jahre vorbeiziehen. Und jeder Herbstspaziergang kann das unvergessliche Kapitel eines richtigen Lebens werden. Augenblicke für immer sind viel mehr als Zufall: Berührend, unterhaltend, literarisch erzählt Volker Jarck in »Sieben Richtige« vom Glück, dass wir alle miteinander verbunden sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Ähnliche
Volker Jarck
Sieben Richtige
Roman
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Sonja
»Sieben Richtige«
erzählt die Geschichten von
Eva Winter
Victor Faber
Marie Faber-Schiemann
Nick Faber [ihr Sohn]
Fabers Nachbarn:
Kathy Ziemer
Roland Ziemer
Greta Ziemer [ihre Tochter]
Linda
Tim
Lucia
Ricardo und Gabriela Santos
Adam Wójcik, Hans-Peter Hess [Kollegen von Marie]
Ursula Faber [Victors Mutter]
Andrea und Richard Wenzel [Maries Schwester und Schwager]
Harald Winter [Evas Vater]
Helena von Campen [Evas beste Freundin]
Sammy Flandergan [Singer-Songwriter]
Schluffi und die Wespe
Charlie Faber
Die Zehntelsekunde,
bevor die Schaukel zurückschwingt: Das ist der letzte Moment ohne Zweifel. Der Moment, in dem wir wissen, dass wir fliegen können, wenn uns irgendwer nur fest genug anschubst. Fliegen bis in den leuchtenden Himmel und nie wieder landen müssen. Die Beine nach vorne gestreckt, die Nase im Wind und grinsend über alle Milchzähne.
Wenn es dann rauschend abwärtsgeht, fühlen wir: Das war schön, aber schöner wird es nicht, denn irgendwann hört es wohl auf.
Bald schon verlieren wir an Höhe, weil irgendwer keine Zeit oder Lust mehr hat, uns mit seiner großen warmen Hand noch mal neuen Schwung zu geben, und werden langsamer und langsamer. Schließlich sitzen wir da, umklammern die kühlen Kettenglieder, rammen die Schuhspitzen in die Erdkuhle unterm Schaukelgerüst und wirbeln ein bisschen Staub auf. Wir könnten jetzt selber schaukeln, aus eigener Kraft, könnten rückwärts Anlauf nehmen, uns abstoßen und keuchend höher hinauskommen, immer noch ein bisschen höher und höher, ganz allein. Aber das ist nicht dasselbe.
Irgendwer ruft nach uns, wir haben die Zeit vergessen und müssen jetzt gehen, es wird schon dunkel. Das mit dem Fliegen hat nicht geklappt, dabei waren wir so kurz davor.
Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal ganz ohne Zweifel.
EINS Der Mittwoch
Nothing fucks you harder than time.
Ser Davos Seaworth, Game of Thrones
Die Heldin
11. Juli 2018 Abends gegen halb acht – Bochum
»Kannst du nicht schneller, Papa? Guck mal, wie schnell ich fahr!«
Roland Ziemer versucht, gleichzeitig seine Tochter neben ihm auf dem Bürgersteig und den Verkehr auf der Knappenstraße im Blick zu behalten. Zum Glück radelt sie für ihr Alter nicht nur schnell, sondern auch schon verdammt sicher. »Ja, ich seh’s, Greta, aber nicht noch schneller, okay?«
Sie wirft ihre dunkelbraunen Haare zurück und drosselt etwas das Tempo.
»Du, Papa?«
»Ja?«
»Warum wolltest du denn gar kein Eis bei Oma?!«
»Der Opa hatte heute so viele Bratwürste auf dem Grill, danach hatte ich gar keinen Hunger mehr.«
Die Wahrheit ist, dass Ludwig Ziemer neben vielen Bratwürsten auch einige halbe Liter mit seinem Sohn verzehrt hat, die sich mit Eis schlecht vertragen hätten, während Greta hinten auf dem Rasen mit ihrer Oma begeistert Mölkky spielte.
Mit der ganzen Kraft ihrer knapp vierjährigen Beine tritt sie jetzt in die Pedale.
Immer wenn kein Regen in Sicht oder Gretas Mama beim Volleyball ist, schwingen Roland Ziemer und seine Tochter sich auf ihre Sättel. Gewissenhaft hat Greta den orange gepunkteten Helm festgezurrt und die Klingeln getestet, mit ihren kurzen Fingern den Reifendruck überprüft, wie sie es bei Herrn Faber von nebenan beobachtet hat, und dann geht es los, über die weniger befahrenen Wege bis zum Königsbüscher Wäldchen und weiter an den Kemnader See: erst den Spechten zuhören, die keinen Feierabend kennen, dann eine große Pommes teilen. Sie können so schnell radeln, dass die Sonne niemals untergeht, sie sind die Giganten der Feldwege, Helden auf Rädern, und manchmal, wenn es nach den Pommes noch was Süßes gibt, dann wird es ein perfekter Tag gewesen sein.
Bei der letzten Tour hat Greta gefragt, »ist dir schon wieder was ins Auge geflogen, Papa?«, als Roland sich hinterm Hustadtring etwas aus dem Gesicht wischte.
Ich bin live dabei, sackte es ihm vom Kopf bis ins Herz, wenn sie die Welt entdeckt. Und sie hat keinen Funken Angst, kein bisschen.
»Hey, nicht so schnell, Greta!«, ruft Roland, als sie am Köttingsholz vorbeifahren, »sonst wird Schluffi noch schlecht.«
Schluffi Schluffinski, Gretas treuer Beifahrer auf dem Gepäckträger ihres grünen Flitzers, ist ein reichlich in die Jahre gekommener Plüschhase mit trüben, liebenswerten Augen: Schluffi, weil er in der Hüfte immer leicht wegknickt, wenn sie ihn irgendwo hinsetzt, und Schluffinski, weil doch jeder einen ganzen Namen braucht, wie Gretas Papa gesagt hat. Schluffi ist immer dabei, seitdem sie in diesem Frühjahr das erste Mal ohne Stützräder von der Schadowstraße bis zu Oma und Opa gefahren ist.
Bochum liegt dumpf und schwitzend da, als wäre es nach dem heißen Julitag zu faul zum Duschen. Die ganze Stadt ist ein Hinterhofgrill. Aus einem Garten hört man Flaschenklirren. Andreas Bourani friert den Moment ein, pfeifend kommt ihnen ein Student im kragenlosen Leinenhemd entgegen, und ein Mann mit tiefer Stimme ruft: »Was steht hier für Zeug rum?!«, bevor die Haustür hinter ihm zufällt.
»Da vorne anhalten wie immer, okay? Greta?«
Seine Tochter und Schluffi sind Roland Ziemer ein Stück voraus, weil er sich mit dem rechten Flipflop in der Pedale verhakt hat und absteigen muss.
»Warte bitte, Schatz! Hey!«
»Jaha! Was machst du denn?«
Greta bremst ab, sieht sich nach ihrem Vater um und rollt langsam auf die Kreuzung Prinz-Regent-Straße zu.
Roland beugt sich nach unten, um die Flipflops auszuziehen, wobei er aufstoßen muss und Wurst mit Pils sich zurückmeldet. Beruhigt stellt er fest, dass seine Tochter abgestiegen ist und am Vorfahrt-gewähren-Schild auf ihn wartet, wie er es ihr beigebracht hat, jeden Morgen vor der Kita an der großen Kreuzung, noch etwas wackelig beim Anfahren und aufgeregt; ihr Selbstvertrauen ist vor allem Papavertrauen, er ist Gas, Bremse und Rückspiegel für sie, seine Frau bringt ihr lieber das Pfeifen auf zwei Fingern bei.
»Mama fährt ja immer Roller«, hat Greta kürzlich festgestellt, »die weiß gar nicht, wie schwer Treten ist!«
Greta beobachtet ihren Vater dabei, wie er seine Sommersandalen auf den Gepäckträger klemmt.
Und dann hört sie das Geräusch.
Es ist so brummend und schrill zugleich, dass Greta es in ihrem Bauch spürt, ehe sie ahnen kann, woher es kommt. Sie lauscht und schaut in den Himmel, lugt an dem gelben Eckhaus nach rechts in die Prinz-Regent-Straße, doch in dem Moment, als ihr Papa von hinten ihren Namen ruft, weiß sie: Das ist kein Flugzeug, das Geräusch kommt von links. Und es kommt schnell. Es kommt schneller, als irgendjemand hören, sehen oder weglaufen kann. Es dröhnt, es tut weh.
Erschrocken weicht Greta zurück, weil ein schwarzes und gleich dahinter ein weißes und ein knallrotes Donnern auf sie zufliegen, schreiend schließt sie die Augen und will zu ihrem Papa, der seine Gazelle auf die Straße geschubst hat und barfuß losgerannt ist. »Aaah!«, schreit es und »Nein!«, dann kracht das schwarze Dröhnen in Höhe der Bushaltestelle rechts auf den Gehweg.
Greta kann sich nicht bewegen, sie springt nicht zur Seite. Sie hat die Augen noch geschlossen, als das laute Etwas sie und ihr Fahrrad gegen die Hauswand schleudert. Und dann an den Betonpollern vorbeischrammend zum Stehen kommt.
Die anderen Geschosse aber heulen vorbei, rauschen weiter, Seite an Seite, in Richtung Königsallee – laut, uneinholbar, unaufhaltsam. Lassen Greta hinter sich, das Vorfahrtsschild und den beim Aufprall erstarrten Roland Ziemer, der in diesem Moment nichts denken kann, der sich nur ducken will und zur Seite springen, viel, viel zu spät, wie Greta hätte zur Seite springen sollen, entkommen, sich retten, nur weg da. Die Superheldin muss doch fliegen können.
Roland zittert. Er muss jetzt da hingehen, wo seine Tochter liegt, zwanzig unendliche Meter entfernt, er muss sich das anschauen, er will nicht wissen, was passiert ist, seine Beine knicken weg.
Ein bisschen Straßenbelag mit weißen Markierungen, drei Schilder und ein paar Häuser, eine Reihe von knorrigen Sträuchern hinter einem Zaun, daran ein Zirkusplakat, rot, orange und blau: eine stinknormale Kreuzung. Ein Ort des Unglücks.
Im Schatten des gelben Altbaus klammert sich Schluffi Schluffinski an Gretas Gepäckträger. Er sieht nicht zerknautschter aus als sonst, aber hinterm linken Ohr hat er frisches Blut.
Der Zirkus kommt Anfang Oktober.
Warten
Auch gegen halb acht – Köln
Noch zwei Stunden Tageslicht, aber vom Lkw keine Spur.
Eva Winter steht am geschlossenen Fenster, die Nase an der kühlen Scheibe, und behält die Birkenallee vor ihrer kleinen Terrasse im Blick.
Ein Junge im zu großen Eishockeytrikot schlurft an dem Halteverbotsschild Ecke Kirchweg vorbei, das sie hat aufstellen lassen. Mit Daumen und Mittelfinger zieht er ein Kaugummi aus dem Mund und klebt es sorgfältig in das ›g‹ von ›Umzug‹.
»Ist nicht viel los in den Ferien«, hat der Chef des Bochumer Umzugsunternehmens gesagt, »aber kann natürlich immer was sein. Kollege startet nach’m Berufsverkehr. Fahrense mal vor, machen sich mal keine Sorgen, wir sind in Köln, bevor’s dunkel wird.«
Direkt gegenüber ihrer neuen Wohnung ist eine Postfiliale, wie praktisch, findet Eva, da kann ich Briefe noch abends rübertragen ohne Jacke, aber ihr fällt niemand ein, dem sie auf Papier schreiben wollte oder müsste, und warum sie warten sollte bis kurz vor Ladenschluss, weiß sie auch nicht.
Seufzend knibbelt sie mit dem Daumennagel einen Aufkleber vom Lichtschalter, den ihre Vormieterin versehentlich oder absichtlich nicht entfernt hat: Barney Robin Marshall Lily steht da noch, der Rest klebt schon an ihrer Fingerkuppe.
Der Fahrer hat nicht angerufen, er würde sich nur melden, wenn’s später wird, hieß es.
»Was genau«, hat Eva gefragt, »meinen Sie mit ›später‹?«
»Später als dunkel.«
Eva beschließt, schon mal das bisschen auszuladen, was sie im Auto hertransportiert hat, weil sie es nicht den Umzugsleuten anvertrauen wollte: das Notebook, das goldgerahmte Foto, die Kaffeemaschine mit der Glaskanne, das kleine weiche Kissen, auf dem steht Ich war’s nicht, ich hab geschlafen!.
Sie greift sich den Schlüssel, der noch wie ein fremdes Stück Metall an dem Anhänger mit der knubbeligen Plastikschildkröte hängt. Er scheint noch nicht zu ihr und ihrem Leben zu gehören. Vorhin war sie fast überrascht, dass sich damit eine Tür öffnen ließ, hinter der sie von nun an wohnen würde. Irgendwas beginnt hier an diesem Abend des 11. Juli, nachdem keine hundert Kilometer und keinen halben Tag entfernt etwas anderes zu Ende gegangen ist.
Eva war überrascht, wie viele Unterschriften man leisten, wie oft man als Blutsverwandter dokumentieren muss, dass gar kein Blut mehr durch den Körper des Angehörigen gepumpt wird. Ausfüllen, ankreuzen, abhaken. Der Tod ihres Vaters war ein letzter aufwendiger Verwaltungsakt für die Tochter des Verwaltungsbeamten. Denn selbst wer zu Lebzeiten alles geregelt hat, endet als Beitragszahler; überall muss man final abgemeldet werden.
Dass man sich um ›schonende Abwicklung‹ bemühen werde, hatte die Heimleiterin gesagt, niemand wolle ja ein ›endloses Ende‹, sie habe da so ihre Lebens- und, nun ja, Todeserfahrung, nur noch die letzten Sachen und die letzten Papiere, und mit dem Foto solle Eva aufpassen, das rutscht immer aus dem schönen und verzogenen Rahmen.
Harald und Luise Winter haben gern gelacht miteinander, solange sie zusammen waren, aber nur ein einziges Mal in eine Kamera. Das war an dem Tag, als Eva den neuen Selbstauslöser testen wollte. Sie improvisierte eine Anekdote aus der Uni, die ihren Eltern gefallen musste, und zählte im Kopf die Sekunden runter. Sie erwischte die beiden in maximaler Fröhlichkeit, schöner Moment. Sie stand zwischen ihnen, einen Kopf größer, hatte sie untergehakt und die Augen weit geöffnet. Das Foto von der kleinen Familie bekam den Ehrenplatz auf der Kommode im Schlafzimmer, später dann auf dem Fernsehschränkchen im Altenheim.
»Sind Sie denn jetzt ganz weg, oder …?«, hat Evas Bochumer Vermieterin anstandshalber gefragt und sich mit dem Übergabeprotokoll Luft zugefächelt. Die runzlige Dame hatte ihre Schlüssel und ihr Blatt Papier, sie wollte nach Hause, murmelte etwas vom Rasen, den sie noch wässern müsse. Eva sagte: »Nee, also, ja – ich bin erst mal ganz weg, glaub ich.«
»Na ja, Sie können machen, was Sie wollen, Sie haben ja niem… − Sie sind ja selbständig.«
»Genau«, antwortete Eva und ergänzte im Kopf: Single und Vollwaise. Ist das eigentlich ein Familienstand? Egal, ich kann alles machen, wie ich will. Yey.
Vor zehn Jahren, als Luise Winters Bauchspeicheldrüse endgültig nicht mehr konnte, da hat Eva mit ihrem Vater gemeinsam den Sarg ausgesucht, die Blumen und den Rahmen für die Anzeige. Zehnmal dachte sie: Das würde Mama mögen, und kein einziges Mal: Eines Tages stehe ich hier allein.
Am Abend nach Luises Beisetzung brachte Eva ihren Vater heim, und er steuerte direkt aufs Schlafzimmer zu; dort nahm Harald Winter das Foto zur Hand und ließ sich aufs Bett sinken, das er nun für sich allein haben würde.
»Sollen wir nicht noch was trinken, Papa?«, fragte Eva vorsichtig.
Ihr Vater schüttelte den Kopf. »Ihre Locken hast du, Evi, und ihre Macken auch. Mein großes Mädchen.«
Eva hatte studiert, wo sie aufgewachsen war, und war geblieben, wo sie studiert hatte. Die WG und dann die eigene Wohnung, in der sie lange blieb, trotz allem – mehr Freiheit brauchte sie nicht, für mehr Freiheit hatte sie einen eigenen Kopf. Immer hätte sie woanders hingehen können, und immer wohnte sie genau deswegen ein Ortsgespräch entfernt von den beiden Menschen, die ihr Ursprung und ihr Zuhause waren.
Evas Aktionsradius fühlte sich immer klein und deutsch an, und so war er gut und schmerzfrei. Es gab in Bochum genug Kneipen, um nicht zweimal mit demselben Mann trinken zu müssen, genug Auslauf und Wolken am Himmel, ein paar U-Bahnen, ein Kino mit Untertiteln, so viele Buchhändler wie Tätowierer, zweimal im Jahr einen schönen Regenbogen. Sie hatte ihren Kiosk, Hautarzt und Friseur, sie hatte das Reisebüro hinterm Bergbau-Museum, von hier aus kam sie an jeden Ort der Welt, der für eine begrenzte Zeit begrenzte Aufregung versprach.
Einmal hatte sie einen Freund gehabt, für Monate, mit dem spazierte sie durch Prag, schnorchelte mit einem anderen vor Lanzarote, dann kurierte sie ganz allein eine Bronchitis auf Kreta aus oder schrieb in wenigen Wochen ein halbes Manuskript in Andalusien, wo eine wilde Katze so lange vor ihrem Apartment campierte, bis Eva für sie eine Nebenrolle erfand in der Geschichte über Rocket und das Meer.
Viele Jahre lang war Eva mittwochs oder freitags bei allen Flügen und Unterkünften von der netten Frau Reschke beraten worden, aber als die in die Babypause ging, buchte Eva sonntagabends online oder fuhr mit dem Auto an die Nordsee und grüßte danach jeden mit ›Moin‹ oder sogar ›Moin, moin‹. Ihre Eltern waren dankbar, dass der erste Weg nach jeder Reise ihre Tochter immer zu ihnen führte. Sie grüßten zurück mit ›Moin‹ oder ›Buongiorno‹ oder ›Kalimera‹ und drückten Eva die Tüte mit Milch, Bier und Schokolade in die Hand, mit Liebe und gut gekühlt.
Im Jahr 2018 ist Eva Winter nun zum Menschen ohne Eltern geworden. Und hat nach so viel Leben die Stadt verlassen, die für immer in ihrem Personalausweis stehen wird. Sie kann machen, was sie will. Sie ist niemandes Kind mehr, sie könnte sogar mutig sein, wenn sie wollte. Eva hat beschlossen, dass es ihr gutgehen wird.
»Also«, knarzte Evas Vermieterin zum Abschied, »Kaution kommt. Kann aber ’n bisschen dauern.« Und verschwand. Ein Nachmieter würde sich finden, es findet sich immer jemand, der nach uns das Licht wieder einschaltet.
Die neuen Kölner Nachbarn haben ihre Autos so viel präziser in die Parkbuchten unter den alten Birken manövriert, dass Evas Wagen hier nicht nur wegen des BO-Kennzeichens auffällt. Sie betrachtet ihren linken Hinterreifen und den deutlichen Abstand zum Fahrbahnrand – egal. Beim Öffnen des Kofferraums fällt ihr ein, dass sie die Ginger-Ale-Kiste noch zum Pfandautomaten bringen wollte, aber so hat sie jetzt zusammen mit dem Kissen wenigstens eine Sitzgelegenheit in der leeren Wohnung, bis endlich die Leute mit den Möbeln eintreffen.
Warten ist ja keine Kunst, findet Eva. Eher Handwerk. Und fingert mit knurrendem Magen aus dem Briefkasten ihres Nachbarn den aktuellen Flyer mit den Sommerangeboten der Pizzeria Pronto.
Jetzt ist es Zeit
Auf der A 3
Ricardo Santos muss anhalten, er muss so unglaublich dringend anhalten.
Eine Fahrtstrecke von siebenundachtzig schlappen Kilometern ist eigentlich ein Witz, eine lächerliche Distanz für einen Profi wie Ricardo, der auf dem Fahrersitz des Lkws jahrelang trainiert hat, seine Blase erst zu entleeren, wenn er ohnehin den Tank wieder auffüllen muss.
Aber an diesem Mittwoch, der so heiß war, dass Ricardo den ganzen Nachmittag über viel trinken musste, hat er schon kurz hinter Wattenscheid das miese Gefühl, dass er nicht wird durchfahren können.
Kurz hinter Hubbelrath ist es dann schließlich so weit: Grummelnd setzt Ricardo Santos dreihundert Meter vor dem Parkplatz Bachtal den Blinker und rollt zu seiner ersten unfreiwilligen Pause in fünfzehn Logistikjahren. Er wird später ankommen als geplant, er muss ja auch noch in Porz die beiden Studenten einsammeln, die beim Ausladen der Möbel helfen sollen, alles Mist heute. Er würde sich jetzt ärgern, wenn seine Tochter ihm nicht neulich mal gesagt hätte, dass er mit den grimmigen, gezackten Falten aussieht wie Opa Enrique damals nach dem zweiten Schlaganfall.
Recht hat sie, denkt Ricardo, nur kurz pinkeln, nicht lange ärgern.
Da kein anderer Wagen auf dem Rastplatz zu sehen ist, beschließt er, das muffige Toilettenhäuschen zu meiden, und stapft hinter den Mülltonnen entlang ein paar Schritte in Richtung der Büsche, die das Gelände säumen. Dort öffnet er den Reißverschluss seiner grauen Latzhose, lauscht dem Lärm der Autos, die an diesem warmen Feierabend über die Autobahn rauschen, und dem Strahl auf trockenem Gras.
Ricardos Blick wandert die Felder des Bachtals entlang. Über ein sattes Grün segeln geduldig zwei Falken auf der Jagd nach Feldmäusen zum Abendessen, noch weiter oben quert ein Flugzeug die A 44, und – eine Wespe schwirrt durch das Sichtfeld des Lkw-Fahrers. Instinktiv pustet Ricardo das kleine dunkle Tier vorsichtig weg, weil man ja nach Wespen nicht schlagen soll – doch pusten soll man auch nicht. Nachdem sie eine Schleife um seinen Kopf geflogen ist, taucht sie direkt an seinem rechten Ohr erschreckend laut wieder auf, er dreht sich zur Seite, wedelt mit der freien Hand zweimal kurz auf und ab – obwohl man ja nach Wespen nicht schlagen soll.
Im nächsten Augenblick spürt Ricardo Santos den Stich.
Er wirft den Kopf zurück und schreit auf, als das streunende Insekt seine Widerhaken in die Haut schlägt, um Gift zu verspritzen, und denkt noch, das kannst du keinem erzählen – aber immerhin wird das Scheißviech ja nun wohl Ruhe geben, so dass er beenden kann, was er angefangen hat, und endlich weiterfahren, um seine Ladung einigermaßen pünktlich nach Köln zu schaffen.
Fluchend betrachtet Ricardo die rote Einstichstelle fünfzehn Zentimeter unterhalb seines Bauchnabels; sie scheint anzuschwellen, sie brennt. Er hat die Träger seines Overalls noch nicht wieder über die Schulter gestreift, als er plötzlich schwankt und ruckartig mit der linken Hand ins Leere greift, um sich irgendwo festzuhalten. Daraufhin schließt er kurz die Augen und atmet durch die Nase ein. Sein Mund ist trocken wie Asphalt, und als er wieder nach oben schaut, sind die Falken am Himmel nur noch verwischte Kleckse. Mit dem Schwindelgefühl zischt ein Schmerz unter die Kopfhaut, und Ricardo hatte nie Kopfschmerzen. Blödes Tier, denkt er, jetzt brennt das wie Hölle, und ich weiß schon gar nicht mehr, wann mich das letzte Mal −
Und dann kann er gar nichts mehr denken, weil ihm die Luft wegbleibt. Sein anaphylaktischer Countdown hat begonnen: Jetzt ist es Zeit für die Angst vorm Sterben.
Keuchend presst Ricardo seine Zungenspitze gegen die Zähne, taumelt aus den Büschen, bleibt mit dem Fuß an einer Plastiktüte hängen, hört sein eigenes Röcheln und reißt die Augen auf in der panischen Hoffnung, dass ein Auto anhält – er schnappt, schnappt, schnappt nach Luft.
Niemand bemerkt ihn, niemand hält, alle fahren vorbei.
Noch einmal bäumt er sich auf, dann sinkt er auf die Knie. Während er zur Seite kippt in den Busch, fliegt die Gemeine Wespe in Richtung Neandertal davon. Sie wird Ricardo Santos überleben um zwei Monate und zehn Tage.
Strikeout
Im selben Moment in Boston
Es ist zu heiß, und ihm fehlen die Worte.
Nach drei Wochen in der großen fremden Stadt hat sich Victor Faber aus Bochum an das rauschende Klappern der Klimaanlage gewöhnt. Es ist der Soundtrack des Sommers in Boston, und er kann sich sein Leben hier nicht mehr vorstellen ohne die künstlich kühlen Nachmittage, die er in Nicks Apartment am Scrabble-Brett verbringt, allein im Kampf gegen hundert Plastikbuchstaben und die Löcher in seinem Kopf.
Die beiden Joker, blank und verheißungsvoll, sind in diesem Sommer seine liebsten Spielkameraden, wenn sein Sohn mit dem Team unterwegs ist. Wenn gar nichts mehr geht, wenn sein Kopf glüht, weil ihm 5738 Kilometer von zu Hause kein deutsches Wort mehr einfällt, dann ist so ein unbeschriftetes Plättchen die letzte Rettung, Frischluft für den Wortschatz.
Ein L, ein A, ein Z, O, R und K liegen gleichmütig auf dem Bänkchen. Und das Y, natürlich. Er hat sich vorgenommen, alles auswendig zu lernen, was man mit dem doofen Y anstellen kann, wofür gibt es Listen im Netz: Yuan, Pitaya, Oxyd, Ysop, Polymer. Manchmal merkt er sich die Begriffe und manchmal auch, was sie bedeuten.
Er hätte das nie mit den Schülern spielen sollen, warum sind sie damals nicht einfach ins Schauspielhaus gegangen: zwei Stunden Physiker mit Musik und tieferer Bedeutung, für jeden ein Spaghetti-Eis auf dem Heimweg, fertig.
In acht Jahren hatte kaum ein Zwölftklässler von ihm wissen wollen, was Sprache und Literatur so besonders macht, sondern nur, was man wissen müsse, um nicht am System zu scheitern. Alle wollten sie be-, nicht verstehen, sei’s drum, er nahm es gelassen, schulterte seinen Rucksack und ging rüber in die Turnhalle, wo hochmotivierte Siebtklässler beim Hockey mit Plastikschlägern auf ihre Schienbeine eindroschen.
Aber dann hatte er, als die Sammelbestellung der Dreigroschenoper nicht rechtzeitig eingetroffen war, in der Mittagspause drei Scrabble-Schachteln im Erdgeschoss der großen Buchhandlung erstanden und beim neunten Deutsch-Leistungskurs seines Lehrerlebens eine unerklärliche Leidenschaft entfacht fürs Deklinieren und Konjugieren, für das lukrative Ä, Ö und X auf rotem Grund. Erst hatten einige Schüler augenrollend abgewinkt bei diesem »analogen Omma-Spiel«, doch bald schon wurde das dunkelgrüne Stoffsäckchen zu jedermanns Wundertüte, und dann jubelten sie, Linda, Tim und all die anderen, wenn sie zum Q noch das U zogen, und kämpften zähnefletschend um Punkte wie früher um die Disco-Verlängerung am letzten Abend im Landschulheim.
Verblüfft stellte Victor fest, dass ein Dutzend Schüler alles nachzuschlagen begann, was ein Begriff hätte sein können. Sie lebten nur dafür: verbundene Wörter ohne Zusammenhang. Und er applaudierte ihnen mit einem Lachen, als ihre fliegenden Fingerspitzen die 26. Duden-Auflage zerfledderten, elf Mädchen und fünf Jungen, die stritten und strahlten, Doppelstunde um Doppelstunde, und ihr Lehrer Faber nannte es lexikalische Vertiefungsübungen zu Flexion und noch irgendwas, das nach Lehrplanvorgaben klang.
Reclam-Hefte blieben unbeachtet in den abgewetzten Rucksäcken, Werther musste ohne sie sterben, und um den Stress einer mündlichen Prüfung zu simulieren, versuchten sie eine Gedichtanalyse in der Pause eines Tretbootrennens. Hechelnd und dümpelnd, mit Sonne im Gesicht, hörten sie Herrn Faber zu, der Erich Fried vorlas: »Das Leben wäre vielleicht einfacher, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Es wäre nur nicht mein Leben.«
Und irgendwer sagte, nach endlosem Schweigen: »Gedichte sind doch irgendwie wie Scrabble, oder? Wenige Buchstaben, aber an der richtigen Stelle.«
Victor hebt den Kopf, manchmal hilft es, den Blick vom Brett zu nehmen und aus dem Fenster zu schauen, bis die Buchstaben einen Sinn ergeben, der im Wörterbuch steht. Er spielt wieder mal gegen seine abschweifenden Gedanken und die amerikanischen Temperaturen. Unten auf der Straße heult sich ein Krankenwagen durch die Fairfield Street, ein UPS-Lieferant blockiert die Fahrbahn.
Ein vibrierendes Ping verrät Victor, dass eine Nachricht eingegangen ist. Während er sich drei neue Steine aus dem Beutel greift, tippt er auf seinem Smartphone das Mail-Symbol an.
Marie hat ihm geschrieben. Marie hat ihm geschrieben mit dem Betreff Nicht so gut.
Typisch Marie: Nie schreibt sie ›schlecht‹ oder spricht von ›beschissenen Neuigkeiten‹, wenn die Neuigkeiten beschissen sind; bei Marie ist alles immer ›weniger positiv‹ oder eben ›nicht so richtig gut‹, weil darin immerhin noch ein ›gut‹ steckt. Als die Ärztin damals am Telefon sagte, sie müsse sich wirklich beeilen, wenn sie sich noch von ihrem Vater verabschieden wolle, da schluckte Marie einmal trocken und sagte zu Victor, der sie fragend ansah: »Er hat sich nicht verbessert, der Zustand.«
Es ist eine lange Mail, und Victors Augen springen nach Lieber Victor nicht in die zweite Zeile, sondern seltsam quer durch den Text, sie entdecken Wörter, deren Zusammenhang er nicht wahrhaben will, weil es Wörter sind, die bisher nicht in Maries E-Mails standen, fremde Wörter wie Zytostatika oder Pertuzumab oder Mortalität. Marie schreibt tatsächlich nicht von ihren Überlebenschancen, sondern von rückläufiger Mortalität. Sie wolle nicht klagen, liest Victor, aber sterben eben auch nicht −
… jedenfalls noch nicht. Und natürlich ist ein fortgeschrittener Tumor in der Brustdrüse nicht so gut, aber weil ja laut Internet und laut Frau Dr. Krominger die Mortalität rückläufig ist, muss niemand verzweifeln, denke ich.
Ich habe mich nun aber gefragt, wie wir es mit der Scheidung machen sollen. Wir hatten uns ja darauf geeinigt, und ich suche schon die ganze Zeit nach Wohnungen, um aus der Pension rauszukommen. Aber wenn du nächsten Sommer nach deinem Sabbatical zurückkommst, geht es mir mit einer normalen Wahrscheinlichkeit schon etwas schlechter. Sollen wir alles früher regeln? Vielleicht möchtest du nachdenken über diese Fragen und etwas entscheiden.
Ich schreibe jetzt auch eine Mail an Nick. Hast du sein Spiel gestern live im Fernsehen angeschaut? Bestimmt. Ich habe schon gelesen, dass sie leider nicht so super waren wie vorgestern, und schaue mir nach meiner Schicht noch die Zusammenfassung auf dem Tablet an. Baseball macht mir mehr Freude als der netdoktor, das habe ich auch der Ärztin gesagt und ihr ein Foto von Nick im Trikot gezeigt. Sie hat mir versprochen, wenn ich eine vorbildliche Patientin bin und überlebe, darf ich ihr irgendwann die Regeln erklären. Du könntest das besser, ich weiß, aber ich bin gern noch eine stolze Sportler-Mama, solange ich da bin.
Ist es immer noch so heiß in Massachusetts? Bochum könnte auch mal wieder Regen vertragen. Du solltest besser frühmorgens laufen gehen, Hitze ist im Alter nicht so gut, dein Kreislauf ist immerhin auch schon 52 ;-)
Bis bald vielleicht,
M.
Victor legt die Spielsteine ab, seine Finger haben sich um ein N, ein A und ein I geschlossen, die kleine rote Abdrücke hinterlassen. Er schaltet das Telefon nicht aus.
Sein Blick verschwimmt über zehn Wörtern, die richtig und unwichtig sind. Marie ist krank, und nun warten auf der grünen Plastikleiste noch K, R Z und O auf die nächste gute Idee von Victor Faber, Lehrer für Deutsch und Sport, Ehemann (getrennt) und Vater, der an diesem 11. Juli schief und ratlos auf dem Stuhl sitzt im Gästezimmer seines Sohnes.
Nach wenigen Sekunden stellen die Synapsen eine Verbindung her zwischen den Zeichen und dem Fremdwortschatz:
Karzinom, überlegt Victor, das wäre ein Bingo. K-A-R- Z-I-N-O hab ich.
Ihm ist eiskalt, und ihm fehlt das M.
Eben nicht
Rom
Abends kurz vor acht sind die alten Steine angenehm warm.
Am Ufer des Tiber, auf einer Mauer mit Geschichte, blinzeln Linda und Tim in die Sonne hinterm Petersdom. Die Luft sirrt über dem Wasser, am Brückengeländer hat auf Höhe des mittleren Bogens eine Schulklasse Aufstellung genommen. Eine Lehrkraft fuchtelt, die Spiegelreflexkamera wie einen Granatwerfer vor der Brust, die Großen sollen nach hinten, die Kleinen gehen nach vorn und wollen nicht klein genannt werden, in zwei Stunden ist die Sonne weg, dann sind Foto und Augenblick im Eimer und die Klassenfahrt für immer, für immer vorbei.
»Der Himmel ist photogeshoppt, oder?« Tim trinkt abwechselnd aus der Wasser- und der Weinflasche.
»Mhm, kann sein.«
»Du bist doch Graphikdesignerin, du müsstest das sehen. Alles tipptopp strahlend blau bearbeitet. Ganz Rom, die komplette Silhouette, eine einzige große Touristengraphik! Oder? Findste nicht? Leuchtet doch voll unnatürlich.«
Linda stützt sich ab, ihre Füße baumeln gegen die Ufermauer, der Stein kratzt an ihren nackten Waden, aber sie muss probieren, wie nah sie mit ihren Espadrilles ans trübe Wasser kommt, ohne dass die Sohlen nass werden.
»Ist noch was drin?«, fragt Linda. Sie sieht die Weinflasche und nicht ihren Freund an.
»Klar.«
»Danke.«
»Prego.«
Mit einem Ächzen lässt Tim sich rückwärts sinken und verschränkt die Arme hinter dem rasierten Kopf.
»Also, ich find’s cool in diesem ollen Rom, Lindi. Ich bin heute so entspannt, ich weiß nicht mal, welchen Wochentag wir haben. Hier kommen wir auf jeden Fall noch mal her, mindestens einmal, mindestens.«
»Ja?«
»Si, Signora. Ist doch super. Kann man ja gar nicht alles gucken in vier Tagen. Ist ja viel zu viel, die ganze Geschichte und so.«
Linda hält die fast leere Weinflasche gegen das Licht. »Signorina, nicht Signora.«
Tim lacht. »Oh, Entschuldigung, Fräulein Bernikov. Aber«, er dreht den Kopf zu ihr, »wir könnten ja heiraten. Oder? Ich meine, bevor wir das nächste Mal herkommen. Oder, genau, Flitterwochen in Rom, wie cool wär das bitte!« Er schickt noch ein Lachen hinterher und wartet, dass seine Freundin einstimmt, doch sie lacht nicht, sie lacht überhaupt nicht.
»Vielleicht«, sagt Linda und fühlt, wie die Sonne noch jede einzelne Pore auf ihren Oberschenkeln wärmt, »hab ich ja gar keine Lust.«
»Keine Lust, hallo? Rom ist ja wohl die Hammerstadt mit dem, was man alles gucken und machen kann. Und du findest doch das Essen super, hast du jedenfalls gesagt, wieso solltest du keine Lust haben, in ein oder zwei Jahren noch mal herzukommen?«
Auf der Brücke Vittorio Emanuele sagt der Lehrer sehr laut »So!«, und als er die Aufmerksamkeit der Klasse hat, erklärt er, sehr viel leiser, irgendetwas, was mit dem Vatikan zu tun haben muss, denn dorthin weist sein nach hinten gestreckter Arm, während er die Großen und die Kleinen nicht aus den Augen lässt.
Linda sagt: »Irgendwie erinnert der mich an den Faber.«
Die Hand schützend über die Augen gelegt, beobachtet sie den Lehrer beim Erklären, auch wenn nicht zu verstehen ist, was er über die Stadt oder die Päpste weiß und in diesem Moment weitergibt.
»Oder? So von der Optik und wie der vor der Klasse steht?«
»Faber hat nicht so gefuchtelt«, bemerkt Tim.
»Nee, das nicht, aber der hat sich auch immer so verbogen, um auf die Tafel zu zeigen.«
»Mhmm. Aber …«
»Ja?«, sagt Linda.
»Immer wenn du irgendwas doof findest, lenkst du ab, anstatt einfach zu sagen: ›Ich hab keine Lust, nächstes Jahr schon wieder nach Rom zu fahren.‹ Kannst du doch einfach sagen. Warum tust du so, als hättest du mich nicht gehört, muss doch nicht sein!«
»Tim?«
Linda zieht die Beine etwas an und dreht sich zu dem Mann, der seit dem fünfjährigen Abitreffen ihr Freund ist.
»Jaaa?« Er richtet sich langsam wieder auf.
»Ich bin fünfundzwanzig …«
»Weiß ich. Bin ich auch.«
»… und ich hab noch nicht entschieden, ob ich noch mal nach Rom will.«
»Aha.«
»Oder wann. Oder wie oft.«
»Okay. Und mit wem, auch nicht?« Tims Stimme kiekst ein bisschen, er hatte noch einen Schluck Wasser im Mund.
»Ja, keine Ahnung, ich meine …«
Tim sieht sie an und streckt die Hand nach der Weinflasche aus.
»Ist fast leer, kannste austrinken. Tim, ich mein ja nur – wieso soll und … und wie kann ich denn jetzt bitte wissen, was passiert … irgendwann?!«
»Du willst keine Flitterwochen.« Er hat die Weinflasche an den Lippen und trinkt nicht. »Dann halt nicht.«
»Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt heiraten will. Wie kommst denn du jetzt überhaupt auf so was?«
»Ich dachte halt, weil’s hier schön ist.«
»Ja, aber woanders isses auch schön! Ich plan doch jetzt nicht unsere Urlaube bis 2044, oder was?!«
Tim hat ein Knurren in der Stimme: »Flitterwochen sind ja wohl kein normaler Urlaub.«
»Kannst du mal mit dem Flitter … Heiratsscheiß aufhören, ich hab echt gerade andere Sorgen!«
»Scheiß? Ja, schönen Dank auch! Boah … Hast du deine Tage, oder was?«
»Nee!! Hab ich nicht, du blöder Arsch! Hab ich eben nicht!«
Da ist es 19 Uhr 46.
In die Schulklasse ist Bewegung gekommen, eine zweite Lehrerin ruft immer abwechselnd »Bitte!«, »Leute!« und »Hallo?!«, um die Gruppe zu disziplinieren, ihr Kollege postiert sich derweil mit zwei Meisterschülern, die ebenfalls mit einer Spiegelreflexkamera bewaffnet sind, am Geländer. Sie planen offenbar irgendeine kühne Perspektive auf das Castel Sant’Angelo, legen Fotoapparat und Kinn auf die schmutzig weiße Steinbrüstung und warten auf den richtigen Augenblick, vielleicht einen Vogelschwarm im Hintergrund.
»Leute! Hallo?! Bitte!«
Einer der großen Schüler hat einer kleineren Schülerin die weiß-grün-rote Basecap vom Kopf gerissen, er fuchtelt damit über dem Brückenrand und droht, sie ins Wasser fallen zu lassen.
»Hallo?! Leute! Bitte!«
»Und jetzt bist du schwanger, oder wie?«
Tim hat irgendwo am Boden der Rotweinflasche seine Sprache wiedergefunden, aber seiner Freundin kann er gerade nicht in die Augen schauen.
In Lindas Blick ist ein wildes Funkeln, ihre Wangen glühen, dünne helle Strähnen scheinen vor ihrer Stirn zu zucken.
»Und?«, sagt sie so laut, dass ein Rentnerpaar auf der Promenade synchron erschrickt, »und was, wenn, Tim? Was dann? Hä? Was?! Dann!?«
Weil Tim den Mund geöffnet, aber keine Antwort zu Stande gebracht hat, fügt sie hinzu: »Heute ist übrigens Mittwoch.«
Das Mädchen auf der Brücke schnappt im Sprung nach der bunten Mütze am ausgestreckten Arm ihres Mitschülers, sie rempelt ihren Lehrer an, als sie strauchelnd wieder landet, und dessen große Kamera fällt in den schlammigen Fluss.
»Bitte! Leute! Hallo?!«
Es ist nur ein Tier
Köln
Eva Winter hat die Klingel getestet und sehr laut eingestellt, sie ist sich ganz sicher, dass es ausgerechnet in dem Moment läuten wird, wenn sie aufs Klo geht, aber irgendwann hält sie es nicht mehr aus. An der falschen Wand des fensterlosen Badezimmers tastet sie nach dem Lichtschalter, und als sie ihn schließlich gegenüber gefunden hat, stellt sie fest, dass ihre Vormieterin offenbar den Strom komplett abgestellt hat.
Als sie um 19 Uhr 48 die leicht klemmende Klappe des Sicherungskastens öffnet, fällt ihr ein gefaltetes Blatt vor die Füße: Darauf sind die Nummern der Sicherungen und die dazugehörigen Räume in Druckbuchstaben aufgelistet – ›hätte Papa genauso gemacht‹, fällt Eva ein, und sie weiß, sie muss sich an dieses ›hätte‹ gewöhnen, das man benutzt, wenn jemand nicht mehr lebt und nichts mehr tut, der alles für einen getan hat, achtundvierzig Jahre lang. Noch nicht mal gezuckt hat ihr Vater, als sie vom Schreiben erzählte, von den Ideen und Geschichten, die sie zum Leben erwecken und zum Beruf machen wollte, neugierig war er, auf seine sorgfältige und höfliche Art; und dass das Vorlesen damals, Anfang der Siebziger, noch weit verbreitet und ein schönes Ritual gewesen sei, noch dazu bei ihr offensichtlich sehr nachhaltig, das freute ihn ohne Abstriche, und so beruhigte er auch Evas Mutter.
Wenn Eva nach dem schlimmsten Tag ihrer erwachsenen Erinnerung zu ihren Eltern gegangen wäre, wenn sie das, was ihr so unsagbar weh tat, damals hätte teilen wollen, dann hätte sie stillen starken Trost gefunden, das wusste sie ganz sicher. Aber das liegt ein halbes Leben zurück, und ausnahmsweise wollte sie ganz alleine traurig sein, wollte später noch Unmengen von Familienfreude teilen, die sie alles andere vergessen ließe, ganz sicher. Denn Luise Winter wusste nicht, dass sie etwas zu laut geredet hatte, an irgendeinem Weihnachtstag bei offener Küchentür, als sie mit Tante Margot über Evas kleinen Bruder sprach, der 1972 unterwegs gewesen war und es nicht schaffte ans Licht der Welt. Sascha sollte er heißen, und Eva sollte nichts davon wissen. Im Flur biss sie sich auf die Lippen und schlich davon. Und als dieselbe untröstliche Scheiße zwanzig Jahre danach passierte, wollte Eva ihre Mutter nicht an das Vergangene erinnern, wollte weder darüber grübeln noch sprechen, ob das Pech vererbtes Pech war.
Seit letztem Freitag bleibt von ihrer Familie eine Platte aus Granit unter rotem Ahorn.
Mit dem Fingerknöchel drückt Eva alle Schalter hoch – in der Küche springt die Lampe an der Dunstabzugshaube an und beleuchtet die feine Staubschicht auf dem Ceranfeld. Den Zettel nimmt sie mit ins Bad. Auf die Rückseite hat jemand etwas gemalt, entweder mit großer Eile oder nicht so großem Talent: eine Sonne, eine Blume, einen Elefanten im Matsch. Einen schlammigen Elefanten mit zu großem Kopf.
Er hatte keinen feinen Bleistift zur Hand, denkt sie, er hatte nur bunt. Sonst wär der ja nicht braun, der Elefant, sondern grau. Braune Elefanten gibt’s nicht.
Erst jetzt bemerkt sie die außergewöhnlich langen, eigenartig gewundenen Zähne des Tiers, und daneben hat der Zeichner geschrieben: Alles nicht schön, aber alles für dich. Du bist nämlich schön und alles für mich. Dein Großwildjäger
Die WC-Spülung rauscht beeindruckend leise und kräftig zugleich, Eva setzt sich auf den Badewannenrand und versucht, sich den Mann vorzustellen, der für die Frau, die hier gewohnt und gebadet hat, ein so seltsam proportioniertes Mammut gemalt hat; den Moment, in dem sie es freundlich oder dankbar oder überrascht entgegengenommen hat, und den Moment, sehr viel später, in dem sie beschlossen hat, dass das nur ein Zettel sei, den man umdrehen kann und weiterverwenden, warum nicht zum Beispiel für die Beschriftung der Sicherungen – als wäre die Stromversorgung von nun an wichtiger als diese wilde und schöne Liebeserklärung.
Ein Kloß im Hals: Eva Winter möchte eine Million Augenblicke erleben in der Geschichte dieser anderen Frau und ihres Großwild-Lovers. Sie will ihn vor sich sehen, die Zungenspitze zwischen den Lippen, wie er mit seinen bunten Stiften ein Tier für die Ewigkeit aufs weiße Blatt kritzelt; wie er die Zeichnung vorm Schlafengehen grinsend unter den Kaffeebecher schmuggelt, den seine Freundin sich für den nächsten Morgen bereitgestellt hat neben der Knäckebrotpackung, sie muss ja früh raus, und jede Minute Schlaf ist kostbar; stutzen wird sie und staunen, ja, wahrscheinlich wird sie verwirrt das Kaffeepulver in den Toaster anstatt in den vorbereiteten Filter schütten und wird den Mann mehr lieben als zuvor und ganz bestimmt für immer und sie –
Es ist nur ein Tier – mit dem Handrücken trocknet Eva die tränennasse Wange –, nur ein ausgestorbenes Zottelvieh, von einem Mann, den ich nicht kenne, nur ein beschissener Zufall, also hör auf zu heulen, Eva Winter, und geh was einkaufen oder eine rauchen oder … sag den Nachbarn guten Tag oder … Mach irgendwas!
Sie kann nicht.
Sie kann nicht einkaufen, sie muss ja hier, wo sie ihre nächsten Jahre verbringen wird, auf die Gegenstände ihres Lebens warten: auf die schwere Topfpflanze, die sie ins Wohnzimmer stellen, auf die Energiesparlampen, die sie einschrauben, auf den Badmintonschläger, den sie bis zum Winter im Keller lagern, und auf das Bett, in dem sie immer ausschlafen will und niemals träumen von dem Stofftier, klein, braun und flauschig, das sie geschenkt bekommen hat vor langer Zeit.
»Ich muss dich allein lassen«, hat ihr Freund damals gesagt und eine pathetische Pause gemacht, die Hände hinterm Rücken versteckt, »ich soll mit auf Klassenfahrt, Berlin, für vier Tage. Blöd – aaaber«, er zauberte das knuffig-plüschige Mammut hervor, »der Kollege hier, der passt auf dich auf.«
»Was ist das denn für’n kleiner Hund?«, fragte sie lachend.
»Das ist doch kein Hund, das ist ein Mammut! Ein … Beschützer … ein Wachmammut! Einerseits wahnsinnig gefährlich – hier, guck, die scharfen Zähne –, aber eben auch sehr anschmiegsam.«
»Verstehe. Danke.«
Ihr höfliches Lächeln verriet, dass sie das ein bisschen zu kindlich-romantisch fand.
»Kannste auf deinen Bauch legen, dann bewacht es unseren Kurzen gleich mit. Hab ich mit deiner Frauenärztin geklärt.«
»Haha, alles klar. Und wie heißt es?«
»Es? Ähm, das Wachmammut, das … heißt … Wama! Wach-Mammut: Wama, so heißt es! So, hier: Wama – Eva, Eva – Wama. Euch kann nichts passieren.«
Sie hat nicht gemerkt, wie sie das Blatt mit einer Hand zerknüllt hat.
Jedem kann alles passieren.