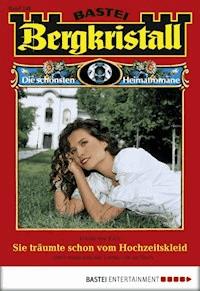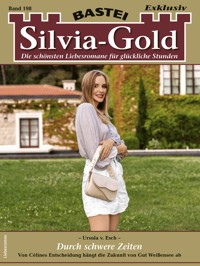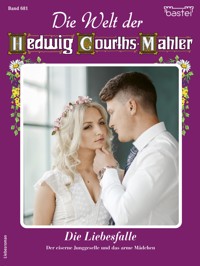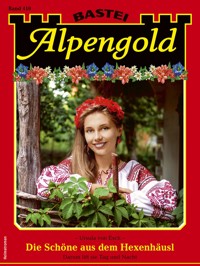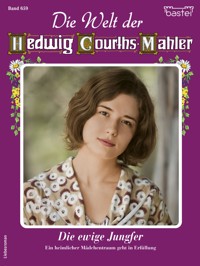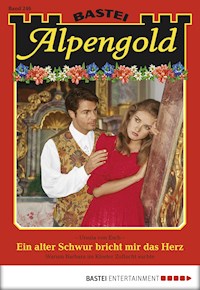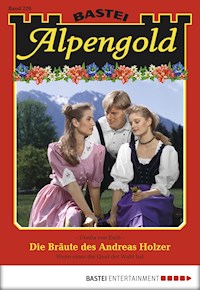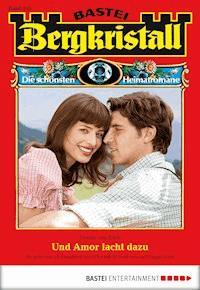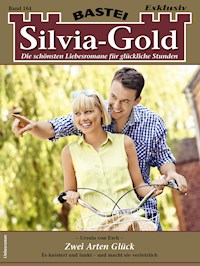
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Silvia-Gold
- Sprache: Deutsch
Jessica versteht sich selbst nicht mehr. Wo ist denn ihr viel gerühmtes Selbstbewusstsein geblieben? Stattdessen sind ihre Knie weich wie Pudding, und ihr Herz rast! Dass Robert von Weißenfeldt aus "gutem Stall" kommt, hat sie bisher nicht sonderlich beeindruckt. Aber als er jetzt vor einem Schloss anhält, wünscht sie sich, der Boden möge sich vor ihr auftun.
»Nervös?«, fragt Robert belustigt. »Werde ich auch sein, wenn ich deine Eltern kennenlerne!«
Jessica wird blass. Dass sie das vergessen konnte! Niemals darf Robert zu ihr nach Hause kommen! Sie muss alles tun, um das zu verhindern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Zwei Arten Glück
Vorschau
Impressum
Zwei Arten Glück
Es knistert und funkt – und macht sie verletzlich
Von Ursula von Esch
Jessica versteht sich selbst nicht mehr. Wo ist denn ihr viel gerühmtes Selbstbewusstsein geblieben? Stattdessen sind ihre Knie weich wie Pudding, und ihr Herz rast! Dass Robert von Weißenfeldt aus »gutem Stall« kommt, hat sie bisher nicht sonderlich beeindruckt. Aber als er jetzt vor einem Schloss anhält, wünscht sie sich, der Boden möge sich vor ihr auftun.
»Nervös?«, fragt Robert belustigt. »Werde ich auch sein, wenn ich deine Eltern kennenlerne!«
Jessica wird blass. Dass sie das vergessen konnte! Niemals darf Robert zu ihr nach Hause kommen! Sie muss alles tun, um das zu verhindern!
»Jessica!«, rief Barbara Büttner entsetzt. »Das ist doch nichts für dich!« Sie strich sich mit einer nervösen Bewegung die Strähne aus dem Gesicht, die sich aus ihrem Knoten gelöst hatte.
»Und weshalb soll es nicht gehen?!« Kampfbereit blickte Jessica, blond, hübsch und gerade zweiundzwanzig Jahre alt, von ihrer entsetzten Mutter zu ihrer womöglich noch entsetzteren Tante.
»Ich habe es vorausgesehen«, orakelte Tante Herta Büttner, die unverheiratete, viel ältere Schwester von Jessicas verstorbenem Vater, »ihr hättet sie nie Jessica nennen dürfen! Damit habt ihr das Unglück sozusagen heraufbeschworen!«
»Ach, Herta, bitte!«, klagte Barbara. Sie hatte das schon so oft gehört, und egal, wie recht Herta haben mochte, es war nicht mehr zu ändern!
»Wieso nicht?« Jessicas Augen blitzten herausfordernd. »Nach allem, was ich weiß, war Großmama Jessica die Einzige in der Familie, die nicht total spießig und langweilig war!«
»Jessica!!!«, erklang es zweistimmig und mit gesteigertem Entsetzen. »Wie kannst du so reden?!«
Jessica lachte zornig und warf sich in einen Sessel. Sie trug Jeans, die für den Geschmack ihrer Tante viel zu eng saßen und ihre Mutter mit Besorgnis erfüllten, da sie Jessicas lange schlanke Beine, den knackigen Po, die Hüften und die Taille so betonten. Das T-Shirt war gleichfalls nicht nach dem Geschmack der beiden Damen Büttner, auch wenn es weit, formlos und verdreht um Jessica schlabberte, denn sie trug ganz offensichtlich nichts darunter, und ihr Busen zeichnete sich unter dem dünnen Stoff nicht weniger reizend ab als ihre appetitliche Kehrseite unter der engen Hose.
Barbara und Herta waren unbeschreiblich stolz auf ihre Tochter und Nichte. Und gerade deshalb waren sie für Jessicas Geschmack auf altmodisch spießige Weise viel zu besorgt um sie. Wenn man sie reden hörte, konnte man denken, dass an jeder Straßenecke ein böser Verführer lauerte und nur auf Jessica wartete. Dabei fühlte diese sich als emanzipierte, modern, junge Frau gegen so primitive Versuchungen gefeit. Schließlich hätte sie schon mal Gelegenheit gehabt, allerlei Erfahrungen zu sammeln, wenn ihr danach gewesen wäre.
Aber es war ihr nicht danach gewesen! Sie würde wegen eines Mannes nie den Kopf verlieren – das sollten die beiden allmählich wissen.
»Ach, Jessica!«, seufzte Barbara bekümmert. »Was redest du für einen Unsinn! Du warst eben noch nie wirklich verliebt!«
»Du tust ja gerade so, als wäre es ein Unglück, wenn man sich wirklich verliebt!«, spottete Jessica.
»Nicht, wenn es der Richtige ist«, mischte sich Tante Herta wieder ein. »Aber ich frage mich, wo sollst du unter dem losen Künstlervölkchen den Richtigen finden? Und erkennen! So jung und harmlos wie du bist!«
Tante Herta war Ende fünfzig und nie verheiratet gewesen. Das würde sich wohl auch nicht mehr ändern, so wie sie aussah. Ganz gewiss nicht unhübsch – aber eben altjüngferlich streng mit ihrem grauen Knoten, dem ungeschminkten, wenn auch regelmäßigen Gesicht, den strengen Hemdblusen – weiß oder weiß blau gestreift –, den langen grauen Röcken, mal weit, mal enger, aber selbstverständlich immer schlecht sitzend, und den fürchterlichen flachen Schuhen, mit denen sie zwar rüstig ausschreiten konnte, die aber jeglichen Charmes entbehrten.
Gelegentlich hielt Jessica ihrer Mutter vor, dass sie in absehbarer Zeit genauso trostlos anzusehen sein würde wie Tante Herta, wenn sie sich nicht schleunigst änderte. Sie zog sich genauso unschick und langweilig an, trug die gleiche unkleidsame Frisur und schminkte sich genauso wenig.
Dabei war Barbara bis zum Tode ihres Mannes vor acht Jahren eine äußerst attraktive Frau gewesen – elegant, schick und jugendlich. Sie war stolz auf ihre bemerkenswert schönen Beine gewesen und hatte deshalb auch immer ausgesucht modische Schuhe getragen, sich nach der neuesten Mode gekleidet und der Knoten, den sie bereits damals trug, hatte dazu sehr apart gewirkt. Denn selbstverständlich war Barbaras Haar damals noch ohne graue Strähnen gewesen, und sie hatte sich gekonnt geschminkt.
Doch nach dem Tod ihres heißgeliebten Mannes war für Barbara das Leben vorbei. Und heute mit ihren gerade fünfundvierzig Jahren ließ sie sich schlicht gehen, wie Jessica empört und betrübt feststellte. Garantiert wäre ihr Vater damit nicht einverstanden!
Jessica lachte zornig, verschränkte herausfordernd die Arme über der Brust und fragte spöttisch: »Hast du denn so viel Erfahrung, Tante Herta, dass du mich beraten kannst?«
Tante Herta wurde rot, dann blass, erhob sich und verließ beleidigt das Zimmer.
»Das war nicht nett von dir«, tadelte Barbara ihre Tochter.
»Es tut mir ja auch leid«, erwiderte Jessica störrisch, »aber warum müsst ihr ständig auf mir herumhacken? Ich will ja schließlich nicht Nachtklubtänzerin werden, sondern Malerin. Und jeder wird euch bestätigen, dass es eine große Auszeichnung ist, wenn man in München auf der Akademie angenommen wird. Was glaubt ihr denn, wie viele hundert junge Leute sich jedes Jahr dort bewerben und mit mehr oder weniger schönen Worten vertröstet und abgeschoben werden? Und ich hatte das Glück, dass man mich annimmt – und nun stellt ihr euch so an ...«
»Ich gebe es ja zu und bin natürlich auch stolz, Liebes! Aber ...«
»Meine Güte, fang nicht wieder damit an! Du kennst sie doch gar nicht, diese berühmte Großmutter Jessica!«, rief Jessica, die Jüngere, sprang auf und lief aufgeregt im Zimmer hin und her.
»Dein Vater hat mir erzählt ...«
»Na, was schon groß?«
»Jessi –!«
»Sag nicht Jessi! Ich hasse diese Verstümmelungen!«
»Entschuldige!« Barbara war den Tränen nahe. »Es ist nur ...« Sie schluckte, nahm sich zusammen und bemühte sich, ihrer Stimme einen festen Ton zu geben. »Deine Großmutter, die Mutter deines Vaters, ist ihrem Mann davongelaufen, als dein Vater fünf und Tante Herta dreizehn waren. Das war für die Kinder bestimmt sehr schwer.«
»Ach, Mamilein! Darüber haben wir schon tausendmal gesprochen. Und ich glaube es gerne, dass es für die Kinder scheußlich war. Bestimmt aber war es auch für Großmama scheußlich. Sie hat sich doch immer wieder vergeblich bemüht, wie ich auch von euch weiß, ihre Kinder wenigstens sehen zu dürfen.«
»Ja«, sagte Barbara nachdenklich, »das ist richtig. Aber damals waren die Gesetze noch anders. Sie war ihrem Mann mit einem Künstler durchgegangen und somit die Schuldige. Da wurden die Kinder ihm zugesprochen, und da sie mit dem Mann in wilder Ehe lebte ...«
»Wilde Ehe!« Jessica lachte spöttisch. »Dieser dämliche Ausdruck! Haben denn die beiden herumgetobt oder sich gestritten oder gar verprügelt? Ich habe immer gehört, sie wären sehr glücklich gewesen – bis auf den Umstand, dass Großmama ihre Kinder nicht sehen durfte.«
»Nun ja, das mag wohl stimmen. Aber damals hatte man eben andere Ansichten. Und auch wenn er ein bekannter Künstler war, war sein Einkommen nicht so gesichert wie das von Großpapa. Und es hat sich einfach nicht gehört, dass er es ausnützte, als er hierher eingeladen wurde, um die Porträts von Großmama, Tante Herta und deinem Vater zu malen.«
»Mein Gott«, murmelte Jessica, alles andere als überzeugt. »Wer weiß wie tödlich langweilig Großpapa war! Jedenfalls sah dieser Maler aufregend gut aus, und Großpapa hatte mindestens zwanzig Kilo Übergewicht.«
»Es kommt nicht nur aufs Äußere an!«, bemerkte Barbara weise.
»Aber auch aufs Äußerliche, Mami! Es ist schrecklich, wie du dich gehen lässt ...«
»Lenk jetzt nicht von unserem eigentlichen Problem ab«, unterbrach Barbara ärgerlich. Sie kannte die modischen Ansichten ihrer Tochter. Aber sie war schließlich fünfundvierzig und Witwe. Für wen sollte sie sich noch schön machen?!
»Für dich selbst!«, rief Jessica. »Und für mich! Und für das Andenken von Papi.« Dann stieg plötzlich ein spitzbübisches Lächeln in ihre Augen. »Sag mal, Mami, findest du nicht, dass Papi eigentlich weit mehr Großmamas Verführer als seinem Vater ähnelt?«
Barbara schnappte nach Luft, wurde rot und erwiderte dann so böse, dass Jessica sich vornahm, heimlich diesbezüglich weitere Nachforschungen anzustellen:
»Schäm dich, so etwas zu behaupten! Papi hat sich einmal bitterlich beklagt, als jemand so eine Anspielung machte. Er hat sehr an seinem Vater gehangen. Gerade weil seine Mutter ihn so früh im Stich gelassen hat.«
»Na schön«, meinte Jessica friedlich, »das ist ja auch nun wirklich nicht mehr aktuell. Ich habe nur überlegt, woher ich meine Begabung habe. In dieser durch und durch unmusischen Familie konnte ich nämlich nichts dergleichen entdecken. Nicht einmal die früher üblichen Höhere-Töchter-Begabungen.«
»Woher willst du wissen, ob unter deinen Ur- oder Ururgroßeltern nicht jemand zeichnerisch begabt war«, erwiderte Barbara noch immer ärgerlich.
»Schon gut, schon gut«, winkte Jessica ab. »Darum geht es mir jetzt nicht. Ich bestehe darauf, dass ich auf die Akademie gehe. Ich bin längst volljährig. Und ihr könnt mich nicht zwingen, einen Beruf zu ergreifen, der mich nicht interessiert. Es kann schließlich sein, dass ich nicht heirate und ihn ein ganzes Leben lang ausüben muss. Oder dass mein Mann nicht genug verdient. Oder ich einfach arbeiten möchte. Oder dass es mir geht wie dir, und ich früh Witwe werde ...«
»Ja, ja«, fiel Barbara ihr Traurig ins Wort. »Ich weiß, Tante Herta und ich können nichts dagegen unternehmen, wenn du nach zwei Semestern dein Sprachstudium abbrichst ...«
»Ich habe nur angefangen, weil ich vergangenes Jahr keinen Platz auf der Akademie bekam. Ich hatte mich zu spät beworben und wollte nicht nur herumsitzen.«
»Das war ja auch vernünftig«, lobte Barbara. »Nur weshalb willst du deine Ausbildung nicht erst beenden und dann auf die Akademie gehen? Wäre das nicht ein ...?«
»Nein!«, unterbrach Jessica sie energisch. »Das wäre nichts! Wer weiß, ob man mich dann noch mal aufnehmen würde. Und ich habe auch keine Lust, meine Zeit zu vertrödeln. Was soll ich schon mit den Sprachen?! Lehrerin werden? Oder Sekretärin? Kannst du dir das vorstellen?« Und ehe ihre Mutter antworten konnte, fügte sie hinzu: »Also ich nicht. Da würde ich ja glatt wahnsinnig!«
Barbara schwieg eine Weile und schaute auf ihre im Schoß gefalteten Hände. Wie verarbeitet sie waren von der vielen Gartenarbeit! Vielleicht sollte sie doch Handschuhe anziehen, wenn sie Unkraut jätete und Blumen beschnitt oder setzte. Die Nägel waren gesplittert. Barbara erinnerte sich, wie oft ihr verstorbener Mann ihre Finger zärtlich geküsst hatte und ihr Komplimente über ihre schönen Hände gemacht. Ach, das lag so weit zurück!
Barbara holte tief Luft und hob den Kopf, um ihrer Tochter in die Augen zu sehen. Wenn sie nur nicht so auffallend schön wäre, ihre liebe Jessica! Wenn sie sich wenigstens ein bisschen beeinflussen ließe! Aber ach, sie war genauso eigenwillig, wie ihre Großmama es wohl gewesen war, wenn man Hertas Erzählungen glaubte.
Barbara atmete nochmals tief durch.
»Du hast dich also entschieden, Jessi – ca!«, fügte sie nach einer kleinen Pause rasch hinzu, bevor ihre Tochter sich wieder über die Koseform ärgern konnte. »Du bist erwachsen, zumindest den Jahren nach, und solltest wissen, was du tust. Wenn du dir nicht raten lässt ...«
»Danke, Mamilein! Du bist die Allerbeste! Ich wusste es doch!« Jubelnd fiel Jessica ihr um den Hals, küsste sie ab und ließ sie nicht mehr zu Wort kommen, bis Barbara die Tochter energisch von sich schob.
»Jetzt lass mich aber mal ausreden, Jessica!«
»Ja, liebe Mami!« Mit vor Freude funkelnden Augen setzte sich Jessica wieder hin, gerade aufgerichtet, die Hände gefaltet auf den Knien.
»Es geht nicht an, dass du dir alle naselang etwas anderes überlegst und deine Ausbildung wechselst.«
»Das tue ich jetzt ganz bestimmt nicht mehr, Mamilein!«, versprach Jessica ernsthaft.
»Es könnte sich aber herausstellen, dass deine Begabung nicht reicht. Was hast du dann vor?«
Jessica sah ihre Mutter verblüfft an. Dann schluckte sie. Natürlich, Mami hatte recht! Das konnte leider durchaus passieren.
»Das – wäre sehr schlimm«, meinte sie leise und so ernst, dass Barbara es zum ersten Mal wirklich bewusst wurde, wie viel für ihre Tochter diese Berufswahl bedeutete. »Dann – würde ich eben doch Lehrerin werden. Kunsterzieherin. Und vielleicht noch eine Sprache dazu nehmen, wenn es verlangt würde.« Jessicas Stimme zitterte, und ganz unmotiviert brach sie in Tränen aus, rutschte von ihrem Sessel, sodass sie vor ihrer Mutter kniete und die umfasste. »Das wäre so schlimm, Mami! Dann will ich nicht mehr leben!«
»Ach, Jessica«, sagte Barbara rasch, »warten wir es doch erst einmal ab. Selbst wenn man auf der Akademie mit dir nicht zufrieden sein sollte, muss das noch nicht ein endgültiges Urteil bedeuten. Auch anerkannte Künstler, Professoren und Sachverständige haben sich schon oft genug geirrt.«
»Meinst du?« Jessica hob ihr verweintes Gesicht und lächelte schon wieder. Sie wischte sich die Augen ab.
»Natürlich, Kleines. Außerdem ist man ja vorläufig noch von deinem Talent überzeugt. Warten wir also erst mal ab.«
»Du hast recht. Ich bin halt – ein bisserl überdreht!«, fand Jessica jetzt selbst, und Barbara stimmte ihr lachend zu.
»Ich sehe jetzt mal nach Tante Herta.« Barbara stand auf.
»Lass mich gehen, Mami. Ich war wirklich scheußlich zu ihr, wo sie doch so lieb ist und es so gut meint«, rief Jessica und umarmte ihre Mutter nochmals.
»Das ist ihr bestimmt lieber«, meinte Barbara und sah lächelnd ihrer Tochter nach. Sie war nicht nur außergewöhnlich schön, sie war im Grunde auch sehr lieb. Und gerade deshalb fürchtete Barbara eben, dass jemand das ausnützen könnte: Ach ja, es war heute nicht leicht, ein junges Mädchen aufzuziehen. Wenn nur ihr Mann noch lebte, bestimmt würde Jessica eher auf ihn hören.
Ein trauriges Lächeln stieg in Barbaras Augen, als sie sich an ihn erinnerte. Jessica war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Und wie die beiden aneinander gehangen hatten! Wie stolz er auf sie gewesen war!
Barbara trat an den Schreibtisch, auf dem neben dem großen Foto ihrer Schwiegereltern auch eine Porträtaufnahme ihres verstorbenen Mannes stand. Jessi hatte wirklich recht. Sehr ähnlich sah er seinem Vater nicht ... auch seiner Mutter, die dunkel im Typ war, glich er nicht.
Aber er hatte davon nie etwas hören wollen! Das waren alles nur dumme Vermutungen. Woher wollte man wissen, ob nicht irgendwo in der Familie jemand groß, schlank, blond, mit schmalem Gesicht und großen, dunkelgrauen Augen unter dichten, schwarzen Wimpern gewesen war?! So wie ihr Mann oder wie Jessi!
♥♥♥
Es war Tradition in der Familie von Weißenfeldt auf Schlossgut Weißenfeldt sich nicht nur mit allem zu befassen, was zur Führung eines großen land- und forstwirtschaftlichen Betriebes gehörte, sondern auch immer künstlerische Talente zu fördern, so weit vorhanden. Wenn es in dieser Beziehung gar nichts zu fördern gab, bemühte man sich, wenigstens die Liebe zu allem Schönen in den Kindern und Enkeln zu wecken.
Das hatte die Familie durch Generationen davor bewahrt, engstirnige Stoppelhopser zu werden, die nicht über die eigene Nase hinauszusehen imstande waren. Und es war nicht zuletzt dieser toleranten, weltoffenen Einstellung und Erziehung zu verdanken, dass der Guts- und Forstbetrieb Weißenfeldt heute weit besser dastand als der mancher Standesgenossen, die über der Tradition den Fortschritt vergaßen.
Die Liebe der Weißenfeldts zum Schönen zeigte sich nicht nur in dem prächtigen, mit Kunstwerken der verschiedenen Jahrhunderte eingerichteten Schloss, in der geschmackvollen Parkanlage, auf deren Beeten das Jahr über die schönsten Blumen blühten und dufteten, sondern auch in der Wahl ihrer Ehefrauen. Immer suchten sich die Weißenfeldts ihre Frauen unter den schönsten jungen Damen des Landes. Und da sie nicht gerade wenig zu bieten hatten, wurde ihnen kaum jemals ein Korb gegeben.
Kein Wunder also, dass auch der jetzige Herr auf Weißenfeldt eine hervorragend elegante und interessante Erscheinung war, ebenso wie sein einziger Sohn und Erbe, der ihm gerade zu einem ernsten Gespräch im Arbeitszimmer gegenüber saß.
Wolf von Weißenfeldt, groß, schlank, dunkelhaarig, mit den interessanten, aristokratischen Gesichtszügen seiner Mutter, die eine italienische Gräfin gewesen war, betrachtete wohlwollend seinen sechsundzwanzigjährigen Sohn Robert, der seiner viel zu früh verstorbenen Gemahlin, der blonden und blauäugigen Tochter eines englischen Earl, wie aus dem Gesicht geschnitten war.
Plötzlich horchte er auf.
»Was hast du da eben gesagt, Robert?«
»Ich dachte, du hörst mir zu!«, erwiderte der vergnügt.
»Mache ich auch. Ich habe mich nur wieder einmal über deine Ähnlichkeit mit deiner Mutter gewundert.«
»Aha«, meinte Robert und warf dem Vater einen forschenden Blick zu, ehe er das eben Gesagte wiederholte. Bei den Altvorderen konnte man auch heute nie so ganz sicher sein, wie sie reagierten.
»Du bist doch mit deinen gerade fünfzig Jahren viel zu jung, um allein zu leben.«
»Dann habe ich mich also doch nicht verhört«, stellte der Baron trocken fest.
»Warum heiratest du nicht wieder?«
»Ganz einfach: Es ist mir nie wieder jemand wie deine Mutter begegnet.«
»Hast du denn dich umgesehen?«
»Nein.« Der Baron war ehrlich. »Aber suchen hilft in den seltensten Fällen. Man begegnet jemandem oder man begegnet niemandem!«
»Hm. Wie wäre es, wenn du nicht nach jemandem wie Mama suchen würdest, sondern nach jemandem, der auf eigene Art ebenso einmalig ist wie Mama?«