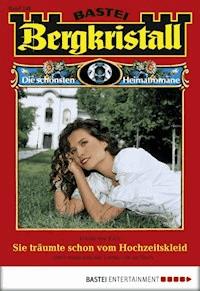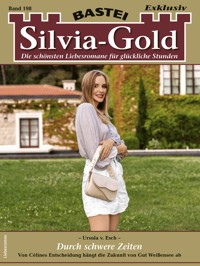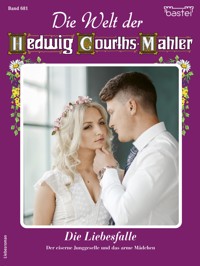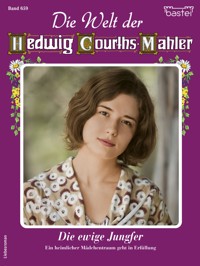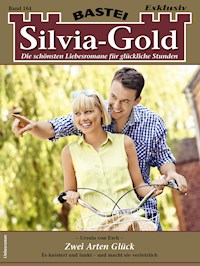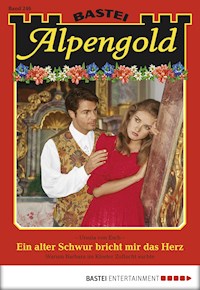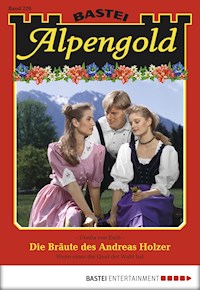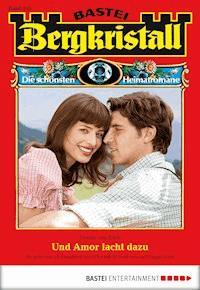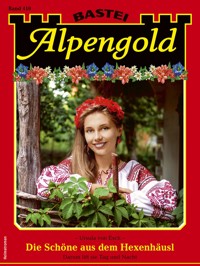
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Alpengold
- Sprache: Deutsch
Seit drei Jahren lebt die junge Elisabeth hier im Dorf, aber glücklich ist sie nicht geworden. Auch hat sie nur wenige Freunde gefunden. Den Herrn Pfarrer vielleicht, der die Waise unter seine Fittiche genommen hat, und den Lehrer, der sie als kluge Gesprächspartnerin schätzt. Aber sonst? "Eine Hex‘ ist sie mit ihren roten Haaren!", hetzt die Pfarrersköchin.
"Die hat bestimmt den bösen Blick", stichelt die Lehrersfrau.
"Stolz ist sie und eingebildet", sagen andere, "dabei hat sie nichts und ist auch nichts. Eine Näherin - was ist das schon!"
Das stimmt im Prinzip, aber gefährlich ist sie doch, die Elisabeth, durch ihren Sanftmut und ihre Schönheit nämlich betört sie heimlich so manches Männerherz, und deshalb machen die Leute im Dorf ihr das Leben schwer.
So vergehen die Wochen für Elisabeth ohne Glanz und Freude - bis sie eines Tages eine schicksalhafte Begegnung hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Schöne aus dem Hexenhäusl
Vorschau
Impressum
Die Schöne aus dem Hexenhäusl
Darum litt sie Tag und Nacht
Von Ursula von Esch
Seit drei Jahren lebt die junge Elisabeth in dem kleinen bayerischen Dorf, aber glücklich ist sie nicht geworden. Auch hat sie nur wenige Freunde gefunden. Den Herrn Pfarrer vielleicht, der die Waise unter seine Fittiche genommen hat, und den Lehrer, der sie als kluge Gesprächspartnerin schätzt. Aber sonst?
»Eine Hex' ist sie mit ihren roten Haaren!«, hetzt die Pfarrersköchin.
»Die hat bestimmt den bösen Blick«, stichelt die Lehrersfrau.
»Stolz ist sie und eingebildet«, sagen andere, »dabei hat sie nichts und ist auch nichts. Eine Näherin – was ist das schon!«
Das stimmt im Prinzip, aber gefährlich ist sie doch, die Elisabeth, durch ihren Sanftmut und ihre Schönheit betört sie nämlich heimlich so manches Männerherz, und deshalb machen die Leute im Dorf ihr das Leben schwer.
So vergehen die Wochen für Elisabeth ohne Glanz und Freude – bis sie eines Tages eine schicksalhafte Begegnung hat ...
»Hex'! Hex'! Hex'!«, schrien die Dorfkinder der alten Walburga Kellner nach, als sie tief gebückt an ihrem Stock durch das Dorf hinkte. Als sie stehen blieb, rannten sie schreiend davon – nur um sich an der nächsten Straßenecke zu verstecken und wieder: »Hex'! Alte Hex'! Krumme, alte Hex'!« zu rufen.
Die alte Frau nickte, schüttelte den Kopf und lächelte ein bisschen traurig. Dann humpelte sie mühsam weiter.
Der Weg vom Hexenhäusl – wie die Dorfbewohner es nannten – bis ins Dorf schien immer länger und beschwerlicher zu werden. Ach, die Walburga wusste nur zu gut, dass sich nicht die Entfernung geändert hatte, dass nicht die Anhöhe steiler geworden war, sondern dass es ihre ohnehin schwachen Kräfte waren, die immer mehr nachließen.
Immer häufiger musste sie stehen bleiben und verschnaufen. Immer schwerer wurde der Korb mit den wöchentlichen Einkäufen – auch wenn diese immer bescheidener wurden. Jedenfalls für sie selbst. Was ihre Lieblinge, die Katzen, anging, so veränderte deren Appetit sich keineswegs. Ganz im Gegenteil. Es wurden immer mehr, und das Futter, das die Walburga für sie heimtrug, wog deshalb immer schwerer.
Schon wieder musste sie den Korb mit den Einkäufen absetzen und ein bisserl verschnaufen. Sie seufzte. Wie sollte das bloß weitergehen? Da waren die ungezogenen Kinder schon wieder!
»Alte Hex'! Alte buckelige Hex'!«, schrien und johlten sie.
»Schämt ihr euch nicht?! Macht, dass ihr fortkommt!«, rief plötzlich eine helle, junge Stimme neben ihr.
»Noch eine Hex'! Eine junge, rothaarige!«, kreischten die Kinder.
»Jetzt reicht's!«, rief Walburga und hob drohend ihre Krücke. Darauf stoben die Fratzen lachend und kreischend davon.
»Es tut mir so leid! Darf ich Ihnen den Korb heimtragen, Frau Kellner?«
»Elisabeth! Sie sind's!«, sagte die Walburga erleichtert. »Ich dachte es mir gleich, als ich die Stimme hörte. Ach ja. Ein Glück ... Haben Sie denn Zeit, mir tragen zu helfen?«
»Aber freilich«, war die freundliche Antwort, und schon nahm das junge Mädchen der Frau den schweren Korb ab.
»So geht's besser«, bedankte sich die Walburga. »Wo sind Sie denn heute auf Stör?«
Störnäherin nannte man im Bayerischen die Frauen, die von Haus zu Haus gehen, flicken und ausbessern, aber auch Aussteuer nähen, Monogramme in Bett- und Tischwäsche sticken und einfachere Kleider herstellen. Heutzutage ist dies ein ganz seltener Beruf, weil man in den großen Kaufhausketten solche Sachen billiger bekommt – aber freilich, kunstvoller und besonderer sind die Arbeiten einer Störnäherin.
Elisabeth Walleitner war ein Findelkind. Ihre Mutter hatte sie auf der Schwelle des Klosters ausgesetzt und einen Brief dazugelegt, in welchem sie bat, die guten Klosterfrauen möchten sich um das arme Würmchen kümmern. Die Schwestern hatten dies gern getan und dem kleinen Mädchen alles beigebracht, was sie konnten und wussten: nähen, sticken, häkeln und stricken. Außerdem hatte Elisabeth eine gute Erziehung genossen, wusste in Kunst- und Kulturgeschichte bestens Bescheid und kannte zudem die Kirchengeschichte fast so gut wie der Herr Pfarrer – die Heiligenlegenden sogar besser als er.
Wahrscheinlich hatten die Schwestern gehofft, Elisabeth würde in ihr Kloster eintreten, und vielleicht hofften sie es im Stillen immer noch. Doch das kleine Mädchen mit den kupferfarbenen Locken hatte sich im Lauf der Zeit zu einer wirklichen Schönheit entwickelt, sodass die Mutter Oberin insgeheim gedacht hatte, es wäre doch schade, wenn so jemand keine Kinder bekommen würde, um all die guten Eigenschaften zu vererben, und zwar die äußeren wie die inneren. Und deshalb hatte sie Elisabeth vorgeschlagen, als diese volljährig wurde, sich erst einmal in der Welt umzusehen, bevor sie einen so schwerwiegenden Entschluss fasste.
Damit die große und gefährliche Welt aber nicht gleich zu sehr über das unerfahrene Dingelchen her stürzte, schickte sie das Mädchen in jenes oberbayerische Dorf, in welchem ihr Bruder Lebrecht als Pfarrer tätig war. Er sollte dort ein wachsames Auge auf die kleine Schönheit haben.
Tja, das war nun gar nicht so einfach bei der Voreingenommenheit, die auch heute noch auf dem Lande herrschte – wenn auch nicht nur auf dem Lande.
Die Haushälterin schlug vor Schreck drei Kreuze, als sie die roten Haare und grünen Augen sah und die zarte milchweiße Haut.
»Nein, mit der bleib' ich keine Nacht unter dem gleichen Dach!«, erklärte sie. »Die hat garantiert den bösen Blick. Das ist doch eine Hex', das sieht man gleich!«
Und da konnte der gute Pfarrer Lebrecht Meier sie noch so sehr an ihr christliches Gewissen erinnern, die Franziska Burger weigerte sich, das Mündel der Frau Oberin im Haus zu haben.
Wohin mit dem armen Mädel? Das war in so einem Dorf alles andere als einfach. Sie war viel zu lieb und viel zu schön, als dass die Bäuerinnen sich so etwas ins Haus geholt hätten.
Schließlich wandte sich Pfarrer Meier an den Dorflehrer Frank Moser. Der konnte doch nicht so starrköpfig und voreingenommen sein. Der hatte bereits erwachsene Kinder und eine Frau, die in der Schule Werken unterrichtete und somit wohl auch ein bisserl toleranter war als das übrige Landvolk.
Zuerst war die Gunda Moser ja auch ganz einverstanden. Aber sehr bald, als sie merkte, dass ihr Mann sich gern mit dem hübschen und klugen Mädchen unterhielt, änderte sich dies, und sie hielt ihm vor, er käme wohl in den zweiten Frühling und Ähnliches.
Elisabeth merkte, dass sie nicht länger gern gesehen war und zog sich immer mehr zurück. Das fiel ihr nicht schwer, da sie als Störnäherin überall in der Gegend gesucht war und sich eigentlich nur sonntags oder feiertags in dem Stübchen aufhielt, das sich unter dem Dach des Schulhauses befand und ihr Zuhause war.
Lehrer Moser, verärgert über das dumme Benehmen seiner Gunda, bestand darauf, dass sie an diesen Tagen mit ihnen aß. Aber manchmal hatte er den Eindruck, es dadurch für Elisabeth nicht leichter, sondern, im Gegenteil, noch schwerer zu machen. Aber wo wollte sie hin, da auch sonst niemand bereit war, sie an diesen Tagen einzuladen?
Das heißt, die Elisabeth hätte eine Menge Einladungen haben können – wenn, ja, wenn sie nicht mit Recht gefürchtet hätte, dass es den jungen Burschen um etwas ganz Bestimmtes zu tun war. Und deshalb lehnte sie alle Einladungen zu Ausflügen und Veranstaltungen konsequent ab.
Erstaunlicherweise brachte das die ganze Dorfjugend gegen sie auf. Nicht nur die abgewiesenen Mannsbilder, was ja verständlich wäre, sondern auch die Frauensleut.
»Was? Die rothaarige Hex' ist sich zu gut, um mit unseren Buben auszugehen?! Die wartet wohl auf was ganz Feines!«, hieß es. Und den Mannsbildern wurde von den eifersüchtigen Mädeln hingerieben: »Tja, da müsstest du schon was Besseres sein; ein Herr Lehrer oder sonst ein Akademischer oder wenigstens recht reich. Vielleicht wartet sie auch auf einen Prinzen oder Filmstar!«
Und dann lachten sie recht giftig und freuten sich, wenn die Burschen sich aufregten.
»Geh, spinn net! Ich tät' doch nie so eine rothaarige Hex' für die Dauer mögen. So mal – na ja, aber heiraten – nein! Weißt du denn net, wie's heißt? ›Rotes Haar und Ellernholz wachst net auf gutem Boden!‹ Nein, nein, wie die schon schaut mit ihren grünen Katzenaugen!«
Aber interessiert hätte das schöne Findelkind trotzdem die Mannsbilder, weil sie halt so was Besonderes war – so ganz anders mit ihren schlanken Gliedern und den zarten, feinen Händen. Ja, so sah es für die Elisabeth Walleitner aus, nachdem sie es jetzt fast drei Jahre in dem Dorf ausgehalten hatte.
Die Walburga Kellner hatte wohl das eine oder andere mitbekommen. Nicht viel, weil sie ja selber keinen Kontakt zu den Dorfbewohnern hatte, den Herrn Pfarrer ausgenommen, und auch der Lehrer Moser besuchte sie einige Male im Jahr, um sich bei ihr Rat zu holen. Aber das waren zwei, die nicht viel herausließen, lediglich über die unbekannte Herkunft des Mädchens sprachen und wie lieb und brav und klug es wäre.
So war es der alten Frau ganz recht, dass sie einmal mit Elisabeth ins Gespräch kam.
»Wo sind Sie denn heute auf Stör?«, wiederholte sie ihre Frage.
»Beim Bürgermeister. Ich näh' an der Aussteuer für die Antonia. Die heiratet im Herbst«, erwiderte Elisabeth.
»Ach so, die Antonia Kapfhammer heiratet. Meine Güte, wie die Zeit vergeht! Ich erinnere mich noch, wie sie ein kleines dickes blondes Mädel war.«
»Blond ist sie noch immer«, erwiderte Elisabeth lachend.
»Und dick auch!«, fügte die Walburga vergnügt hinzu. »Aber hierzulande mag man es ja, wenn einer mollert ist und Holz vor der Hütten hat.« Sie sah von schräg unten zu der schlanken, geschmeidigen Elisabeth empor. »Hast du keine Verehrer?«
Die wurde rot.
»Na, sag's schon!«
»Keine richtigen, Frau Kellner. Die wollen bloß ...« Sie verstummte, dann sagte sie rasch: »Es ist halt, weil man nicht weiß, wer meine Eltern sind, und weil ich auch nix hab' und – rothaarig bin.« Sie seufzte ein wenig.
»Ja ja, ich hab' so was gehört«, meinte die Walburga freundlich. »Man darf nicht anders sein – das ist das Schlimmste, was einem passieren kann!« Auch sie seufzte ein wenig, weil sie das aus eigener bitterer Erfahrung wusste.
Jetzt hatten sie das Dorf hinter sich gelassen und gingen auf den Wald zu, an dessen Rand das Hexenhäusl lag. Mit seinem tiefgezogenen Schindeldach hätte es wirklich einem Märchen entstammen können. Doch erwartete man darin keineswegs eine böse Hexe, fand zumindest Elisabeth, sondern eine liebe, alte, weise Frau.
Die Wände waren weiß gekalkt, die Fensterläden grün gestrichen, und vor den Fenstern waren Blumenkästen, in denen rote und rosa und rotweiße Geranien in überschäumender Pracht blühten.
Auch der kleine Garten rund um das Häusl war ein buntes Blumenmeer. Auf den Holzpfosten rechts und links von der Gartentür saß je eine dicke Katze. Die eine war weißrot, die andere gefleckt. Als sie ihre Herrin kommen sahen, erhoben sie sich fast gleichzeitig, streckten und reckten sich und sprangen herunter, um ihr mit hocherhobenen Schwänzen entgegenzuschreiten.
Jawohl, sie schritten, würdevoll und gelassen, damit man ja nicht übersah, dass sie freiwillig kamen und keinesfalls, weil man das von ihnen erwartete.
Walburga streichelte sie und redete auf sie ein, während sie sich an ihren Beinen rieben, schnurrten und miauten. Lächelnd sah Elisabeth zu.
»Oh, da sind ja noch mehr!«, rief sie dann.
Inzwischen hatten zwei andere die Plätze auf den Pfosten eingenommen, eine schwarzweiße und eine weiße mit grauem Häubchen und grauem Schwanz. Und nun kamen noch weitere Katzen um das Haus herumgelaufen.
»Du liebe Zeit, wie viele sind es denn?«, fragte Elisabeth lachend.
»Tja, allmählich werden es mir fast zu viele«, gestand die Alte und begrüßte liebevoll eine jede, die zu ihr kam. »Aber ich bringe es eben nicht über mich, sie fortzujagen. Ich lasse sie zwar gleich kastrieren und sterilisieren, wenn sie zu mir kommen, aber unsere reichen Bauern sind leider zu geizig, um das ebenfalls zu tun. Sie kümmern sich nicht darum, was aus den armen, überzähligen Tieren wird, jagen sie einfach fort. Entweder sie verhungern, oder sie bringen in Erfahrung, dass hier die alte Kräuterhexe wohnt, die ein Herz für heimatlose Tiere hat.«
»Mir tut es auch oft weh, wenn ich sehe, in welch erbärmlichen Zwingern sie ihre Wachhunde halten und an was für kurzen Ketten die Hofhunde liegen. Aber wenn man etwas sagt, macht man es oft noch schlimmer.«
Walburga nickte zustimmend.
»So ist es. Nur ein Tier, das Ansehen und Gewinn bringt, hat auf dem Land Aussicht auf eine gute Behandlung. Und mit den Menschen ist es oft ähnlich«, fügte sie hinzu. Als sie Elisabeths erschrockenen Blick sah, lächelte sie ein wenig. »Kommen Sie doch noch ein bisschen mit herein. Ich habe nicht oft Gesellschaft!«
Elisabeth warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und erschrak.
»Tut mir sehr leid, Frau Kellner. Aber es geht wirklich nicht mehr. Ich sollte bereits beim Bürgermeister sein – seit einer halben Stunde, aber ich werde es halt nacharbeiten!«
»Schade«, fand die alte Frau. »Ich hätte mich gern ein bisschen mit Ihnen unterhalten.«
»Ich würde Sie auch gern einmal besuchen«, erwiderte Elisabeth. »Vielleicht am Sonntagnachmittag?«
»Warum kommen Sie nicht gleich nach der Messe zum Mittagessen?«, schlug Walburga vor. »Garantiert schmeckt es mir auch besser, wenn ich nicht nur in der Gesellschaft meiner Katzen essen muss!«
»Oh, sehr gern! Vielen Dank!«, rief Elisabeth so erfreut, dass Walburga mit Recht annahm, dass die sonntäglichen Mittagessen für sie wohl auch nicht besonders angenehm waren.