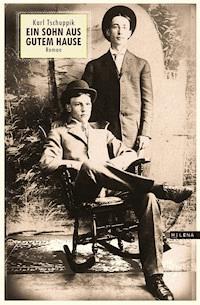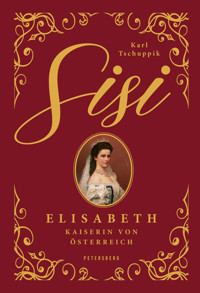
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Petersberg Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Schicksal Elisabeths von Österreich, genannt "Sisi", bewegt seit jeher die Gemüter. Um ihr Leben ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden. Um ihren Cousin Franz Joseph zu heiraten und damit Kaiserin von Österreich zu werden, muss sie bereits mit sechzehn Jahren ihr geliebtes Zuhause im bayerischen Possenhofen verlassen. Ihre für damalige Verhältnisse recht freie und unbeschwerte Jugend in Bayern tauscht sie gegen das Leben am habsburgischen Hof, mit all seinen strengen Sitten und Gebräuchen. Ihre anfängliche Verliebtheit in Franz Joseph wird schnell überschattet von den Intrigen und Konventionen am österreichischen Hof. Ihr freies Wesen – der Vater hat sie sich in Possenhofen frei entfalten lassen – wehrt sich gegen all die Zwänge der Monarchie und die Enge des höfischen Zeremoniells. Sie reitet gerne, treibt Sport, achtet auf ihre Ernährung, interessiert sich für Literatur und hat immer ein offenes Herz für die Anliegen der Menschen. Der Kaiser und sein Hofstaat hingegen kümmern sich vorwiegend um den Machterhalt. Elisabeth zieht sich immer mehr vom Hof zurück und unternimmt zahllose Reisen, um ein halbwegs selbstbestimmtes Leben führen zu können. Bei einem Besuch in Genf wird Elisabeth schließlich von einem Attentäter heimtückisch mit einer Feile erstochen, sie wurde 60 Jahre alt. Der österreichische Journalist Karl Tschuppik, der die letzten Jahre der Kaiserin selbst miterlebt hat, fängt in dieser eindrucksvollen Biografie äußerst feinfühlig den Zeitgeist und den steten Kampf der Kaiserin gegen die Attacken auf ihren freien Geist und eigenen Willen ein und zieht den Leser einmal mehr in den Bann einer Frau, die selbstständig, klug, gebildet, wunderschön und herzlich war – und all das nicht sein durfte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KARL TSCHUPPIK
Sisi
ELISABETH KAISERIN VON ÖSTERREICH
KARL TSCHUPPIK
Sisi
ELISABETH KAISERIN VON ÖSTERREICH
ist ein Imprint der
HEEL Verlag GmbH
Gut Pottscheidt
53639 Königswinter
Tel.: 02223 9230-0
Fax: 02223 9230-13
E-Mail: [email protected]
www.petersberg-verlag.de
© 2022 HEEL Verlag GmbH
Petersberg Verlag ist ein Imprint der HEEL Verlag GmbH
Bearbeitete Neuausgabe des Klassikers „Elisabeth – Kaiserin von Österreich“. Orthografie und Interpunktion wurden der neuen deutschen Rechtschreibung angepasst. Grammatikalische Eigenheiten und Lautstand wurden behutsam modernisiert. In Einzelfällen wurden Namen und Orte der heutigen Schreibweise angepasst.
Umschlaggestaltung: Christine Mertens, HEEL Verlag
Umschlagmotive: © Bridgeman Images Berlin, „Empress Elizabeth of Austria“ in Hungarian costume, 1867 (oil on canvas), Künstler: Raab, Georg (1821–85) / Austrian
© Adobe Stock: christine krahl
Satz: Stefan Witterhold, HEEL Verlag
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Wiedergabe in jeder Form und der Übersetzung in andere Sprachen, behält sich der Herausgeber vor. Es ist ohne schriftliche Genehmigung des Verlags nicht erlaubt, das Buch und Teile daraus auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen oder unter Verwendung elektronischer bzw. mechanischer Systeme zu speichern, systematisch auszuwerten oder zu verbreiten. Ebenso untersagt ist die Erfassung und Nutzung auf Netzwerken, inklusive Internet, oder die Verbreitung des Werkes auf Portalen wie Google Books.
– Alle Rechte vorbehalten –
Printed in Czech Republic
ISBN: 978-3-7553-0042-7
eISBN: 978-3-96664-877-6
INHALT
VORREDE
I. Die Märchenprinzessin
II. Im goldenen Käfig
III. Die Flucht
IV. Rückkehr
V. Dr. Christomanos
VI. Ludwigs Tod
VII. Das Ende Rudolfs
VIII. Letzte Jahre
IX. Der Mord
GLOSSAR
QUELLEN
DIE BILDER
Er hat nur seinen eigenen Willen heilig gehalten und nur seinen Träumen gelebt; seine Trauer war ihm wertvoller als das Leben ...
Elisabeth über Achilleus
VORREDE
KAISERIN ELISABETH, IM LEBEN NUR VON wenigen erkannt, ist auch nach dem Tod eine verschleierte Gestalt geblieben. Ihr Leben wie ihr Sterben waren ungewöhnlich, ihr Wesen nicht danach, sich dem forschenden Blick leicht zu erschließen: Die schöne sechzehnjährige Prinzessin, von einer Laune des Zufalls aus ihrer Märchenwelt und der Fantasielandschaft der Wittelsbacher entführt, wurde als Gattin ihres Cousins, des Kaisers Franz Joseph, in ein Dasein von Konflikten, Pein und tiefstem Leid verstrickt. Die Ehe, der wesensfremde Hof der Lothringer, die Mutter Franz Josephs, Staatsräson und Würdepathos nahmen die blutjunge, romantische Prinzessin wie feindliche Mauern gefangen. Elisabeth sucht der Ehe und dem Hof zu entfliehen, ohne doch den Entschluss zur Befreiung und die Freiheit selbst zu finden. Sie war eine originale Natur, geistig ihrer Umgebung überlegen, doch auch das Kind einer Zeit, die das Emanzipationsbedürfnis der Frau erst als literarisches Wetterleuchten vor sich sah. Die bürgerlichen Frauen, ihre Mängel und Schmerzen, waren zu Elisabeths Zeiten im Dunkel: Die Tochter aus edlerem Haus, die sich voreilig an eine gewöhnliche Ehe band und nun den Sturz ins Banale erlebt; das stolze Mädchen, von Eltern und Verwandten um des Vorteils willen zu einem Bund verführt, der es erniedrigt; die Ungeliebte, der das gemeine Talent des Stoikers versagt ist, die Steine und Würmer der Zwangsehe zu schlucken - der Dichter dieser Frauen war noch nicht gekommen. Elisabeths pessimistischer Romantizismus war die Philosophie des schönheitstrunkenen, unfreien Menschen. Sie hatte, ohne Ibsen zu kennen, die Sehnsucht der Nora und der Hedda Gabler. Sie war darin freier als diese Vorbilder der unfreien bürgerlichen Frauen, dass sie innerhalb ihrer Begrenzung zeitweilig fliehen und das Ziel ihrer Flucht wählen konnte; unfreier durch den Druck, den Tradition und Stellung auf sie ausübten. So unvorstellbar ein König ist, der aus der tieferen Erkenntnis auf Rang und Würde verzichtete, so unmöglich eine Elisabeth, die ihrer Welt gänzlich entflohen wäre. Es war das Äußerste an Rebellion, dass sie sich von Zeit zu Zeit dem ›Notwendigen‹ durch die Flucht entzog. Den letzten Schritt, den Bruch mit der Welt, der sie zugehörte, hat sie nicht gewagt.
In der schwersten politischen Krise Franz Josephs kehrte sie zu ihm zurück. Sie vollbrachte, was keinem seiner Räte gelungen wäre. Als er sein Selbstbewusstsein wieder gewann, nahm sie von neuem ihr Wanderleben auf. Nach dem Tod ihres Sohnes entschwand sie den Blicken der Welt, bis sie, die Verblühende, die das Altern hasste und fürchtete, in Genf vom Dolch des Mörders getroffen wurde.
Die Menschen ihrer Tage, im Besonderen die engeren Untertanen Franz Josephs, haben wenig darüber nachgedacht, warum die Kaiserin Wien und den Kaiser am liebsten aus der Distanz bejahte; sie woben um Elisabeths Haupt einen Legendenkranz, der Dichtung und Wahrheit eng verflocht. So lebt sie auch in der Elisabeth-Literatur, teils vergöttlicht, teils als die ›exzentrische Frau‹, die das Leid des Kaisers vermehrte.
Dieses Buch versucht die äußere historische und die innere Wahrheit zu einem Bild dieser Frau zu vereinen, deren Wesen so ungewöhnlich war wie ihr Schicksal.
Wien, im September 1929
Karl Tschuppik
I. DIE MÄRCHENPRINZESSIN
DIE HERZOGIN LUDOVIKA VON BAYERN FÄHRT mit zwei Töchtern und einem großen Plan. Eine Tochter aus vornehmem Haus, die zur Brautschau geführt wird, ist noch artiger als sie Geburt und Erziehung gemacht haben. Prinzessin Helene sitzt im Reisewagen neben ihrer jüngeren Schwester wie eine Kränkelnde auf dem Weg zum Arzt. Die Mutter hat Sisi zur Aufheiterung Helenes mitgenommen und um sich selbst davor zu bewahren, auf der langen Fahrt von München nach Ischl ständig mit Helene und dem Plan allein zu sein. Sisi, sechzehn Jahre alt, weiß nicht, dass es das Recht der Mütter ist, Vorsehung zu sein; sie ahnt nicht, woran die ältere Schwester kränkelt. Sie ist auf dieser Reise heiter und unbefangen wie bei ihren Spielen im Schlosspark zu Possenhofen oder bei den Pferden des Vaters.
Helene, die älteste der fünf Töchter des Hauses, ist ausersehen, die Gemahlin des jungen Kaisers von Österreich zu werden. Der Plan ist nicht im Heim der Herzogin Ludovika geboren worden; so sehr sich die Herzogin stets dessen bewusst bleibt, die Tochter eines Königs zu sein, so vergisst sie doch nicht, dass sie, die jüngste der sechs Töchter Maximilians I. von Bayern, unter ihrem Rang verheiratet wurde. Karoline, die älteste ihrer Schwestern, war Kaiserin, die Gattin des Kaisers Franz; Elisabeth, Gattin Friedrich Wilhelms IV., saß auf Preußens Thron; Amalia, die Gattin König Johanns, und Maria, Friedrich Augusts Frau, waren Königinnen von Sachsen. Erzherzogin Sophie, die willensstärkste der sechs bayrischen Königstöchter, hatte die Anwartschaft auf Österreichs Kaiserthron; sie hat noch besser gewählt: sie machte ihren ersten Sohn, Franz Joseph, zum Kaiser. Nur sie selbst, Ludovika, die Jüngste, musste sich bescheiden. Ihr Gatte Herzog Maximilian gehört der Nebenlinie des bayrischen Königshauses an; die höfische Unterscheidung nennt ihn nicht Herzog von Bayern, in ihrem Bereich ist er ein Herzog in Bayern.
Ludovika litt darunter. Es ist ihre große Sorge, das Ansehen des Hauses zu steigern, ihr steter Gedanke, die nun heiratsfähige älteste Tochter höher zu stellen als die Entscheidung ihrer Eltern sie selbst gestellt hat. Doch den Wunschblick nach Wien, zum kaiserlichen Neffen, hat sie nur in der Fantasie gewagt. Österreichs junger Kaiser ist Europas beste Partie. Dreiundzwanzigjährig; Herr der wiederaufgerichteten habsburgischen Macht; in den Augen der konterrevolutionären Welt der neue Erlöser und Held; ein Glückskind, ebenso sympathisch wie mächtig und reich. Die Prinzessinnen königlichen Geblüts finden keine bessere Wahl. Franz Joseph wäre für das Possenhofener Herzogshaus unerreichbar gewesen. Den Plan, den Ludovikas Reisewagen birgt, hat Erzherzogin Sophie, des jungen Kaisers Mutter, entworfen. Die energische, zielbewusste Frau will ihr Werk vollenden. Sie hat das Recht, sich als Retterin Österreichs, als die Bewahrerin der habsburgischen Hausmacht zu fühlen. Vor fünf Jahren, 1848, in den Tagen der Ratlosigkeit, des Zauderns, der Schwachheit und des Entsagens gab es am Wiener Kaiserhof, im ganzen Kreis der Erzherzöge, Fürsten, Minister, Diplomaten und Generale nur einen Mann - die Erzherzogin Sophie. Ihr Machtwille hat den Feuerbrand der mitteleuropäischen Revolution gelöscht. Sie hat die Skepsis des Hofs und die schleichende Toleranz besiegt, das Konzept des Freiherrn von Kübeck zur Aktion gemacht, den Säbel der Konterrevolution in den drei Fäusten Radetzky, Jellačic und Windischgrätz in Schwung gebracht. Sie hat Österreich wieder einen Kaiser gegeben. Den eigenen Sohn. Nun will sie, die wirkliche Regentin, dem Kaiser auch die Gattin wählen.
Was lag näher als das Vorbild des väterlichen Hauses? Vernunft, Kalkül sind die besten Heiratsstifter. Und der Gehorsam vor der katholischen Kirche. Erzherzogin Sophie ist eine fromme Frau, dem Glauben schwärmerisch ergeben. Wie sie einst Tage und Nächte darauf sann, den wankenden Thron für den Sohn zu retten, so wandte sie jetzt alle Sorgfalt der Aufgabe zu, dem Sohn die passende Frau zu finden. Der Kreis der Auswahl wurde eng unter dem unabweislichen Gebot der Kirche, er zog sich schließlich um München zusammen. Bei dieser Entscheidung ergaben sich zwei Vorteile: Die Rücksicht, die man der Kirche schuldig war, die Braut aus einem streng katholischen Haus zu wählen, kam zugleich der eigenen Familie zustatten. Erzherzogin Sophie fiel es nicht schwer, ihrer jüngsten Schwester Ludovika zu sagen, was sie dachte; es war die große Glücksbotschaft für Possenhofen. Und der junge Kaiser? Das Selbstherrscherturn des Dreiundzwanzigjährigen, auf den Kampffeldern in Ungarn, auf der Niederwerfung des rebellischen Wien gegründet, unbeschränkter und gefestigter als der vormärzliche Absolutismus, diese Machtfülle versinkt vor den Türen der mütterlichen Appartements. Der junge Kaiser ist der ergebenste Sohn. Die Mutter hat den Thron wieder auf feste Beine gestellt; der Träger der neuen Macht verwandelt sich vor ihr in einen fügsamen Knaben. Was sie tut, ist weise und gut. Der Philosoph des neuen Absolutismus, der Staatsrat von Kübeck, hatte es nicht nötig, den lieben Gott zu strapazieren; die göttliche Vorsehung ist der Wille der Mutter. Und sie hat Gründe, den Sohn bald verheiratet zu wünschen.
Franz Josephs Mutter gehört zu jener Art österreichischer Frauen, die religiös sind, ohne prüde zu sein. Das große Beispiel ist Maria Theresia. Die Angelegenheiten des Sexus werden freimütig behandelt, wobei man sich instinktgemäß mit der alten, aristokratischen Tradition der katholischen Kirche eines Sinnes weiß. Wie Maria Theresia in ihren Briefen an Maria Antoinette als erfahrene Mutter intime Ratschläge erteilt, so hat auch Erzherzogin Sophie keine Scheu vor den Schlafzimmergeheimnissen ihrer Söhne. Sie fasst es als praktische Vernunft auf, den Knaben bei den ersten Schritten in das geheimnisvolle Land selbst an der Hand zu führen, eine Erziehung, die nicht ihre Erfindung ist, sondern seit jeher im Kaiserhause geübt wird. Das Wort von den ›hygienischen Damen‹ stammt nicht vom Hof, sondern aus der aristokratischen Umgebung, die zynisch und gelegentlich witzig ist, aber ungefähr trifft es auf das Wesen einer Institution zu, die man als notwendig und vernünftig betrachtet. Solange der junge Kaiser die vorgesehene Einrichtung als etwas Gegebenes hinnahm, ohne davon ernstlich affektioniert zu werden, solange hatte die Mutter Zeit und Muße, die Ehe vorzubereiten. In den letzten zwei Jahren jedoch nahm die Erzherzogin Sophie mit Besorgnis wahr, dass ihr Sohn der Gefahr nahekam, die Dame, die keineswegs für sein Herz bestimmt war, ernsthaft zu lieben. Es war also Zeit, den Kursus der Liebe zu beenden und Franz Joseph eine Frau zu suchen. Nach der sorgfältig getroffenen Wahl wurde alles Weitere in Briefen zwischen den Schwestern, Sophie und Ludovika, vereinbart. Franz Joseph kannte seine Base Helene, er hatte sie in München und Ischl kennen gelernt, bei ihren Begegnungen mochte man meinen, dass sie einander sympathisch seien. Das genügte der Mutter des Kaisers.
Ludovika aber betete seit Wochen jeden Morgen und jeden Abend, dass Gott ihrem Kind das große Glück bescheren möge.
Herzog Max in Bayern
Jetzt, da der Reisewagen Richtung Ischl zueilt, ist Herzogin Ludovika nur mehr auf jene kleinen Dinge der Regie bedacht, von denen sie als kluge Frau weiß, welche Rolle ihnen bei der Werbung der Braut zukommt. Am Plan selbst kann sich nichts ändern. Sophie will es, der Himmel hat es bestätigt. Die Herzogin bereut es jetzt nicht, die zweite Tochter mitgenommen zu haben. Die anderen drei der fünf Töchter des Herzogspaares, Marie, Mathilde, Sophie, sind noch Kinder. Elisabeth, man ruft sie Sisi, der Liebling des Vaters, ist die heiterste der Töchter, knabenhaft, dem Geschmack der Mutter zu knabenhaft, aber erheiternd und unterhaltend in ihrem lebhaften Sinn für die Landschaft, für neue Gesichter und alle Veränderungen einer Reise. Sie ist dem Vater, nicht der Mutter nachgeraten. Das empfindet die Herzogin immer wieder aufs Neue, seitdem Elisabeth ein großes Kind geworden ist.
Der Vater! ... Die Herzogin ist nun fünfundzwanzig Jahre verheiratet, dieses Jahr 1855, nächsten Monat, im September, vollendet sich das Vierteljahrhundert der Ehe. War sie glücklich, diese Ehe? Die acht Kinder, fünf Mädchen, drei Söhne, scheinen es zu bezeugen. Sie war es nicht, und nicht allein deshalb, weil Ludovika das Gefühl bedrückte, resignierend Frau geworden zu sein. Es war nicht leicht, den Herzog Max zum Gatten zu erziehen. Es gelang auch Ludovikas Klugheit und Diplomatie nicht. Er ist der aristokratische Bohème geblieben, der er von Jugend auf war. Viele Sprossen der Zweibrücken-Birkenfeldschen Linie des uralten Adelshauses der Wittelsbacher hatten diesen Hang, das Metier der Fürsten durch echte Neigungen des Geistes zu verletzen. Herzog Max, der Gatte, ähnelt in manchen Zügen seinem Schwiegervater, dem ersten Bayernkönig von Napoleons Gnaden, dem Franzosenfreund und liebenswürdigen Schuldenmacher. Er ist gründlicher gebildet als König Maximilian I., er hat, obwohl General der Kavallerie, viel mehr literarische als soldatische Passionen. Er wäre, sofern sich Literatur und Hippologie verbinden ließen, ein angenehmer Schriftsteller, ein geschmackvoller Feuilletonredakteur geworden. Er hat die Universität München nicht nur als Ehrengast besucht, seine Reisen nach Griechenland, in die Türkei, nach Nubien und Ägypten hat er als gut beobachtender, denkender Mensch erlebt. Sein Buch Wanderungen nach dem Orient bestätigt es. Ein dramatischer Versuch und einige Novellen lassen erkennen, dass Herzog Max sich ernstlich bemüht hat, die literarische Neigung zu einer Begabung zu steigern. Er schrieb anonym, nur wenige wussten, wer ›Fantasus‹ war. Die Ehe, die heranwachsenden Töchter zwangen den Herzog, auf eine Ordnung des Haushalts bedacht zu sein. Die herzogliche Familie lebt standesgemäß, Herbst und Winter im Münchener Stadtpalais, Frühjahr und Sommer am Starnberger See, im Schloss Possenhofen, einem geräumigen, doch einfachen Bau. Die Generalsgage ist nicht zu entbehren. Doch Herzog Max trägt das bayrische Gewand, Joppe und Lederkniehose, viel lieber als die Uniform seines Kavallerieregiments. Er verzichtet auch als General nicht auf die stete Begleitung und Gesellschaft seines Hofmusikers, jenes seltsamen Wiener Gastwirtssohnes Johann Petzmacher, den er 1857 in Bamberg kennen gelernt hat und seither nicht von seiner Seite lässt. Petzmacher, ein Wiener Original, hat den Herzog das Spielen auf der Zither gelehrt, er war der Begleiter auf den großen Reisen, und der Herzog selbst erzählt es gern, wie sie beide auf der Spitze der Cheopspyramide die Bergzither erklingen ließen. Herzog Max hat selbst nach fünfundzwanzig Ehejahren auf seine Freiheiten nicht verzichten gelernt. Die Herzogin musste sich damit abfinden, dass er sich auch räumlich separierte. Es war klug von ihr, die Eigenart des Gatten zu respektieren. Er bewohnt das Parterre des Possenhofener Schlosses, seine Zeit und Freiheit sind nicht an die Uhr des ersten Stocks gebunden. Tagelang ist er mit Petzmacher, mit Jägern und Holzfällern im Gebirge. Er ist heute fünfundvierzig Jahre alt, jugendlich schlank, von der Sonne gebräunt wie die bäuerlichen Gefährten der Jagd, ein ausdauernder Bergsteiger, ein vortrefflicher Schütze, der beste Reiter. Er hasst jedes Zeremoniell, er lacht gern und freut sich an derben, originalen Menschen. Sisi liebt diesen Vater mit dem Enthusiasmus der innersten Verwandtschaft. Was sie sein möchte, das ist er. Was sie als Vollendung des eigenen Wesens erträumt, besitzt er als natürliche Gabe. Neben ihm ist sie glücklich, mit ihm ausreiten zu dürfen steigert den heroischen Reiz, den ihr das Pferd bereitet. Es ist ihr Stolz, mit dem Vater Schritt zu halten. Sie hat seinen Gang; sie steigt auf die Berge, sie reitet, sie schwimmt, weil sie es zum ersten Mal vom Vater gesehen hat. Helene ist anders geartet. Sie ist der Mutter ähnlich, nicht dem Vater. Sie ist still, sie ist fromm, sie hat nicht die Unbefangenheit der jüngeren Schwester. Sie ist auch äußerlich anders als Sisi. Sie hat nichts von deren knabenhaft-rassigen Merkmalen, nicht die Geschmeidigkeit des überschlanken Körpers, nicht die Schönheit des Auges, nicht das leuchtend dunkle Haar. Sie ist die Mutter-Tochter, und so wie sie ist, wird sie, die Mütter wollen es, die beste Gattin Franz Josephs, eine würdige Kaiserin auf Habsburgs Thron sein.
Der Reisewagen hat den Chiemsee passiert, im alten Traunstein, in Salzburg hat man Station gemacht. Bei jedem Halt, bei jedem Pferdewechsel muss Sisi mütterliche Ermahnungen hören. Sisis Vertraulichkeit mit den Kutschern, den Knechten und den Pferden missfällt der Herzogin. Sisi wird daran erinnert, dass ihr Mitreisen an eine Bedingung geknüpft wurde; sie hatte versprechen müssen, gehorsam zu sein. Einmal, in Rosenheim, drohte die Mutter, Sisi zurückzuschicken. Sisi hatte sich beim Tränken der Pferde zu schaffen gemacht und kam mit nassen Schuhen und Armen zurück. Nun wird ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt; die im Kammerwagen mitfahrende Zofe hilft der Mutter, Sisi im Zaum zu halten. Doch nicht dies allein bewirkt, dass Sisi während der letzten Strecke der Fahrt, von Salzburg zu den Salzkammergut-Seen, stiller ist. Die Herzogin richtet ihre Worte nur an Helene, das Gespräch der Mutter und das Benehmen der älteren Schwester lassen Sisi ahnen, dass in Ischl eine Überraschung wartet. Man kommt, wie es der Plan vorgesehen, zur vereinbarten Zeit am Ziel an. Erzherzogin Sophie kann trotz der Würde, die sie auch im einfachen Sommerkleid trägt, herzlich sein. Ihr Gatte, Erzherzog Franz Carl, hat mehr die Freundlichkeit des Auges und des Lächelns als die der Worte, die von den schweren Lippen nur sparsam fließen. Er ähnelt seinem ältesten Bruder, dem abgedankten Kaiser Ferdinand, der als Pensionist in der Prager Burg lebt. Helene und Sisi küssen mit einem tiefen Knicks Tante Sophie die Hand. Es ist die Herzlichkeit und Höflichkeit der nahen Verwandten mit der Betonung des Respekts, den man dem mächtigen Hause schuldig ist. Es hat sich seit dem letzten Besuch in Ischl nichts an den Formen des Empfangs geändert, dennoch ist alles anders. Die Brüder des jungen Kaisers sind da, Sophies Hofstaat ist gewachsen, man sieht neue Gesichter, mehr Uniformen. Alle diese Menschen bewegen und benehmen sich, als ob sie unter stetem Befehl stünden. Wo ist er, der Mittelpunkt dieser Würden und Ämter, der junge Kaiser? Er hat seine Reise nach Ischl zweimal verschoben, nun ist die Ankunft auf den sechzehnten August festgesetzt. Am achtzehnten August ist sein vierundzwanzigster Geburtstag. Noch hält ihn Wien gefangen. Sie sind hart und ereignisvoll gewesen, diese sieben Monate des Jahres 1855: Die Emeute in Mailand, die unermüdliche Agitation Piemonts, die Konspirationen der ungarischen Emigranten, Mazzinis Manifeste - die besiegte Revolution glimmt wie das Feuer unter der Aschendecke. Am achtzehnten Februar züngelte es empor, den jungen Kaiser selbst zu vernichten. War es nicht ein Wunder, dass der Dolch des ungarische Schmiedegesellen János Libényi an der Krawattenschnalle des Kaisers abprallte? Das Wort des Kardinals Rauscher ist seither die stete Bekräftigung des neuen Regimes: Wir haben ein gutes Gewissen! Die Schatten der Gehenkten, der Füsilierten werden den jungen Kaiser nicht schrecken.
Geschwister der Kaiserin Elisabeth von Österreich, Schloss Possenhofen, Karl Josef Stieler (1770 - 1858)
Am sechzehnten August ist Sisi von morgens an der Gouvernante überlassen. Der Kaiser ist gekommen. Sisi sieht die Dinge, die um sie herum geschehen, nur mehr wie ein Kind, das ins Nebenzimmer verbannt ist, während die Großen Gesellschaft halten. Die Mutter und Helene haben kaum einen Blick für sie. Es ist Empfang im Schloss. Vorher erscheint Tante Sophie bei ihrer Schwester, Helene wird angekleidet, es kommen Diener mit Blumen, der Kardinal war zweimal bei der Herzogin, ein Adjutant des Kaisers übergibt einen Brief. Sisi ist mit der Gouvernante allein, aber die Unruhe der anderen überträgt sich auf sie. Am nächsten Tag kommt der Kaiser zu Besuch. Die Mutter hat es so gewünscht, so ist es vorgesehen. Franz Joseph hat in keiner Stunde seines Lebens einen Rat oder einen Wunsch der Mutter angezweifelt. Er ist so ganz ihr Werk, dass sich ihm ihre Absichten als seine eigenen mitteilen. Dieser Gleichklang der Naturen ist bisher umso unbeschwerter von einer Empfindung des Zwangs gewesen, als die neu aufgerichtete, unbeschränkte Macht dem Kaiser das Gefühl einer unendlichen Willensfreiheit gibt. Es ist das erste Mal, dass Franz Joseph einen Wunsch der Mutter als ein fremdes, ihn beengendes Gebot empfindet. Er hat ihr bei Gesprächen und Andeutungen über die Wahl der Gattin seine Absicht nicht verhehlt, nur der eigenen Stimme folgen zu wollen. Sie hat solche Äußerungen mit dem Ohr einer Mutter aufgenommen, die überzeugt ist, auch diese Lebensfrage des Sohnes besser entscheiden zu können als er selbst. Franz Joseph gehorcht der Mutter, als er am siebzehnten August das Herzogpaar, Onkel und Tante, besucht. Er weiß nicht, wie weit dieser Weg vorausbestimmt ist, ihm blieb verborgen, dass Mutter und Tante in ihren Briefen den Plan bis ins Einzelne vorbereitet haben. Er erkennt aber, dass die Tante, der Herzog und Helene eine Entschließung erwarten. Es ist eine Gebundenheit, von der er sich auch beim Mitspiel des zartesten Takts nicht befreien kann, ohne aufs äußerste gespannte Erwartungen jäh zu vernichten und ein Feld zertretener Hoffnungen, verletzter Gefühle und Empfindungen zurückzulassen. Bei Tisch, der vier Gedecke trägt, sitzt der junge Kaiser mit Helene und ihren Eltern. Sisi speist mit ihrer Gouvernante im Nebenzimmer. Der Herzogin schien es ratsam, die ungestüme jüngere Tochter in dieser entscheidenden Stunde zu separieren. Die Zeit des Besuchs ist abgesteckt, jede Minute rückt den Zeiger der Uhr dem Punkt näher, der von Franz Joseph die Entscheidung fordert. Er fühlt die Hand der Mutter, die zarte und doch starke Hand, die ihn durch die Bangigkeit dieser Minuten führen will. Er spürt die im Blut pochenden Zweifel, er sieht sich Abschied nehmen von den kleinen Wonnen des Alleinseins; er hört jeden Sekundenschlag in den Pausen, die das Gespräch lässt, er ist bedrückt beim Blick auf Helenes Befangenheit, wie von dem Auge der Tante, aus dem eine bange Frage spricht. In diesen Moment des Zauderns eines Dreiundzwanzigjährigen dringt die Stimme der Sechzehnjährigen aus dem Nebenzimmer. Sisi, das Kind, wird zu Tisch gerufen. Sie kommt mit lebhafter Bewegung herein; ein kleiner Streit mit der Gouvernante hat ihre Wangen gerötet. Mit kindlicher Unbefangenheit, nichts von der Schwere des Augenblicks ahnend, die über dem Kreis der Großen schwebt, grüßt sie ihren Cousin Franz Joseph. Der junge Kaiser ist von der Sechzehnjährigen wie geblendet. Ein plötzlicher Entschluss, jede Hemmung, jeden Zweifel beiseiteschiebend, jagt durch sein Hirn. Nicht Helene, Sisi wird seine Frau werden. Da der Zeiger der Uhr den Kaiser ruft, hat sich das Schicksal Franz Josephs und Elisabeths erfüllt.
Kaiserin Elisabeth
Es gibt ungefährdete Menschen, denen die Vorsehung alle Erfahrung vieler Geschlechter in die Wiege legt. Franz Joseph, der junge Kaiser aus dem Hause Habsburg-Lothringen hat kein solches Gut empfangen. Die Paarung von Machtwillen und Klugheit, wie sie noch Karl dem Sechsten und dessen Tochter Maria Theresia zu eigen gewesen, hatte nach dem Aussterben des Mannesstamms ihre fortzeugende Kraft eingebüßt. Nach Josephs des Zweiten Experiment wider die Tradition rettete Metternich das Haus aus den Stürmen der Napoleonischen Kriege. Dann aber schien es, als ob die Habsburg-Lothringer mit dem schwachgeistigen Kaiser Ferdinand von der Geschichte Abschied nehmen sollten. Der Thron war auf die Entschlusskraft und die Klugheit einer Verwandten gestellt. Jetzt, da Franz Joseph sich seiner Mutter zum ersten Mal widersetzt, benimmt er sich wie ein Kind aus einer traditionslosen Familie: Er folgt seinen Augen, seinen Sinnen, seinem Herzen. Der Abend des siebzehnten August 1853 verlangt bis in die Nachtstunden nach einer langen Zwiesprache der Mutter mit dem Sohn. Der Instinkt der Mutter lehnt die Wahl Franz Josephs ab. Warum Sisi, ein unvollendetes Geschöpf, fast noch ein Kind, warum nicht Helene? Franz Joseph hört, was er unzählige Male von der Mutter vernommen hat: Der Kaiser hat Pflichten; er lebt nicht wie jedermann; er ist nicht nur sich, er ist dem Haus, er ist für seine Berufung Gott verantwortlich. An diesen Worten hat Franz Joseph niemals gezweifelt. Jetzt klingen sie wie aus einer anderen Welt. Kann das, was er will, schlecht sein? Er fühlt sich plötzlich so stark und ist sich seines eigenen Willens so bewusst, dass ihn auch die eindringlichste Rede der Mutter nicht wankend zu machen vermag. Die Mutter spricht Worte, die wie eiskalte Wellen an seinen Körper schlagen: Ein sechzehnjähriges Mädchen ist keine Kaiserin; zur Kaiserin wird man geboren, man kann dazu nicht erzogen werden; Sisi ist dem Vater nachgeraten, Helene hat das Blut ihrer Mutter. Nach einem langen Schweigen erklärt Franz Joseph, überhaupt nicht heiraten zu wollen. In der Nacht empfängt die Mutter den Kardinal.
Am achtzehnten August, es ist Franz Josephs vierundzwanzigster Geburtstag, lässt des Kaisers Mutter, am Tor der Kirche, der sechzehnjährigen Elisabeth den Vortritt; der Hof, die Welt wissen, was sich ereignet hat. Fünf Tage danach bringt die ›Wiener Zeitung‹, das Journal der Staatsregierung, die Mitteilung, »Seine Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät ... Kaiser Franz Joseph der Erste, haben sich ... in Ischl nach Einholung der Einwilligung seiner Majestät König Maximilians des Zweiten von Bayern ... mit Prinzessin Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern, Tochter Ihrer Hoheiten des Herzogs Maximilian Joseph und der Herzogin Ludovika, geborener königlicher Prinzessin in Bayern, verlobt. Möge der Segen des Allmächtigen ...« Der junge Kaiser bleibt einen Monat lang bei seiner Braut. Es ist Franz Josephs Lebensfrühling, die Zeit reinen Glücks, da er, unbeschwert vom Druck der Würde, nichts als verliebt sein darf. Elisabeth lebt wie im Wachsein des Traums. Sie hatte den Kaiser-Cousin nur von den Augenblicken kurzer Begegnungen gekannt und nicht mehr von ihm gewusst, als was das Bild ihr sagte: Ein junger Leutnant, der Kaiser sein muss. Nun ist ein Jüngling vor ihr, der sich freuen und lachen kann, er ist wie ein Mann und auch wie ein Knabe, er spricht zu den anderen, wie ein Kaiser sprechen muss, und vor ihr ist er sehr einfach. Er ist hübsch. Seine raschen Bewegungen, seine großen blauen Augen machen ihn noch jünger, als er ist. Er kann so schnell zu Pferd steigen wie sie. Elisabeth denkt an den Vater. Neben dem jungen Kaiser zu reiten ist noch schöner. Nie zuvor hat sie diese Freude der erhöhten Bewegung, die Lust des Reitens so stark empfunden wie an der Seite des jungen Kaisers. Er hält Schritt, er überholt sie, sie erreicht ihn, sie verlangsamen den Gang, sie reichen einander die Hand. Sie sind allein. Man riecht den Wald, spürt den raschen Atem der Pferde. Die Wiesen leuchten. Wer von beiden findet zuerst am Rande der Bergstraße Erdbeeren? Elisabeth springt vom Pferd und pflückt sie. Es sind ihre schönsten Vormittage.
Helene ist mit dem Vater nach München gefahren.
Sophie und Ludovika, die Schwestern, schweigen vor dem Glück der Kinder. Des Kaisers Mutter aber weiß, dass ihr eine schwere Aufgabe bevorsteht: Sie muss ein Naturkind zur Kaiserin erziehen.
Oktober, November, Dezember 1853, Januar, Februar, März 1854 sind Monate langer Briefe und kurzer Besuche in München und in Possenhofen. Der junge Kaiser ist wieder in Wien. Er muss alles selbst entscheiden. Schwarzenberg ist nicht mehr. Seit der Aufhebung des Kriegsministeriums ist der Kaiser auch sein eigener Sachwalter des Heeres. Es ist ihm für seine Post nach Bayern wenig Zeit gegeben. Er ist wieder der pünktlichste Beamte seines Staats. Und doch ist er verändert. Auf seinem Arbeitstisch steht das Bild Elisabeths. Er unterbricht den Vortrag eines seiner Räte und zeigt das Bild der Braut. Der strenge Polizeiminister Freiherr von Kempen trägt es missbilligend in sein Tagebuch ein. Franz Joseph hebt den Belagerungszustand auf, der über Wien und Prag verhängt war. Er gibt den Liguorianern1 die Kirche zu Maria Stiegen2 und ihr ehemaliges Kloster in der Inneren Stadt zurück. Er mildert das Todesurteil, das acht junge Leute der Prager Gesellschaft getroffen hat, Gymnasiasten, Hochschüler, Künstler, zu Schanzarbeit in leichtem Eisen. Freiherr von Kempen bedauert dieses Zurückschrecken vor der gerechten Strafe als eine Gefahr für die Autorität der Gesetze und der Polizei.
20. April 1854. Elisabeth nimmt Abschied von Possenhofen und München, von ihrer Kindheit, ihrer Jugend, ihrem Mädchentum; Abschied von Wittelsbach. Sie hat es früher nie empfunden, auf welche Art man mit dem eigenen Hause und dessen Landschaft verbunden ist. Es ist ein schmerzhaft-wohliges Erkennen, dass alles in ihrem Dasein zusammengehört: Possenhofen, München, der Vater, der Starnberger See, die weißen Berge am blassblauen Horizont, Wittelsbach, die Jäger, die Freiheit der Sommertage, die Sprache, der König, die jungen Prinzen, der Hof. Elisabeth kann es nicht so ausdrücken, wie sie es fühlt, sie weiß nur, dass es in ihrer neuen Heimat anders ist. Der Sprache des Instinkts fehlen die Worte zur Kennzeichnung des empfundenen Gegensatzes. Es ist die Verschiedenheit der zwei Geschlechter Wittelsbach und Habsburg-Lothringen: Hier lebt ein fantasiebegabtes Adelshaus unter den Segnungen einer Freiheit, die dem privaten Geschmack keine Fesseln auferlegt; dort herrscht ein starres Zeremoniell, hinter dessen Riesenkulisse sich ein schlichtes Bürgerdasein verbirgt. Der Münchener Hof ist viel kleiner als die Wiener Hofburg, aber seine Fantasielandschaft ist unendlich neben der Beengtheit des österreichischen Kaiserhauses. »Möge der Segen des Allmächtigen«, so sprach die Zeitung Franz Josephs, »über diesem für unser Kaiserhaus und das Kaiserreich so glücklichen und frohen Ereignisse ruhen.« Es ist die Sprache der großen Welt, der Elisabeth nun angehört, die Sprache der gratulierenden Könige, Fürsten, Bischöfe, Diplomaten, Generale.
Diese Worte vernimmt Elisabeth jetzt Tag für Tag, eine Flut bedruckten Papiers überschwemmt ihr Zimmer, Deputationen, Vereine, Menschen, die sie nie gesehen hat, kommen huldigend ins Haus. Sie gehört nicht mehr sich selbst, sie ist nicht mehr allein, jedes Wort, das sie spricht, wird von hundert Ohren aufgefangen. Rührend und schön ist der Abschied von den Possenhofeuer Leuten: Vom Gärtner und seiner alten Frau, von den Jägern, vom Bootsmann, von den Dienern und Stallburschen. Elisabeth wird plötzlich von einem so heftigen Schmerz überfallen, dass sie laut weint.
Am zwanzigsten April verlässt Elisabeth München. Die Natur hat den Menschen ein Organ versagt, das sie befähigen würde, die unterirdischen Stimmen des eigenen Wesens zu deuten; nur im Traum werden diese Geister zu Malern und rücken mit bildhaften Symbolen nahe heran. Die kindhafte Elisabeth erlebt diese Abschiedsstunde, als ob sie, schwimmend, in eine reißende Strömung geraten wäre. Ein ungeheurer Wirbel von Menschen, Musik, Stimmen, weißblauen Fahnen und Blumen hüllt sie ein. Ihr armes kleines Herz kann es nicht fassen, dass sie, gestern die ungekannte Prinzessin ihres eigenen Fantasiereichs, heute diesen Aufruhr von Anteilnahme eines ganzen Landes als verdientes Los empfangen soll. Die zartveranlagte Natur wird auch vor einer gerechten Huldigung verlegen, weil sie es gern vermeidet, jemand von seinem Stolz etwas preisgeben zu sehen.
Elisabeth ist zu rein, als dass sie den Chor der ihr unbekannten Welt des loyalen Patriotismus mit wahrer Freude vernähme. In allem Jubel, der sie umschließt, läuft als treuester Gefährte der unterirdische Schmerz nebenher, den sie in Possenhafen so heftig empfunden hat. Die Mutter ist glücklich in diesem brausenden Huldigungssturm gutmütiger Menschen; der Vater, etwas verlegen, nimmt dennoch mit erkennbarer Freude an dem Glück der Herzogin teil. Nur auf kurzen Strecken zwischen freien Feldern kommen wohltuende Pausen der Stille. Vor dem nächsten Ort schlagen wieder Böllerschüsse ans Ohr, Musik ertönt, Kinderstimmen rufen. Dann müssen die Wagen halten. Brave Leute in festlicher Kleidung treten an den Wagen, das Sprechen fällt ihnen oft schwer, man möchte es ihnen gern erleichtern, es ist aber alles einfach und herzlich gemeint. Das wiederholt sich in jedem Dorf, in jedem Marktflecken. In Straubing wartet der Dampfer ›Stadt Regensburg‹. Die Donau trägt das Schiff nach Passau, nach Linz. Die Ortschaften an den Ufern des Stroms sind beflaggt, die Leute schwenken Tücher und Fahnen, überall ist Feiertag und Musik. In Passau kommen die ersten Österreicher, eine Abordnung, die Elisabeth an der Grenze ihrer neuen Heimat willkommen heißt. Die Donau wird breiter, die Ufer entfernen sich vom Schiff. In Linz ist der nächste Empfang. Als die Stadt in Sicht kommt, hört man Glockengeläute. An den Ufern drängen sich viele Menschen, die österreichischen Farben leuchten, rot-weiß und schwarz-gelb. Auf dem Landungsplatz wartet bei einer hohen Ehrenpforte eine festliche Menge. Man sieht die grünen Federn der Generalshüte, das Weiß der Paraderöcke, grelles Rot und Gold, Mädchen mit Blumen, die geraden Reihen des Militärs. Die Musik spielt die habsburgische Hymne. Der junge Kaiser ist da. Er ist seiner Braut entgegengefahren. Es ist seit Wochen das erste Wiedersehen. Das große Reich, der Hof kündigen sich beim Empfang an. Das alte Gebäude der Statthalterei ist festlich hergerichtet, am Abend leuchten tausende Fackeln vor den Fenstern, ein Männerchor singt, Musikanten spielen. Die Ovationen wiederholen sich im Ständetheater, die Rufe nehmen kein Ende, sie begleiten Elisabeth bis in den Schlaf.
Kaiserin Elisabeth
Es ist der zweiundzwanzigste April. Ein neuer Dampfer, der den Namen des Herrschers trägt, größer als das bayrische Schiff, erwartet Elisabeth, um sie nach Wien zu führen. Der Kaiser hat alle Rosen Schönbrunns zum Schmuck des Schiffs gegeben. Es ist das artigste, geschmackvollste Geschenk unter den vielen Gaben, die Elisabeth erwarten, dieses blühende Kleid auf dem Körper des Schiffs. Franz Joseph ist zeitlich früh nach Wien vorausgefahren. Das Schiff braucht den vollen Tag, um Wien zu erreichen. In der Wachau, zwischen dem Stift Melk3 und Krems, scheint die Sonne auf die schönste Stromlandschaft Österreichs; vor Wien ziehen sich Wolken zusammen. Es ist halb sechs Uhr abends, als das Schiff in Nussdorf, dem Wiener Hafen, landet.
Der junge Kaiser hat Wien mit dem Schwert erobert, aber während der fünf Jahre seiner Regierung die Herzen der Stadt nicht zu gewinnen vermocht. Die Reichshaupt- und Residenzstadt war bis vor wenigen Wochen unter militärischer Herrschaft, im Zustand der Belagerung. Ein Teil der Gesellschaft, die stets Untertänigen, Beamte, Offiziere, der Klerus, auch kleine Bürger, sind damit zufrieden; sie ziehen die Ordnung der Polizeigewalt einer Freiheit ohne Sicherheit vor. Die anderen jedoch, nicht nur die Enttäuschten der zwei Sturmjahre, die Angehörigen der geistigen Berufe, Advokaten, Ärzte, viele höhere Beamte, auch Kaufleute und Handwerker lassen sich nicht überzeugen, dass der junge Kaiser auf dem richtigen Weg sei. Franz Joseph ist nicht beliebt. Der Wiener hat seit Maria Theresias Tagen, von Joseph, von Leopold, Franz und Ferdinand ein anderes Bild vom Kaiser empfangen, als Franz Joseph es jetzt zeigt. Der Absolutismus Franz’ hatte das Kleid patriarchalischen Kleinbürgertums; jedermann konnte zu ihm. Er selbst trug, wenn er mit der Kaiserin die Basteien entlang spazierte, das Gehaben eines Wiener Bürgers zur Schau. Ferdinand war ein schüchterner, freundlicher Herr. Es war unvorstellbar, ihn als General zu sehen. Franz Joseph ist nur Offizier. Den ›rothosigen Leutnant‹ sieht man nicht anders als zu Pferd. Er ist stets von Offizieren umgeben. Er hat Österreich zum Soldatenstaat gemacht. Soldaten, Polizei und Gendarmerie beherrschen das Reich. Es ist nicht daran zu denken, dass er dem Zivilstand irgendeine Art von Teilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten zugestehen werde. Es gibt keine Vereine, keine Zusammenkünfte mehr. Die Presse muss sehr fügsam und auch vor der strengen Zensur sehr vorsichtig sein. Die Selbständigkeit der Gemeinden, ihre Geschäfte selbst zu verwalten, ist aufgehoben worden. Das Reisen ist durch viele Passvorschriften der Polizei sehr erschwert. Die Steuern sind hoch; eben in diesem Jahr wurde die Zuckersteuer eingeführt, die Branntweinsteuer und die Grundsteuer erhöht, die Stempelsteuer verdoppelt. Das Silbergeld verschwindet aus dem Verkehr. Die Ausgaben für die Armee steigen von Jahr zu Jahr. Die Staatsbahn musste auf die Dauer von neunundneunzig Jahren einer französischen Gesellschaft zur Ausbeutung überlassen werden. Es gibt keine Verantwortlichkeit der Minister; diese englischfranzösische Erfindung verträgt sich nicht mit Kübecks These von der Selbstherrlichkeit der habsburgischen Majestät. So fällt alle Verantwortung auf den jungen Kaiser. Er ist nicht beliebt.