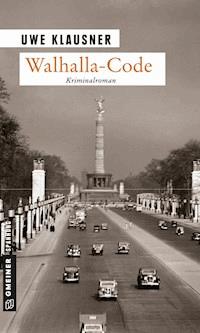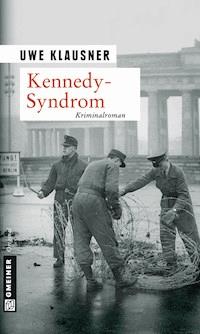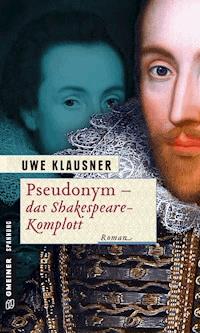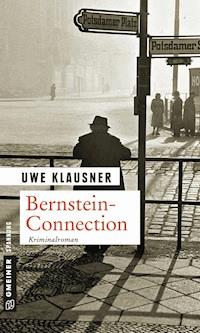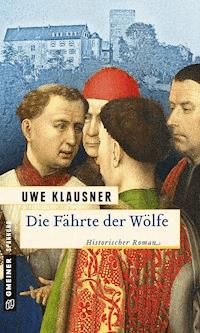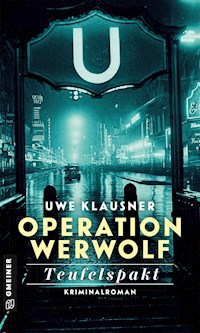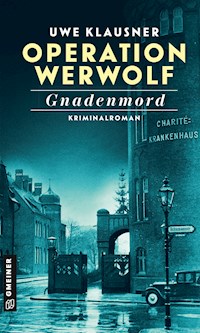Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wien, Februar 1889. Pater Alban, Kustos der Kapuzinergruft, erhält hohen Besuch. Um wen es sich bei der verschleierten Frau handelt, wird ihm nicht mitgeteilt. Doch merkt er recht bald, dass er Kaiserin Sisi vor sich hat, die das Grab ihres Sohnes besuchen möchte. Dessen Suizid hat die k. u. k.-Monarchie in eine tiefe Krise gestürzt. Dass Kronprinz Rudolf zuerst seine Geliebte und danach sich selbst erschoss, darf unter keinen Umständen publik werden. Doch dann nimmt sich Alban des Falles an - und bringt das Kaiserhaus in große Schwierigkeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Klausner
Sisis schwerste Stunden
Historischer Kriminalroman
IMPRESSUM
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Kor«relationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2024 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elisabeth_of_Austria,_by_Franz_Xaver_Winterhalter.jpg
ISBN 978-3-7349-3034-8
HAUPTFIGUREN (fiktiv)
Pater Alban, Kustos
Emil Prohaska, Journalist
Severin, Albans Mentor und Lehrer
B.F., Albans Mutter
HAUPTFIGUREN (real)
Johann Loschek (1845-1932), Kammerdiener des Kronprinzen
Hermann von Widerhofer (1832-1901), Leibarzt Rudolfs
Franz Joseph I. (1830-1916), Kaiser von Österreich
Elisabeth (1837-1898) alias »Sisi«, seine Frau
Graf Eduard Taafe (1833-1895), K.u.k. Ministerpräsident
Irma Sztaray (1864-1940), Sisis Hofdame
STAMMBAUM
DOKUMENT
K. K. Hofburgtheater
In Folge plötzlichen Ablebens Sr. K. und K.
Hoheit des durchlauchtigsten
Kronprinzen Erzherzogs
Rudolph
bleiben die k. k. Hoftheater
heute geschlossen.
Wien, am 30. Jänner 1889
EINS TODESPAKT
HERMANN VON WIDERHOFER, LEIBARZT DES KRONPRINZEN (56 JAHRE)
1
Jagdschloss Mayerling im Wienerwald, Mittwoch, 30. Jänner1889, 12.00 Uhr
»Wie furchtbar, mir fehlen die Worte!«, nahm mich Loschek vor dem Ostflügel in Empfang, sah mich an, als stünde der Weltuntergang bevor, und trottete zum Kutschbock, um das Fahrtgeld zu bezahlen. Fast wäre er dabei ins Stolpern geraten, ohne Blick für den überfrorenen Schnee, der wie ein Grabtuch auf dem Hof des Jagdschlosses lastete. Unweit der Tür hatte sich ein Schwarm Raben niedergelassen, leicht vornübergebeugt, wie Bestatter beim Herablassen des Sarges. Unheil lag in der Luft, so peinigend wie die klirrende Kälte, die sich wie Eisnadeln durch den Kaschmir bohrte. »In den besten Jahren, und dann so etwas. Das begreife, wer will.«
Meinen Arztkoffer in der Hand, kletterte ich aus dem Fond und sah mich um. Vom Personal, ansonsten recht zahlreich, keine Spur, auch die Leibjäger wie vom Erdboden verschluckt. Fast schien es, als sei das Schloss mit einem Bannfluch belegt, so öde und verlassen sah es aus.
»Hier, das ist für Sie.« Loschek drückte dem Fiaker einen Dukaten in die Hand. Allemal genug, um sich sein Schweigen zu erkaufen. Letztendlich aber gut angelegtes Geld. Je weniger Mitwisser, desto besser für den Ruf der Monarchie. Und desto mehr Chancen, die Klatschblätter außen vor zu lassen.
Es sei denn, ein Reporter winkte mit den Scheinen.
Und ein Domestike im Schloss packte aus.
Geschähe, was nicht geschehen durfte, dann würde der Kaiser im Kreuzfeuer stehen. Nebst Gattin, von Franz Joseph liebevoll »Sisi« genannt. »Seiner Mutter wird es das Herz brechen, die arme Frau!«
Besser, ich sagte nichts dazu.
Der Mann hatte schon genug am Hals.
Einen Seufzer konnte ich mir dennoch nicht verkneifen. Das waren noch Zeiten, als ganz Wien der Kaiserin zu Füßen lag. Mit heute, jenseits der 50, kaum mehr zu vergleichen. Eher geduldet als geliebt, hatte Sisi ihren Kredit verspielt. Und dann erst die ewigen Kapricen, mit denen sie ihre Trabanten in Aufregung versetzte. Dazu einer meiner Kollegen, weiland Badearzt im bayerischen Brückenau, der den Narziss unter die bewährten Fittiche nahm: »Blutarm, menschenscheu und gemütskrank.«
Ein hartes Urteil, mag sein.
Doch näher an der Wahrheit, als man denkt.
Aber wehe, man sprach dies offen aus. Auch jetzt noch, nach dreieinhalb Jahrzehnten Ehe, ließ der Kaiser nichts auf die Egomanin kommen. Da hielt ich mich doch lieber bedeckt. Dabei wusste ich aus erster Hand, wie ambivalent das Verhältnis zu ihren Kindern war. Und wie sehr der Kronprinz darunter litt. Respektive gelitten hatte. Von einem innigen Miteinander, das sei in aller Deutlichkeit betont, konnte wahrhaftig keine Rede sein. Eine Tatsache, die ihm zeitlebens zu schaffen machte. Und die Rudolf darin bestärkte, einen Schlussstrich zu ziehen.
Wie am heutigen Mittwochmorgen geschehen.
»Willkommen in Mayerling, Herr Doktor. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt?«
»Sie haben vielleicht gut reden, Loschek«, antwortete ich verstimmt, heilfroh, die Rutschpartie im Zweispänner hinter mir zu haben. Vier Stunden über Stock und Stein, in halsbrecherischem Tempo, bei Schnee, Glatteis und Temperaturen wie im Gefrierkeller.
Mit fast 57 Jahren auf dem Buckel.
Das musste ich erst mal verdauen.
Steif vor Kälte, trat ich wie ein Derwisch auf der Stelle. Noch nie war mir eine Fahrt so endlos vorgekommen, und noch nie war ich so aufgewühlt gewesen wie heute. Ein denkwürdiger Tag, das konnte man jetzt schon sagen. Vergleichbar mit einem Erdbeben, das die Monarchie in den Grundfesten erschüttern würde.
So sie den Skandal, der sich gerade anbahnte, überstand.
Der Kronprinz leblos aufgefunden, viel schlimmer hätte es nicht mehr kommen können.
Trotz Mantel mit Pelzbesatz am Erfrieren, seufzte ich bekümmert auf. Wäre ich dazu imstande gewesen, ich hätte den Tag aus dem Kalender getilgt. Mit einem Federstrich, ohne darüber nachzudenken. »Schwamm drüber, für die Kälte können Sie ja nichts.«
»Sie sagen es, Herr Doktor«, pflichtete mir Loschek bei, wartete ab, bis sich der Zweispänner außer Hörweite befand, und lamentierte: »Aber es stimmt schon: Eine Fahrt im Winter ist nicht so ohne, der Fiaker kann einem leidtun.«
»Wobei ich nicht weiß, was schlimmer war – das Wetter oder die Schaulustigen«, gab ich mit Blick auf meine Taschenuhr zurück, deren Zeiger exakt auf 12 Uhr deuteten. »Und wenn wir gerade dabei sind, Loschek: Ich weiß über alles Bescheid.«
»Wie das?«
»Prinz Coburg ist mir ein Stück entgegengefahren. Um mich auf den neuesten Stand zu bringen. Die vielen Reporter, Sie wissen schon.« Seinem Naturell entsprechend hatte Prinz Philipp von Sachsen-Coburg und Gotha, Schwager und Jagdgefährte des Kronprinzen, bei der Schilderung der Tragödie kein Blatt vor den Mund genommen. Und hatte mich darum gebeten, Stillschweigen zu bewahren. Für mich ginge es nur darum, mir ein Bild von der Lage zu machen. Aus Sicht des Experten, wenn man so wolle. Auf meine Frage, warum die Polizei nicht schon längst in Aktion getreten sei, hatte der Prinz denn auch prompt eine Antwort parat. Der Kreis der Eingeweihten, so der Intimus des Toten, müsse so klein wie nur irgend möglich bleiben. Denn nur so könne man einen Skandal vermeiden. Davon abgesehen sei das Gelände in Privatbesitz, will heißen: Auf den Schlössern, die zum Eigentum der Krone zählten, stünde es der Polizei nicht zu, ihre Befugnisse wahrzunehmen. Es sei denn, man bitte sie darum. Was aus Gründen der Staaträson zu unterbleiben habe.
Zitat Ende.
Der Kronprinz tot, natürliches Dahinscheiden ausgeschlossen. Vor ein paar Stunden, als ich das Telegramm aus Mayerling in Händen hielt, hatte sich das alles ganz anders angehört. Seine Hoheit sei schwer erkrankt, stand da zu lesen, verbunden mit der Bitte, mich nach Mayerling zu begeben. Und zwar unverzüglich, der Zustand des Patienten sei ernst. Dass Rudolf zu dem Zeitpunkt schon tot war, konnte ich freilich nicht ahnen. Geheimhaltung geht vor, so lautete offenbar die Devise, selbst auf die Gefahr, als Lügner dazustehen.
Ob es gelänge, die Pressemeute aus Wien hinters Licht zu führen, daran hegte ich meine Zweifel. Wurde das Schloss doch förmlich belagert, den Sturmböen zum Trotz, die wie eine Sense über die Häupter der Schaulustigen fegten. Schlechte Kunde verbreitet sich bekanntlich schnell, kaum verwunderlich, dass es vor Gaffern nur so wimmelte. Darunter auch Dutzende von Reportern, die das Tor wie ein Heuschreckenschwarm umlagerten. Fast so vielköpfig wie das Heer von Polizisten, allen voran die Agenten aus dem Präsidium, als Zivilisten getarnt, wie könnte es anders sein.
Kaum verwunderlich, dass die Gerüchte nur so ins Kraut schossen. Da behaupteten die einen, der Kronprinz sei einem Komplott zum Opfer gefallen, die andern, offenbar in der Mehrheit, ein gehörnter Gatte sei gewaltsam bei ihm eingedrungen, habe Rudolf in flagranti mit seiner Frau ertappt, zur Pistole gegriffen und den Homme à Femmes aus dem Weg geräumt. Ein Blutbad so recht nach jedermanns Geschmack, wie die erregt geführten Debatten bewiesen.
Armes Österreich-Ungarn, mehr fiel mir dazu nicht ein.
»Wenn Sie jetzt bitte mitkommen wollen«, lud mich Loschek mit belegter Stimme ein, ihm ins schwach erleuchtete Parterre zu folgen, auf dem Weg zum Entreezimmer des Kronprinzen, dessen Fensterläden von innen verriegelt worden waren. »Bitte hier entlang, Doktor Widerhofer, es ist alles noch so, wie wir es vorgefunden haben.«
»Und die Tür da, wer hat sich daran zu schaffen gemacht?«, richtete ich das Wort an den schwermütigen Begleiter, wie kaum ein anderer mit dem Privatleben Rudolfs vertraut. »Sieht mir nach einem Einbruch aus, oder was meinen Sie dazu?«
Johann Loschek, langjähriger Intimus des Kronprinzen, Anfang 40, stattlich und absolut loyal, schüttelte das bärtige Haupt. »Das war ich«, bekannte er geknickt, fuhr mit dem Handrücken über die Augen und hatte Mühe, die Contenance zu bewahren. »Mit einem Hammer.«
»Sonst noch was?«
»Nicht, dass ich wüsste«, zögerte das Faktotum die Replik hinaus, sah sich um, als befände sich ein unsichtbarer Lauscher im Raum, und strich eine angefeuchtete Haarsträhne hinters Ohr. »Seinen Jagdgefährten zu verlieren, für den Prinzen war das ein großer Schock. Wie es aussieht, wird er ihn so schnell nicht verwinden.«
»Wer außer Ihnen beiden war noch vor Ort?«
»Graf Josef Hoyos, ein langjähriger Freund des Hauses«, tat sich Loschek auch jetzt mit seiner Antwort schwer, darauf bedacht, die Worte sorgsam zu wählen. »Gestern Abend hat er mit dem Kronprinzen zu Tisch gesessen – und die Nacht im Mayerlinger Hof verbracht.«
»Und weiter?«
»Also, das war so: Da Prinz Philipp nicht imstande war, dem Kaiser die Nachricht vom Sui…« Zutiefst erschrocken, brach Loschek überhastet ab, lockerte den Livree-Kragen und raunte mir von links ins Ohr: »Da der Prinz mit den Nerven am Ende war, fiel Graf Hoyos die schwere Aufgabe zu, den kaiserlichen Hoheiten Bericht zu erstatten. Unter uns, Herr Doktor: Wer reißt sich denn schon darum, den Kaiser über das Dahinscheiden seines Sohnes zu informieren, in seiner Haut hätte ich wirklich nicht stecken wollen.«
»Wann genau ist Hoyos nach Wien aufgebrochen?«
»Vor dreieinhalb Stunden. Wie ich ihn kenne, hat er sich keine Pause gegönnt.«
»Daraus folgt, der Kaiser dürfte im Bilde sein«, erwiderte ich matt und ließ den Blick durch das rustikale Entreezimmer schweifen, an dessen Wänden Dutzende von Jagdtrophäen prangten. Durch den Spalt zwischen den Läden sickerte das Tageslicht hindurch, kaum mehr als ein schwaches Aufglimmen, das den Raum in diffuses Dämmerlicht tauchte. Wie bei derlei Anlässen üblich, wurde das Mobiliar von dunklen Tüchern verhüllt, desgleichen der Spiegel zu meiner Linken, so breit wie die gesamte Wand. »Dann lassen Sie mal hören, Loschek«, forderte ich das Faktotum auf, den Blick auf die eingeschlagene Tür gerichtet, hinter der sich das Schlafzimmer des Kronprinzen befand. »Was genau ist heute Morgen passiert?«
Loschek seufzte. »Als ob wir beide das nicht wüssten.«
»Wenn wir gerade dabei sind: Ich weiß es zu schätzen, wenn man mir die Wahrheit sagt. Besonders dann, wenn es sich um heikle Angelegenheiten dreht. Oder um Belange von nationaler Tragweite, falls Sie verstehen, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte.«
»Ein Telegramm geht durch viele Hände, das wissen Sie so gut wie ich.«
»Verschleierung um jeden Preis, verstehe«, presste ich mit mühsam unterdrücktem Unmut hervor, versenkte meinen Blick in denjenigen meines Begleiters und sagte: »Ich schlage vor, wir bleiben beim Thema. Und darum abermals: Was ist hier vorgefallen, jetzt lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen!«
»Ganz wie Sie wünschen, Herr Doktor.«
»Frage: Wann haben Sie Seine Hoheit zum letzten Mal gesehen?«
»Um zehn nach 6 Uhr in der Frühe.«
»Bei welcher Gelegenheit?«
»Der Kronprinz kam zu mir ins Zimmer«, leitete Loschek die Schilderung der Vorkommnisse ein, wies mit dem Kinn auf die Tür zu meiner Rechten, wo sich das Domizil des diensthabenden Kammerdieners befand, und stieß ein halblautes Verlegenheitsräuspern aus. »Und erteilte mir den Befehl, die Pferde einzuspannen. Ich war noch nicht richtig draußen, da hörte ich auch schon zwei Schüsse.« Das Faktotum warf einen neuerlichen Rundblick durch den Raum, umklammerte seinen Hals, als drohe er zu ersticken, und deutete auf die demolierte Schlafzimmertür. »Die von dort drüben kamen, da bin ich mir ganz sicher.«
»Und dann?«
»Klopfen zwecklos, keine Reaktion. Die Frage war, was tun. Da sich Prinz Philipp noch in Wien befand, blieb mir nichts übrig, als mich an Graf Hoyos mit der Bitte um Instruktionen zu wenden.«
»Der Ihnen befahl, die Tür aufzubrechen.«
»Ganz recht. Das Loch in der Türfüllung war gerade einmal groß genug, dass ich meine Hand hineinzwängen und die Tür von innen aufsperren konnte. Welch grauenhafter Anblick, ich kann es immer noch nicht fassen!«
»Und der Schwager Seiner Hoheit, was war mit ihm?«
»Er kam erst kurz nach 8 Uhr hier an. Familienfeier am Vorabend – Sie verstehen.«
»Ich bemühe mich darum«, fiel es mir schwer, die Schilderung des Kammerdieners nachzuvollziehen. »Habe ich Sie da richtig verstanden: Die beiden Schüsse fielen zehn Minuten nach 6 Uhr?«
Loschek bejahte stumm.
»Was würden Sie schätzen, wann haben Sie sich Zugang zum Schlafzimmer verschafft?«
»Circa zwei Stunden später.«
»Wie bitte, erst zwei Stunden später?«, wiederholte ich konsterniert, ließ den Blick zwischen Loschek und der Tür hin- und herpendeln und fragte: »Und Sie sind sich da auch wirklich sicher?«
»Der Kronprinz hatte mich angewiesen, ihn um 7.30 Uhr zu wecken.«
»Alles, was recht ist, aber jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr.«
»Er hat sich eben noch mal hinlegen wollen!«, begehrte der Kammerdiener auf, hatte sich jedoch rasch wieder unter Kontrolle. »Was gibt es denn da zu verstehen?«
»Nur um es sich am Ende anders zu überlegen«, kam ich nicht umhin, mich in Sarkasmus zu üben, mehr denn je im Zweifel, ob es Sinn machte, die Unterredung zu vertiefen. »Aber lassen wir das, schließlich stehen wir erst am Anfang.« Meinen Arztkoffer in der Hand, wies ich mit der Kinnspitze zur Tür. »Nach Ihnen, Loschek, jetzt wird es ernst!«
2
13.40 Uhr
Einen Tatort zu untersuchen, das war nichts für schwache Nerven. Besonders dann, wenn man den Toten kannte.
Oder wenn man geglaubt hatte, ihn zu kennen.
Mortui vivos docent. Klingt gut, aber nur in der Theorie. Einmal angenommen, ich fand die Wahrheit heraus: nichts schlimmer, als wenn sie publik werden würde.
Schweigen um jeden Preis.
Nur darauf kam es heute an.
Um ganz ehrlich zu sein, Begängnisse waren meine Sache nicht. Falls möglich, zog ich es vor, ihnen aus dem Weg zu gehen. Selbst jetzt noch, mit 30 Dienstjahren im Gepäck. Außer vielleicht, man hatte keine Wahl.
So wie heute, am Tag eins der Kaiserdämmerung.
Dein Pech, Herr Doktor.
Da musst du durch.
Was weiß ich, woran das lag. Expertise besaß ich zur Genüge, vor allem, was den Beschau von Mordopfern betraf. Da gab es den betagten Sandler, tot aufgefunden unter der Franz-Joseph-Brücke, vom Täter mit 16 Messerstichen traktiert. Des Weiteren das strangulierte Flitscherl, abgelegt in einem Hinterhof in Neulerchenfeld, gerade einmal 14 Jahre alt. Oder die Wasserleichen aus der Donau, aufgedunsen, entstellt und mit Bisswunden übersät. Und da gab es natürlich auch die Toten, für die sich kein Mensch zu interessieren schien, viele davon mittellos, beim Auffinden bereits stark verwest. Ein Anblick, bei dem sich einem das Herz zusammenkrampfte, selbst jetzt noch, Jahrzehnte später.
Jedoch nichts im Vergleich zu der Szene, auf die ich an jenem Mittwoch stieß.
Der Raum, in dem die Tragödie ihren Lauf genommen hatte, lag an der Südostecke des Wohntrakts, mit vier Fenstern an jeder Seite, vergittert und mit dunklen Klappläden davor. Grob geschätzt war er etwa 50 Quadratmeter groß, reich möbliert und mit allem ausgestattet, was der Kronprinz während der Jagd benötigte. Als da wären ein Schreibsekretär, eine bequeme Sitzgruppe, ein Waschtisch mit Frisierspiegel und dergleichen mehr. Das Badezimmer lag gleich nebenan, ein nicht alltäglicher Luxus, von dem der Kaiser in der Hofburg nur träumen konnte.
Doch genug davon, blicken wir den Tatsachen ins Auge. Um zu begreifen, was sich hier abgespielt hatte, musste man kein Kriminalbeamter sein. Auf dem Bett, das sich an der nördlichen Wand befand, lag die Leiche einer jungen Frau, laut Loschek Rudolfs Geliebte, gerade einmal 17 Jahre alt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Baronesse, nur eine von zahlreichen Amouren, die der sinnenfrohe Kronprinz unterhielt.
Mary Vetsera war der Typ von Frau, den man gemeinhin als Kokette bezeichnet, ungewöhnlich hübsch, auch noch im Tod. Wie sie so dalag, zwar allenfalls mittelgroß, jedoch dunkelhaarig, mit vollendeter Figur, Schmollmund und mandelförmigen Augen, den Körper der Länge nach ausgestreckt, erweckte sie den Eindruck einer Schlafenden, ein unergründliches Lächeln im Gesicht. Am Körper trug sie eine schwarze Plüschjacke, für Normalsterbliche kaum erschwinglich. Umso mehr, da sie laut Etikett aus der Werkstatt des k.-u.-k-Hofschneiders Fischer stammte. Hinzu kamen ein beigefarbener Rock, eine Skunkboa, um den schlanken Hals zu drapieren, sowie ein paar lederne Sommerpumps, auch sie von erlesener Qualität.
Ganz anders hingegen der Kronprinz, dessen Kopf und Oberkörper aus dem Bett ragten, wobei seine Rechte den Boden berührte. Dort hatte sich eine große Blutlache gebildet, deren Spuren bis an den Rand des Läufers reichten. Auch das Laken war mit Blutspritzern übersät, ein Anblick, den ich mein Lebtag nicht vergessen werde.
Und dann lag da auch noch dieser Infanterierevolver, Kaliber neun Millimeter, Dienstwaffe eines Offiziers der k.-u.-k.-Armee.
Keine weiteren Fragen, Herr Doktor.
Zumindest vorläufig.
In Gesprächen hatte der Kronprinz nie ein Blatt vor den Mund genommen. Auch dann nicht, wenn es um heikle Themen ging. Je älter er wurde, desto klarer trat sein Hang zum Morbiden hervor, ein Erbteil seiner bayerischen Mutter, wie mir scheint. Nur ein Beispiel unter vielen: Auf seinem Schreibtisch in der Hofburg, so wird übereinstimmend berichtet, habe sich außer dem Offiziersrevolver auch ein Totenschädel befunden, mit dem er mitunter sogar Zwiesprache hielt. Ich zitiere: »Manchmal brenne ich förmlich darauf, einen Sterbenden zu sehen und ihn dabei zu beobachten, wenn er seine letzten Atemzüge tut. Das Merkwürdige dabei ist, dass von allen Personen, die ich sterben sah, jede anders aus dem Leben geschieden ist. Was mich betrifft, ziehe ich einen Schuss in die Schläfe bei Weitem vor. Ein kurzer Handgriff, und es ist vorbei.«
Genau das waren seine Worte gewesen, nicht nur mir gegenüber.
Worte, die von niemandem ernst genommen wurden.
Es tat weh, ihn so zu sehen. In der Blüte seiner Jahre, gerade einmal 30, schlank, vollbärtig und hochgewachsen, zu Lebzeiten ein Mensch, der über eine ungewöhnliche Aura und den sprichwörtlichen Wiener Charme verfügte, mit dem er seine Mitmenschen, allen voran solche weiblichen Geschlechts, in den Bann zu ziehen verstand. Ein Charakterzug, der nicht ohne Folgen blieb. Auch und gerade, was Rudolfs Gesundheit betraf. An galanten Krankheiten, das kann ich aus langjähriger Erfahrung bestätigen, herrschte beim Kronprinzen von Österreich kein Mangel. Halbseidene Damen hatten es ihm seit jeher angetan, der Grund, weshalb Rudolf, wiewohl bereits verheiratet, drei Jahre vor Mayerling an Gonorrhoe erkrankte. Ob Quecksilberkuren das richtige Mittel waren, um den Thronfolger dauerhaft zu kurieren, wage ich indessen zu bezweifeln. Tatsache ist, Rudolf ergriff die Flucht nach vorn, wie er mit sarkastischem Timbre bemerkte, machte die Nächte zum Tag und betrank sich, am liebsten mit Champagner und Kognak, was seinen Verfall umso mehr beschleunigte. Damit nicht genug, kamen Morphium und Kokain hinzu, eine Mixtur, die selbst hartgesottene Naturen in den Ruin getrieben hätte.
Morphium, Alkohol und Frauen, so lautete seine Marschroute, was, wie ich meine, den kaiserlichen Hoheiten nicht entgangen sein dürfte. Erstaunlich genug, dass selbst der Kaiser sich weigerte, davon Notiz zu nehmen. Ein Umstand, der kein gutes Licht auf das Vater-Sohn-Verhältnis wirft. Was die Kaiserin betrifft, neigte auch sie dazu, die Augen vor der Realität zu verschließen, eine Egozentrikerin von hohen Gnaden, wenn die Bemerkung des Menschenkenners gestattet ist. Ihre jüngste Tochter war und blieb nun mal ihr Augapfel. Kein Wunder also, dass Rudolf rotsah, wenn die Rede auf Marie Valerie kam.
Drei Frauen, drei Gegenspielerinnen, die eigene Ehefrau an vorderster Front: Was seine unmittelbare Umgebung betraf, hatte Rudolf nichts zu lachen gehabt. Eine Tatsache, an der er indes nicht unschuldig war. Wie sehr Kronprinzessin Stephanie, Tochter Leopolds II. von Belgien, unter seiner Untreue litt, entzieht sich zwar meiner Kenntnis. Dass es aber für böses Blut sorgt, wenn man seine Frau mit Gonorrhoe infiziert, liegt ja wohl auf der Hand.
Wechselnde Liebschaften, Alkohol und Drogen, so auch Morphium in hoher Dosierung: Wen wunderte es da, wenn das Folgen hatte. Frühzeitiges Altern war nur eine davon, hinzu kamen Schlafstörungen, permanente Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit. Krass ausgedrückt, es gab Tage, an denen Rudolf aussah wie der Tod.
Aber lassen wir das.
Anderes Thema.
Nicht etwa, dass ich allwissend bin. Oder dass ich mich für unfehlbar halte. Gegen Allüren, die man den Angehörigen meiner Profession gern nachsagt, war und bin ich immer noch immun. Dessen ungeachtet ließ die Recherche nur ein Fazit zu, allen anderslautenden Hypothesen zum Trotz.
Und zwar das nun folgende: Nach eingehender Prüfung stand für mich fest, dass Rudolf zuerst seine Geliebte erschoss und im Anschluss Suizid beging, nicht etwa binnen Minuten, wie sich beim Beschau der 17-Jährigen herausstellte. Hundertprozentig sicher war ich mir zwar nicht, aber was die Merkmale der Totenstarre betraf, befand sich der Kronprinz Mary gegenüber im Rückstand, will heißen: Nachdem er seine Geliebte getötet hatte, muss er noch längere Zeit mit sich gerungen und gezögert haben, den Entschluss zum Selbstmord in die Tat umzusetzen. Ich persönlich würde von einer Differenz von drei Stunden ausgehen, wenn nicht gar von vier.
Was den genauen Hergang betrifft, möchte ich mich nicht festlegen. Tatsache ist jedoch, Marys Tod erfolgte durch Fremdeinwirkung. Der Einschuss fand an der linken Schläfe statt, wobei sich das Austrittsloch des Projektils am rechten Ohr befand. Bei genauerem Hinsehen konnte ich feststellen, dass die Haare neben dem Ohr leicht angesengt wurden, verursacht durch die Hitze des Mündungsfeuers, Indiz für einen Schuss aus nächster Nähe. Da keinerlei Kampfspuren oder Verletzungen zu erkennen waren, die auf ein Handgemenge hindeuteten, war weiterhin davon auszugehen, dass sich die Getötete nicht zur Wehr setzte. Die Tat erfolgte also im Einvernehmen, so bizarr die Vorstellung auch anmuten mag.
Daraus ergibt sich folgendes Fazit, mangels Instrumentarium aus der Pathologie jedoch ohne Gewähr: Während Mary Vetsera auf der linken Bettkante sitzt, stellt sich Rudolf unmittelbar neben sie hin, zückt den Revolver und zielt auf die linke Schläfe, die nur um Haaresbreite von der Mündung entfernt ist.
Dann drückt er ab.
Das Projektil durchschlägt den Schädel und dringt in den rechts vom Bett befindlichen Nachttisch ein. Die Baronesse ist tödlich getroffen, fällt seitlich nach hinten und wird von ihrem Liebhaber nach links gelegt.
Respektive von ihrem Mörder.
Erst Stunden später rappelt sich der Kronprinz auf, setzt sich auf die rechte Bettkante, den Armeerevolver in der Hand. Um sicherzugehen, den richtigen Einschusswinkel zu erwischen, benutzt er dabei einen Handspiegel, der sich in seiner Linken befindet.
Dann drückt er abermals ab.
Wie nicht anders zu erwarten, dringt das Projektil in die rechte Schläfe ein, durchschlägt den Schädel und bleibt nach dem Austritt in der Mauer stecken.
Der Kronprinz liegt entseelt auf dem Bett.
Todeszeitpunkt 6.10 Uhr, vor siebeneinhalb Stunden.
»Sie haben zwei Schüsse gehört, habe ich Sie da richtig verstanden?«
»Aber natürlich, wo denken Sie hin«, setzte sich Loschek vehement zur Wehr, rang nach Luft, als sei er am Ersticken, und fingerte einen Zettel aus der Uniformjacke hervor. »Hier, nehmen Sie. Ich denke, damit erübrigen sich sämtliche Fragen.«
»Und wo haben Sie ihn her?«
»Er lag auf dem Nachttisch«, antwortete Loschek bedrückt, drückte mir die Notiz in die Hand und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht. »Sein letzter Wille, kurz vor seinem Tod zu Papier gebracht.«
»Den man ihm nicht erfüllen wird, so viel steht fest.« Jetzt war ich es, dem es schwerfiel, Haltung zu bewahren. Um zu begreifen, was da stand, musste ich den Text gleich mehrfach lesen. Der Schrift nach zu urteilen, die ich auf Anhieb wiedererkannte, war die Abfassung in großer Hast erfolgt, als laufe dem Verfasser die Zeit davon: »Lieber Loschek«, war auf dem Bogen mit dem Stempelaufdruck des Jagdschlosses zu lesen, »holen Sie einen Geistlichen und lassen Sie uns in einem Grab im Kloster Heiligenkreuz beisetzen. Die Pretiosen meiner teuren Mary nebst Brief von ihr überbringen Sie der Mutter Marys. Ich danke Ihnen für Ihre jederzeit so treuen und aufopferungsvollen Dienste. Den Brief an meine Frau lassen Sie ihr auf kürzestem Wege zukommen.«
Ein Abschiedsbrief an seine Frau.
Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet.
Vor allem, die Ehe hatte nur noch auf dem Papier Bestand. Toute Vienne wusste darüber Bescheid. Nun gut, anfangs sah es danach aus, als hätten sich die beiden zusammengerauft. Speziell nach der Geburt ihrer Tochter, an der Rudolf mit jeder Faser hing. Doch damit war es längst vorbei. Kaum unter der Haube, ging er beim Heurigen ein und aus, verkehrte mit Fiakern, Müßiggängern und Ganoven. Oder trieb sich in halbseidenen Etablissements herum, besonders häufig im Salon von Madame Wolf, einem Bordell für gehobene Ansprüche – und für Leute, die mit Geld nur so um sich warfen.
Dass sich Stephanie den Affront nicht bieten ließ und es deshalb immer öfter zu Disputen kam, verwundert indessen kaum. Tragisch nur, dass sich die Wertschätzung für die Betrogene in Grenzen hielt, auch und vor allem bei der Kaiserin. Aus ihrer Antipathie hatte sie nie einen Hehl gemacht und besaß auch keine Hemmungen, ihre Schwiegertochter vor anderen als »Trampeltier« zu bezeichnen. Der Kaiser hingegen tat genau das, was er auch sonst in heiklen Situationen machte: Er schaltete auf Durchzug. Dass er über Rudolfs Eskapaden Bescheid wusste, davon gehe ich jedoch aus. Denn wozu gab es schließlich die Personenschützer, allesamt Polizeiagenten, die ihn rund um die Uhr im Auge behielten. Egal wo, ob im Bordell oder beim Heurigen, Eskapaden aller Art mit eingeschlossen. Offiziell handelte es sich zwar um Leibwächter, aber wer sich damit auskennt, weiß, dass die Regierung nichts dem Zufall überließ, an ihrer Spitze Graf Eduard Taafe, Ministerpräsident, Duzfreund des Kaisers und Rudolfs erbittertster Widersacher. Ihm allein war es zu verdanken, dass der Kaiser auf Distanz zu Rudolf ging, so er ihm denn jemals nahestand. Prosaisch ausgedrückt: Franz Joseph traute seinem Sohn nicht über den Weg, weder politisch noch anderweitig. Was die Kaiserin betraf, sie lebte in ihrer eigenen Welt, auf der Flucht vor den Vorboten des Alters, vor denen sie eine Heidenangst hatte.
»Fragt sich, was man davon halten soll«, murmelte ich stirnrunzelnd vor mich hin, steckte den Zettel ein und hatte Mühe, die Fassung zu bewahren. Der Mief im Raum, ein Gemisch aus Leichengeruch, Kerzenrauch, verbrauchter Luft und Schweißdunst, tat ein Übriges, um meine Beklommenheit noch zu steigern. Nichts lieber, als auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden, gerade so, als ließe einen der Anblick kalt.
Dem war jedoch nicht so. Der Tod der beiden Weltflüchtigen ging mir nah, den Erkenntnissen vor Ort zum Trotz. Umso mehr, da mir bewusst war, wie der Hof auf die Tragödie reagieren würde. Die Verantwortlichen würden einen Teufel tun, dem letzten Willen des Paares zu entsprechen, allen voran der Kaiser, dem das Ansehen der Familie über alles ging. Das Ziel lautete, den sich anbahnenden Skandal zu vertuschen, koste es, was es wolle, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.
Endstation Kapuzinergruft, etwas anderes käme für den Kaiser nicht infrage.
Und Mary?
An das, was mit ihrem Leichnam geschehen würde, wollte ich jetzt lieber nicht denken.
»Und da wäre noch etwas.«
Aus den Gedanken gerissen, sah ich Loschek aus dem Augenwinkel an.
»Nämlich ihre Abschiedsbriefe«, fügte der Adlatus des Kronprinzen hinzu, überreichte mir eine schwarze Ledermappe, auf der sich die Initialen »HV« befanden, und vollendete mit halblautem Raunen: »Die Abkürzung steht für den Namen ihrer Mutter. Sie heißt Helene.«
»Ich weiß. Die Dame ist mir vom Sehen bekannt. Versteht es blendend, sich in Szene zu setzen.« Ein flaues Gefühl im Magen, nahm ich die Mappe mit dem Aufdruck in Empfang, klappte sie auf und entnahm ihr ein versiegeltes Kuvert, wie der Notizzettel auf dem Nachttisch mit einem Aufdruck versehen. »Wie dem auch sei, eine unüberlegte Tat sieht anders aus.«
Der Kammerdiener nickte stumm.
»Eins freilich gibt mir zu denken.«
»Und das wäre, Herr Doktor?«
»Gegenfrage: Finden Sie es nicht merkwürdig, dass Rudolf an seine Frau schrieb, um Adieu zu sagen? Nach allem, was zwischen den beiden vorgefallen ist? An Personen, die ihm wirklich etwas bedeutet haben, hat ja weiß Gott kein Mangel geherrscht.«
»Mitnichten«, erklärte mein Gegenüber lapidar, zog einen Schlüssel hervor, um das Geheimfach von Rudolfs Schreibsekretär zu öffnen, und förderte ein versiegeltes Konvolut zutage. »Hier, Herr Doktor: die Briefe an seine Mutter, an seine Schwester Valerie, an Baron Hirsch, einen Freund des Hauses, sowie an Szögyény-Marich, einen Freund und engen Vertrauten. Und das Schreiben an die künftige Witwe, wenn ich das mal so sagen darf.«
»Macht zusammen fünf.«
»Sechs, um ganz ehrlich zu sein. Es ist nämlich auch ein Brief an die Kaspar dabei.«
Mizzi Kaspar, die Grande Cocotte von Wien.
Wie konnte ich sie nur vergessen.
Um ihre Gunst zu gewinnen, so der Tratsch hinter vorgehaltener Hand, habe sich der Kronprinz in tiefe Schulden gestürzt. Da traf es sich recht gut, dass Baron Hirsch, Duzfreund und schwerreicher Bankier, nicht zögerte, Rudolf aus der finanziellen Patsche zu helfen. Wann genau die Affäre mit der Salonprostituierten begann, darüber kann ich zwar nur mutmaßen, dass Rudolf jedoch Unsummen auf den Tisch blätterte, um sich die bei Madame W. in der Pilgramgasse beschäftigte Soubrette gewogen zu machen, entspricht den Tatsachen. Nur ein Beispiel unter vielen: Dank der Zuwendungen des Kronprinzen war die Kaspar in der Lage, ein dreistöckiges Haus auf der Wieden zu ergattern, zum Kaufpreis von 60.000 Gulden. Mithin eine ansehnliche Summe, auch für mich, der ich aus dem Vollen schöpfen konnte. Wie praktisch, dass es sich mitten im 4. Bezirk befand, genauer gesagt in der Heumühlgasse 10, per Fiaker von der Hofburg in Kürze zu erreichen.
Dass es vor dem Liebesnest vor Naderern nur so wimmelte, und das rund um die Uhr, versteht sich beinahe von selbst. Wovon Rudolf indessen nichts ahnte, war, dass die Kaspar längst nicht so diskret agierte, wie sie ihm gegenüber vorgab. Wie sonst wäre das Sicherheitsbüro an Details gekommen, die es befähigten, sein Intimleben auszuschnüffeln. Hatte Rudolf doch nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr er mit seinem Dasein haderte – und dass er nichts lieber täte, als sich zu absentieren.
Apropos: Wie ich erst Monate später erfuhr, hielt sich Rudolf auch vorgestern bei Mizzi auf, verlässlichen Quellen zufolge bis drei Uhr morgens, um sich im Anschluss mit Mary nach Mayerling zu begeben. Nicht genug damit, erteilte er die Anweisung, die Kaspar mit 30.000 Gulden zu bedenken, auszuzahlen nach seinem Tod, als Dank für die »geleisteten Dienste«.
Da fällt mir gerade ein: Als unentbehrlich, weil verschwiegen wie ein Grab, hatte sich ein gewisser Bratfisch erwiesen. Vorname Josef, geboren in Wien und Fiaker von Beruf. Sowie Sänger in einschlägigen Lokalen, zumeist beim Heurigen. Soweit ich weiß, war er Rudolf bei einem Zechgelage begegnet, zusammen mit einem gewissen Hans Schrammel, Mitglied des gleichnamigen Quartetts. Begeistert von dessen Sangeskünsten, fasste der Kronprinz den Entschluss, Bratfisch zu seinem Leibfiaker zu ernennen. Mit der Zeit wurde eine Art Freundschaft daraus, in deren Verlauf es zu manch zünftiger Jause kam, auch im Beisein von Mizzi Kaspar, die von Liptauer nicht genug bekommen konnte.
Doch zurück zum Thema. Als Leibfiaker hatte Bratfisch die Aufgabe, die Vetsera zum Rendezvous mit dem Kronprinzen zu chauffieren. So auch vorgestern, wie ich aus berufenem Munde erfuhr. Vom vereinbarten Treffpunkt, der Marokkanergasse im 3. Bezirk, ging es weiter zum Roten Stadl, einem Gasthof vor den Toren Wiens – und von dort aus direkt nach Mayerling. Erst gestern noch, so ein Gewährsmann im Präsidium am Schottenring, sei Bratfisch von Rudolf gebeten worden, ihm im Beisein von Mary ein paar Lieder vorzutragen.
Soweit die Informationen aus erster Hand. Um wen es sich handelt, tut nichts zur Sache.
Wirklich geliebt, das hat sich im Nachhinein erwiesen, hat Rudolf die Vetsera nicht. So schwer es mir fällt, dies auszusprechen, die Wahrheit muss auf den Tisch. Mag sein, Rudolf sehnte den Tod herbei, aber ihm mutterseelenallein ins Auge zu blicken, dazu besaß er nicht den Mut. Mary Vetsera kam ihm da gerade recht, bereit, ihr Schicksal mit dem seinigen zu teilen.
Ein Wunsch, den die Kaspar von sich wies, mit Wissen des hiesigen Polizeipräsidenten. Baron Krauss unterließ es jedoch, die nötigen Schritte zu ergreifen, mit welchen Folgen, wurde binnen Kurzem klar.
Wie gesagt: Was seine Liebschaften betrifft, rangierte die Soubrette an erster Stelle, längst nicht mehr nur Maitresse, sondern Vertraute und Ersatz für eine Mutter, mit der er zeitlebens nicht richtig warm geworden war. Von seinem Vater, der ihn für unwürdig hielt, sein Nachfolger zu sein, nicht zu reden.
»Ein Brief an die Kaspar, sagen Sie?«, erwiderte ich zerstreut, kaum mehr imstande, mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren. »Die stadtbekannte Prostituierte?«
Loschek nickte.
»Wenn wir gerade von den Abschiedsbriefen reden«, spann ich den Gedanken beharrlich fort, den Blick auf das verschnürte Bündel gerichtet, das ich mit nachdenklichem Blick betrachtete. Und fügte nach einem Verlegenheitsräuspern hinzu: »Sind Sie sich sicher, dass das Konvolut hier vollständig ist?«
»Absolut«, bekräftigte Loschek, heftete den Blick auf Rudolfs Leichnam und kämpfte dabei mit den Tränen. »Um Ihre Frage vorwegzunehmen, Herr Doktor: Von einem Brief an den Kaiser weiß ich nichts. Hätte mich auch gewundert, wenn Seine Hoheit einen geschrieben hätte – nach allem, was zwischen den beiden vorgefallen ist!«
3
Arbeitszimmer des Kaisers in der Hofburg, Donnerstag, 31. Jänner 1889, 7.00 Uhr
»Und wenn Sie sich nun irren, Widerhofer – was dann?«
Da saß er nun, um Haltung bemüht, nur mehr ein Schatten früherer Tage. Und weigerte sich, der Wahrheit ins Auge zu blicken. »Auch ein Leibarzt macht mal Fehler, das wissen Sie so gut wie ich.«
Es zerriss mir das Herz, den Kaiser so zu sehen. Egal, was zwischen den beiden vorgefallen war, das hatte der Mann nicht verdient.
Kein Vater der Welt hatte das verdient.
»Ich wünschte, dem wäre so, Majestät«, antwortete ich mit Bedacht, entschlossen, nichts zu beschönigen. Als Arzt hatte ich die Pflicht, die Dinge beim Namen zu nennen, so sehr mir die Tragödie auch naheging. »Aber nach allem, was ich weiß, ist an der Sachlage nicht zu rütteln. Die Indizien sprechen für sich. So schwer es mir fällt, es offen auszusprechen: Der durchlauchtigste Kronprinz hat Suizid begangen. Allem Anschein nach mithilfe seiner Dienstwaffe, einem Infanterieoffizier-Revolver vom Typ Gasser-Kropatschek, Kaliber neun Millimeter. Wie Eurer Majestät bekannt sein dürfte, wurde ihm die Waffe in Prag übergeben. Am Beginn seiner Dienstzeit beim Infanterieregiment Nr. 36. Sie verblieb in seinem Besitz, wie bei höheren Dienstgraden üblich.«
»Ich nehme an, der Revolver wurde konfisziert?«
Ich nickte.
»Dann sorgen Sie dafür, dass er mir ausgehändigt wird – und zwar unverzüglich«, forderte mich der Kaiser im Befehlston auf, für einen Moment wieder ganz der Alte, nur um im Anschluss umso tiefer in Apathie zu versinken. »Was in Mayerling passiert ist, muss unter uns bleiben, nicht auszudenken, wenn etwas durchsickert.«
»Fragt sich, wie das zu bewerkstelligen ist.« Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm ich meine Aktentasche zur Hand, ließ den Verschluss aufschnappen und griff hinein. Zum Vorschein kam ein sorgsam umwickelter Gegenstand, Gewicht circa 750 Gramm, das Corpus Delicti schlechthin. »Wenn Euer Majestät geruhen würden, einen Blick darauf zu werfen. Hier ist er.«
Der Kaiser zögerte, die Hände um die Kante seines Schreibtischs gekrallt, ein herzerweichendes Bild des Jammers. Dann riss er die rechte Schublade auf, streckte die Hand aus und nahm den Revolver in Empfang. Ein leichter Schubs, und die Tatwaffe entschwand meinen Augen.
Um zu seinen Lebzeiten nicht mehr aufzutauchen.
Dass damit eine Grenze überschritten wurde, war uns beiden klar. Fortan ging es nicht nur darum, einen Skandal zu vertuschen, sondern um die Frage, ob ein Mord vorlag. Was mich betraf, gab es am Tatbestand nichts zu rütteln, weder aus juristischer noch aus medizinischer Sicht. Als Rudolf zur Waffe griff, um Mary Vetsera zu töten – sprich: um einen sorgsam ausgeklügelten Mord zu begehen –, konnte von einer Affekthandlung nicht die Rede sein. Weiterhin galt es festzuhalten: Laut Loschek habe Rudolf normal gewirkt, er sei, so die exakte Wortwahl, »sogar regelrecht vergnügt« gewesen, im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, und das unmittelbar vor der Tat.
Vermindert schuldfähig, da geistig verwirrt?
Nie und nimmer.
Wenn überhaupt, dann depressiv. Ein Umstand, der seiner Umgebung – Vater und Mutter mit einbezogen – trotz Scheuklappen nicht entgangen sein dürfte.
»Und dann wären da noch seine Abschiedsbriefe«, ergriff ich beherzt das Wort, zog ein verschnürtes Bündel hervor und drückte es dem Kaiser in die Hand. »Ich habe mir erlaubt, sie in Verwahrung zu nehmen. Damit sie nicht in die falschen Hände gelangen.«
»Wie ich sehe, kann man sich auf Sie verlassen«, wurde mir unerwartetes Lob zuteil, während der Kaiser das Konvolut in Augenschein nahm. »Und an wen sind sie gerichtet?«
Ich zögerte.
»Mich kann nichts mehr erschüttern, machen Sie sich da mal keine Sorgen«, versetzte der aschfahle Monarch, legte das Bündel auf den Schreibtisch und sah mich an. »Ich kann mir schon denken, was jetzt kommt, wir beide hatten ja nicht viel gemeinsam.«
Nicht viel gemeinsam.
So konnte man es natürlich auch formulieren.
In Wahrheit waren sie sich spinnefeind gewesen, und das seit geraumer Zeit. Der Kronprinz habe nicht das Zeug dazu, sein Nachfolger zu sein, so der Kaiser im vertraulichen Gespräch. Und das gleich mehrfach, auch mir gegenüber.
Deutlicher konnte man sein Missfallen nicht zum Ausdruck bringen. »Nun reden Sie schon, Widerhofer – an wen hat er alles geschrieben?«
»An insgesamt sechs Personen, so wurde mir von Loschek berichtet«, unternahm ich den Versuch, die Klippe, auf die das Gespräch zusteuerte, zu umschiffen. »Unter anderem an seine Frau.«
»Und an wen noch?«
»Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, befindet sich auch ein Brief an …«
»Weichen Sie mir nicht aus, ich möchte die Wahrheit erfahren!«, fiel mir der Kaiser gereizt ins Wort, umklammerte die Lehne seines Stuhls und blitzte mich aus dem Augenwinkel an. »Ich nehme an, seine Mutter war ihm die Mühe wert?«
Ich bejahte schweigend.
»Und seine Geschwister, was ist mit denen?«
»Schenkt man dem Kammerdiener Glauben«, zog ich es vor, meine Hinhaltetaktik zu beenden, holte tief Luft und deutete mit dem Zeigefinger auf den Stapel, »so befindet sich ein Brief an Erzherzogin Valerie darunter, des Weiteren eine Nachricht an Baron Hirsch sowie an den Sektionschef im Ministerium des Äußeren.«
»Macht zusammen fünf.«
»So ist es, Majestät.«
»Mit anderen Worten, ich komme am Schluss.«