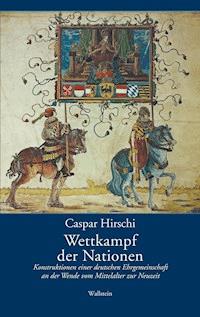Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Wort der Wissenschaft hat in der Öffentlichkeit Gewicht. Umso attraktiver ist es für demokratisch gewählte Politiker, sich bei ihren Entscheidungen auf Experten zu berufen. Experten erhalten dadurch eine privilegierte Position in der Gesellschaft, und es mehren sich Stimmen, die vor dem Umkippen der Demokratie in eine "Expertokratie" warnen. Die Auswirkungen für die Wissenschaft finden dabei kaum Beachtung. Ihre Vertreter eignen sich als Skandalfiguren, an denen sich der Volkszorn abreagieren und die Politik schadlos halten kann – eine Entwicklung, die für die ganze Wissenschaft, gerade in antielitären Zeiten, zur Gefahr zu werden droht. In seiner großen Untersuchung rekonstruiert Caspar Hirschi die Geburt des Experten im Frankreich Ludwigs XIV. und veranschaulicht an faszinierenden "Expertenskandalen" aus Geschichte und Gegenwart, welche Risiken eine an politischen Interessen ausgerichtete Wissenschaft eingeht. Eine brisante Analyse mit wissenschaftspolitischer Sprengkraft und ein wichtiger Baustein für die Selbstkritik einer Wissenschaft, deren Vertreter den Platz am Tisch der Entscheider der Rolle des öffentlichen Kritikers immer häufiger vorziehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CASPAR HIRSCHI
Skandalexperten,
Expertenskandale
Zur Geschichte eines Gegenwartsproblems
Inhalt
Einleitung: Der Traum der Wissensgesellschaft
IAufstieg und Fall eines drogenpolitischen Technokraten
IIDie Geburt des Experten im Gericht
IIIDer animalische Magnetismus vor dem Expertentribunal
IVMord oder Selbstmord? Experten in der Affaire Calas
VDie Affaire Dreyfus als Expertenskandal
VIDas Expertenbeben von L’Aquila
Schluss: Die Disziplinierung der Wissenschaft
Anmerkungen
Abbildungsnachweise
Dank
für Göttiandi,le critique supérieur
Einleitung
Der Traum der Wissensgesellschaft
Ein guter Historiker wird man nicht, indem man die Gegenwart aus seinem Geist tilgt, ganz im Gegenteil.
PIERRE BOURDIEU, Manet. Eine symbolische Revolution (2015)
Als der Kalte Krieg ein Ende fand und das World Wide Web am Anfang stand, brach eine kurze Zeit zum Träumen an. Es waren nur ein paar Jahre, aber das reichte für agile Denker, um prächtige Luftschlösser einer neuen Welt- und Wissensordnung zu entwerfen. Spätestens 2001 wurden die Traumgebäude weggefegt. Sie hielten den symbolischen Druckwellen, die der Einsturz des World Trade Centers ausgelöst hatte, nicht stand. Das Erwachen aber war hart, und es dauerte lange. Bis heute klammern wir uns an einzelnen Traumfetzen fest, nur um der grauen Wirklichkeit nicht ins Gesicht schauen zu müssen.
Zu den Träumen aus den 1990er-Jahren gehört die Vorstellung, wir lebten in einer Wissensgesellschaft. Sie steht für das Versprechen einer Welt, in der Information über Ideologie und Ignoranz triumphiert, vermittelt durch Experten, die sie in immer höherer Quantität und Qualität zur Verfügung stellen. Was der Ritter für die Feudalgesellschaft, der Entdecker für die Kolonialgesellschaft und der Fabrikant für die Industriegesellschaft war, sollte der Experte für die Wissensgesellschaft sein: Vorreiter eines neuen, hochgebildeten Menschenschlags, der dank seiner Kompetenz in der Politik den Konsens herbeiführt und in der Wirtschaft die Effizienz erhöht. Wenn Wissen der wichtigste Rohstoff der Zukunft sein sollte, wie es eine ebenso einprägsame wie schiefe Analogie wollte, so würden Experten die erfolgreichsten Rohstoffhändler der Welt werden.
Hätte es eines letzten Beweises bedurft, dass der Traum der Wissensgesellschaft geplatzt ist, so haben ihn der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union und der Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus erbracht. Nicht weil in beiden Ereignissen die Ignoranz über das Wissen triumphiert hätte, wie es aus manchen Kommentaren der ersten Stunde herausklang. Was den Brexit-Entscheid und die Trump-Wahl zu Akten der Illusionszerstörung machte, war die Art und Weise, wie sie im Vorfeld eingeordnet worden waren. Die Bürgerinnen und Bürger wussten um die kapitale Bedeutung der anstehenden Entscheidung, die Massenmedien berichteten rund um die Uhr über den Stand des Rennens, und viele Experten von Rang und Namen bezogen in seltener Geschlossenheit und Entschiedenheit Stellung: Sie sprachen sich für den Verbleib Großbritanniens in der EU und für die Wahl Hillary Clintons zur amerikanischen Präsidentin aus. Das Brexit- und Trump-Lager versuchte, aus der Not eine Tugend zu machen, spielte die Experten gegen das Volk aus und erntete empörte Reaktionen. In den Medien dominierte die Erwartung, die Bürger würden der Stimme der Wissenschaft, wenn sie so laut und eindeutig erklang, am Ende schon folgen. Und beide Male verkündeten die letzten Prognosen demoskopischer Experten, dass alles den erwarteten Lauf nehmen würde. Als es dann anders kam, war die politische Erschütterung umso größer. Die beiden ältesten Demokratien der Welt haben nicht nur schwerwiegende Entscheidungen mit ungewissem Ausgang für die ganze Welt getroffen, sie haben den Glauben an eine von Expertenwissen angeleitete Politik aufgekündigt.
Seither zeigt sich weit über Großbritannien und die Vereinigten Staaten hinaus in aller Deutlichkeit, was sich schon lange abgezeichnet hat: Mit dem Internetzeitalter ist keine expertenbasierte Konsensdemokratie entstanden, in der ein informierter Pragmatismus den Platz der ideologischen Konfrontation einnimmt. Eher ist das Gegenteil eingetreten. Die Polarisierung hat zugenommen, politische Extremisten und religiöse Fundamentalisten treiben die etablierten Parteien vor sich her, das Internet erleichtert die Verbreitung von Propagandalügen und Fehlinformationen, und wissenschaftliche Experten sehen sich als Komplizen einer »korrupten« Elite im Kreuzfeuer.
Wie schnell sich das Blatt gewendet hat, zeigen Bemühungen von staatlichen Behörden, den wissenschaftlichen Anteil an der eigenen Arbeit sprachlich zum Verschwinden zu bringen. 2017 erwog das Gesundheitsministerium der Vereinigten Staaten, in Budgetdiskussionen mit dem Kongress auf Begriffe wie »evidence-based« oder »science-based« zu verzichten, in der Annahme, dadurch eher Unterstützung von den republikanischen Mehrheiten in beiden Parlamentskammern zu erhalten.1
Was ist das für eine Welt, in der die Wissenschaft zur politischen Hypothek und der Experte zum populären Hassobjekt wird, und wie ist sie entstanden? Zeitdiagnostiker haben rasch eine Antwort gefunden, in der sich der Traum der Wissensgesellschaft ins Gegenteil verkehrt, den Albtraum einer demokratisch verbrämten Herrschaft der Dummen. Das meistbeachtete Buch zum Thema ist The Death of Expertise des amerikanischen Politikwissenschaftlers Tom Nichols.2 Es wurde begeistert aufgenommen und schon kurz nach dem Erscheinen in elf Sprachen übersetzt. Nichols diagnostiziert eine »umgekehrte Evolution«, weg von »geprüftem Wissen« hin zu »Volksweisheiten und Mythen«, wobei diese nicht mehr von Mund zu Mund, sondern über elektronische Medien verbreitet würden. Der Tod der Expertise komme in Gestalt eines »von Google angetriebenen, auf Wikipedia beruhenden und von Blogs durchtränkten Kollapses jeder Trennung zwischen Profis und Laien, Studenten und Lehrern, Wissenden und Staunenden – mit anderen Worten, jenen mit einem klaren Leistungsausweis auf einem Gebiet und jenen mit gar keinem«. Wer zu letzteren gehöre, könne umso ungehemmter die eigene Ignoranz zum Ausdruck der individuellen Selbstbestimmung verklären, Gefühlen den Vorzug vor Tatsachen geben und sich in »fast kindlicher« Weise auch nur dem Einmaleins politischer Prozesse verweigern. Die amerikanische Öffentlichkeit, konstatiert Nichols, sei nicht mehr imstande, wissenschaftliche Experten von politischen Entscheidungsträgern zu unterscheiden, und deshalb umso mehr geneigt, beiden alles Mögliche anzulasten. In Donald Trumps Wahl sieht Nichols eines der jüngsten und lautesten Signale, »die den bevorstehenden Tod der Expertise ankündigen« – und mit ihm das baldige Ende der Demokratie.3
Nichols’ Zeitdiagnose ist deprimierend für die Menschheit, aber tröstlich für die Wissenschaft. Wenn wir es mit einer Evolution rückwärts zu tun haben, die vom Internet befeuert wird und wegen der »Faulheit der Öffentlichkeit« kaum aufzuhalten ist, dann fallen Experten einer Entwicklung zum Opfer, für die sie keine Verantwortung tragen und an der sie nichts Wesentliches ändern können. Was ihnen bleibt, ist das einsame Rufen in der Wüste oder, wozu der von Nichols zitierte Publizist James Traub nach dem Brexit appelliert hat, der heroische »Aufstand gegen die ignoranten Massen«.4 Zwar widmet Nichols den Fehlern von Experten ein ganzes Kapitel, aber was er darin an Versäumnissen, Fehleinschätzungen und Selbstüberschätzungen von Kollegen anführt, erscheint als nachgeordneter Problemzusammenhang, dessen Ursachen wissenschaftsintern gelöst werden könnten. Der Wissenschaftsjournalist Mathias Plüss, der Nichols’ Buch im Magazin des Schweizerischen Nationalfonds vorgestellt hat, gibt dessen Tenor treffend wieder, wenn er seine Leserinnen und Leser beschwichtigt, die »gegenwärtige Expertenkrise« sei »keine eigentliche Wissenschaftskrise«.5 Wenn dem so ist, kann man getrost zur eigenen Forschung und zur Tagesordnung zurückkehren.
Wer heute die Apokalypse der Expertise ausruft, ist genauso wirklichkeitsfremd wie die Propheten, die vor dreißig Jahren die Ankunft der Wissensgesellschaft verkündet haben. Was Experten derzeit widerfährt, ist kein Tod auf Raten, verschuldet durch die digital verdorbenen Massen der Dummen und Faulen, sondern ein medial inszeniertes Degradierungsritual. Degradiert werden kann aber nur, wer zuvor privilegiert worden ist. Genau deswegen gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Expertenkult der jüngeren Vergangenheit und der Expertenschelte der Gegenwart. Die Geschichte ist reich an Überhöhungen und Erniedrigungen von Experten, und oft lagen beide nahe beieinander. Während aber das Drama früher auf konkrete Auseinandersetzungen mit spezifischen Spezialisten bezogen war, hat es heute eine generalisierende Dynamik angenommen, die grundsätzlich neu ist. Brexiteers und Trumpisten haben diese Dynamik nicht entfacht, sondern aufgenommen und in die ihnen nützliche Richtung gelenkt. Entstanden ist sie schon früher, spätestens mit der pauschalen Überhöhung von Experten zu privilegierten Bewohnern der Wissensgesellschaft. Da die Wissenschaftler an dieser Überhöhung mitgewirkt haben, tragen sie nun auch einen Teil der Verantwortung am Gegenwind, der ihnen ins Gesicht bläst. Wollen wir aber verstehen, wie sie in die jetzige Situation geraten sind, müssen wir zuerst den Spuren nachgehen, die der Traum der Wissensgesellschaft in der politischen Realität hinterlassen hat, bevor wir die Geschichte des Experten weiter zurückverfolgen. Das soll in diesem Buch geschehen.
Experten als Wissensparlamentarier
Der Politologe Robert E. Lane, der als Begriffsschöpfer der Wissensgesellschaft gilt, hegte schon 1966 die Erwartung, die Mitglieder der »knowledgeable society« würden sich »von objektiven Standards einer verifizierbaren Wahrheit« leiten lassen und im Fall eines höheren Bildungsabschlusses sogar nach »wissenschaftlichen Regeln des Beweisens und Schlussfolgerns« handeln. In erster Linie aber versprach sich Lane von der neuen Ordnung eine Entpolitisierung der Politik: An die Stelle der »üblichen kurzfristigen politischen Kriterien« und des »ideologischen Denkens« würde die »Anwendung wissenschaftlicher Kriterien für politische Beschlüsse« treten. Im Konzept der Wissensgesellschaft lebte die Hoffnung, der Politik könne der polarisierende Parteiengeist ausgetrieben werden.6
Als die Prognose der Wissensgesellschaft in die Welt gesetzt wurde, war sie das optimistische Gegenstück zum Gespenst der Technokratie, das in den 1960er- und 70er-Jahren, bedingt durch die wissenschaftliche Aufrüstung und den technischen Planungsoptimismus beidseits des Eisernen Vorhangs, weit prominentere Autoren umtrieb.7 Technokratiekritiker wie Herbert Marcuse und Jürgen Habermas unterschieden sich von Lane nicht so sehr in der Beschreibung, umso mehr aber in der Bewertung ihrer Zukunftsvisionen. Auch sie hielten Experten für Pioniere und Profiteure einer technischen Planbarkeit von Politik, nur sahen sie in ihnen eine Gefahr für die demokratische Meinungsbildung und Mitbestimmung.8 Was den einen ein Gewinn an Rationalität, war den anderen ein Verlust an Egalität, und lange sah es aus, als hätten Letztere die Debatte gewonnen.
Während die Technokratiekritiker vor und nach 1968 den antielitären und theorieaffinen Grundton der Zeit trafen, verfehlten ihn die Anhänger der Wissensgesellschaft gleich doppelt. Sie redeten einer neuen Bildungsaristokratie das Wort und setzten mehr auf rhetorischen Effekt als auf theoretische Substanz. Tatsächlich besitzt der Begriff der Wissensgesellschaft, anders etwa als jene der Agrar-, Industrie- oder Dienstleistungsgesellschaft, die auf der gleichen kategorialen Ebene angesiedelt sind, keine Trennschärfe. Sobald man unter »Wissen« mehr versteht als reine wissenschaftliche Erkenntnis, sobald man Kategorien wie »Alltagswissen« oder »kulturelles Wissen« ins Spiel bringt, erscheint die Behauptung, eine Gesellschaft sei »wissensbasiert«, etwa so spezifisch wie die Feststellung, sie beruhe auf geschlechtlicher Fortpflanzung. Selbst Autoren, die den Begriff stark machen wollen, verstehen Wissen als »anthropologische Konstante«.9 Mit anderen Worten: Sie können sich ein Gegenstück zur Wissensgesellschaft, so etwas wie eine »Unwissens-« oder »Ignoranzgesellschaft«, gar nicht vorstellen. Damit aber beginnen die Probleme bereits bei der Frage, welche Gesellschaften nicht als Wissensgesellschaft gelten dürfen.
Es brauchte andere Zeitumstände, damit der rhetorische Wohlklang die theoretische Dürftigkeit zuzudecken vermochte. In den 1980er-Jahren ging der Technokratiekritik mangels ideologischen Rückhalts an den Universitäten und empirischer Evidenz einer Expertenherrschaft die Luft aus. In den 1990er-Jahren setzte dann die Idee der Wissensgesellschaft zum verspäteten, aber umso steileren Höhenflug an. Der Fall des Eisernen Vorhangs weckte neue Hoffnungen auf eine ideologiefreie Politik wissensbasierter Problemlösung in globaler Perspektive, und die digitale Informationsexplosion beflügelte die Erwartung eines Wissenswettbewerbs unter Experten zum Besten der Menschheit. Sollte es in Zukunft noch gesellschaftliche Bruchlinien geben, würden diese zwischen Spezialisten und Laien, Gebildeten und Ungebildeten verlaufen.
Die Regierungen westlicher Demokratien machten sich die Rede von der Wissensgesellschaft rasch zu eigen, nicht zuletzt, weil sie sich damit das Prädikat einer wissensbasierten Politik ausstellen konnten. Die Berufung auf »unabhängige« Experten wurde zum festen Bestandteil der Choreografie, mit der Regierungen ihre Beschlüsse rechtfertigten, und so entstand zu nahezu jedem Thema, das sich in medienwirksamer Weise wissenschaftlich unterfüttern ließ, eine passende Expertenkommission. 2015 hat der Politikwissenschaftler Edward Page den Versuch unternommen, die Zahl der wissenschaftlichen Beratungsgremien in staatlichem Auftrag zu ermitteln. Er kam allein für Großbritannien auf über achtzig.10 Je umstrittener ein Sachverhalt wirkte, desto attraktiver erschien die präventive Herstellung und öffentliche Inszenierung eines Expertenkonsenses. Kontroversen sollten im Keim erstickt werden, indem man eine Situation des wissenschaftlich vorgegebenen Sachzwangs kreierte.
Eine Weile lang ging die Rechnung auf. Expertenkommissionen wurden so zusammengesetzt, dass sie nach außen wie kleine Wissensparlamente wirkten, in denen alle Spezialistenmeinungen zu einem Thema vertreten waren. Ihre Beratungen waren in aller Regel vertraulich, ihre Berichte öffentlich, sodass Differenzen zwischen Experten und Politikern vor dem Erscheinen der Berichte bereinigt werden konnten und kaum Dissens an die Öffentlichkeit drang. Das Beratungsergebnis konnte anschließend als offizielle Position der Wissenschaft ausgegeben werden.
In dieses Vorgehen flossen verschiedene Vorstellungen von Wissenschaft ein, die konzeptionell unvereinbar, funktional aber stimmig sind. Während das Wissensparlament Ausdruck eines pluralistischen Wissenschaftsverständnisses ist, das sich vom Glauben an die reine Objektivität und politische Neutralität der Wissenschaft verabschiedet hat, beruht die Arbeit in diesem Parlament auf einer Parallelisierung der wissenschaftlichen mit der demokratischen Konsensfindung, als ließe sich wissenschaftlicher Dissens durch Kompromisseschmieden überwinden. Der Schlusskompromiss jedoch, der von möglichst allen »Parteien« mitzutragen ist, wird medial wieder so aufbereitet, dass der Eindruck entstehen soll, es gebe tatsächlich eine wissenschaftliche Wahrheit, die von einer neutralen Expertenelite garantiert und von den politischen Auftraggebern respektiert werde.
Diese zweckdienliche Inkonsequenz erlaubte es sogar, den »Expertenrat« erst nach dem Entscheid einzuholen, wenn dies aus Zeitdruck, Kontrollbedürfnis oder anderen Gründen opportun erschien. In offensichtlicher Weise geschah dies 2011 beim deutschen Atomausstieg, als sich die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima zu einer raschen Reaktion gezwungen sah, umso mehr, als sie vom Tsunami in Japan auf dem falschen Fuß erwischt worden war. Ein halbes Jahr zuvor hatte sie, gestützt auf drei Expertengutachten, den »Ausstieg vom Ausstieg« verkündet und die Laufzeiten deutscher Kernkraftwerke verlängert. Um nun den »Ausstieg vom Ausstieg vom Ausstieg« zu begründen, brauchte es erneut die Unterstützung von Experten, diesmal mit konträrer Empfehlung, und dazu noch post festum. Die Regierung holte Gutachten von zwei weiteren Gremien ein, darunter von einer eigens für diesen Zweck ins Leben gerufenen »Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung«, die den Tenor ihrer Stellungnahme bereits im Titel mitdiktiert bekam. Die Übung ging angesichts der ungünstigen Umstände erstaunlich glatt über die Bühne, und genau das war der Zweck des geballten Expertenaufgebots.
»Technokratie« als List der Politik
Die Aufrüstung der Expertenberatung im Namen der Wissensgesellschaft führte nicht zu einer technokratischen Durchdringung der Politik, wie es der Begriff der Expertokratie oder die Rede von wissenschaftlichen Beratungsstäben als »fünfter Gewalt« im Staat (neben der Exekutive, Legislative, Judikative und der Presse) suggeriert.11 Vielmehr verstärkte sie die politische Instrumentalisierung der Wissenschaft. Regierungen mit ungewählten Fachspezialisten an der Spitze waren in jüngerer Zeit seltene und eher kurzlebige Ausnahmen für akute Krisensituationen. Sie kamen zustande, wenn Parteipolitiker angesichts des Zwangs zu unpopulären Maßnahmen noch so gerne auf Regierungsverantwortung verzichteten, und sie hielten sich gerade so lange, bis die Krise überwunden schien und die Parteipolitiker wieder eine günstige Gelegenheit sahen, in Machtpositionen einzurücken. So erging es der italienischen Regierung unter dem Ökonomen Mario Monti und der griechischen Regierung unter seinem Fachkollegen Loukas Papademos. Beide wurden 2011 auf dem Höhepunkt der südeuropäischen Staatsschuldenkrise unter internationalem Druck eingesetzt, und beide mussten, als das Schlimmste überstanden war, wider Willen wieder abtreten. In Griechenland war es bereits nach einem halben Jahr, in Italien nach eineinhalb Jahren so weit.
Experten, die in wissenschaftlichen Beratungsorganen mitwirkten und an gewählte Regierungen mit technokratischen Erwartungen herantraten, machten ähnlich ernüchternde Erfahrungen. Fanden sie mit ihren Forderungen keine politische Unterstützung, wurden sie im besten Fall ignoriert und im schlechtesten kaltgestellt. Ersteres widerfuhr nach 2008 mehreren Ökonomen in europäischen Expertengremien, als sie aus wissenschaftlichen Modellen zwingende Maßnahmen zur Stabilisierung der Eurozone ableiteten, damit aber bei den auf Zeit spielenden Regierungen Nordeuropas auf taube Ohren stießen. Letzteres traf 2009 den englischen Psychopharmakologen David Nutt in seiner Funktion als Präsident der staatlichen Expertenkommission für Drogenkonsum, nachdem er die britische Regierung öffentlich zu einer wissenschaftlich abgestützten Drogenpolitik aufgefordert hatte: Er wurde zum Rücktritt gezwungen.
Experten erhalten durch ihre exponierte Tätigkeit in der Politik zwar mehr Verantwortung, aber es ist eine Verantwortung ohne Verfügungsgewalt, und dadurch bleiben die Profite, solange das System einigermaßen funktioniert, bei den politischen Eliten. Noch mehr als bei erfolgreichen Aktionen wie dem Atomausstieg zeigen sich die ungleichen Kräfteverhältnisse bei misslungenen Vorhaben. Sehen sich Politiker aufgrund »expertenbasierter« Entscheidungen medialer Empörung und öffentlichem Unmut ausgesetzt, geraten sie in Versuchung, die symbolische Verantwortung, die sie ihren Experten zuvor aus legitimationsförderlichen Gründen abgetreten hatten, in eine reale Schuld zu übertragen. In solchen Situationen bieten sich Experten als Blitzableiter an, und ein politischer Missstand lässt sich mit dem Argument wegerklären, die Regierung sei nicht wissensbasiert genug beraten worden. Wie schnell sich die politische Rechtfertigungslogik drehen kann, erlebten Erdbebenexperten in Italien nach der Zerstörung des Abruzzenstädtchens L’Aquila 2009, als sie für die mangelhaften Präventionsmaßnahmen der Regierung den Kopf hinhalten mussten, nachdem sie sich kurz zuvor von der gleichen Regierung als inoffizielle Pressesprecher hatten einspannen lassen.
Die Reaktionen der Scientific Community auf Skandale wie jenen um den englischen Drogenexperten und die italienischen Erdbebenexperten fielen heftig aus. Allerdings kamen sie dem Versuch gleich, den Traum der Wissensgesellschaft vor der Realität in Schutz zu bringen. Dadurch blieb das strukturelle Risiko, das die hohe Exponiertheit von Experten im politischen Betrieb für Demokratie und Wissenschaft mit sich brachte, ausgeblendet. Man hat die Gefahr erst in dem Moment erkannt, als politische Hasardeure mit explizit gegen Experten gerichteten Kampagnen Erfolge feierten, die man kurz zuvor noch für unmöglich gehalten hätte. Mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten waren es nicht nur die zwei ältesten Demokratien, sondern auch die zwei weltweit führenden Wissenschaftsnationen, in denen sich eine expertenkritische Politik zuerst auf breiter Basis durchsetzte. Vor allem in den Vereinigten Staaten wich die Empörung nun dem Entsetzen, aber dadurch wurde die Ratlosigkeit, wie der Gefahr zu begegnen sei, nur noch größer. Damit sind wir wieder beim Gegenwartsproblem angelangt, um dessen Geschichte es hier geht.
Zurück zu den Anfängen
Dieses Buch beginnt und endet in der Gegenwart. Der Hauptteil wird eingerahmt von den Fallstudien über den englischen Drogenexperten und die italienischen Erdbebenexperten, die 2009 fast zeitgleich, aber unabhänigig voneinander öffentlich degradiert wurden. Die detaillierte Rekonstruktion der beiden Fälle zeigt, dass nicht nur die Politik, sondern auch die Medien und die Wissenschaft zur Überhöhung des Experten beitragen, damit in der Öffentlichkeit unerfüllbare Erwartungen schüren und letztlich das Skandalisierungspotenzial der Rolle steigern. Die Absichten von Politikern, Journalisten und Forschern unterscheiden sich dabei so stark, wie sich die Auswirkungen auf ihren Berufsstand gleichen: Dem kurzfristigen Nutzen für einzelne Akteure steht der langfristige Schaden für die Metiers in Form eines öffentlichen Vertrauensverlusts gegenüber. Insofern stellen die Polemiken gegen »fake news«, »broken politics« und »partisan experts« unterschiedliche Symptome desselben Problemzusammenhanges dar.
Die Kapitel zwischen den Fallstudien zur Gegenwart gehen bis in die französische Monarchie des späten 17. Jahrhunderts zurück, wo die Figur des Experten erstmals eine erkennbare Gestalt angenommen hat. Es war die Zeit, als der junge Ludwig XIV. Versailles zum Zentrum einer prachtvollen Hofkultur aufbaute und sein Finanzminister Jean-Baptiste Colbert die königliche Verwaltung zum Vehikel einer raffinierten Innovationspolitik machte.12 Beide Vorgänge folgten einem strukturanalogen Muster, das in der Formalisierung offizieller Abläufe bestand. Während davon am Hof die Rituale des königlichen Zeremoniells betroffen waren, ging es in der Verwaltung um die Verfahren der administrativen Arbeit. Das formelle Festschreiben der Prozeduren erbrachte da wie dort einen Kontrollgewinn, allerdings um den Preis einer Selbstunterwerfung unter das eigene Regelwerk. Ludwig XIV. wurde durch das höfische Zeremoniell ebenso diszipliniert wie seine Hofleute, Colbert durch die administrativen Abläufe ebenso auf Effizienz getrimmt wie seine Funktionsträger.
Im Zentrum der französischen Innovationspolitik, die Colbert in den zwei Jahrzehnten seines Wirkens zwischen 1661 und 1683 angestoßen, aber längst nicht abgeschlossen hat, standen Verfahren des Sammelns, Prüfens, Verbesserns, Verwaltens und Verteilens von politisch verwertbarem Wissen. Für den Historiker Jacob Soll war Colbert ein »Information Master«, der den Ausbau der staatlichen Macht in neuer Weise mit dem Aufbau eines Informationsmonopols verband.13 Letztlich ging es bei seinen Reformen aber um mehr, nämlich um das Filtern und Umwandeln von Information in Wissen – und um dessen Weitergabe an Akteure außerhalb der Verwaltung, damit es seine Erneuerungskraft in Industrie, Handwerk, Handel und Armee entfalten konnte.14 Zu diesem Zweck griff Colbert auf bestehende Funktionsträger wie die Intendanten zurück, denen er umfassende Aufgaben in der Informationsvermittlung von der Provinz nach Paris übertrug, und er setzte neues Fachpersonal wie die Inspektoren ein, denen er den Doppelauftrag erteilte, privates Wissen über die französischen Manufakturen zu erwerben und den Manufakturen umgekehrt staatliches Wissen über neue Technologien oder Absatzmärkte zu vermitteln.15
Eine entscheidende Rolle bei der verfahrensgeleiteten Verwandlung von Information in Wissen kam Institutionen zu, in deren Betrieb Colbert nicht direkt eingreifen konnte, deren Rahmenbedingungen er aber umso stärker zu gestalten versuchte: die Gerichte und die Akademien. Hier nun trat die Figur des Experten in Erscheinung. Der Experte war, begriffs- wie rollengeschichtlich gesehen, ein Geschöpf des Gerichts. Der Befund kommt nur auf den ersten Blick überraschend: Das Gericht stand im 17. Jahrhundert wie keine andere Institution für eine verfahrensgeleitete Wahrheitsermittlung und Urteilsbegründung und stellte damit für Herrscher wie Forscher eine Orientierungsgröße ersten Ranges dar. Die Figur des Experten ist aus den von Colbert initiierten Reformen der gerichtlichen Gutachtertätigkeit hervorgegangen und avancierte in den königlichen Akademien über den Aufbau von Verfahrensabläufen nach gerichtlichem Vorbild zu einer Stütze seiner Innovationspolitik.
Experten empfahlen sich für ihre Schlüsselrolle bei der Verwandlung von Information in Wissen aufgrund von zwei Eigenschaften, die ihnen nach der Reform des französischen Zivilrechts durch den Code Louis 1667 zugeschrieben wurden: Sachkompetenz und Unabhängigkeit. Die beiden Eigenschaften standen von Beginn an in einem Spannungsverhältnis zueinander, denn in der Gerichtspraxis ging die Gewährleistung der einen oft auf Kosten der anderen. Hatte Colbert mit dem Code Louis die Unabhängigkeit der Experten gestärkt, indem er Vorschriften erließ, wer zum Experten qualifiziert und wie die Begutachtung durchzuführen sei, so wurde nach dessen Umsetzung bald moniert, die Gerichte hätten es mit inkompetenten Experten zu tun, weil viele Spezialisten, die mit den Angeklagten den gleichen Beruf und damit oft auch die gleiche Zunftzugehörigkeit teilten, wegen mangelnder Unabhängigkeit ausgeschlossen seien. Auf diese Weise kam ein Prozess des permanenten Reformierens und Justierens in Gang, der im Verlauf des 18. Jahrhunderts eine neue Expertenfigur hervorbrachte, die Kompetenz und Unabhängigkeit endlich zu vereinigen schien: den staatlich akkreditierten und alimentierten Wissenschaftler mit Sitz in einer königlichen Akademie.
Auch diese Figur hatte ihr institutionelles Fundament in Colberts Innovationspolitik. Als er Finanzminister wurde, gab es zwei königliche Akademien in Frankreich, als er starb, sieben dieser Prestigeinstitutionen. Den fünf Akademien, an deren Gründung er beteiligt war, wurden spezielle Tätigkeitsgebiete zugewiesen, auf denen sie Informationen sammeln, prüfen und zu wertvollem Wissen verarbeiten sollten. Eine unter ihnen, die 1666 gegründete Académie royale des sciences, stieg im 18. Jahrhundert zur europaweit führenden Forschungsstätte im Bereich der mathematischen und experimentellen Wissenschaften auf. Neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit wirkte die Académie des sciences auch als Gutachterinstanz für technische Erfindungen, die, wenn sie als neu und nützlich taxiert wurden, mit einem königlichen Privileg versehen wurden, das ihren Urhebern zugleich als Qualitätszertifikat und Konkurrenzschutz diente. Mit der Zeit avancierte die Akademie zu einer Art fortschrittsverpflichteten Zensurbehörde auf industriellem, militärischem und logistischem Gebiet.16 Und mehr als ihre eigenen Forschungen war es diese Gutachtertätigkeit, die innerhalb der Akademie zum Aufbau von Verfahrensabläufen nach gerichtlichem Vorbild führte.
Dass die Entstehung der Expertenrolle in engem Zusammenhang mit der Entwicklung einer modernen Innovationspolitik steht, hat neben dem Zusammenwirken bestimmter Institutionen und Personen noch tieferliegende Ursachen. Beide Prozesse fallen in eine Zeit der herrschaftlichen und wissenschaftlichen Expansion, in der die Verarbeitung neuer Informationen zu einem vorrangigen Problem wird. Während die europäischen Staaten fremde Kontinente erobern und globale Handelsrouten etablieren, entdecken europäische Forscher unbekannte Welten von der größten bis zur kleinsten Dimension. Für das territoriale wie wissenschaftliche Ausgreifen sind technologische Innovationen zentral, und nicht selten kommen die gleichen Instrumente zum Einsatz – so etwa das Fernrohr, das für die maritime Navigation wie für die astronomische Observation Anwendung findet. Entsprechend naheliegend ist es für die Beteiligten, die Ausdehnung der staatlichen Macht und des wissenschaftlichen Wissens als ineinander verschränkte Vorgänge zu verstehen. Zeitgenossen sprechen metaphorisch vom Erobern unbekannter Gestade, wenn sie das Erzielen neuer Erkenntnisse meinen, und erforschen konkret Steine, Pflanzen, Tiere und Menschen fremder Länder, während diese von ihren Regierungen unterworfen werden.17
Die präzedenzlose Geschwindigkeit, mit der neues Wissen erschaffen und neue Territorien erschlossen werden, erzeugt bei Herrschern wie Forschern den Eindruck unbegrenzter Möglichkeiten, aber auch einen Zustand der Unübersichtlichkeit und Überforderung. Um 1700 beginnen sich die Klagen von Gelehrten zu häufen, sie könnten das Wissen, das auf ihrem Gebiet publiziert würde, nicht mehr absorbieren.18 Je weiter sich das Reich des Wissens ausdehnt, desto kleiner wird die Parzelle, die ein einzelner Mensch gründlich bewirtschaften kann. Dadurch erhöht sich nicht nur der Druck zur Spezialisierung, sondern auch der Bedarf nach Wissensvermittlung zwischen den sich ausformenden Spezialgebieten. Die Herrschaftsapparate europäischer Staaten durchlaufen im selben Zeitraum einen vergleichbaren Prozess. Sie können die gesteigerten Anforderungen ihres territorialen und administrativen Ausgreifens nur bewältigen, indem sie die Arbeitsteilung erhöhen und die Kommunikation verdichten. Dabei wird auch das Verhältnis von Wissenschaft und Politik neu organisiert. Zu den klassischen Funktionseliten der Juristen gesellen sich wissenschaftliche Fachleute unterschiedlicher Ausrichtung, die jedoch, damit sie die Entscheidungsträger stets mit neuestem Wissen versorgen können, weniger dem Herrschaftsapparat einverleibt als in weitreichender Autonomie belassen und von außen als Berater beigezogen werden.
Im Zeichen der Spezialisierung, Autonomisierung und gleichzeitigen Instrumentalisierung der Wissenschaften setzt sich unter Herrschern und Forschern eine Einstellung durch, die in dieser Entschiedenheit ebenfalls neu ist: Wissen ist Macht, aber die Wissenden sind nicht die Mächtigen. Experten entstehen in einer Welt, in der das alte Ideal einer personellen Einheit von Wissen und Macht, wie es noch die Renaissancekultur mit den Figuren des platonischen Philosophenkönigs und des ciceronianischen Senatsredners proklamierte, auseinanderbricht. Sie sind Kreaturen arbeitsteiliger Machtstrukturen, in denen Herrschende wie Wissende ihre Kompetenzen konzentrieren, um in komplementärer Kooperation auf neue Probleme reagieren und selber neue Lösungen produzieren zu können.
Damit sich solche Strukturen stabilisieren, bedarf es der Selbstbeschränkung aller Beteiligten. Idealtypisch heißt das: Experten können noch so viel von einer Sache verstehen, sie müssen die Ausführung anderen überlassen. Sie dürfen Einfluss auf Entscheidungsträger ausüben, aber keine Entscheidungsbefugnis beanspruchen. Die Macht von Politikern und Richtern bleibt unangetastet. Umgekehrt sind diese dazu verpflichtet, sich nicht in die Wissensarbeit der Experten einzumischen. Die Glaubwürdigkeit von Experten steht und fällt mit der ihnen zugestandenen Unabhängigkeit. Sie sind darauf angewiesen, dass sich ihrer Wissensarbeit Handlungsfelder eröffnen, die Entscheidungsträger als autonom respektieren und für nützlich halten. Damit sind Experten Günstlinge einer umfassenden Staatspatronage, durch die sie sogar einen gewissen Schutz vor dem Staat selbst genießen. Der Expertenrolle liegt sowohl ein Autonomieversprechen als auch ein Beratungsbedürfnis von Seiten der Entscheidungsträger zugrunde. Politikern und Richtern ist der Part von einsichtsfähigen Vernunftmenschen zugedacht, die genug wissen, um zu wissen, dass sie nicht genug wissen. Sie sollen sich aus eigenem Willen an einen Informationstropf hängen, der sie konstant mit neuem Wissen versorgt. Sind die Bedingungen, unter denen ein Expertendasein idealiter möglich ist, schon derart voraussetzungsreich, kann davon ausgegangen werden, dass sie realiter nur selten zur Gänze erfüllt sind. Und berücksichtigt man zudem, dass Experten auch unter idealen Bedingungen in einem Umfeld tätig sind, das neben ihrer formellen Aufgabe eine Fülle informeller Funktionen zulässt, wird die strukturelle Brisanz ihres Tuns sichtbar. Darin liegt das Skandalpotenzial der Expertenfigur.
Skandalgeschichten
Während das erste historische Kapitel die Bedingungen untersucht, unter denen Experten im Ancien Régime vom Gericht in die Politik und zugleich vom Handwerk in die Wissenschaft aufstiegen, beschreiben die darauffolgenden Kapitel die systemischen Spannungen, denen sie ausgesetzt waren, anhand von großen Skandalen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Experten waren jeweils an entscheidender Stelle in öffentliche Affären verwickelt, und manchmal wurden sie sogar selber zum Skandalon. Die Geschichte dieser Skandale ist schon oft erzählt worden und hat sich in der öffentlichen Erinnerung zu mythischen Lehrstücken verfestigt, aber gerade deshalb ist es reizvoll, sie von ungewohnter Warte aus zu betrachten. Mit dem Blick auf die involvierten Experten und mit der Analyse wenig beachteter Quellen entsteht jeweils ein neues, in mancher Hinsicht überraschendes Bild der Ereignisse, das mit dem Anspruch verknüpft ist, ihren historischen Ablauf und ihre heutige Relevanz besser zu erfassen.
Alle beleuchteten Skandale eint, dass sie stark von Wissenskonflikten geprägt sind. In ihnen prallen unvereinbare Wahrheitsansprüche zu bestimmten Ereignissen oder Sachverhalten aufeinander und werden mit wissenschaftlichen Mitteln ausgefochten. Was macht Skandale als Untersuchungsgegenstände so interessant, abgesehen von der hohen Dosis an Dramatik, die sie Betroffenen wie Beobachtern bescheren? Zu einem Skandal kommt es dann, wenn eine medial erhobene Anklage gegen bestimmte Personen wegen eines Normenverstoßes eine ebenso medial orchestrierte Entrüstung von unbeteiligten Dritten auslöst. Die skandalisierten Personen werden einem öffentlichen Tribunal ausgesetzt, das weder eine Rollentrennung zwischen Anklägern und Richtern noch eine Verteidigung vorsieht. Zudem können sich die Anklagepunkte im Verlaufe des Prozesses verschieben oder ganz verlagern, weshalb der Soziologe John B. Thompson von Verstößen »erster« und »zweiter Ordnung« spricht, an denen viele Skandale erst entzündet und anschließend am Lodern gehalten werden.19 Damit überlagern sich in Skandalen zwei Zeit- und Handlungsebenen, die in Gerichtsprozessen systematisch getrennt sind: jene des zu klärenden Tatbestandes und jene des aktuellen Prozessgeschehens. Skandale bestehen aus Ad-hoc-Deutungen von Vorgängen, die noch gar nicht abgeschlossen sind, sondern im Akt des »Enthüllens« weiter vorangetrieben werden, bis sie sich in einem reinigenden Gewitter oder in allgemeinem Überdruss erschöpfen. Man sollte Skandale daher als mediale Degradierungsrituale von Personen oder Institutionen und nicht als außergerichtliche Strafverfahren verstehen.20
Ein Degradierungsritual bedarf, um Aufmerksamkeit zu erhalten und Wirkung zu erzeugen, einer beträchtlichen Fallhöhe der betroffenen Personen. Zielscheibe eines Skandals kann nur werden, wer einen guten Ruf zu verlieren und hohen Ansprüchen zu genügen hat. Experten haben beides, aber das ist noch nicht alles, was sie zu idealen Opfern der Skandalisierung macht. Das Degradierungsritual wird im Namen der öffentlichen Meinung vollzogen und folgt der Rechtfertigungslogik, dass soziale Normen und moralische Gebote höhere Geltung haben als der Rang und Namen der Degradierten. Skandalisierer setzen eine breit geteilte Überzeugung von Normalität voraus, an die sie appellieren und mit der sie dem skandalisierten Geschehen den Eindruck der Eindeutigkeit verleihen. Die erfolgreiche Suggestion von Eindeutigkeit ist Voraussetzung dafür, dass ein Skandal überhaupt in Gang kommen kann. Allerdings ist es mit der Eindeutigkeit vorbei, sobald im Zuge der medialen Bewirtschaftung des Skandals Gegenstimmen zu Wort kommen, welche die Anklage relativieren, kritisieren oder ihrerseits skandalisieren. Gerade jene Skandale, die sich zu großen Medienereignissen auswachsen, folgen kaum je dem Szenario, das ihnen die Skandalisierer der ersten Stunde zugedacht haben. Anstatt einer »runden« und »sauberen« Geschichte, die von der Enthüllung des Skandalons über die öffentliche Degradierung der Skandalisierten zur kollektiven Bekräftigung von verletzten Normen führt, produzieren sie ein voyeuristisches Drama voller Ambivalenzen, Ungerechtigkeiten und Uneindeutigkeiten und lassen dabei eine latente Normenkonkurrenz zum offenen Konflikt ausarten. Bei Expertenskandalen ist es zum Beispiel die gleichzeitige Geltung einer an der öffentlichen Meinung und am wissenschaftlichen Forschungsstand orientierten Politik. Die Aufmerksamkeitslogik der Medien hat an der Eskalation meist einen bedeutenden Anteil, ist aber selten ein ursächlicher Faktor. Skandale sind Mechanismen zur Entladung von sozialer Aggression, und insofern gehört es zu ihrer »Natur«, dass sie mit dem Anspruch starten, eine verletzte Ordnung wiederherzustellen, und in einem Feld der Verwüstung enden können.
Genau das aber macht ihre Faszination für die historische und soziologische Forschung aus. Skandale spülen innere Spannungen im Normengefüge einer Gesellschaft an die Oberfläche, ohne dass diese von den Beteiligten selber thematisiert, geschweige denn gelöst werden könnten. Sie lassen zu hohe, zu enge oder zu widersprüchliche Erwartungen an bestimmte Personen, Institutionen oder Verfahren erkennen, indem sie diese wiederholt zur Zielscheibe von Entrüstungskampagnen machen. Für Experten gilt dies, wie die folgenden Kapitel zeigen werden, in besonderem Maße.
Um den tiefer liegenden Spannungen der hier behandelten Skandale auf die Spur zu kommen, werde ich den jeweiligen Handlungsablauf, der zu einem bestimmten Skandal geführt hat, detailliert darlegen. Das gibt mir die Möglichkeit, die Skandalisierungsnarrative gegen den Strich zu bürsten. Als Sofort-Deutungen mit Entrüstungsfunktion sind Skandalisierungsnarrative chronisch unzuverlässige Rekonstruktionen, und da sie auf die normative Dimension eines Geschehens fixiert sind, um Schuldige zu überführen und abzustrafen, können sie dessen kulturellen und strukturellen Unterbau kaum Beachtung schenken. Gleichwohl bleiben viele Skandalisierungsnarrative auch in der Rückschau unhinterfragt stehen, sei es, weil sie für die Medien zu attraktiv sind, um kritisch überprüft zu werden, sei es, weil die Gesellschaft moralisch eindeutige Dramen als öffentliche Reinigungsrituale braucht. Häufig sind auch die historischen Nacherzählungen von Skandalen noch derart nahe an ursprünglichen Skandalisierungsnarrativen, dass ein Verständnis ihrer Entstehungszusammenhänge erschwert ist. Von den hier analysierten Fällen gilt das für den kürzlich erfolgten Expertenprozess von L’Aquila ebenso wie für die weit zurückliegenden Skandale um die Familie Calas und um Alfred Dreyfus.
Die Gegenwärtigkeit der Geschichte
Indem dieses Buch Geschichte und Gegenwart eng aufeinander bezieht, um die historischen Voraussetzungen der heutigen »Wissenspolitik« freizulegen, erzählt es nicht etwa eine »lineare« Geschichte, die von einem Entwicklungsstadium zum nächsten schreitet, bis sie im Hier und Jetzt anlangt. Vielmehr beschreibt es eine ungerichtete Dynamik, die von einem steten Widerspruch zwischen innovativen Absichten und ihren unintendierten Folgen vorangetrieben wurde und noch immer wird. Gibt es ein Erzählmuster, das die Chronologie des Buches durchzieht, so ist es jenes einer Wiederkehr ähnlicher Konstellationen unter veränderten Bedingungen. Es dient dem doppelten Zweck, die Geschichtlichkeit der Gegenwart und die Gegenwärtigkeit der Geschichte zu verdeutlichen.
I
Aufstieg und Fall eines drogenpolitischen Technokraten
Er wurde entlassen, weil er nicht zugleich ein Regierungsberater und ein Aktivist gegen die Regierungspolitik sein kann. Dieses Prinzip ist wohlbekannt und seit Langem in Kraft.
ALAN JOHNSON, Why Professor Nutt was Shown the Door (2009)
Was ist unter einem Experten zu verstehen? Ich schlage vor, den Begriff mit drei Tätigkeiten zu verbinden: der Demonstration von Spezialwissen, der Vermittlung dieses Wissens an Laien und der Behauptung von Unabhängigkeit. Experten treten als Repräsentanten eines Wissensgebiets auf und weisen sich durch Fachtitel aus, die ihre Zugehörigkeit zu einer Spezialistengemeinschaft bezeugen. Ihre Rolle können sie nur ausüben, wenn Außenstehende mit Fragen an sie herantreten. Experten werden um Informationen und Einschätzungen, um Empfehlungen und Rat gebeten. Egal, ob sie auf der medialen Bühne oder hinter verschlossenen Türen agieren, ihre kommunikative Tätigkeit beschränkt sich auf das Antwortgeben. Die Antworten kommen dabei Übersetzungen gleich. Experten präsentieren, anders als Spezialisten im Gespräch unter sich, ihr Fachwissen in einer von Fachjargon so weit gereinigten Form, dass es für Laien verständlich wird.
Die Art der Fragen setzt den Rahmen, in dem sich Experten bewegen können. Vor Gericht beantworten sie Sachfragen und werden entsprechend als Sachverständige bezeichnet. Ähnlich limitiert ist ihr Spielraum in den Medien, wo die Choreografie von Experteninterviews, am auffälligsten in Nachrichtensendungen, der mündlichen Befragung von Sachverständigen im (angloamerikanischen) Gericht nachempfunden ist. Ungleich mehr Möglichkeiten haben Experten in der Politik. Hier ist ihr potenzieller Einfluss am größten, denn sie sollen nicht nur Materien erklären, sondern auch Maßnahmen empfehlen. Sie treten, um die Analogie zum Gericht weiterzuführen, zugleich als Sachverständige und als Anwälte auf. Zu entscheiden aber haben sie nichts. Wo diese Grenze aufgeweicht oder aufgehoben ist, verwandeln sich Experten in Technokraten.
Gemeinsam dagegen ist Experten im Gericht, in den Medien und in der Politik die Erwartung, dass ihre Aussagen aus unabhängiger Position erfolgen. Unabhängigkeit bedeutet dabei zweierlei: am Beratungsgegenstand kein ökonomisches Interesse zu haben und in der Beratungstätigkeit keinen politischen Einflussversuchen ausgesetzt zu sein. Entstehen Zweifel an der Unabhängigkeit, erscheinen Experten je nach Situation als Lobbyisten oder Propagandisten, und ihre Glaubwürdigkeit ist ramponiert.
In den Mühlen der Politik
Die Definition des Experten bietet eine erste Klärung, worüber wir sprechen, aber sie lässt noch nicht erahnen, in welchem Spannungsfeld Experten stehen. Dazu braucht es die Analyse von Fallbeispielen. Die erste betrifft einen Fall im doppelten Sinne. Es geht um den Sturz eines Drogenspezialisten in England, der als Vorsitzender einer staatlichen Expertenkommission die unsichtbaren Grenzen seines Tätigkeitsbereichs austestete. Als er merkte, dass er sie überschritten hatte, war es schon zu spät. Die Folgen waren für ihn relativ dramatisch, für uns sind sie umso erhellender. Beginnen wir aber, als das Schielen nach der Macht für ihn noch allzu reizvoll wirkte.
Am 18. Juli 2006 legte die parlamentarische Kommission für Wissenschaft und Technologie des britischen Unterhauses einen Bericht zum Umgang der Regierung mit ihren Drogenexperten vor.1 Es ging um die Mitglieder des Advisory Council on the Misuse of Drugs, dem unabhängigen Beratungsorgan für die Drogenpolitik. Der Bericht präsentierte einen ernüchternden Befund. Die Zusammenarbeit zwischen dem Expertengremium und der Regierung funktioniere nicht zufriedenstellend. Die Parlamentarier machten für die Missstände beide Seiten verantwortlich. Auf der Regierungsseite bemängelten sie ein Desinteresse für empirische Evidenz und auf Expertenseite ein Versagen bei der Erarbeitung derselben. Zudem zeigten sie sich beunruhigt, dass sich der Innenminister, in dessen Verantwortung die Drogenpolitik fällt, und der Präsident des Advisory Council im Bezug auf die Kompetenzen des Gremiums öffentlich widersprachen.2
Besonders hart ins Gericht ging der Bericht mit den Experten. Die Parlamentarier zeigten sich »extrem enttäuscht« über die mangelnde Transparenz und Präsenz des Gremiums.3 Vor allem aber warfen sie dem Advisory Council vor, seiner Hauptaufgabe, der Klassifikation von Drogen nach ihrer Gefährlichkeit, ungenügend nachgekommen zu sein.4 Was hat es mit dieser Klassifikation auf sich? Die Gefährdungsklassen sind ein Pfeiler der britischen Drogenpolitik. Sie setzen den strafrechtlichen Sanktionsrahmen für den Besitz und Handel illegaler Rauschmittel. 2006 waren zum Beispiel für die »Class C«-Droge Anabolika für Besitz maximal zwei Jahre Gefängnis und für den Handel bis zu 14 Jahre Gefängnis vorgesehen, für die »Class A«-Droge Kokain für Besitz dagegen bis zu sieben Jahre Gefängnis und für Handel maximal lebenslänglich.5 Seit dem Misuse of Drugs Act von 1971 werden illegale Drogen in Großbritannien in drei Gefährdungsklassen eingeteilt, wobei das Gesetz nicht festlegt, nach welchen Kriterien die Klassifikation zu erfolgen hat, sondern den ebenfalls 1971 gegründeten Advisory Council beauftragt, die Klassifikation regelmäßig zu evaluieren und zu aktualisieren. 2006 nun bemerkte die parlamentarische Kommission, die offiziellen Experten könnten keine wissenschaftlich gestützte Begründung abgeben, wie die Drogen ihren jeweiligen Platz im ABC-System gefunden hätten.
Ausgenommen von der Kritik war ein einzelnes Gremium innerhalb des Advisory Council, das Technical Committee. Dessen Mitglieder, betonten die Parlamentarier, arbeiteten seit 18 Monaten an einem alternativen Klassifikationssystem, ohne dass dieses im Council diskutiert worden sei.6 Den Vorsitz des Technical Committee hatte Professor David Nutt, ein Spezialist für die zerebrale Wirkung von Drogen, der damals die Abteilung für Psychopharmakologie an der Universität Bristol leitete. Nutt hatte den Parlamentariern einen unveröffentlichten Entwurf des neuen Klassifikationssystems zur Verfügung gestellt, den diese nun in ihrem Bericht ausführlich würdigten.
Schaut man sich die Passagen an, die der Bericht aus Nutts Entwurf zitiert, und ergänzt dazu noch Nutts mündliche Aussagen aus den Anhörungsprotokollen der Kommission, erhält man den Eindruck, die Parlamentarier hätten ihre Kritik an der Expertenbehörde aus dem Technical Committee ebendieser Expertenbehörde bezogen. Sie beriefen sich auf Nutts Papier, um die fehlende Systematik im Klassifikationssystem, die willkürlichen Grenzen zwischen den Gefährdungsklassen und die problematische Verknüpfung zwischen Schädlichkeit und Strafmaß hervorzuheben.7 Weiter führten sie Nutts mündliche Aussage an, wonach »in der (Präventions-)Erziehung die Botschaft empirisch abgestützt« sein müsse, wenn man verhindern wolle, dass die Leute sagten, »sie ist Müll«,8 und schlossen mit der Empfehlung:
Mit dieser grafischen Darstellung der Gefährlichkeit von Drogen wollte David Nutt 2007 die fehlende wissenschaftliche Basis der britischen Drogenpolitik mit ihren drei Gefährdungsklassen A, B und C sichtbar machen. Illegale und legale Drogen sind nach einem Berechnungsschema von »unabhängigen Experten« angeordnet und zugleich nach ihrer gesetzlichen Klassifikation eingefärbt. Das Schema der Experten, das die körperliche Abhängigkeit, die gesundheitlichen Folgen und den gesellschaftlichen Schaden aufrechnet, weist Alkohol und Tabak als gefährlicher aus als Drogen der höchsten gesetzlichen Gefährdungsklasse A wie LSD und Ecstasy.
Die identifizierten Probleme verdeutlichen die Tatsache, dass die angekündigte Überarbeitung des Klassifikationssystems dringend geboten ist, und die Regierung wird aufgefordert, die Beratungen darüber unverzüglich aufzunehmen. Es ergeht der Vorschlag, dass die Regierung eine wissenschaftlich besser abgestützte Schädlichkeitsskala entwickeln und diese von den Strafen für Besitz und Handel abkoppeln soll. Des Weiteren wird ein dringender Bedarf an höheren Investitionen in die Forschung festgestellt, um die politische Entwicklung auf diesem Gebiet zu unterstützen.9
Nutts mit anderen Forschern geschriebener Entwurf für eine neue, wissenschaftlich solidere Schädlichkeitsskala erschien im März 2007 in der renommierten Fachzeitschrift The Lancet.10 Die Publikation löste, unterstützt von einer Pressekonferenz der Autoren, ein beträchtliches Medienecho aus. Allerdings war dafür weniger die Klassifikationsmethode verantwortlich als ein umfassender Vergleich von legalen und illegalen Drogen.
Die BBC staunte, dass Alkohol und Tabak unter zwanzig ausgewerteten Drogen auf den Schädlichkeitsplätzen fünf und neun rangierten und damit weiter vorn als mehrere Drogen der Klasse A.11 Der Guardian titelte: »Alcohol worse than ecstasy on shock new drug list«.12 Der Artikel kam jedoch erst im zehnten Absatz auf das neue Klassifikationssystem zu sprechen, das neben den gesundheitlichen Folgen auch die körperliche Abhängigkeit und den gesellschaftlichen Schaden quantitativ auswertete. Dass bei diesen Kriterien ein systematischer Vergleich von legalen und illegalen Drogen nicht ganz ohne Tücken ist, kam nicht zur Sprache; der Ton war durchweg positiv. Wie die BBC unterstrich der Guardian die politischen Implikationen der Befunde und zitierte ein Mitglied der parlamentarischen Kommission mit den Worten, der Advisory Council müsse der Regierung nun formelle Vorschläge unterbreiten, wie man das geltende System auf der Grundlage der neuen Erkenntnisse reformieren könne.
Ende Juni 2007 trat Gordon Brown die Nachfolge von Tony Blair an der Spitze der Labour-Regierung an, und im Zug des üblichen Stühlerückens wurde Jacqui Smith zur Innenministerin ernannt. Spätestens jetzt schien die Botschaft von David Nutt und der parlamentarischen Kommission für Wissenschaft und Technologie an der Regierungsspitze Gehör zu finden. Im Januar 2008 wurde Nutt zum neuen Präsidenten des Advisory Council ernannt.13 Er hatte im Schatten des politischen Machtwechsels den Machtkampf im wissenschaftlichen Beratungsstab gewonnen.
Bis er aber das Amt im Oktober des gleichen Jahres offiziell antrat, war die Aufbruchstimmung wieder verflogen. Die Regierung Brown war nach anfänglichem Auftrieb in ein Umfragetief gefallen, aus dem sie sich mit populären Maßnahmen wieder herausmanövrieren wollte. Im Mai 2008 entschied Jacqui Smith auf der Basis einer eilends durchgeführten öffentlichen Umfrage und gegen den Rat des Advisory Council, Cannabis von der C-Klasse in die B-Klasse anzuheben, nachdem die Droge erst vier Jahre zuvor auf Empfehlung der Experten von der Regierung Blair abgestuft worden war. So bestand einer der letzten öffentlichen Auftritte von Sir Michael Rawlins, dem von Nutt verdrängten Präsidenten des Advisory Council, darin, sein Missfallen über die wissenschaftlich nicht nachvollziehbare Regierungsentscheidung zum Ausdruck zu bringen.
Nutt versuchte nach seinem Amtsantritt dennoch, das neue Klassifikationssystem in die politische Realität umzusetzen. Dazu nahm er sich als Erstes die »Überprüfung« von Ecstasy als Droge der A-Klasse vor, obwohl die Innenministerin verkündet hatte, eine Abstufung würde »eine gefährliche Botschaft« aussenden.14 Wie nach den Ergebnissen der Lancet-Studie nicht anders zu erwarten, kam die Expertenkommission zum Schluss, Ecstasy gehöre in eine tiefere Klasse, sah aber vom präzedenzlosen Vorschlag ab, die Droge in exakter Befolgung von Nutts neuem Klassifikationssystem gleich um zwei Klassen abzustufen.
Die moderate Anpassung nach unten rief bereits die Medien auf den Plan, und nun war es mit der wohlwollenden Berichterstattung vorbei. Das Boulevardblatt Daily Mail warnte im November 2008 vor den »verheerenden Folgen«, die eine Abstufung von Ecstasy haben könnte, und berief sich dabei auf einen Psychologieprofessor der Universität Swansea, Andrew Parrott, der sich als Ecstasy-Experte ausgab und Nutt widersprach. Der Artikel schloss mit einem Wink an Jacqui Smith, sie müsse sich, nachdem sie soeben die »desaströse Abstufung« von Cannabis rückgängig gemacht habe, auf »politischen Widerstand« gefasst machen, wenn sie der Expertenmeinung nachgebe. Die deutlichste Botschaft des Daily Mail war jedoch das Bild zum Text. Es handelte sich um eine Fotografie, die eine junge bewusstlose Frau an Schläuchen in einem Spitalbett zeigt. Darunter stand: »1995 starb Leah Betts, nachdem sie an ihrem 18. Geburtstag beim Feiern Ecstasy genommen hatte.«15 Das Bild hatte einen hohen Wiedererkennungswert, war es doch im Anschluss an den Tod des Teenagers bereits für eine massenmediale Anti-Drogen-Kampagne benutzt worden.
Der mediale Wink wäre nicht nötig gewesen. Als der Artikel im Daily Mail erschien, hatte Jacqui Smith den Experten bereits mitgeteilt, eine Abstufung von Ecstasy komme nicht infrage. Einige Mitglieder des Advisory Council, unter ihnen auch der neue Präsident Nutt, signalisierten nach dem einmaligen Ereignis einer zweifachen Missachtung ihrer Empfehlungen Widerstand. Über den Guardian ließen sie verlauten, sie planten einen Vorstoß, die Klassifikation von illegalen Drogen aus den Händen der Politiker zu nehmen und nach dem Vorbild des Monetary Policy Committee der Bank of England, das die Zinssätze festlegt, einem kleinen, unabhängigen Expertengremium zu übertragen, in dem die Fachleute selbständig beraten und entscheiden könnten. Mit anderen Worten: Sie wollten sich in Technokraten verwandeln. Im gleichen Artikel wurde Nutt mit den Worten zitiert, der Advisory Council werde als Nächstes ein Gutachten zu LSD vorlegen, das wie Ecstasy in der obersten Gefährdungsklasse rangierte, gemäß seinem neuen Klassifikationssystem aber relativ ungefährlich sei.16
Dazu sollte es nicht kommen, denn Anfang 2009 begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. Die Empfehlung zur Abstufung von Ecstasy stand kurz vor der Publikation, und obwohl die Experten damit rechnen mussten, dass sie in den Wind sprechen würden, investierten sie viel Energie in den Bericht, um die wissenschaftliche Solidität des neuen Klassifikationssystems unter Beweis zu stellen. Auf fünfzig Seiten Text bestimmten sie die Gefährlichkeit von Ecstasy nach dem im Lancet vorgestellten Kriterienkatalog und stellten systematische Vergleiche mit anderen Drogen an. Zur sozialen Schädlichkeit etwa merkten sie an, Ecstasy-Konsumenten gingen häufiger einer beruflichen Tätigkeit nach als Heroin- oder Kokainabhängige und neigten seltener zu Gewaltausbrüchen als Alkoholisierte. Diente der Vergleich mit illegalen Drogen der Klasse A dazu, die hohe Beschaffungskriminalität ihrer Konsumenten hervorzuheben, so hatte der Einbezug der legalen Droge Alkohol den Zweck, die starke Kriminalitätsanfälligkeit der durch Suff Berauschten zu betonen.17
Um dem wissenschaftlichen Argumentarium präventiv die Spitze zu brechen, kündigte Jacqui Smith bereits ein paar Wochen vor der Publikation der Empfehlung über den Daily Mail ein weiteres Mal ihren Widerstand gegen die Experten an. Die politische Niederlage der Expertenkommission war vorauszusehen, ließ sich aber noch in einen moralischen Sieg verwandeln. Diese Absicht könnte David Nutt geleitet haben, als er Ende Januar in seiner fachwissenschaftlichen Hauspostille, dem Journal of Psychopharmacology, ein Editorial mit dem Titel »Equasy: eine übersehene Sucht mit Implikationen für die derzeitige Drogendebatte« veröffentlichte.18 Die Droge Equasy, legte Nutt dar, werde von mehreren Millionen Briten konsumiert, darunter Kindern und Jugendlichen, sie löse die Ausschüttung von Adrenalin und Endorphinen aus und führe jährlich zu zehn Todesfällen, hundert schweren Straßenunfällen und einem Mehrfachen an Gehirnschäden.
Was ist Equasy? Nutt definierte es als »Equine Addiction Syndrome«, zu Deutsch: als Reitsucht zu Pferde. Er benutzte die phonetische Nähe zu Ecstasy als Aufhänger für das Argument, man könne die Gefährlichkeit von illegalen Rauschmitteln erst realistisch einschätzen, wenn man sie in Relation zu legalen Tätigkeiten mit hohem Gefährdungsgrad setze. Bei einem Pferderitt sei das Risiko eines körperlichen Dauerschadens deutlich höher als bei einem Ecstasy-Trip. Sein Editorial schloss mit der Forderung, die politische Klassifikation von Drogen zukünftig unter Einbezug dieser Vergleichsebene vorzunehmen.
Es dauerte ein paar Tage, bis die Medien Wind von Nutts Editorial bekamen. Zuerst reagierte der Daily Telegraph, was sicher nicht Nutts Szenario eines perfekten Skandals entsprach. Die konservative Zeitung verfolgte in drogenpolitischen Fragen eine repressive Linie, und weil sie sich zudem als Stimme des alten englischen Establishments verstand, musste sie an Nutts Vergleich einer Partypille mit Britanniens edelstem Sport und heiligstem Tier Anstoß nehmen. Der Telegraph stellte den Vergleich ausführlich vor, versah ihn aber mit einer anderen Pointe: Durch den Mund von drogenpolitischen Hardlinern ließ er verlauten, Nutt befinde sich auf einem »persönlichen Kreuzzug« zur Legalisierung von Ecstasy. Das war zwar falsch, eignete sich aber gut als Brücke zur Forderung, Nutt als Präsidenten der staatlichen Expertenbehörde zu entlassen.19 Der »Torygraph« verband die Rücktrittsforderung mit einer scharfen Kritik an der Labour-Regierung, welche die Personalie Nutt und den drogenpolitischen Zickzackkurs letztlich zu verantworten habe.
Der Artikel verfehlte seine Wirkung nicht. Über David Nutt entlud sich ein telefonisches Donnerwetter der Innenministerin. Jacqui Smith verlangte von ihm eine öffentliche Entschuldigung gegenüber den Angehörigen von Ecstasy-Opfern. Nachdem sich auch mehrere Mitglieder des Advisory Council von der Aussage ihres Präsidenten distanziert hatten, kam Nutt der Forderung nach. Damit konnte er seinen Vorsitz behalten. Zwei Tage später übte sich die Innenministerin vor dem Unterhaus in Schadensbegrenzung. Nutts provokativer Vergleich wurde von ihr mit einem populistischen Kurzschluss erledigt:
Leah Betts starb 1995, nachdem sie an ihrem achtzehnten Geburtstag erst Ecstasy und dann ungefähr sieben Liter Wasser geschluckt hatte. Die Fotografie, die sie im Koma kurz vor dem Tod zeigt, trug zum Ruf von Ecstasy als einer hochgefährlichen Droge bei. Sie wurde in Kampagnen für eine repressive Drogenpolitik eingesetzt und tauchte 2009 wieder in den Medien auf, als David Nutt mit seinem Vergleich von Ecstasykonsum und Pferdereiten für Empörung sorgte.
Ich bin sicher, die meisten Menschen würden den Bezug, den er in seinem Artikel zwischen Pferdereiten und illegalem Drogenkonsum erdichtet, einfach nicht hinnehmen. Für mich ist das eine Verharmlosung eines ernsthaften Problems; es trivialisiert die Gefahren von Drogen, demonstriert Gefühllosigkeit gegenüber den Familien von Ecstasy-Opfern und sendet an junge Menschen die falsche Botschaft über die Gefährlichkeit von Drogen.20
Smith machte sich die vermeintliche Empörung aus dem Volke zu eigen, indem sie Nutt als Paradefall eines verrückten (»nutty») Professors vorführte und dabei eine Argumentation aufbaute, die alle Folgerungen aus der angeblichen Ungeheuerlichkeit seines Vergleichs zwischen Partypille und Pferdesport ableitete: Nutts moralisches Versagen, emotionale Kälte, politische Gefährlichkeit – und sachliche Unredlichkeit.
Ganz anders kommunizierte das Innenministerium den Entscheid, die Empfehlung des Advisory Council zu ignorieren. Hatte Smith bei ihrer Anhebung von Cannabis ein halbes Jahr zuvor noch versucht, die Illusion einer expertengestützten Politik aufrechtzuerhalten, so blieb ihr nun bloß die Möglichkeit, den Dissens mit den Experten möglichst herunterzuspielen. Smith ließ dafür ihrem Unterminister, Alan Campbell, den Vortritt, der die Ecstasy-Frage nicht als Problem der Wissenschaft, sondern der politischen Kommunikation darstellte: Die Regierung habe die Pflicht, die Öffentlichkeit zu schützen, und könne es sich nicht leisten, bei jungen Leuten den Eindruck zu wecken, sie nehme Ecstasy weniger ernst.21 Damit waren die Argumente gekonnt ignoriert und das Thema vorläufig erledigt.
Ein riskantes Geschäft
Nutts Spielraum als Experte war nach der öffentlichen Bloßstellung im Parlament geschrumpft, sein Plan einer wissenschaftlich gestützten Drogenklassifikation gescheitert. Seiner akademischen Karriere tat das allerdings keinen Abbruch. Nutt wechselte von der Universität Bristol auf einen privat finanzierten Lehrstuhl am Imperial College London, wo er ein neues, auf ihn zugeschnittenes Departement aufbauen konnte. Ein erster politischer Hoffnungsschimmer schien für ihn auf, als Jacqui Smith Anfang Juni 2009 im Zuge eines Spendenskandals von ihrem Posten zurücktreten musste und durch Alan Johnson ersetzt wurde, der zuvor das Amt des Gesundheitsministers bekleidet hatte. Schon im Juli sah Nutt die Zeit gekommen, dort weiterzumachen, wo er mit seinem »Equasy«-Editorial aufgehört hatte. Er hielt im Londoner King’s College vor hundertfünfzig Hörern einen Vortrag mit dem Titel »Die Einschätzung der Schädlichkeit von Drogen: ein riskantes Geschäft?«.22 Zu Beginn stellte er nochmals das neue Klassifikationssystem und dessen Ergebnisse aus der Lancet-Studie vor, um anschließend den Gründen nachzugehen, warum es in der Politik auf so viel Widerstand gestoßen war. In den Mittelpunkt seiner Argumentation rückte er die wahrnehmungsverzerrende Wirkung der medialen Berichterstattung und die fehlerhafte Auswertung öffentlicher Umfragen durch die Regierung.
Als Beweis für die manipulative Rolle der Medien führte Nutt Statistiken aus Schottland über die Berichterstattung bei Todesfällen an. Sie zeigten, dass Todesfälle infolge von Drogenkonsum eine viel höhere Chance haben, in die Medien zu kommen, als solche nach einer Überdosis Medikamente, und sie zeigten ebenso, dass ein Tod durch Methadon nur in einem von 16 Fällen eine Medienmitteilung wert ist, während ein Tod durch Ecstasy so gut wie immer ein mediales Nachspiel hat. In Nutts Augen beeinflusste die mediale Aufmerksamkeitspolitik die staatliche Drogenpolitik gleich doppelt, einerseits direkt, andererseits indirekt über die Resultate von Meinungsumfragen.
Damit war Nutt bei Jacqui Smith angelangt. Vor ihrem Cannabis-Entscheid im Mai 2008 hatte sie sowohl eine öffentliche Umfrage als auch eine wissenschaftliche Studie – die dritte in fünf Jahren – zur Schädlichkeit von Cannabis in Auftrag gegeben. Während der Advisory Council nach einer neuerlichen Datenerhebung zum Schluss gekommen war, Cannabis sei, auch in Form des konzentrierten »Skunk«, relativ harmlos, nie tödlich und daher in der C-Klasse zu belassen, hatte die öffentliche Umfrage scheinbar das gegenteilige Resultat ergeben: 58 Prozent der Befragten wünschten eine Aufwertung und 32 Prozent sogar eine Einstufung in die A-Klasse, während nur 18 Prozent den Status quo beibehalten und 11 Prozent Cannabis legalisieren wollten.23 Für Jacqui Smith hatte dieses Ergebnis damals den Ausschlag gegeben, ihren Entscheid im Unterhaus mit der »öffentlichen Wahrnehmung« (»public perception») und dem Gebot der »Vorsicht« (»caution») zu rechtfertigen – so ernst sie die Empfehlung der Experten auch nehme.24
Nutt argumentierte in seinem Vortrag jedoch, die Umfragezahlen drückten gar nicht den Wunsch nach einer repressiveren Drogenpolitik aus. Als die Befragten nämlich zum Strafmaß für Cannabis-Besitz Stellung nahmen, votierten 41 Prozent für die C-Klasse, 27 Prozent wollten gar keine Strafe und bloß 24 Prozent wünschten eine Erhöhung in die B- und A-Klasse. Nach Nutts Lesart hieß das: Ein Großteil der Befragten sah in der Drogen-Klassifikation vor allem ein Abschreckungsinstrument und davon wiederum ein beträchtlicher Teil sogar einen funktionalen Ersatz für das gesetzliche Strafmaß. Wenn überhaupt, mussten die Umfrageergebnisse als Votum für die Abkoppelung der politischen Klassifikation von der gesetzlichen Repression verstanden werden.
Die im Rückblick entscheidenden zwei Argumente folgten aber erst am Ende des Vortrags. Das eine knüpfte an die provokative Parallele zwischen Ecstasy-Schlucken und Pferdereiten an: Um die Schädlichkeit von Drogen richtig einschätzen zu können, sei es nützlich und nötig, systematische Vergleiche mit anderen menschlichen Aktivitäten zu ziehen, die legal, aber gefährlich seien. Das andere war ein Fehdehandschuh in Richtung des neuen Innenministers: Wegen des Dissenses zwischen Experten und Politikern sei der Zeitpunkt reif, eine öffentliche Debatte über die relative Schädlichkeit und rechtliche Klassifikation von Drogen zu beginnen. Mit ihr lasse sich dann auch die Frage klären: »Wem vertraut die Öffentlichkeit mehr – Experten oder Politikern?«25
Nach dem Vortrag geschah lange nichts. Die im Titel von Nutts Vortrag gestellte Frage nach dem Risiko seiner wissenschaftlichen Beratertätigkeit wurde erst beantwortet, als der Text drei Monate später vom King’s College veröffentlicht wurde. Nun brach eine öffentliche Debatte aus, allerdings eine andere als die von Nutt angekündigte.26 Auslöser war nicht die Publikation selbst, sondern ihre multimedial orchestrierte Ankündigung. Nutt versuchte mit ihr einem zweiten Telegraph-Szenario vorzubeugen und das Heft des Handelns diesmal in der Hand zu behalten: Am Tag der Veröffentlichung erschien eine regierungskritische Passage aus seinem Vortrag im Guardian, flankiert von einem Begleitartikel, in dem ein Journalist, der zuvor schon drei Artikel zu Nutts Reklassifizierungsinitiative geschrieben hatte, eine alte Nachricht als neue Erkenntnis verkündete: »Alkohol schlimmer als Ecstasy«.27 Nutt selbst gab am gleichen Tag der BBC zwei Interviews und stellte dem Sender die Tabellen aus seinem Aufsatz für die Internet-Berichterstattung zur Verfügung.28
Tags darauf kam die Reaktion aus dem Innenministerium. Sie fiel heftig aus. Alan Johnson forderte Nutt per E-Mail zum Rücktritt aus dem Advisory Council auf. Die Begründung lautete, er habe als offizieller Experte den Auftrag, die Regierung mit »wissenschaftlichen Tatsachen« (»matters of evidence«) zu versorgen. Mit seinen jüngsten Kommentaren, die »so viel mediale Aufmerksamkeit« erhalten hätten, habe er sich jedoch von den Tatsachen verabschiedet und für eine Neuausrichtung der Regierungspolitik »lobbyiert«. Als Präsident des Advisory Council könne er den Eindruck nicht vermeiden, er schließe dessen Tätigkeit in seine Kommentare ein. Dadurch aber untergrabe er die »wissenschaftliche Unabhängigkeit« (»scientific independence«) des Expertengremiums. Der Innenminister betonte weiter, es sei nicht Nutts »job« als Präsident der staatlichen Expertenbehörde, eine öffentliche Debatte über die Drogenpolitik zu lancieren: »Es ist wichtig, dass die Botschaften der Regierung über Drogen klar sind und Sie als Berater nichts unternehmen, um deren öffentliches Verständnis zu untergraben.«29 Da Nutt nach seinem Vergleich von Ecstasy-Schlucken und Pferdereiten nun erneut gegen diese Auflage verstoßen habe, habe Johnson das Vertrauen in ihn verloren und fordere ihn auf, sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung zu stellen.
Dieser Brief hatte politisches Sprengpotential. Das harte Durchgreifen war das eine, die Rechtfertigung desselben das andere. Der Innenminister schien nicht nur eine lästige Person loswerden, sondern Experten allgemein in die Schranken weisen zu wollen. Das nutzte Nutt aus. Zwar musste er der Rücktrittsaufforderung Folge leisten, nicht aber ohne die Kündigung publik zu machen und von einem ihm wohlgesinnten Journalisten kommentieren zu lassen. Der gleiche BBC-Journalist, der tags zuvor über den Inhalt von Nutts Vortrag berichtet hatte, veröffentlichte wenige Stunden nach der Kündigung das Schreiben des Innenministers sowie Nutts schriftliche Reaktion darauf. In seinem Kommentar zur Vorgeschichte der Ereignisse übernahm er im Wesentlichen die Darstellung aus Nutts Vortrag.30
Auch die Printmedien griffen die Geschichte auf, und diesmal war es der linksliberale Guardian, der die Labour-Regierung am schärfsten angriff. In einem Editorial wurde Johnson beschieden, er sei zu schwach, um mit unbequemen Wahrheiten umzugehen, und ziehe es daher vor, »to shoot the messenger«.31 Johnson ließ diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen und schrieb einen Leserbrief, in dem er zum Kündigungsgrund präzisierte, Nutt habe nicht wegen seiner Ansichten gehen müssen, sondern wegen seiner unvereinbaren Rollenkombination aus »Regierungsberater« und »Aktivist gegen die Regierungspolitik«. Er fügte an: »Dieses Prinzip ist wohlbekannt und seit Langem etabliert.«32
Der Protest der Wissenschaft
Als der Leserbrief erschien, hatte der Innenminister bereits neue Sorgen, denn das Ganze wuchs sich zu einem wissenschaftspolitischen Skandal aus. Zwei Mitglieder des Advisory Council waren aus Protest über die Kündigung zurückgetreten, und vier weitere sollten nach einem Gespräch mit Johnson Anfang November folgen. Protest kam auch aus der parlamentarischen Kommission für Wissenschaft und Technologie, die drei Jahre zuvor mit ihrem Ruf nach einer wissenschaftlich fundierten Drogenpolitik Nutts Aufstieg an die Spitze des Advisory Council eingeleitet hatte.
Ebenfalls Anfang November veröffentlichten rund hundert Wissenschaftler, davon 17 offizielle Regierungsberater, unter der Federführung von Lord Martin Rees, dem Präsidenten der Royal Society, eine Erklärung, in der sie die Regierung zur Zusicherung von drei »Prinzipien im Umgang mit wissenschaftlicher Beratung« aufforderten.33 Das erste Prinzip war die Respektierung der akademischen Freiheit, die es jedem wissenschaftlichen Experten erlaube, sich uneingeschränkt zu äußern, sofern er nicht in seiner Funktion als Regierungsberater auftrete; ausgenommen von diesem Prinzip seien nur jene Wissenschaftler, die aus Gründen der nationalen Sicherheit Geheimhaltungsklauseln unterschrieben hätten. Das zweite Prinzip war die Garantie der wissenschaftlichen Unabhängigkeit von Expertenkommissionen, die es verbiete, Experten aufgrund öffentlicher Äußerungen über eine Empfehlung an die Regierung zu tadeln, zu bestrafen oder zu entlassen, auch dann, wenn die Regierung die betreffende Empfehlung abgelehnt habe. Das dritte Prinzip schließlich galt der angemessenen Berücksichtigung von wissenschaftlichem Rat, wonach die Regierung, wenn sie Expertenmeinungen zurückweisen wolle, die Kommission noch einmal anhören müsse, und dann, sofern sie bei ihrer Absicht bleibe, die Gründe für die Rückweisung im Detail darzulegen habe.
Die Intervention der Scientific Community gab Johnson die Gelegenheit, die Befriedung von »Nutt-Gate«, wie die Zeitschrift Nature den Skandal nannte, dem Wissenschaftsminister Paul Drayson zuzuschieben. Drayson zeigte gegenüber den Wissenschaftlern Verständnis, kritisierte Johnson für die fehlende Absprache und begrüßte die Ausarbeitung der Beratungsprinzipien.34 Anstatt die drei Prinzipien aber zu bekräftigen, ließ er ein eigenes Grundsatzpapier »Über die wissenschaftliche Regierungsberatung« ausarbeiten, das er am 15. Dezember 2009 dem Parlament zur Konsultation vorlegte. Darin konzedierte er offiziellen Experten, sie dürften »sachbezogene Beweise und Analysen öffentlich kommunizieren, auch dann, wenn sie zur Regierungspolitik im Widerspruch stehen«.35 Zugleich verlangte er von den wissenschaftlichen Beratern Akzeptanz dafür, dass die Wissenschaft nur ein Teil des »Beweismaterials« sei, das von der Regierung zur politischen Entscheidungsfindung berücksichtigt werde. Zum Stein des Anstoßes wurde aber folgender Satz: »Die Regierung und ihre wissenschaftlichen Berater sollen zusammenarbeiten, um eine übereinstimmende Position zu erreichen, und beide sollen durch ihr Handeln nicht das gegenseitige Vertrauen untergraben.«36
Die Vorbehalte gegen diesen Passus wurden vom Oxforder Abgeordneten Evan Harris im Times Higher Education zusammengefasst. Harris hielt der Regierung in scharfem Ton vor, sie wolle sich mit dem Satz einen gleichgeschalteten Expertenapparat aufbauen. Für ihn passte auch ins Bild, dass der Entwurf des Wissenschaftsministers kein Bekenntnis zur akademischen Freiheit enthielt. Er sah die Labour-Regierung auf dem Weg zu einem Umgang mit Experten, wie ihn George W. Bush in den Vereinigten Staaten pflegte, und stellte die Diagnose: »Entweder haben den sehr gesunden und gescheiten Wissenschaftsminister Lord Drayson zwischenzeitlich die Sinne verlassen, oder seine Hand muss von bösartigeren oder neandertalerischen Kräften in den Korridoren der Macht geführt worden sein.«37
Drayson ruderte Ende Februar 2010 nach einer Anhörung in der parlamentarischen Kommission für Wissenschaft und Technologie zurück und gab am 24. März die Schlussfassung der Prinzipienliste bekannt. Diese würdigte nun im ersten Absatz die akademische Freiheit von wissenschaftlichen Beratern. Die Aussage, Regierung und Experten sollten sich gemeinsam um eine übereinstimmende Position bemühen, wurde fallen gelassen, nicht aber die Passage, beide dürften nicht das gegenseitige Vertrauen untergraben.38 Auf mehrmaliges Nachhaken von Evan Harris hin gab der Wissenschaftsminister zu verstehen, die wissenschaftlichen Berater selbst respektive ihre offiziellen Vertreter, die Chief Scientific Advisers, hätten darauf bestanden, den Vertrauenspassus im Dokument zu behalten. Schließlich, so Drayson, bilde er »fast einen Hippokratischen Eid zwischen beiden Seiten«.39
Das Prinzip, zwischen Ministern und Experten müsse eine Vertrauensbeziehung bestehen, kam einer nachträglichen Absolution für Innenminister Johnson gleich. Dieser nämlich hatte sich früh von seiner im Leserbrief an den Guardian vertretenen Argumentation, Nutt habe eine unhaltbare Doppelrolle spielen wollen, verabschiedet und sich auf den im Kündigungsschreiben verwendeten Wortlaut zurückbesonnen, er habe sich von Nutt trennen müssen, weil er kein Vertrauen mehr in ihn gehabt habe.40