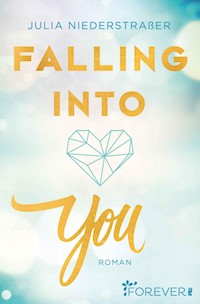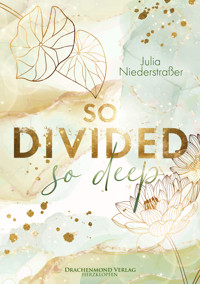
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Herzdrachen
- Sprache: Deutsch
Zoey möchte ihren Lebensretter finden. Den Mann, der ihr Herz nach einem Unfall wieder zum Schlagen brachte. Noah, ein Sanitäter der Kleinstadt Shellington, ist nur zögerlich bereit, sich mit ihr zu treffen. Doch der Widerwille weicht bald einem Knistern zwischen ihnen, das immer stärker wird. Die Erlebnisse der Vergangenheit lassen sich allerdings nicht so leicht abschütteln und stellen sich ihrer wachsenden Zuneigung in den Weg …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
So Divided So Deep
JULIA NIEDERSTRASSER
Copyright © 2023 by
Drachenmond Verlag GmbH
Auf der Weide 6
50354 Hürth
https://www.drachenmond.de
E-Mail: info@drachenmond.de
Lektorat: Nina Bellem
Korrektorat: Michaela Retetzki
Layout Ebook: Stephan R. Bellem
Illustrationen: Bianca Wege
Umschlagdesign: Emily Bähr
Bildmaterial: Shutterstock
ISBN 978-3-95991-747-6
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Prolog
1. Kapitel 1
2. Kapitel 2
3. Kapitel 3
4. Kapitel 4
5. Kapitel 5
6. Kapitel 6
7. Kapitel 7
8. Kapitel 8
9. Kapitel 9
10. Kapitel 10
11. Kapitel 11
12. Kapitel 12
Epilog
Danksagung
Drachenpost
Ihr habt uns zerstört.
Auseinandergerissen, was zusammengehörte.
Von uns ist nichts mehr übrig.
Wir drei, das gibt es nicht länger.
Ich bin jetzt anders.
Stärker.
Leichter.
Freier.
Ihr musstet mich erst betrügen, damit ich das verstehe.
Ihr musstet mich erst um Verzeihung bitten,
damit ich klarsehen kann.
Ich musste sterben, um mich zu finden.
Prolog
Zwischen Davor und Jetzt passt exakt eine Sekunde. Mehr braucht es nicht, um ein Leben zu verändern.
Hinter jeder Sekunde verbergen sich unzählige Möglichkeiten. Auf die meisten ist das Herz vorbereitet. In den hintersten Ecken hält es Masterpläne bereit, um uns zu schützen. Es rechnet mit Dingen, an die wir selbst nicht denken. Und wenn man Glück hat, treffen die abwegigsten davon nicht ein. Die, die eigentlich nicht mal als Option auftauchen.
Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passieren könnte.
Dass mich mein Herz nicht schützen kann.
Kapitel 1
ZOEY YOUNG @ZYOUNG • 4 D
Bringt dir der Druck irgendwas? Nein? Dann befreie dich davon.
Ich liege. Alles andere schaffe ich nicht. Vielleicht atme ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Das Einzige, bei dem ich mir sicher bin, ist die Schwere meines Körpers. Meine Glieder bestehen aus Zement, ihr Gewicht müsste das Krankenhausbett entzweibrechen und mich mit in den Abgrund zerren. Physisch müsste irgendwas geschehen, um mein Innerstes widerzuspiegeln. Doch es passiert nichts. Äußerlich bin ich Zoey, einfach Zoey. Die Beine in Gips, der Kopf bandagiert und mit Schläuchen übersät, die in meinen Körper eindringen, mich mit undefinierbaren Flüssigkeiten vollpumpen. Eine demolierte Variante der altbekannten Zoey. Das hoffen sie zumindest. Alle, die mich besuchen, gehen davon aus, dass ich irgendwann wieder die Alte werde. Alles wird gut, flüstern sie. Vielleicht beruhigt es sie sogar, mich aber nicht. Alles wird gut.
Für mich nicht. Ich könnte sie spoilern. Ihnen verraten, wie vergeblich ihre Erwartungen sind. Denn nichts wird mehr wie vorher sein. Dafür ist das Drahtseil um mein Herz zu mächtig. Der stechende Schmerz der Trauer und der Wut, der Scham und des Unverständnisses ist zu präsent, als dass ich Platz für Altes oder Neues machen könnte. Jede vermeintliche Lücke dafür wird von der Schwere in mir niedergewalzt, wird von einem stechenden Gefühl ausgefüllt. Sie sind die einzigen Dinge, die ich spüre: Schwere und Schmerz, Schmerz und Schwere.
Ich glaube nicht, dass sich das jemals ändern wird. Wie auch, wenn mir der Verrat und die Lügen alles genommen haben? Meine Liebe, mein Selbst und mein Leben. Sie sind dafür verantwortlich, dass ich gestorben bin, haben mich ins Hier und Jetzt geworfen, in dem ich allein mit allem klarkommen muss.
»Ms. Young?«
Im Zeitlupentempo suche ich mit meinen Augen nach der Urheberin der Stimme und finde eine freundlich lächelnde Krankenschwester samt Handschuhen. Sie war schon öfter hier. Selbst meine Pupillen fühlen sich schwer an. Schwer und fremdbestimmt, weil nicht ich bewusst dafür sorge, dass sie sich bewegen. Augenblicklich schieben sich dunkelgrüne Iriden vor meinen Geist. Vielleicht sind sie es. Vielleicht sind sie der Grund für das Funktionieren meines Körpers. Ich strecke den Rücken durch, versuche es zumindest, und habe keine Ahnung wieso. Es ist fast so, als würde ich mich befreien wollen – von dem Drahtseil um mein Herz. Aber es passiert nichts.
»Ms. Young, ich weiß, es ist anstrengend, aber wenn Sie mitmachen würden, müssten Sie nicht über die Sonde ernährt werden. Ich müsste Sie nicht ständig nerven.« Sie deutet auf den Schlauch in meinem Bauch, während sie das Shirt, das mir Mom gebracht hat, hochrafft. Schweigend sehe ich durch die Frau hindurch. Sie ist da. Ich nicht. Ich bin in meinem Schmerz gefangen, in der Schwere. Ich bin allein. Allein mit dem Warum, das über allem steht. Ich liege. Warum? Ich atme. Warum? Sie haben mich betrogen. Warum?
Knapp ein Jahr später
Alles wird gut. Ich glaube, manche Sätze muss man nur oft genug hören, um an sie zu glauben. Mittlerweile tue ich es. Alles wird gut und ich, das passt. Wie schnell sich Überzeugungen ändern können. Noch vor ein paar Monaten existierte vermutlich kein Satz, den ich mehr gehasst habe. Den ich für heuchlerischer gehalten habe. Denn nicht für alle wird alles gut. Für mich schon, ich muss es nur wirklich verinnerlichen. Gedankenverloren gebe ich im Liegen meiner besten Freundin im Hängesessel mit dem nackten Fuß Anschwung und zupfe an den Fransen des Teppichs unter mir.
»Was macht eigentlich die Suche nach deinem Lebensretter?« Helenas Gesicht taucht zwischen den Seitenkordeln des Sessels auf. Er ist an dem mittleren Balken befestigt, an dem sich die beiden Dachschrägen meiner Wohnung treffen.
»Nichts. Sämtliche Leute, die ich befragt habe, haben nichts gesehen. Hab sogar Mr. Baker ausgehorcht, weil ich dachte, dass ihm als Pfarrer vielleicht irgendjemand was erzählt hätte. Aber er wusste nichts. Mein Lebensretter scheint nicht zu existieren.« Er muss aber, schießt es mir durch den Kopf. Automatisch beiße ich mir innen auf die Unterlippe und hoffe wie immer, das Ungesagte nicht doch noch auszusprechen. Viel zu oft wurde mir in letzter Zeit geraten, die … Intensität meines Wunsches, wie sie es nennen, zu verheimlichen. Mom und Dad waren da sehr deutlich. Es wäre besser, wenn ich mit dem, was passiert ist, abschließen würde. Doch das kann ich nicht. Zumindest nicht mit dem Teil, der dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt noch hier sein kann. Die krumme Nase meiner besten Freundin lugt zwischen den Tauen des Leinentuchs hervor, in dem sie liegt. Der Karabinerhaken knarzt, gibt bei jeder Bewegung des unter ihm baumelnden Hängesessels gefährliche Geräusche von sich. Keiner von uns geht darauf ein, bisher ist die gemütliche Variante einer Schaukel nie abgerissen. Helly schwingt die Beine aus dem Sessel, stoppt ihren Schwung mit den Fersen und richtet die Miniversion eines Reagenzglases an ihrer Muschelkette. Die schwarze Locke darin gleicht ihrer eigenen hüftlangen Haarpracht, stammt allerdings von ihrem Grandpa. Obwohl er ihr nicht gerade nahesteht, ist sie ein Erinnerungsstück. Eine Mahnung an sie selbst, niemals so egoistisch wie er zu werden und alles und jeden im Stich zu lassen, wie er es getan hat, weil er davon überzeugt war, in Schweden bei seinen Vorfahren sei es schöner. Sie steht auf, krempelt die Enden der Latzhose auf die gleiche Höhe, sodass die angenähten Kirschen am Bündchen der Socken darunter hervorblitzen. In einer fließenden Bewegung lässt sie sich vor mir im Schneidersitz nieder und ich rapple mich auf, nehme auf meinen Unterschenkeln Platz. Vor nicht allzu langer Zeit wäre das undenkbar gewesen. Mittlerweile merke ich nichts mehr von den Gipsen, Bandagen und Schläuchen.
»Ich hab mir was überlegt.« Ihr Nuscheln ist noch ausgeprägter als sonst. Ihre Sätze kommen in den seltensten Fällen mit dem Tempo ihres Hirns mit, dafür ist es viel zu schnell. Wahrscheinlich gibt’s kein schnelleres. Den Ausdruck ihrer wunderschönen blauen Augen kann ich nicht einordnen. Einen klareren Farbton habe ich noch nie gesehen. Er ist fast durchsichtig, obwohl sie ihre Gedanken so oft dahinter versteckt.
Fragend sehe ich sie an. »Ja?«
»Vielleicht kann …«, ihre Lider heben sich, verleihen den letzten vier Buchstaben einen dramatischen Touch, »… überhaupt kein Lebensretter gefunden werden, weil du es selbst warst. Deshalb ist es vergeblich.«
»Hä?« Mit dem Daumen kreise ich über die rotbraunen Ornamente der Hennafarbe an meinem Zeigefinger. Helena mischt sich selten in die Angelegenheiten anderer ein. Sie ist diejenige, die andere unterstützt, egal ob sie der gleichen Meinung ist oder nicht. Aber wenn sie den Mund aufmacht, hat es immer eine Bedeutung, und exakt das macht mich gerade nervös.
»Eventuell hattest du eine außerkörperliche Erfahrung und hast dir in der Nacht selbst zugeflüstert, dass du weiterleben musst.«
Eine Narbe flackert vor meinem Geist auf. Dunkelgrüne Iriden starren mich an, hypnotisieren mich. Bisher gehören sie zu niemandem außer mir. Zu mir, weil sie mir Kraft gegeben haben. Weil sie da waren, als ich in der Wut und der Trauer, dem Unverständnis und der Scham beinahe untergegangen wäre. Irgendwas in mir zieht mich zu diesem Blick, zu dem Abbild meiner Rettung. Sie waren da, haben nach und nach das Drahtseil von meinem Herzen gerissen, den schneidenden Schmerz.
»No way.« Diese Augen kann ich mir nicht eingebildet haben. Weshalb sollten sie mich sonst seit dem Unfall vor einem Jahr verfolgen?
»Zoey.« Sanft hakt meine beste Freundin ihren kleinen Finger in meinen. »De facto hat niemand irgendwas gesehen.« Stirnrunzelnd betrachte ich sie, muss mir das Schmunzeln verkneifen. Durch das College ist ihr Latein-Gebrauchsgrad drastisch gestiegen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das im Vergleich zur Highschool toppen kann. Der Druck an meinem Finger wird fester, holt meine Aufmerksamkeit zurück zu ihr. »Nicht mal die Sanitäter konnten dir helfen. Und du hast bis jetzt nichts Neues rausgefunden. Glaubst du nicht, dass man sich auf einer kleinen Insel an einen heldenhaften Ersthelfer erinnern würde? Hier passiert doch nichts weiter als Fisch- und Hummerfänge. Da wäre so eine Geschichte das Highlight der nächsten Wochen.«
Klappernd weht das Fenster auf und zu, bringt die kühle Oktoberluft zu uns herein. Gänsehaut übersät meinen Bauch, zeichnet sich unter dem Spitzenbündchen meines Crop Tops ab.
Ich schlinge die übergroße Strickjacke, die ich darüber trage, um mich und schüttle den Kopf. »Er war da. So merkwürdig sich das auch anhört. Es kann nicht anders gewesen sein.« Das meinten Mom und Dad wohl nicht mit »Du musst damit abschließen. Wenn du das Thema ständig aufwärmst, kommst du nie zur Ruhe«. Ich erhebe mich ruckartig und schließe das Fenster. Ihnen geht es nicht mal um den Lebensretter, es geht um sie. Um ihre eigene Angst, sich positionieren zu müssen, eine Wahl treffen zu müssen. Entweder ich oder meine … Lexie. Also soll ich schweigen und verzeihen, damit alles wieder gut ist.
Im Vorbeigehen hole ich unter der Korkoberfläche des Wohnzimmertischs Streichhölzer hervor und beginne, die unzähligen verschiedenfarbigen Stumpenkerzen anzuzünden. Manche davon werfen auf ihren Sockeln ein mystisches Licht auf meine Aquarellmalereien an den Wänden, lenken den Fokus auf meine kreierten Landschaften und Porträts in goldenen Rahmen. Die Lichtspender, die auf Tabletts auf den drei naturfarbenen Teppichen stehen, lasse ich aus. Ebenso die, die sich hinter dem Hängesessel befinden. Er hängt als Raumteiler neben zwei Makramee-Vorhängen. Unentschlossen sehe ich Helly an, mustere ihre kurvige Gestalt von der Seite und umfasse instinktiv das Kärtchen in meiner Jackentasche. Mit den Fingern fahre ich über die Oberfläche des laminierten Rechtecks, sauge die Silben in mich auf, die ich vorhin mit einem Filzstift draufgeschrieben habe. Sprich aus, was dich beschäftigt, lass das Negative los und fokussiere dich auf alles Positive. Anders als bei meinen Eltern muss ich mich bei Helena nicht zurückhalten und Dinge verbergen, oder? Das hat sie bereits mehrfach bewiesen. Warum also nicht auch bei dem Thema, das für meine Eltern ein rotes Tuch zu sein scheint?Kurz senke ich die Lider, gebe Mom und Dads Rat, abzuschließen, die Chance zu siegen.
Innerlich fange ich rückwärts zu zählen an, warte darauf, dass ich mich, ohne großartig darüber nachzudenken, irgendwo zwischen drei und null entscheide, in dem Moment der Stille erkenne, was ich will. Drei: Ich atme ein, konzentriere mich auf den tiefen Luftstrom, der durch mich hindurchfließt, mich aufrechter macht. Zwei: Die Muskeln meines Oberkörpers ziehen sich allmählich zusammen, lassen meinen Atem entweichen. Eins: Ich will es loswerden. Wir unterhalten uns doch sowieso gerade darüber. Welchen Unterschied macht es, wenn ich es drastisch formuliere? So, wie es in mir aussieht?
»Irgendwo in Shellington ist der Mann, der mein Herz wieder zum Schlagen gebracht hat. Ich weiß das einfach. Ich muss ihn finden. Er … er ist das Gute in dem ganzen Scheiß, der passiert ist. Und ich möchte mich nur noch an das Gute erinnern. Wenn er da ist … vielleicht ist dann auch der Unfall vergessen. Außerdem sind wir beide die Einzigen, die dabei waren. Die Dinge, an die ich mich nicht mehr erinnere, kann er eventuell zurückholen. Das heißt also, ich werde ihn so lange suchen, bis er irgendwo aus der Versenkung auftaucht. Daran wird mich niemand hindern, Helly.« Obwohl ich murmle, leiser und leiser werde, ist mir bewusst, dass sie mich hört. Ich spüre ihre skeptischen Blicke auf mir. Sie sagt mehr, als sie es mit Worten tun könnte. Die Zweifel sind unverkennbar, was nur fair ist. Schließlich wird niemand, der nicht das Gleiche erfahren hat wie ich, die Dringlichkeit, meinen Lebensretter kennenlernen zu wollen, nachempfinden können.
Sie räuspert sich. »Okay. Aber du meldest dich, falls ich helfen kann, oder?«
Lächelnd nicke ich und fläze mich auf die Kissenlandschaft, die meinen Tisch umringt. Exakt deshalb ist Helena die einzige Person aus meiner Vergangenheit, mit der ich noch Zeit verbringe. Im Gegensatz zu unseren anderen mittlerweile ehemaligen Freunden zwingt sie mich nicht, über die Gründe für den Unfall zu reden. Sie ist nicht wie Michelle, Claus und Tim, die allesamt auch mit Lexie und Connor befreundet waren und um der Gruppe willen von mir verlangten, den beiden zu verzeihen. Es sei ein Ausrutscher gewesen, der jedem passieren kann. Helena hat sich für mich entschieden, obwohl ich sie nie vor die Wahl gestellt habe. »Das haben sie selbst verbockt. Ich bleibe bei dir« hat sie gesagt, als ich sie davon überzeugen wollte, sich weiterhin mit den fünfen zu treffen, da sie ihr nichts getan haben. Wäre mir nicht schon seit Jahren klar, dass sie meine beste Freundin ist, hätte es spätestens zu diesem Zeitpunkt festgestanden. Seitdem herrscht zwischen uns und den anderen Funkstille. Connor lebt nicht mal mehr hier. Den Gerüchten zufolge hat er ausschließlich seine Eltern eingeweiht, wohin er gezogen ist, und diese sagen nichts. Selbst wenn ich es wüsste, ich würde nicht mit ihm reden wollen. Dafür ist es zu spät. Die Einzige, mit der ich wirklich gern spreche, ist Helena. Sie versucht mir keine Meinung einzutrichtern, nach der ich Lexie vergeben müsste. Mom und Dad predigen beinah, dass ich ihr verzeihen muss. Aber bei Helena darf ich sein, wer ich bin und muss nicht zu dem Menschen zurückkehren, der ich einmal war: leistungsorientiert, geradlinig und brav. Eins steht fest, solange sie an meiner Seite ist, wird wirklich alles gut. Ich hebe meinen Arm und deute auf die aufgetragenen Muster der Mehndi-Kunst darauf. »Soll ich dich vor oder nach dem Essen anpinseln?«
* * *
Mit den Zehen wackele ich zum Takt der Musik, verfehle den Rhythmus mit derselben Präzision wie mit meiner Hüfte. Die Silberanhänger des Kettchens um mein Fußgelenk klirren dabei, begleiten den elektrisierenden Beat. Dua Lipaträllert mir aus meinem Handy entgegen, und ich spüle Helenas und mein benutztes Geschirr über dem Spülbecken ab. In einer schwungvollen Drehung greife ich hinter mir an den Kühlschrankgriff nach dem festgebundenen Tuch. Ich setze mich mit der Hälfte meines Hinterns in das offene Standregal daneben und lege die Beine auf die Küchenzeile. Ausstrecken kann ich sie nicht, dafür ist der Gang zu schmal. Selbst ein Tisch findet hier keinen Platz, weshalb ich zum Essen nach oben gehen muss. Über den bunten Fliesen schwebend trockne ich den Teller ab, summe vor mich hin. Nachdem wir unsere Sandwiches verputzt haben und ich Helena die Ornamente auf die Fingerknöchel gezaubert habe, die sie bei dem Date heute Abend tragen möchte, ist sie vor einer halben Stunde losgespurtet. Zu spät zum ersten Treffen zu kommen ist für sie so schlimm wie für mich, sich zu hetzen. Bei der Erinnerung an den hektischen Ausdruck auf ihrem rundlichen Gesicht schleicht sich ein Grinsen auf meine Lippen. Es verstärkt sich noch, als ich an die unmittelbare Blässe ihrer ohnehin schon hellen Haut denken muss. Doch plötzlich wird die Musik von einem Countrysong unterbrochen. Ich verharre, brauche nicht zu überprüfen, wer da anruft. Das ist sein Lied. Dad, schießt es mir traurig durch den Kopf, und ich rege mich immer noch nicht. Früher habe ich es geliebt, heute graust mir davor. Weil es bedeutet, dass ich mit ihm reden muss und doch nichts sagen darf. Ansonsten enttäusche ich ihn. Der heitere Rhythmus durchdringt sämtliche Schichten meines Körpers, sticht in meinem Brustkorb. Langsam hebe ich den Arm, taste über mir in dem Fach des Regals nach dem Handy und nehme das Gespräch an, ohne auf das lachende Bild von ihm und mir auf dem Display zu sehen. Ihn zu ignorieren bekomme ich nicht hin. Nicht jedes Mal.
»Ja?«
»Zoey.« Beim Ende meines Namens fehlt der helle Klang, der Dads sonst so dunkle Stimme fröhlicher macht. Mehr brauche ich nicht, um zu wissen, dass ich es heute noch vor dem Gespräch geschafft habe, seine Erwartungen zu enttäuschen.
»Dad.« Schweigen. Er hasst die Stille, dennoch kann er nicht anders. Keine Erwiderung. Ich schlucke, stehe auf und stelle den Teller samt Tuch auf die Küchenzeile. Normalerweise bin ich diejenige, der die Sätze ausgehen. Die nicht viel erzählen kann, da alles falsch ist. Es ist verkehrt, dass ich nicht über den Unfall reden möchte, über meinen Lebensretter aber schon. Dass ich die Familie und alte Freunde nur selten sehen will, während ich mich trotzdem mit Helena treffe. Nicht in Ordnung ist auch mein Auszug von zu Hause, nur um in diesem Rattenloch zu versauern. Das Kissenlager, das ich mein Bett nenne, ist ohnehin die reinste Katastrophe.
Was für alle anderen falsch ist, ist für mich genau richtig.
Sie meinen zu wissen, was zu mir passt, und vergessen mich dabei.
Aber sie lieben mich.
Zumindest die, die ich mal war.
Ich räuspere mich, zwirble eine verirrte Haarsträhne zurück in die Spange. Danach fahre ich auf der anderen Seite über meinen Sidecut. Hoffe, dass mich das Gefühl der weichen Stoppeln beruhigt, und lasse es direkt wieder – kein Potenzial für Besänftigung. Denn mit meinen türkis gefärbten Spitzen, die mein Kinn gerade so erreichen, und dem Rest meiner schwarzen Mähne plus abrasierter Seite habe ich wohl vor ein paar Wochen den höchsten Grad der Schande erklommen. Die Mienen meiner Eltern hätten nicht geschockter sein können. Dads damalige vorwurfsvolle Schnaufer ähneln denen, die er jetzt von sich gibt.
Leise frage ich: »Geht’s euch gut?«
»Nein, Zoey, uns geht es nicht gut. Wir machen uns nämlich nicht mehr nur Sorgen um dich, sondern befürchten mittlerweile, dass du dein Leben völlig ruinierst.«
»Weil?«
Schweigen, das zweite. Und dann: »Weil …« Er stockt. »Weil … du dein Studium abgebrochen hast! Du hast mir nichts, dir nichts alles hingeworfen, was du dir vor einem Jahr am College aufgebaut hast. Du wolltest an die Kunstschule. Du wolltest nichts anderes, und jetzt? Ist Aquarell nicht mehr wichtig für dich, oder wie sollen wir das verstehen?«
Ganz automatisch beiße ich mir innen auf die Unterlippe, hindere mich selbst daran, Dinge auszusprechen, die er nicht hören will. Ich will ihm nicht wehtun. Bei ihm schaffe ich nicht, was ich bei Helena hinbekommen habe: ehrlich zu sein. Meine Ehrlichkeit würde ihn verletzen.
»Woher …?«
»Eine Dozentin hat deine Schwester heute angesprochen und gemeint, wie schade es sei, dass du aufgehört hast.«
Lexie. Es gibt keine Buchstaben, die weniger hasserfüllt durch meinen Geist spuken könnten. »Aha.«
»Zoey!« Wenn ich bei ihm wäre, würde er den Cowboyhut von seiner grauen Matte reißen und mich mit verständnislosen Augen ansehen, deren Intensität erlöschen, sobald ihm wieder die Ähnlichkeit zu meiner Mutter auffällt. Vor einer Ewigkeit hat er zugegeben, dass es ihm besonders nach dem Unfall wehtut, so viel von ihr in mir zu sehen. Allem voran ihre Freiheitsliebe, die sie schlussendlich dazu gebracht hat, uns zu verlassen. Ich selbst kann mich kaum an sie erinnern; Dad dafür umso mehr. Erst als Meredith, meine Mom, mit ihrer Tochter in unser Leben getreten ist, fing er an zu heilen. Bis vor einem Jahr wäre ich nie auf die Idee gekommen, sie nicht als meine Schwester zu bezeichnen. Mittlerweile ist sie meine Stiefschwester, wenn überhaupt. Denn Lexie ist an allem schuld, ist für den Unfall verantwortlich. Für all die negativen Gefühle, mit denen ich mich im Krankenhaus gequält habe. Für das Drahtseil, das mein Herz eingeschnürt hat.
Störrisch stampfe ich aus der Küche, lasse das Badezimmer hinter mir und poltere die steile Treppe zu meinem Wohnzimmer mit abgetrenntem Schlafbereich hoch. Währenddessen sage ich beinahe angriffslustig: »Was? Ich kann Kunst auch ohne den ganzen Druck machen. Sogar viel besser. Ich höre nicht mit der Aquarellmalerei auf, ich mache es nur eben nicht mehr für die Dozenten.« Bei dem Kissenlager hinter dem Hängesessel angelangt, lege ich mich auf die beigen und dunkelgrünen Hüllen und starre an die schrägen Decken.
»Und das ist dir einfach so eingefallen?« Sarkasmus. Etwas, das Dad nicht leiden kann, gerade allerdings zu perfektionieren scheint.
Es weckt in mir ein Grummeln, das in meinem Magen wütet. Ich würde so gern mehr sagen; das »Lexie hat dafür gesorgt, sie ist daran schuld« rauslassen, aber ich tue es nicht. Es wäre unfair. Der Leistungsdruck hat mich schon vorher gestört. Doch ohne die Geschehnisse der Vergangenheit hätte ich mich wahrscheinlich nie davon gelöst. »Einfach so war das bestimmt nicht. Das hat mir der Unfall klargemacht.« Schweigen, das dritte, Enttäuschung, die zweite. Ginge es nach Dad, hätte ich lügen sollen. Mir was ausdenken müssen, damit ich nicht an dem Thema kratze, das unsere Familie entzweit.
»Das hat Lexie nicht gewo–«
»Wäre auch noch krasser, wenn, oder?«
Er seufzt, ich kann fast sehen, wie er den bulligen Kopf schüttelt. »Irgendwann musst du ihr verzeihen, Schatz. Du musst die ganze Sache abhaken und endlich weitermachen. Setz deine Karriere deswegen nicht aufs Spiel.«
Das Grummeln wütet jetzt nicht mehr nur in meinem Magen, sondern steigt als ätzende Glut meinen Hals empor.
»Ihr wollt nicht über meinen Lebensretter reden, und ich will nichts von Geschwisterliebe und Vergebung hören. Also fang gar nicht erst damit an.« Schweigen, das vierte.
»Ich möchte nur wissen, ob du dir im Klaren darüber bist, was du da tust. Du verabschiedest dich von einem Traum, den du schon mit sechs Jahren hattest. Lehnst das Stipendium ab, das du seit Monaten nutzt, und hast keine Perspektiven. So ein spiritueller Hokuspokus hat keine Zukunft, Schatz. Davon wirst du nicht leben können. Da hat man ja selbst mit Kunst noch bessere Aussichten.«
Ich strecke den Zeigefinger in die Höhe, folge dem Satz, den ich vor ein paar Tagen auf das Kärtchen geschrieben habe. Es klebt über mir an dem Holzbalken, reiht sich in die kreuz und quer hängenden Rechtecke mit Sprüchen ein. Einige davon sind auch auf meinem Twitteraccount verewigt. Bringt dir der Druck irgendwas? Nein? Dann befreie dich davon. Meine Aquarellzeichnung unter den Worten springt mir fast entgegen. Die hintereinander verschlossenen und blühenden Lotusblumen mit Blättern werden größer und größer. Der darüberstehende Ratschlag an mich selbst verschwimmt vor meinen Augen, weil ich derart fokussiert drauf spähe. »Ich werde Yogalehrerin, Dad. Das ist meine Perspektive, und ich weiß, was ich da mache. Von dem Kunststudium warst du anfangs auch nicht begeistert, und dann …«
»Das ist was anderes. Warum ausgerechnet Yoga?« Ich schlucke. Da ist er, der Satz, den ich von Anfang an erwartet habe. Alles außerhalb von Zahlen ist für ihn schwer zugänglich, doch das eigentliche Problem ist seine Ex-Frau, meine leibliche Mutter. Weil sie Yoga gemacht hat, ist es schlimm, dass ich es nun auch möchte. Es ist der nächste Punkt, in dem ich ihn an sie erinnere.
Es ist das nächste Falsch, mit dem ich meine Eltern quäle.
Dass ich für den Lehrgang zahlen muss und mir das Geld dafür im Café Breeze und mit meinem Etsy-Shop zusammenspare, bleibt besser unerwähnt. Sobald ich die Summe zusammenhabe, startet die Ausbildung in Indien. Woanders kommt für mich nicht infrage. Aus irgendeinem Grund muss ich der Kultur meiner leiblichen Mutter näher sein. Sie kennenlernen, obwohl ich sie selbst nicht treffen werde. Würde ich einen anderen Traum haben, den ich mir erarbeiten muss, wäre mein Kellnerinnenjob kein Problem. Hätte meine Mutter Dad nicht verlassen, wäre es kein Drama.
Kapitel 2
ZOEY YOUNG @ZYOUNG • 4 H
Bist du kurz vorm Durchdrehen, fahr Fahrrad. Oder schrei.
Lass alles los, hinterher hat das Glück mehr Platz.
Die Kapuze des Mantels umhüllt mich, schirmt mich von der in der Dämmerung versinkenden Außenwelt ab. Der rote Stoff schließt mich ein, sorgt dafür, dass ich am Hafen allein bin. Das Stimmengewirr der Passanten ist weit entfernt. Viel weiter, als es bei den wenigen Metern zwischen der hinter mir liegenden Uferpromenade und dem Wasser vor mir üblich ist. Ich vergrabe meine Hände in den Manteltaschen, beobachte die Nebelwölkchen meines Atems. Sie wabern über vereinzelte Eisschollen des Atlantiks, kündigen den Winter an, der Shellington nach und nach unter einer dicken Schneeschicht bedecken wird. Die kältere Luft der Umgebung trifft mein Gesicht, friert die Haut ein und hält die Gedanken an. Stoppt die Tirade meines Dads, der meinen Plan, Yogalehrerin zu werden, auch nach dem stundenlangen Telefonat nicht akzeptieren kann, und verankert mich im Hier und Jetzt. In der Wärme meines Körpers, die nur durch die Kühle der Nase, der Wangen und der Lippen durchbrochen wird. In der Ruhe, die von den massiven Pfählen am Rand des Meeres ausgehen. Der Reglosigkeit des stellenweise eingefrorenen Ozeans, auf dem orangene Lichtkegel des in der Ferne beleuchteten Damms tanzen. Ich schließe die Augen, inhaliere die klare Brise. Seit einigen Monaten bin ich öfter hier. Anders als früher kapsle ich mich von dem Treiben hinter mir ab und genieße dessen Präsenz, während ich mich von dem Chaos in meinem Kopf löse. Nach den Konfrontationen mit meiner Familie ist dieses Fleckchen Erde zwischen Trubel und Einsamkeit genau das Richtige. Alles wird gut ist hier so viel näher als sonst.
Nach ein paar Minuten stapfe ich den frostigen Steinhang hinauf, kehre zu der Uferpromenade zurück und bahne mir einen Weg, vorbei an den an Heizpilzen sitzenden Menschen in den Restaurants und Bars. Ihr Geschnatter umgibt mich wie eine Kuppel, die torfigen Düfte der verschiedenen Whiskysorten und die Aromen der Fischbrötchen umwehen mich. Ich bin mittendrin, könnte nicht dichter an der Geschäftigkeit der Leute sein und bin trotzdem gelassen, bin ganz bei mir. Ich bin da.
Vereinzelte Blicke folgen mir, ebenso Getuschel hinter vorgehaltener Hand. Seit meinem Unfall und meinen Bemühungen, meinen Lebensretter zu finden, scheint die gesamte Insel involviert zu sein. Wesentlich mehr als meine Eltern. Selbst eine Kommilitonin von Helena hat sie vor ein paar Wochen gefragt, ob es schon Neuigkeiten gebe. Schmunzelnd laufe ich weiter, freue mich auf den warmen Kakao, den ich mir zu Hause machen werde. Von irgendwoher ertönt eine bekannte Stimme. Sie ist nicht nah genug, um sie zu erkennen, also schlendere ich an den bunt gestrichenen Cottages entlang. Verschiedenfarbige kegelförmige Bojen, die an deren Außenfassaden hängen und seit Ewigkeiten ein Touristenmagnet sind, wackeln im leichten Wind. Innen werden für exakt diese fotowütigen Urlaubenden Souvenirs von Shellington angeboten. Meistens sind es kleine Seehunde und getöpferte Hütten am Meer.
Als ich in eine Seitengasse abbiegen will, packt mich auf einmal jemand am Arm. Erschrocken wirble ich herum und starre in hellblaue Augen. Ehe ich realisiere, wer das ist, weiß ich, dass es Lexie ist. Die helleren Nuancen, die ihre Pupillen umkreisen, sind unverkennbar. Einen Moment lang sehen wir uns an. Wochen liegen zwischen uns, für mich ist es noch immer zu kurz. In der letzten Zeit bin ich zur Meisterin geworden, ihr aus dem Weg zu gehen. Die Orte zu meiden, an denen wir uns begegnen könnten. Hier hätte ich sie am allerwenigsten erwartet, nicht am langweiligsten Fleck derInsel, wie sie es immer nennt. Was macht sie hier? Ich habe das Bedürfnis, meine … Lexie zu schlagen, wegzurennen, und will sie gleichzeitig in den Arm nehmen.
Mein Herz setzt einen Schlag aus, vielleicht versteckt es sich auch.
Will der Vergangenheit entkommen, nicht noch mal vom Drahtseil eingeschnürt werden.
»Hey«, presst sie hervor. Sie lässt mich langsam los. Trauer und Wut buhlen in mir um Aufmerksamkeit. Vor einem Dreivierteljahr hätte mich unser Zusammentreffen völlig überfordert, mich in die Vergangenheit zurückgeworfen. Ich kann beinahe spüren, wie sich das Drahtseil um mich legt, sich nach und nach um mich wickelt. Automatisch drücke ich das Kreuz durch, obwohl kein Grund dazu besteht. Im Krankenhaus habe ich das ständig getan, habe versucht, mich von der Einengung zu befreien, Raum zu schaffen. Bis ich mich unter der Trauer und der Wut, dem Unverständnis und der Scham nach und nach weniger bewegte. Nur mein Herz war noch regungsloser. Auch wenn mich die jetzige Begegnung nicht kaltlässt, ist es nicht annähernd wie damals. Das Drahtseil ist fort. Schon lange.
Dennoch höre ich Lexie in den Untiefen meines Gedächtnisses. Höre ihre tränenerstickten Worte, ohne die ich ihr vielleicht hätte verzeihen können. Die das Drahtseil so festgezurrt haben, dass es zwischen mir und den negativen Gedanken nichts anderes mehr gab. Da war kein Platz mehr.
Sie sind so nah; ihre Sätze sind so dicht, obwohl sie längst verklungen sind. Ich werde ihr Geständnis ewig hören. Egal wie weit hinten, unten, vergraben oder verschüttet es von meinem Gedächtnis aufbewahrt wird. Es ist da. Ihr Ich bin in Connor verliebt, Zoey. Noch bevor ihr zusammengekommen seid, war ich in ihn verliebt wird immer präsent sein. Weil sie gelogen hat. Weil sie mir ihre Gefühle über ein Jahr lang verschwiegen hat. Weil sie mir hätte vertrauen können, so wie sie es sonst auch getan hat. Stattdessen hat sie dabei zugesehen, wie Connor und ich uns annäherten, während sie bereits in ihn verliebt war. Sie hätte es verhindern können.
Alles, was passiert ist, hätte nicht sein müssen, wenn sie ehrlich gewesen wäre.
Möglicherweise hatten Michelle, Tim und Claus recht und ich hätte Lexie vergeben können. Wäre es um einen Seitensprung gegangen, hätte ich es eventuell irgendwann verkraftet. Aber ihre Lüge, ihre riesengroße Lüge kann ich ihr nicht verzeihen. Nicht, wenn sie es von Anfang an gewusst hat. Innerlich verbanne ich Lexies tränenerstickte Worte aus meinem Gedächtnis und fange an runterzuzählen. Versuche mich zu beruhigen, um zwischen drei und null zu entscheiden, was ich will. Drei: Ich atme tief ein, konzentriere mich auf den Luftstrom, der durch mich hindurchfließt. Zwei: Meine Muskeln ziehen sich nach und nach zusammen, entlassen meinen Atem. Eins: Lexie stopft die Hände tief in die Taschen ihrer Pumphose und sieht mich an. Ihre feinen Gesichtszüge sind zu einer erwartungsvollen Miene verzogen. Fuck, fluche ich stillschweigend und verkrampfe. Sie macht es mir unmöglich, mich zu entspannen, herauszufinden, wonach mir ist.
»Was willst du?« Ich weiß nicht, ob ich laut genug bin, denn ungebetene Bilder prasseln auf mich ein, werden mir erbarmungslos hingeklatscht. Sie unter ihm. Stöhnend. Er flüstert ihren Namen. Connor und Lexie. Die zwei Personen, denen ich am meisten vertraut habe. Die ich geliebt habe. Mein Herz trommelt gegen meine Rippen, schiebt die Trauer und die Wut in den Hintergrund. Es ist wieder da, das Bedauern, fast so, als würde es mich von der Erinnerung ablenken wollen. Mich vor dem Verrat meines Ex-Freundes und meiner Stiefschwester schützen wollen.
Ich hätte nie gedacht, dass es jemals gegen sie sein könnte.
Dass aus Liebe Hass werden könnte.
Distanziert betrachte ich sie, mache mir nichts aus ihrem verzweifelten Blick. Von uns dreien ist nichts mehr übrig. Daran ändern auch komische Gefühlsaufwallungen nichts, bei denen ich sie in den Arm nehmen möchte. Im Vergleich zu der Wut sind sie mickrig.
»Falls du wegen mir nicht mehr ans College gehen willst, damit wir uns nicht zufällig begegnen …«, beginnt Lexie, klemmt sich die bauchnabellangen dunkelblonden Strähnen hinter das Ohr, »… breche ich gern ab. Schmeiß das Studium nicht hin, bloß weil ich …« Sie stockt, und ich bemerke zum ersten Mal, dass der sonst so hüpfende Klang ihrer Stimme weniger enthusiastisch ist.
Für eine Sekunde siegt die Trauer; das Bedauern katapultiert sich an die Oberfläche. Es spricht für mich: »Ich will das wirklich. Studieren ist nichts mehr für mich.«
Sie runzelt die Stirn, glaubt mir kein Wort, was verständlich ist. Vor dem Unfall wäre mir so was nicht im Traum eingefallen. Vor dem Abend, als ich sie und Connor in flagranti erwischt und bei meiner Flucht im Auto durch die ganzen Tränen den Baum nicht gesehen habe, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, irgendwo anders hinzuwollen. Das Art Shellington College war alles, was ich wollte. Selbst mit dem Leistungsdruck. Und jetzt bedeutet es nichts mehr. Merkwürdig, wie schnell sich Dinge ändern können.
»Bist du dir sicher?«
Ihre Frage beschwört Szenen in mir herauf, holt die Vergangenheit zurück und löscht den mickrigen Teil der Trauer und des Bedauerns in mir aus.
Dunkelheit. Schmerz. Stiche, die meine Glieder durchlöchern, sich in mein Hirn bohren, bis da nur noch Schreie sind. Kreischende Töne, die nicht von mir stammen können und sich doch vertraut anhören. Und dann Stille. Nichts. Stille und wieder nichts. Licht, gleißende Helligkeit, die mich zu sich ruft, und ein Druck, der mich hält. Sich auf mich legt, als wäre er ein Teil von mir, der mich vor allem anderen abschirmen müsste. Stille. Nichts. Schmerz.
Damals habe ich nicht an den Tod gedacht, heute weiß ich, dass er irgendwo dazwischen war.
Irgendwo zwischen der Stille und dem Nichts bin ich gestorben.
Zitternd senke ich die Lider, meide den Anblick der Person, die für all das verantwortlich ist. Ich versuche mich von der Vergangenheit zu lösen, indem ich mir dunkelgrüne Iriden und eine schattenhafte Narbe in Erinnerung rufe, weil sie mich gerettet haben; vor Ort und im Krankenhaus haben sie mich am Leben gehalten.
»Lass mich endlich in Ruhe«, zische ich. Lexies Anwesenheit verdrängt die Sicht auf das Gute. Lässt die Augen und die Narbe verschwimmen, die zu demjenigen gehören, der mich nach dem Unfall reanimiert hat. Während der Zeit im Krankenhaus habe ich mir geschworen, nicht mehr an das Vergangene zu denken. Mich nicht an dem Negativen festzukrallen, da es ausschließlich Kummer verursacht. Es gibt keine Begründung für das Verhalten der zwei Menschen, die mir mit am wichtigsten waren. Alles wird gut funktioniert nur ohne sie. Also fokussiere ich mich auf alles andere, auf die guten Dinge, die mich stärken, und nable mich von dem Rest ab. Selbst wenn es manchmal schwerfällt.
Ich drehe mich hektisch um, renne beinahe davon und ignoriere das bittende »Zoey!«, das hinter mir herjagt.
Lärmend hieve ich mein Fahrrad über die mit Folie abgedeckten Gartenbänke, knalle dabei gegen die Blecheimer an den Wänden und lasse das Rad vor Helenas Garage wieder runter. Ich kralle mich an dem Lenker fest. Mein Zeigefinger ruckt von links nach rechts. Im Gegensatz zu dem unsteten Flattern in mir wirkt er fast kontrolliert. Der Schein der hinter uns baumelnden Glühbirne erhellt unsere Silhouetten auf der Einfahrt.
Meine beste Freundin rümpft die Nase und zieht den Schal fester um ihren Hals. Bei meiner unangekündigten Ankunft konnte sie sich kein weiteres wärmendes Kleidungsstück überwerfen. Als ich mit dem Ersatzschlüssel, den sie mir bei ihrem Einzug überreicht hat, vor ein paar Minuten die Garage aufgeschlossen habe, ist sie mir verdattert gefolgt, hat die Tür ihrer besenkammergroßen Wohnung zugezogen und mich wortlos beobachtet. Falls sie davon genervt sein sollte, dass ich so kurz nach ihrem Date bei ihr aufkreuze, lässt sie sich nichts anmerken.
Stattdessen greift sie nach dem Lenker des Fahrrads, sucht meinen Blick unter der riesigen Kapuze. Gerade fühlt sie sich nach einer Art Schutzschild an. In der Dunkelheit und mit der Glühbirne als einzige Lichtquelle muss mein Gesicht hinter Schatten verborgen sein.
»Den Drahtesel brauchtest du schon seit Wochen nicht mehr. Was ist los? Wen verhauen wir?« Obwohl sie mal wieder nuschelt, treffen mich ihre Worte mit Präzision. Sie hat recht. Eine ganze Weile lang musste ich nicht mehr radeln, um alles abzuschütteln. Um den Bildern zu entfliehen.
Ich war stark genug.
Anders als heute.
Trotzdem bin ich nicht schwach, daran muss ich mich erinnern.
Ich bin nur verletzlicher – verletzlich-stark.
Mein Hirn spult immer und immer wieder die Vergangenheit ab, pflanzt sie seit der Begegnung an der Uferpromenade in meine Gedanken.
»Lexie«, bringe ich hervor und schwinge ein Bein über den Sattel.
»Dann komme ich mit.«
Ich schüttle den Kopf, versuche die Erinnerung von ihr unter ihm zu verscheuchen. »Ich muss jetzt los.«
Das Jetzt klingt nicht annähernd so gequält, wie ich mich fühle. Mein Zeigefinger ruckt noch zügiger als eben von links nach rechts.
»In der Dunkelheit und noch dazu so aufgewühlt lasse ich dich nicht allein. Fahr schon mal vor. Ich hole dich ein.« Im Schnellschritt entfernt sie sich von mir, geht auf die abgewetzte Haustür zu, die sie samt winzigem Zimmer gern in Kauf nimmt, solange sie den Garten und die Garage mitbenutzen darf. Dafür hat sie sogar größere und modernere Unterkünfte abgesagt. Vielleicht liegt es aber auch an der Nähe zu ihrem Elternhaus, es ist nur drei Straßen entfernt. »Die gleiche Route wie sonst auch?«, ruft sie mir zu.
Meine Antwort besteht aus einem dünnen »Ja«, bevor ich in die Pedale trete und der Straße folge. Mit ihrem Mountainbike wird sie mich bald einholen, schließlich ist sie eine wesentlich schnellere Fahrerin als ich. Querfeldein gehört zu ihren Entspannungstouren.
Mein Atem beschleunigt sich, lenkt mich von der Umgebung ab. Ich kenne die hügelige Route auswendig, nichts davon nehme ich wahr. Die Luft rast durch meinen Körper und treibt die Szenen an, denen ich entkommen will. Jeder hektische Atemzug offenbart ein neues Bild. Connors nackter Oberkörper. Einatmen. Lexies Fingernägel. Sie gleiten über seine Haut. Noch mal einatmen. Seine stoßenden Bewegungen. Ausatmen. Seine Hände um ihren Hinterkopf. Und ausatmen, viel zu lang aus. Die liebevollen Blicke zwischen Lexie und Connor. Mein Puls dröhnt in meinen Ohren, der eisige Fahrtwind fegt mir ins Gesicht. Die Kapuze klappt nach hinten weg, bietet mir keinen Schutz mehr.
Ich atme ein. Mein Brustkorb senkt und hebt sich schneller und schneller. Die Bilder wechseln, zerren mich zurück zu dem Unfall. Dunkelheit. Schmerz. Stiche. Und Schreie, die von der Stille verschluckt werden. Von dem grausigen Nichts, das meine Glieder einkesselt. Dunkelheit. Atme ich aus? Plötzlich taucht ein heller Streifen auf, ob er nur in meinem Kopf existiert, kann ich nicht sagen, doch er ist da. Vergrößert sich vor meinem inneren Auge, schiebt die Szenen an den Rand meines Bewusstseins. Mächtige, hoch aufragende Baumstämme des abgelegenen Wanderwegs ziehen an mir vorbei, sind fast eins mit der Nacht. Weiße Reflektoren leuchten an ihnen auf, sobald sie das Fahrradlicht trifft. Kalter Schweiß klebt an meiner Haut. Meine Beinmuskeln sind angespannt, gehen mit den Radelbewegungen mit. Rasch aufeinanderfolgende Nebelwölkchen meines Atems wabern vor mir in der Luft. Ich spüre, dass die nächsten Erinnerungen auf mich warten, hinter meiner Schläfe pochen und sich in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit stehlen wollen. Lexies blasse Miene taucht vor mir auf. Der Moment, als sie mich im Türrahmen erkennt und begreift, dass ich dabei zusehe, wie sie mit meinem Freund schläft. Ich atme ein, kämpfe gegen den Drang an, direkt den nächsten Zug zu nehmen, und pruste stattdessen. Keuche den Atem beinahe aus, dehne ihn so lang ich es irgendwie schaffe. Gleichzeitig konzentriere ich mich auf das Treten der Pedalen. Ich muss mich auf meinen Körper fokussieren, zur Ruhe kommen, um die Gedanken auszusperren. Wenn mich die Vergangenheit einfängt, ist es schwer, wieder rauszukommen. Deshalb strample ich, gebe meinen Knochen, meinen Sehnen, jeder Faser von mir etwas zu tun, auf das ich achten kann. Ich horche in mich hinein, fühle, wie mein Knie nach oben wandert, während sich das andere streckt. Mein Brustkorb hebt sich langsamer. Die Nebelwölkchen sind nicht mehr so dicht aneinandergedrängt. Lexies und Connors Gesichter flackern neben dem sandigen Pfad auf, drängen sich nicht in den Vordergrund, sondern verlieren an Intensität. Meine Unterschenkel spannen sich an und lassen kurz danach locker. Ich atme ein und aus. Ein und aus.
»Zoey!« Helenas Stimme umweht mein Ohr. Ich drossle das Tempo, obwohl es nicht notwendig ist. Sie wird auch so zu mir aufschließen. Ich hole noch einmal tief Luft, schließe die Augen und öffne den Mund. Ich kreische, schreie, brülle. Radle weiter und breite die Arme aus. Höre auf zu strampeln und fliege mit dem Wind die steilere Strecke des Wanderwegs hinunter. Ich throne auf dem Fahrrad, schreie nach wie vor.
* * *
Der Schein der Lichterkette um den Hängesessel umgibt mich. Die goldenen Kugeln sind mit den Seitenkordeln des Tuchs verwoben, schlängeln sich bis zum alles tragenden Karabinerhaken hinauf. Erschöpft beobachte ich Helena, verharre an ihrer zusammengerollten Position auf den Kissen um den Wohnzimmertisch und lausche ihren Schnarchern. Nach exakt drei Sägegeräuschen pausieren sie für zwei Atemzüge und beginnen dann von vorn. Unsere Räder über die metallene Außentreppe hoch in meine Wohnung zu schleppen, scheint sie noch mehr geschlaucht zu haben als mich. Einen Moment lang hatten wir überlegt, sie in ihre Garage zu bringen und hinterher zu mir zu laufen. Ich reibe mir gähnend über die Lider, will das Brennen verscheuchen und setze mich aufrechter hin, um die Gemütlichkeit zu vergraulen. So friedlich wie gewöhnlich werde ich heute Nacht nicht schlafen können. Nicht nach der Begegnung mit Lexie. Obwohl sich die Müdigkeit auf meine Augen presst, sie kleiner und kleiner werden lässt, kann ich sie nicht schließen. Sobald ich das mache, kehren die Szenen zurück. Das weiß ich von den Malen zuvor. Wach sein ist besser, da kann ich die Gedanken kontrollieren. Deshalb lenke ich mich auch nach dem Radfahren ab, bestärke das gute Gefühl, das ich dadurch bekommen habe.
Bis eben habe ich die Bestellung für Etsy verpackt. Die von mir gebundene Makramee-Wimpelkette macht sich morgen auf den Weg zu ihrer neuen Besitzerin und beschert mir ein wenig mehr Geld in meinem Yoga-Makramee-Sparbeutel. Obendrauf habe ich eine Kopie meines vorhin kreierten Kärtchens hineingelegt, was ich dank Helenas Einfall bei allen Verkäufen mache. Bisher kam das Goodie in Form von Sprüchen immer gut an. Nachdem das Paket sicher verklebt darauf wartet, abgeschickt zu werden, habe ich mir das Tablet geschnappt und erstelle nun einen neuen Tweet. Das Goodie-Kärtchen wird dabei Thema sein. Die Pinsel, die Aquarellfarben samt Wasser und der Haarlack zum Fixieren der gezeichneten Pigmente auf dem Papier liegen noch auf der Korkplatte des Tisches. Daneben und nicht weit von meiner dampfenden Kakaotasse entfernt befindet sich das daraus entstandene Kärtchen. Die Vorderseite zeigt die schwarzen Umrisse eines Fahrrads. Auf der Rückseite sind die geschlossenen und blühenden Lotusblumen zu sehen. Sie zieren jede meiner Arbeiten. Die Tatsache, dass ihre Blätter Schmutz abweisen, hat irgendwas Beruhigendes. Es gefällt mir, weil ihnen der Dreck nichts anhaben kann. Die klaren, mit Filzstift gezeichneten Linien heben sich von dem grün- und goldfarbenen, im Wasser verlaufenen Hintergrund ab, den ich mit Pinseln erschaffen habe. Im obersten Drittel ist der neue Spruch zu finden. Bist du kurz vorm Durchdrehen, fahr Fahrrad. Oder schrei. Lass alles los, hinterher hat das Glück mehr Platz. Nicht alle Kärtchen verewige ich bei Twitter, aber die meisten davon teile ich mit meinen knapp zehntausend Followern. Denn was mir im Krankenhaus klar geworden ist, könnte auch für andere nützlich sein. Also veröffentliche ich meine Sätze, die mich dank eines dünnen Heftchens begleiten. Als das Warum und die Frage nach dem Grund für Lexies und Connors Verrat und der größten Lüge meiner Stiefschwester übermächtig wurde, überreichte mir Madame Bernard die zerfledderten Seiten eines Ratgebers. Die Krankenschwester und die dunkelgrünen Iriden sind dafür verantwortlich, dass ich in der Wut und der Trauer, dem Unverständnis und der Scham nicht untergegangen bin.
Ich habe mich in mir selbst verloren und in der Fremde wiedergefunden.
Jede verblasste Zeile des Heftchens hat mir geholfen. Die darin thematisierten Lebensphilosophien sind unendlich einfach, und deswegen liebe ich sie. Hygge und positive thinking. Wer diese Begriffe verinnerlicht, schafft es, sich auf die guten Dinge zu fokussieren. Zu entschleunigen, sich für sich selbst Zeit zu nehmen und zu genießen. Hygge und positive thinking haben mich zum Yoga gebracht, zu mehr Achtsamkeit mir gegenüber. Dieses eine dänische Wörtchen, das nicht viel mehr als Gemütlichkeit bedeutet, und diese zwei englischen Wörter geben mir Kraft; vielleicht ja auch anderen. Mit einem Klick lade ich den Tweet mit dem heutigen Spruch und dem Link zu meinem Etsy-Account hoch. Anschließend lehne ich mich in dem Hängesessel zurück. Das mechanische Licht des Tabletdisplays wird nach und nach weniger grell. Unter halb geschlossenen Lidern spähe ich umher. Trockenblumen und Gräser stehen in Vasen auf dem Boden, werfen Schatten an die grün gestrichenen Wände. Gerade wirken sie dunkelgrau. Der Mond scheint durch das Fenster, verwandelt einen breiten Strahl davon in eine hellere Variante. Es wäre so einfach, jetzt einzuschlafen, dem hypnotischen Sog der Gemütlichkeit nachzugeben. Wären nur nicht die Erinnerungen … energisch richte ich mich auf, klettere im Zeitlupentempo und mit dem Elan eines Faultiers aus dem Tuch und halte das Tablet fest. Ein müder Kälteschauer überfällt mich, will mich vermutlich ins Bett befördern, weshalb ich mir unter dem Tisch eine Wolldecke hervorhole. Ich hänge sie mir über meine Schultern, lehne mich unter dem Fenster gegen die Heizung. Hart und unangenehm, exakt das, was ich brauche, um wach zu bleiben. Dadurch wird der morgige Tag zwar kaum auszuhalten sein, aber das ist ein fairer Preis für sorglosere Stunden.
Geistesabwesend scrolle ich durch die Tweets anderer Nutzer und sehe mir meinen neuesten noch mal an. Mitten in der Nacht sind da schon Leute, denen mein Beitrag gefällt. Sie retweeten und kommentieren. Menschen, die ich kenne oder noch nie gesehen habe, interessieren sich für die Dinge, die mich beschäftigen. Vor meinen Augen verschwimmen die Buchstaben, werden schummrig. Während ich sie anstarre, taste ich nach dem Gedankenblitz, der durch mich hindurchflitzt, als könnte er selbst nicht glauben, dass er sich gerade einbringt. Mir Ideen liefert, Flöhe ins Ohr setzt, mich anstachelt, mir …
Mein Finger fliegt zum Display, ich öffne das Nachrichtenfeld und fange an zu tippen. Ohne darüber nachzudenken, bilden sich Worte in meinem Hirn, finden sich zu Sätzen zusammen und werden zu einem großen Ganzen, das ich nicht richtig fassen kann. Irgendwann drücke ich auf Twittern. Ich bemerke erst hinterher meinen rasenden Puls. Die Hitze, die meine Haut bedeckt, und meine trockene Kehle. Ungläubig lese ich, was ich fabriziert habe:
Zoey Young @zyoung • 10 s
Lebensretter gesucht! In der Nacht vom 12.11.20 auf den 13.11.20 hatte ich auf der Woodshell Gate einen Unfall. Die Gegend ist sehr
abgelegen, aber vielleicht kann sich ja jemand an den Mann erinnern, der noch vor den Sanitätern da war. Möchte mich gern bedanken.
Xoxo Zoey
»Was machst du da?«
Erschrocken zucke ich zusammen, lasse das Tablet auf meinen Schoß plumpsen und sehe zu Helena. Ihr Kopf ist auf dem angewinkelten Arm abgestützt. Schläfrig mustert sie mich, ihr schwarzes Haar steht in alle Richtungen ab.
»Hab getwittert.«
Ein undefinierbares Grummeln ist die einzige Antwort, die ich bekomme. Danach rollt sie sich wieder in ihre Ausgangsposition und schnarcht zwei Sekunden später weiter. Hastig tippe ich auf den Bildschirm, bin unschlüssig, ob ich die Nachricht löschen soll, und klicke auf die drei kleinen Punkte, bei denen ich die Delete
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: