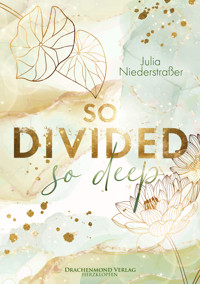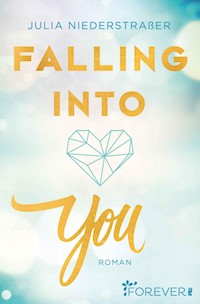4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Gefühlvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe hinter Millionen von Worten: Slowburn-Romance über Vertrauen und Podcasts für Fans von Lilly Lucas und Kathinka Engel »Das Problem an einem Neuanfang ist nicht, sich einmal dafür zu entscheiden, sondern immer wieder Ja zu ihm zu sagen.« Lodi ist sich sicher: Ihr eigener Podcast, in dem sie ihren Gefühlen freien Lauf lässt, wird für immer ein Geheimnis bleiben. Schließlich weiß sie, wie sehr man verletzt wird, wenn man sich öffnet – selbst von ihren Eltern. Als sie jedoch den bekannten Podcaster Zaid bei einem Workshop kennenlernt, erwacht in ihr der Wunsch, nicht mehr nur den Audiodateien anzuvertrauen, wie es in ihr aussieht. Auch Zaid kann Lodi nicht vergessen, und langsam nähern sich die beiden einander an. Sie nehmen sogar gemeinsam eine sehr persönliche Podcast-Folge auf. Doch dann erfährt die Öffentlichkeit plötzlich davon, und Zaid scheint der Trubel um seine Person gar nicht so ungelegen zu kommen … »Julia Niederstraßer hat mit ihrer Geschichte einen ganz eigenen Wörterwirbelsturm geschaffen. Cozy, Wohlfühl-Atmosphäre, liebevolle Details und viel Tiefgang. Für mich ein Mustread!« (Bianca Wege / waystowrite_)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »All the Words we keep in Silence« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Redaktion: Tintenweber Lektorat (www.tintenweber-lektorat.de)
Sensitivity Reading: Sharif Bitar
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Emily Bähr, www.emilybaehr.de
Covermotiv: Rawpixel.com; dolararts, LeoEdition
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Content Notes
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Epilog
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Content Notes
Liebe Leser:innen,
dieser Roman enthält potenzielle triggernde Inhalte.Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung mit einer Auflistung der Themen:
Rassismus, unerfüllter Kinderwunsch, familiäre Probleme
Prolog
Ich bin laut, doch niemand hört mich.
Nicht wirklich.
Keinem fallen die fehlenden Worte auf. Die, die ich hinter anderen, belanglosen verberge. Die, die trotzdem nicht aufhören, in mir zu wirbeln. Jeden Tag kreisen diese Sätze in meinem Inneren, schließen sich im Stillen zu Emotionen und Gedanken zusammen, bis sie zu einem brüllenden Sturm werden. Und dennoch werde ich ihn nicht freilassen, nicht wenn er gehört werden könnte. Das habe ich mehrmals getan und wurde von der Wucht der Antworten umgerissen. Seitdem wohnt in mir die Enttäuschung, hat sich für immer eingenistet.
Mein Wörterwirbelsturm und ich bleiben ungehört, verklingen in der Stille dieses Podcasts.
Ich seufze glücklich und erschöpft. Irgendein Gefühl zwischen Leichtigkeit und Schwere durchflutet mich. Es ist Routine. Die Kopfhörer abnehmen und an den Nagel oberhalb meines Schreibtisches hängen. Routine. Das Mikrofon auf der Tischplatte ausschalten. Routine. Noch einen Moment im kühlen Licht des Laptops sitzen, bis er auf Stand-by schaltet und ich wie alles andere in meinem Zimmer von der Dunkelheit verschluckt werde. Routine. Ich strecke mich auf dem länglichen Hocker aus und entwirre meine kribbelnden Beine. Während der Aufnahme im Schneidersitz zu sitzen, ist eindeutig eine schlechte Idee, aber es gehört ebenfalls zu meiner Routine.
Wie zufrieden solche Abläufe mich machen könnten, hätte ich nie gedacht. Eben habe ich zum hundertsten Mal auf Record gedrückt und eine Podcast-Folge produziert – vorausgesetzt, ich würde sie oder eine der anderen jemals veröffentlichen. Und trotzdem war es das hundertste Mal, dass ich meine Gedanken nicht nur Satz für Satz aufgeschrieben, sondern laut ausgesprochen und in einer Audiodatei abgespeichert habe. Erneut entschlüpft mir ein Seufzen, fast so, als würde mein Körper die Stille des Raumes füllen wollen, wie es meine Worte bis eben noch getan haben. Schon bei der Aufnahme hatte ich das Gefühl, dass diese der Einstieg sein könnte; die erste ausgestrahlte Folge, wenn ich mich trauen würde. Der Beginn des Podcasts, den ich seit Jahren hochladen möchte.
Ich schüttle meinen Kopf, starre an die Wand. Obwohl ich in der Schwärze kaum etwas erkennen kann, stelle ich mir die dunklen Schemen meines Spiegels an der Wand vor. An dem goldenen Rahmen sind gelborange Trockenblumen angebracht. Warum denke ich überhaupt über eine mögliche erste Folge nach? Sie wird wie all die anderen Aufnahmen auf meinem Laptop vermodern. Ein ungehörter, unveröffentlichter Podcast. Außer mir weiß niemand von seiner Existenz.
Ich schnaube. Das war’s also mit glücklich.
Frustriert rappele ich mich auf, um in die Küche zu gehen und mir einen Strawberry-Cheesecake-Tee zu machen, aber mitten in der Bewegung verharre ich mit meinem Blick an der Stelle, wo sich mein Mikrofon befinden müsste. Falls ich mich doch irgendwann trauen sollte, bräuchte ich einen Begrüßungs- und Abschiedsslogan. Das gehört zu den meisten professionellen Podcasts, denn es steigert den Wiedererkennungswert. Ich überlege, wische dabei fast hypnotisch über das Touchpad des Laptops. Als dieser durch die Berührung plötzlich wieder hochfährt, zucke ich wegen des grellen Lichts zusammen. Wenigstens die Begrüßung aufzunehmen, kann ja nicht schaden …
Kurz entschlossen setze ich meine Kopfhörer auf, schalte das Mikro an und beginne: »Hallo Welt, ich bin’s – die mit dem Wörterwirbelsturm-Podcast.«
Kapitel 1
Zwei Tage später
Moms Geburtstag, blinkt mir die eingespeicherte Erinnerung vom Display meines Handys entgegen. Ich atme schwer, halte in der einen Hand meine Wasserflasche und in der anderen das Smartphone. Die schwitzenden Sportlerinnen und Sportler um mich herum blende ich aus, nehme auf einer Holzbank abseits des geschäftigen Treibens im Fitnessstudio Platz und wünschte, ich wäre nicht vom Crosstrainer gestiegen, um eine kurze Pause zu machen, in der ich nichts ahnend nach meinem Handy gegriffen habe. Es ist jedes Jahr die gleiche Frage, die sich mir stellt: Befolge ich Moms Befehl oder tue ich, was ich als richtig erachte? Mein Finger schwebt über dem Symbol von WhatsApp. Alles in mir schreit danach, ihr nicht zu schreiben. Ihren Geburtstag das erste Mal zu ignorieren, weil ich sowieso keine ordentliche Reaktion erhalten werde. Schließlich gratuliert sie mir auch nie. Seit ich denken kann, hat sie mir immer bloß zugenickt und sich anschließend abgewandt. Es gab weder Glückwünsche noch irgendwelche Herzlichkeiten.
Ich stopfe das Handy zurück in die Hosentasche, lehne mich einen Moment lang gegen die Wand und trinke einen Schluck aus meiner Wasserflasche. Geistesabwesend streiche ich die losen Strähnen aus meinem Gesicht, die nicht im Bauernzopf halten. Wie bei Mom, denke ich grimmig und lasse meine Hand sinken. Außer der krausen Struktur und der Farbe unserer Haare haben wir nicht viel gemeinsam. Gegen die Struktur kann ich nichts tun. Gegen das Aschblond schon. Seit letztem Jahr färbe ich mir die lange Mähne hellbraun, dabei mag ich das Blond. Es passt nur nicht zu meinem Neuanfang. Der Ton wäre zu sehr sie. Und damit genau das, was ich mir vorgenommen habe zu vermeiden.
Ich will nicht so sein wie Mom. Nicht noch mehr als ohnehin schon. Denn ihre Gefühlskälte hat mir genug genommen.
Vor allem mich selbst.
Aber, wäre ich wie sie, würde ich mich nicht melden, und das entspräche so gar nicht dem Neuanfang, den ich geplant habe: Im Gegensatz zu Mom Emotionen zeigen und meinen Podcast veröffentlichen.
Also krame ich mit zittrigen Fingern das Handy erneut hervor, stelle die Flasche ab, öffne unseren Chatverlauf und tippe drauflos, ohne länger zu überlegen.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich hoffe, dein Tag ist schön.
Der Bildschirm verschwimmt vor meinen Augen, weil ich ihn so intensiv anstarre. Es dauert wenige Sekunden, bis sie mir förmlich in den Magen boxt, obwohl sie meilenweit entfernt ist.
Worte können brutaler sein als jeder Schlag.
Du sollst mir nicht gratulieren, wann begreifst du das endlich?
Kein Dank, keine Nachfrage, was ich im letzten Jahr getrieben habe. Nichts. Und gleichzeitig ist es alles. Unsere gesamte Beziehung.
Ein Schnaufen entfährt mir. Dennoch verspüre ich eine leichte Zufriedenheit, weil ich es geschafft habe, nicht wie Mom zu sein. Es ist ein kleiner Sieg; aber gewonnen ist gewonnen.
Meine Mundwinkel zucken. Die Erinnerung im Handy kann gelöscht werden. Für ein Jahr ist wieder Ruhe.
Die goldenen Absätze meiner Overknees versinken im Laubteppich, und jeder meiner Schritte wirbelt die Blätter auf dem Gehweg auf. Dunkelblauer Himmel, dunkelblaue Stiefel mit goldenen Sonnen- und Sternmotiven. Man könnte meinen, ich hätte sie an die Färbung des Abends angepasst. Hinter den weißen Lamellenzäunen der Oak Lane liegen verschlafene Vorgärten, versprechen die typische Kleinstadtidylle Neuenglands in den USA, wegen der ich hergezogen bin. Wegen ihr und wegen der sieben Stunden Fahrt, die sich dadurch zwischen Mom und mir befinden. Was gerade lang genug ist, um den Start in ein neues Leben zu wagen und meine Vergangenheit hinter mir zu lassen. Vielleicht haben es mir aber auch die zahlreichen Flüsse und Seen angetan, ihre verzweigten Verläufe an den Straßen entlang. Das hügelige Auf und Ab der Landschaft und ihre Konturen am Horizont. Das satte Rotorange der Baumkronen, das von jedem Winkel Maple Hills aus zu erkennen ist, fühlt sich an wie eine kleine Umarmung, egal, wo ich bin.
Ich beschleunige meinen Gang, inhaliere den erdigen Herbstduft und meine, am Ende der Straße einen flackernden Lichtpunkt zwischen den hoch aufragenden Gebäuden des Maple Hill Colleges auszumachen. Aus allen Richtungen strömen meine Kommilitoninnen und Kommilitonen und ich auf das halbjährliche Bonfire zu, heben im Gehen mitgebrachte Flaschen in die Luft, um sich zuzuprosten, und verfallen zunehmend in Schweigen, je näher sie dem Ziel kommen. Es ist ein alter Brauch, dass die Studierenden sich am Vorabend jedes neuen Semesters auf dem Vorplatz der betonklotzartigen Hauptgebäude der Geisteswissenschaftsfakultät des Colleges treffen, um die auf den verwitterten Außenfassaden eingemeißelten Vor- und Nachnamen nach dem eigenen abzusuchen. Sie können diagonal versteckt sein, in Linien, die ein Dreieck oder jede andere Form ergeben.
Unter den grauen Flachdächern wimmelt es mittlerweile von Buchstaben, die Ehemalige gemäß der Tradition nach ihrem Abschluss kreuz und quer hinterlassen. Es heißt, wer seinen Namen entdeckt, findet auch in der Realität zu sich selbst. Obwohl die Wahrscheinlichkeit gering ist, versuchen es die meisten immer wieder.
Lächelnd nicke ich einigen Leuten zu, die ich vom Sehen her kenne, folge ihnen zu den drei verschieden großen Feuerschalen, die in einem Dreieck aufgestellt sind und deren Wärme sich wie eine Decke um uns legt. Eine Weile beobachte ich die Rauchschwaden und Funken, die durch die Luft wabern, ehe sie verglühen. Ab und zu erhellt ein Blitz die Umgebung, wenn das Zeitungsteam des Colleges ein Foto vom Event macht, um es hinterher wie gewöhnlich auf die Internetseite zu setzen. Beiläufig vergrabe ich meine Hände in den Taschen meines Parkas und stoße mit den Fingern gegen ein Stück Papier, was mich zusammenzucken lässt.
Der Flyer, schießt es mir unwillkürlich so heftig durch den Kopf, dass kaum ein anderer Gedanke mehr Platz hat. Der Flyer, der Flyer, der Flyer.
Nach dem Fitnessstudio wurde er mir von einer Studentin achtlos in die Hand gedrückt. Inzwischen kenne ich seinen Inhalt auswendig, habe ihn in den letzten Stunden mehrfach zerknüllt, wieder glatt gestrichen und erneut zerknüllt, weil er mich nicht losgelassen hat. Die Chance, die er verkündet.
101.1 BigBeat sucht dich: Du hast einen Podcast und etwas zu sagen? Wir haben den Sendeplatz. Bewirb dich jetzt und werde DER Newcomer oder DIE Newcomerin auf dem Podcast-Olymp.
Wenn einer der größten Radiosender Neuenglands einen Wettbewerb ausruft, muss man eigentlich teilnehmen. Zumal man nichts weiter machen muss, als einen Fragebogen auszufüllen, eine unveröffentlichte Folge als Hörprobe einzusenden und den Link zum eigenen Podcast einzufügen.
Es wäre so einfach. Es könnte meine Chance sein, sofern ich mich endlich traue, den Wörterwirbelsturm hochzuladen. Denn das ist die Voraussetzung: der Podcast muss öffentlich existieren. Abermals beginne ich, den Flyer zu zerknüllen, hebe ihn ein Stückchen an und hole ihn doch nicht heraus. Ich kann ihn weder anschauen, noch kann ich ihn auf den Boden fallen und verschwinden lassen. Alles in mir sträubt sich dagegen, daher zerknülle ich ihn nur noch mehr. Das Rascheln des Papiers ist durch den Stoff meines Parkas gedämpft. Trotzdem mache ich ein paar Schritte rückwärts, als würde ich etwas Verbotenes tun. Als würde ich etwas in Betracht ziehen, das mir nur schaden kann. Denn meine letzten Versuche, meine Gedanken und Gefühle mitzuteilen, sind vor ein paar Jahren gehörig schiefgegangen. Ich reiße meine Hände aus den Taschen, nähere mich wieder den Feuerschalen und den Umstehenden und versuche, mich von dem, was in meiner Parkatasche schlummert, zu lösen. Dennoch gehen mir die Zeilen nicht mehr aus dem Sinn. 101.1 BigBeat sucht dich. Und in meinem rasenden Puls liegt die Antwort, von der ich nichts hören möchte, weil sie mich zerstören könnte. Doch genau darin liegt der Neuanfang, den ich wollte, oder? Deshalb bin ich umgezogen. Um meine Angst, erneut verletzt zu werden, zu überwinden. Die Frage ist nur, wann ich es schaffe, wann ich den Mut dazu haben werde. Ich presse meine Lippen aufeinander und schiebe den Gedanken beiseite, dass Mom einen ebenso schmalen Mund hat.
Eine kleine Gruppe Studierender schmort Würstchen über dem Feuer. Der würzige Duft steigt mir in die Nase und ist eine willkommene Ablenkung zu dem Chaos in meinem Kopf. Plötzlich schaltet irgendwer Musik ein, die kaum lauter ist als das Knistern der Glut.
Ich weiß noch, wie ich mich bei meinem ersten Bonfire vor einem Jahr darüber gewundert habe, wie ruhig es zugeht. Wie friedlich. Dabei hätte ich eher mit einer Party gerechnet, einem lauten Einstieg ins Semester. Stattdessen verschmelzen die Silhouetten meiner Mitstudierenden mit der hereinbrechenden Nacht, und geflüsterte Worte ziehen ihre Kreise, während nach und nach unzählige Fingerspitzen über die kühlen weißen Backsteine gleiten. Beim Fest zu sein, hat etwas Magisches. Es ist ein Anfang, ein Loslassen, ein Zusammensein. Es geht darum, zu wissen, dass man Teil von etwas ist, dass ein Stück von einem in der Welt verewigt ist, und sei es bloß der eigene Name, der von Ehemaligen hinzugefügt wurde. Die Möglichkeit, ihn unter all den anderen innerhalb des Buchstabenwirrwarrs wiederzufinden, lockt uns her. Manche jedes halbe Jahr, manche seltener, manche nie.
Und ich? Ich bin ständig am Suchen. Immer nur kurz, aber ich kann nicht anders. Jedes Mal, wenn ich die Hauptgebäude passiere, wandert mein Blick zu den Mauern voller Buchstaben. In der Hoffnung, am Ort meines Neustarts irgendeine Art von Halt zu finden.
»Lodi«, ertönt es auf einmal hinter mir. Charlys unverkennbarer Zimtduft umweht mich, als sie ihr Kinn auf meine Schulter legt, wofür sie sich auf die Zehenspitzen stellen muss.
Kurz versteife ich mich, bevor ich mich wieder entspanne. Manchmal glaube ich, ich habe vergessen, wie es sich anfühlt, von jemandem freiwillig berührt zu werden, und brauche einen Moment, um mich daran zu erinnern.
»Hey«, erwidere ich grinsend und wische mir eine ihrer blonden Strähnen von den großen Cateye-Gläsern meiner Brille.
Meine Mitbewohnerin umrundet mich, drückt mir ein Bier in die Hand und pustet sich den schwarz gefärbten Pony aus der Stirn. Flackernde Schatten färben ihre Wangen, als wäre der weiße Ton ihrer Haut eine Leinwand. »Wie sieht’s aus, hast du dich schon gefunden?«
»Als ob ich ohne dich anfangen würde.«
»Sehr brav.«
Ich proste ihr zu. »Wollen wir?«
»Unbedingt.« Ihr spöttischer Unterton ist unüberhörbar.
»Ach komm, eigentlich gefällt’s dir, sonst wärst du nicht hier.«
»Hätten in den letzten Jahren wenigstens mehr als ein paar Dutzend Leute Erfolg gehabt, wäre es motivierender.«
»Ein paar Dutzend sind besser als niemand. Das zeigt, dass man es schaffen kann.«
»Eine Anna Smith vielleicht, weil es ihren Namen tausendfach gibt.«
»Pst«, mache ich und hake mich bei ihr unter. »Egal, was du sagst, der Zauber bleibt. Sollte eine Anna Smith ihren Namen finden, ist es genau ihr Anna Smith. Ganz sicher.«
Charly lacht leise. Gemeinsam schlendern wir zu einem Stück Wand, an dem kaum jemand steht. Je weiter wir uns von den Feuerschalen entfernen, desto weniger ist von ihrer schützenden Wärme zu spüren.
»Meine Eltern wollten übrigens wissen, ob wir eine Hollywoodschaukel im Garten gebrauchen könnten«, beginnt Charly und kramt ihr Handy aus ihrem Jutebeutel mit Violinschlüssel-Motiv hervor. Sie schaltet die Taschenlampe ein und richtet den Lichtkegel auf die Mauer vor uns. Unzählige Linien verzieren die massiven Steine, verbinden sich zu ungleichmäßigen Buchstaben. »Ich habe einfach mal Ja gesagt. Schätze, das war okay?«
»Eine Hollywoodschaukel?« Ungläubig hole ich mein Smartphone ebenfalls aus der Tasche, schalte die Lampe an und platziere mein Bier mit einem dumpfen Laut auf dem Rasenstreifen vor dem Gebäude. »Gibt’s Menschen, die so was ablehnen würden?«
»Es gibt ja auch welche, die keine Schokolade mögen.«
Ich muss sie nicht anschauen, um zu sehen, wie sich ihre feinen Züge zu einer Grimasse verziehen.
»Schuldig im Sinne der Anklage.« Schmunzelnd trete ich dichter an die Wand heran und kneife die Lider zusammen. Es ist schwer, in den gemeißelten Strichen Wörter zu erkennen. »Deine Eltern sollen mir einfach sagen, was sie dafür haben wollen, ja?«
Das Sparbuch, das Mom für mich angelegt hat – zumindest in dieser Hinsicht hat sie für mich gesorgt –, ist zwar noch gut gefüllt, allerdings kann ich davon nicht mehr ewig leben. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, meine Stunden bei Maple Love aufzustocken. Garcia würde mich sowieso gern öfter hinter der Ladentheke voller Ahornsirups in jeder vorstellbaren Variation sehen.
Charly stöhnt genervt. »Mom ist beleidigt, wenn ich sie andauernd frage, wie viel du bezahlen sollst, sobald sie uns eine Freude machen wollen.«
»Ich bin eure Mieterin. Dass sie dir Sachen kauft, ist was anderes, als mir welche zu schenken.«
»Tut sie ja nicht. Sie schenkt sie uns beiden.«
»Charly.« Ich seufze tief wegen all der Herzlichkeit, die sie und ihre Familie mir entgegenbringen. Wegen des Wenigen, was ich ihnen zurückgeben kann.
Seit ich Charly an meinem ersten Collegetag begegnet bin, ist sie die Einzige, der ich ein wenig mehr als die Oberfläche von mir gezeigt habe. Vielleicht liegt es daran, dass meine Verzweiflung mehr als deutlich war, als ich aufgrund von Platzmangel kein Zimmer im Studentenwohnheim gefunden habe und sie mich kurzerhand bei sich einquartiert hatte. Denn ihre Eltern haben ihr am äußersten Rand der Stadt ein Häuschen samt kleinem Garten gekauft, damit sie in Ruhe lernen kann und sich mit möglichst wenig Problemen des Studentinnenlebens herumplagen muss. Hätte ich Charly nicht kennengelernt, würde ich vermutlich noch heute in dem heruntergekommenen Motel in einem Vorort wohnen.
»Lass mich irgendwas für sie tun, wenn ich schon kein Geld dazulegen darf.«
»Du könntest den Abwasch übernehmen.«
»Ich bezweifle, dass ich damit deinen Eltern etwas Gutes tue«, grummle ich und betrachte die Mauer noch eingehender als nötig. Wenn ich so weitermache, meißle ich mit meinem Blick neue Linien in das Mauerwerk.
»Die zwei sind zufrieden, solange ich es bin.«
»Noch mal, ich meine es ernst.«
»Ich auch. Echt jetzt, Lodi, es ist alles gut. Mach dich locker. Mom und Dad freuen sich, wenn sie uns glücklich machen können. Und wir sind ja wohl mehr als glücklich mit einer Hollywoodschaukel, oder nicht?«
»Auf jeden Fall.« Während ich spreche, verliert sich mein Tonfall in der wohligen Wärme in meiner Brust. Ich glaube, sie und ihre Familie sind die Ersten, die mir gezeigt haben, wie es sich anfühlt, wenn sich jemand um einen sorgt. Wenn man jemandem wichtig ist. »Dann lade die beiden bitte zum Kuchenessen ein. Ich backe.«
»Auch Cookies?«
»Kein Backen ohne Cookies! Die sind ein Muss.«
»Deal!«, ruft sie begeistert und nickt in Richtung unserer leuchtenden Handys. »Und jetzt finden wir gefälligst irgendwas, das wie Charlotte Eriksson und Lodi Williams aussieht.«
Kapitel 2
Eine Woche später
Der beschwingte Beat des Songs Ain’t It Fun von Paramore erfüllt mein Zimmer, die Stimme der Leadsängerin vermischt sich mit meiner. Ich lasse den Kugelschreiber in meiner Hand im Takt der Musik auf und ab wippen, viel schneller als meine Füße. Obwohl ich vom Fitnessstudio heute Morgen noch ausgelaugt bin, tanze ich von meinem Bett zum Schreibtisch, bleibe einen Moment dort stehen, um im aufgeschlagenen Geschichtsbuch darauf eine Jahreszahl nachzulesen, und singe lauthals mit. Falls mich Professor Dr. Archer in der nächsten Vorlesung erneut für seine spontane Abfragerunde auswählen sollte, werde ich vorbereitet sein. Beim letzten Mal, gerade einmal vier Tage nach Semesterbeginn, hat er mich kalt erwischt.
Mit dem Finger fahre ich eine Zeile in dem dicken Wälzer nach und versuche, mir das Datum einzuprägen. 11/22/1963: John F. Kennedy wird erschossen. Ich drehe mich schwungvoll um, summe weiter und verliere die Daten direkt wieder, weil Charly in meinem Türrahmen lehnt und belustigt die perfekt geschminkten Brauen hochzieht. Einer Musikstudentin mit meinem Gesang zu imponieren, gehört wohl nicht zu meinen Fähigkeiten. Für einen Moment übernimmt sie meinen plötzlich verklingenden Part, und im Gegensatz zu meinen sind ihre Töne voll. Sie füllt damit ganz leicht die Bühnen der schummrigen Bars aus, in denen sie sonst auftritt.
»Sorry, bin am Lernen.« Ich schalte die Musik an meinem Handy aus und stopfe es in die Tasche meines Hoodies.
»Tanzend und singend. Wenn ich das früher gemacht habe, hat mir meine Grandma einen Vortrag über gute Lernbedingungen gehalten.« Charlys Kopfschütteln wird von einem Klimpern unterlegt, da die jeweils vier länglichen Ohrringe beider Seiten bei der Bewegung gegeneinanderstoßen.
»Zum Glück bist du nicht deine Grandma.«
»Richtig.« Sie lacht. »Ich will dich auch gar nicht stören, aber Mom fragt, ob Donnerstag klappt.«
Nachdenklich ziehe ich die Stirn kraus. »Welche Uhrzeit?«
»Nachmittags. Ich schätze, ab vier?«
»Müsste gehen.«
»Dann gebe ich ihr Bescheid.« Demonstrativ reibt sie sich über ihren Bauch. »Und meinem Magen.«
»Wieso das?«
»Na ja, er muss für Platz sorgen, damit ich mindestens eine Tonne deiner legendären Cookies vertilgen kann, ohne dass mir schlecht wird.«
»Eine Tonne, geht klar.«
»Mindestens«, wiederholt sie, bevor sie die Tür wieder hinter sich schließen will und sich doch noch mal zu mir umdreht. »Fast hätte ich es vergessen.« Sie fischt einen gefalteten Zettel aus ihrer Hosentasche. »Mir ist dein Parka vorhin von der Garderobe gefallen, als ich meine Jacke abgenommen habe. Dabei muss der hier rausgerutscht sein. Mir gehört er jedenfalls nicht.« Beiläufig streckt sie mir den Zettel entgegen, wartet darauf, dass ich nach ihm greife, aber ich kann nicht.
Meine Muskeln versteifen sich, während ich auf dieses zerknickte und ramponiert aussehende Papier starre, als könnte ich es durch bloßes Anstarren verschwinden lassen. Selbst in gefalteter Form erkenne ich es. Das ist mein Flyer von 101.1 BigBeat.
»Lodi?«
Obwohl ich Charly höre, schaffe ich es nicht, zu reagieren. Stattdessen fixiere ich das unförmige Rechteck in ihrer Hand, presse meine Lippen aufeinander und versuche, das Chaos in meinem Hirn zu koordinieren, ohne es wirklich zu fassen zu bekommen. Den Flyer so unvorbereitet zwischen uns zu sehen, ist zu viel. Schließlich gehört er in meine Parkatasche; nicht allzu weit von mir entfernt und gleichzeitig versteckt. Ich atme ein und sage leicht lächelnd: »Ja, ich glaube der gehört mir. Er wurde mir zugesteckt. Aber eigentlich kann der weg.«
»Bist du sicher?«
»Klar.«
Neugierig kneift sie ihre Augen zusammen, schaut mich einen Moment lang abwägend an, ehe sie den Zettel hastig auseinanderfaltet und liest. Ich rühre mich nicht, lausche meinem donnernden Puls und halte an meiner Reglosigkeit fest, weil mich jede Bewegung verraten würde. Sie daran zu hindern, die Zeilen zu lesen, würde Fragen aufwerfen. Ich kann nur warten und mir in dem angespannten Schweigen zwischen uns Antworten zurechtlegen, die nicht preisgeben, was der Flyer in mir hervorruft.
Charly blickt auf. »Ein Podcast-Wettbewerb?«
Ich zucke mit den Schultern. »Keine Ahnung, kann sein. Ich weiß nicht, was da draufsteht.«
»Podcasts«, sagt sie mehr zu sich selbst als zu mir, um mich gleich darauf interessiert anzuschauen. »Hörst du so was? Irgendwie konnte ich mich damit nie anfreunden.«
»Ich auch nicht.«
Ein Schatten legt sich über ihre Miene, nimmt ihr die Leichtigkeit, die ihre Gesichtszüge sonst zeichnet. Ihr ist klar, dass ich lüge. »Na gut, dann schmeiße ich ihn einfach weg.«
Ich schlucke, nicke. Und dann spüre ich für einen winzigen Moment diesen Druck in meiner Brust, der den Wörterwirbelsturm ankündigt, den ich aussprechen möchte, aber nicht kann: Nein. Bitte wirf den Flyer nicht weg. Bitte gib ihn mir zurück. Silbe für Silbe steigt zirkulierend empor, ohne über meine Lippen zu gelangen.
»Okay«, sagt sie, und es klingt wie eine Aufforderung, sie aufzuhalten. Wie eine Einladung, mich ihr anzuvertrauen. Doch ich bleibe still. Ich kann nicht anders, weil ich weiß, was passieren wird, wenn ich zu viele Emotionen zeige; zu viel von mir. So viel also zu meinem Neuanfang.
»Okay«, wiederhole ich und erkenne die Enttäuschung in Charlys Gesicht.
Mit einem Mal höre ich meine frühere Mitschülerin Cassie in meinem Kopf, und obwohl es drei Jahre her ist, habe ich das Gefühl, das Echo ihrer Stimme schlägt genau in meinem Herzen ein. Wie Blitze verbrennen ihre Worte die getroffenen Stellen. Wie soll das funktionieren, Lodi? Freundschaft bedeutet, dass man sich alles anvertraut. Das machst du nicht, also sind wir keine Freundinnen. Automatisch wandert meine Hand zu meiner Brust, als könnte ich mein Herz so vor der Erinnerung an die einzige Person schützen, die zumindest ein paar Wochen lang versucht hat, sich mit mir anzufreunden. Cassies Vorwurf ist der Beweis dafür, dass ich das nicht gut kann. Ich bin keine gute Freundin, und Charlys Enttäuschung nach zu urteilen, sieht sie das ähnlich. Dabei wäre ich es so gern.
»Dann gehe ich mal wieder und sage meinen Eltern Bescheid«, sagt sie. Mit einem bedeutungsschweren Blick durchquert sie mein Zimmer, legt den Flyer auf meinen Hocker und schließt die Tür hinter sich.
Später am Abend liegt der Flyer noch immer auf dem Hocker. Ich habe ihn nicht angerührt, nur niedergestarrt. Während des Lernens ist mein Blick ständig dorthin gewandert. Selbst jetzt noch, als ich mich fürs Bett fertig mache, kann ich kaum woanders hinsehen. Ich ziehe die beigefarbenen Gardinen am Fenster zu, dimme dadurch die verbliebene Helligkeit der untergehenden Sonne. Der dünne Stoff verdunkelt den Raum in genau dem richtigen Maße, damit ich nicht in völliger Finsternis schlafen muss. Für den Bruchteil einer Sekunde gleitet mein Blick erneut zum Hocker, und ich balle die Hände zu Fäusten. Wut schäumt meine Kehle empor, vermengt sich mit dem bitteren Geschmack von Frustration auf meiner Zunge.
Weshalb bin ich nach Maple Hill gezogen? Ganz bestimmt nicht, um dort anzuknüpfen, wo ich aufgehört habe. Trotzdem trete ich seit über einem Jahr auf der Stelle. In gewisser Weise sind meine Eltern immer noch bei mir. Wegen ihnen traue ich mich nicht, beim Wettbewerb teilzunehmen. Wegen ihnen verschließe ich mich vor der einzigen Person, der etwas an mir liegt und die mir wichtig ist.
Ich atme tief ein, zwinge mich zur Ruhe. Sich aufzuregen, ist sinnlos, wenn sich nichts ändert. Nur leider schaffe ich das nicht. Deshalb bleibt der Flyer auf dem Hocker, und Charly halte ich auf Distanz, obwohl sie offensichtlich gemerkt hat, dass dieses gefaltete und zerknickte Stückchen Papier etwas mit mir anstellt.
Um mich abzulenken, hebe ich den flauschigen Überwurf meines Bettes an, decke dadurch den Kasten unter dem Bettgestell auf und greife nach frischen Räucherstäbchen, die ich mit den alten vom Fensterbrett austausche. Obwohl es erst Ende September ist, kann ich es kaum erwarten, dass sich der würzige Fruitcake-Duft im Raum verteilt und das Aroma von Orangen und Muskatnuss hinterlässt. Ein Hauch von Winter mitten im Herbst.
Ich krame meine Kuschelsocken und den kurzen Schlafanzug hervor und schalte die Lichterketten über dem Spiegel mit den Trockenblumen an. Nachdem ich mich umgezogen habe, hole ich mir den Laptop vom Schreibtisch, fläze ich mich auf den Überwurf und schaue einen Moment an die Decke über mir. Unzählige Sterne aus Fingerfarbe leuchten auf mich herab, werfen ihren Schein auf die dunkelblaue Wand. Vor ein paar Wochen noch, als ich aus einer Laune heraus spontan die Farbe besorgt habe, hätte ich nicht erwartet, wie sehr ich ihren Anblick lieben würde. Ein kleines bisschen Nachthimmel in meinem Zimmer.
Ich klappe den Laptop auf meinem Schoß auf, öffne Spotify und wähle den ersten True Crime-Podcast aus meiner Bibliothek. Wenn es irgendetwas schafft, mich zu entspannen, dann sind es Geschichten über Morde und Verbrechen. Doch wenige Minuten später, in denen ich nach neuen Backrezepten google und eine Tochter ihre eigene Großfamilie zerstückelt, kann ich nicht aufhören, die Kissen in meinem Rücken permanent zur Seite zu rücken, weil ich keine bequeme Position finde und nicht zur Ruhe komme. Letztendlich pfeffere ich sie vom Bett.
Immer wieder wandern meine Gedanken zu dem Flyer und Charly. Wie schon beim Bonfire flüstert mir mein rasendes Herz Dinge zu, die ich nicht hören will, obwohl ich zeitgleich nach ihnen lechze. Wäre da nur nicht diese Angst … Frustriert klappe ich den Laptop zu und verharre reglos in der Stille. Dafür macht mich nun das stetige Ticken der Wanduhr neben meinem Kleiderschrank nervös. Die leuchtenden Zahlen des überdimensional großen Ziffernblatts kommen mir plötzlich beinahe wie Zuschauer vor, die darauf warten, was ich als Nächstes tue. Aber ich habe absolut keinen Plan, weiß nichts mit mir anzufangen. Meine Gedanken verknoten sich zu einem wirren Knäuel: der Flyer, Charly, meine Eltern und die Wut auf mich selbst, weil ich nicht mehr in der Lage bin zu handeln.
Und dann überfällt mich mit einem Mal die Erinnerung an Charlys enttäuschten Gesichtsausdruck. Meine Finger krallen sich wie von selbst in den flauschigen Überwurf. In einem anderen Leben hätte ich vielleicht weniger abweisend reagiert, hätte sie einfach eingeweiht und ihr von meinem Podcast erzählt. Oder ihr zumindest verraten, dass ein Teil von mir den Wettbewerb interessant findet. Statt mich zu verschließen, hätte ich mich Charly geöffnet. Hätte ich liebende Eltern gehabt, wäre mit Sicherheit alles anders gekommen. Traurigkeit sickert durch mich hindurch, dringt in meine Brust ein und verfestigt sich, macht meine Glieder schwer.
Ein Kloß in meinem Hals verhindert, dass ein Ton über meine Lippen kommt. Doch auf ein Schluchzen oder Tränen brauche ich ohnehin nicht zu warten. Mein Körper hat sich daran gewöhnt, dass das nichts bringt.
Denn da ist keine Mom, die ihn tröstend in die Arme nimmt und hält.
Mich hält.
Ich nage auf meiner Unterlippe herum, finde mit der Zunge die winzige Narbe kurz vor meinem linken Mundwinkel und fahre immer wieder darüber. Jeder Millimeter davon steht für das, was ich nie hatte. Für denjenigen, der mich noch weniger wollte als meine Mom. Mein Erzeuger. Ununterbrochen driften meine Gedanken zu Mom und dem Mann, der ihr das Herz gebrochen hat. Der dafür verantwortlich ist, dass ich mit gerade einmal zwei Jahren plötzlich ohne Vater aufwachsen musste. Dass sich der einzige Elternteil, der mir nach seinem Weggang geblieben ist, in Arbeit vergräbt und Emotionen als lästiges Übel ansieht. Seit siebzehn Jahren bin ich allein, weil mein Erzeuger lieber durch die Staaten reisen will, anstatt mit mir und Mom eine Familie zu sein. Ihm sind die anderen Rollen wichtiger, die er an den Schauspielhäusern New Yorks ergattern kann. Also schlug er an Moms Geburtstag ihre Bitte aus, bei uns zu bleiben und sesshaft zu werden. Seitdem ist dieser Tag ruiniert, gilt bei uns als der Tag, der alles veränderte. Ich glaube, ich habe sie danach nie mehr lächeln gesehen. Dafür weinen. Anfangs gab es so viel Weinen. Bis sie irgendwann dazu überging, sämtliche Gefühle einzusperren, auch die für mich. Ihr Job als Dolmetscherin wurde zu ihrem einzigen Lebensinhalt, und ich war allein. Lernte, mich in ihr Ebenbild zu verwandeln, mich wie sie zu verhalten. Sie eine Zeit lang zu kopieren. Denn so schrie sie mich nicht an, sondern schwieg. Trotzdem reichte es nicht. Ich reichte nicht.
Spätestens an der Highschool begriff ich vollends, dass es neben meiner noch andere alleinerziehende Mütter gab. Einige trugen so viel Liebe und Hingabe in sich oder opferten sich für ihre Kinder auf, weshalb ich wütend wurde und Mom oft Vorwürfe machte. Darauf reagierte sie jedoch mit noch mehr Nichtachtung oder strafte mich mit weiteren Zurückweisungen. Vermutlich wäre das ewig so weitergegangen, wäre da nicht dieser eine Nachmittag gewesen. Dieser eine Nachmittag, an dem ich mir die Narbe zugezogen habe. An dem ich mit fünfzehn Jahren bei meinem Erzeuger einen Versuch gestartet habe, meine Gefühle preiszugeben, indem ich vor seiner Tür gestanden und ihn darum gebeten habe, bei ihm wohnen zu dürfen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwem noch mehr egal bin als Mom. Wobei egal nicht ganz stimmt. Mich vor sich stehen zu sehen, hat er gehasst. Alles an meinem Dasein war ihm zuwider.
Seit diesem Nachmittag vor nunmehr vier Jahren existiert der Wörterwirbelsturm-Podcast. Weil es sicherer ist, mich nur in meinem Kopf und auf meiner Festplatte zu öffnen. Es verletzt mich nicht, deswegen sind die Audiodateien die einzigen Zeugen meiner Worte. Sie kennen mich besser als irgendjemand sonst.
Ich kralle meine Finger noch stärker in den Überwurf, als könnte ich mich daran festhalten, um mich nicht in der Erinnerung zu verlieren.
Ein paarmal tief einatmend lasse ich den Stoff wieder los und klappe meinen Laptop erneut auf. Mein Blick huscht hin und her, landet abermals auf dem Flyer. Bevor ich darüber nachdenken kann, gebe ich die Worte Wettbewerb 101.1 BigBeat in die Suchleiste ein. Die Buchstaben rauschen förmlich an mir vorbei, weil ich in Gedanken viel zu beschäftigt damit bin, die Gesichter meiner Eltern in den Hintergrund zu drängen. Unter der Traurigkeit ätzt sich die Wut von vorhin einen Weg in alle Richtungen. Es ist, als würde sie durch sämtliche Venen fließen und meine Finger auf dem Touchpad drängen, sich schneller zu bewegen.
Das Problem an einem Neuanfang ist nicht, sich einmal dafür zu entscheiden, sondern immer wieder Ja zu ihm zu sagen. Mit meinem Umzug habe ich es getan, das war der Beginn. Doch seit ich hier bin, ist dieses Ja so unscheinbar, dass ich es kaum erkennen kann.
Vielleicht ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, ein weiteres, deutlicheres hinzuzufügen.
Ich lade den Fragebogen für den Wettbewerb herunter, speichere die Bedingungen und Richtlinien und scrolle durch die Liste meiner Aufnahmen.
Wenn ich die Vergangenheit hinter mir lassen möchte, führt kein Weg daran vorbei, dass ich mich öffne. Ohne Veränderung kein Neustart. Ich muss mich ja nicht sofort anmelden oder Charly in jedes Detail meines Lebens einweihen. Kleine Schritte sind in Ordnung. Die Bewerbungsfrist dauert noch zehn Wochen, das ist ausreichend, um eine Entscheidung zu treffen. Der Gedanke, meinen Podcast dafür hochladen zu müssen, bereitet mir Magenschmerzen. Dennoch lege ich im kühlen Schein des Laptoplichts einen Ordner an. Es ist eine Möglichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Ich kann es immer noch verwerfen.
Gegen meinen Willen drängen sich Erinnerungen an die Oberfläche. Erinnerungen an kleine Zettel, die ich Mom mit zehn unter ihrer Schlafzimmertür hindurchgeschoben habe.
Mommy, ich habe dich lieb.
Mommy, wir brauchen Daddy nicht.
Mommy, darf ich heute bei dir schlafen? In meinem Schrank sind Monster.
Nach kurzer Stille war da jedes Mal ein Rascheln von Papier, mit dem Mom meine Worte weggeschmissen hat.
Einen Moment erstarre ich, mein Zeigefinger schwebt über dem Touchpad. Gefühle zu zeigen, macht angreifbar, es kann wehtun.
Aber es muss nie mehr so sein, oder? Deshalb bin ich schließlich in Maple Hill.
Zitternd fülle ich die Datei mit Informationen über den Wettbewerb aus und rufe die Webseite des Colleges auf. Mir ist schon vor Wochen ein Workshop ins Auge gefallen, den ich nicht weiter verfolgt habe. Dafür war die Furcht vor dem, was geschehen könnte, zu groß. Doch heute ist es anders. Heute ist die Hoffnung stärker, dass ich es schaffe, meinen Neuanfang voranzutreiben.
»Podcast und Synchronisation«, murmele ich, während ich die alphabetisch geordnete Angebotsliste an freiwilligen Kursen überfliege.
Wenn ich bei 101.1 BigBeat eine Chance haben will, muss ich bestens vorbereitet sein. Heimlich Sätze ins Mikrofon zu sprechen, reicht dafür nicht aus, und Podcasts zu hören genauso wenig. Ich benötige mehr Fachwissen über das Thema. Zwar müsste ich meinen Stundenplan umwerfen, könnte nur wenige meiner Pflichtseminare belegen und müsste sie stattdessen nächstes Semester machen, doch das wäre es wert.
Als ich in der Liste bei P ankomme, halte ich automatisch die Luft an, klicke auf den Link und spüre deutlich meinen Puls am Hals. Während die Seite lädt, wird das Pochen intensiver, zieht sich schließlich bis zu meinen Ohren hoch, bis es darin dumpf rauscht. Wie gebannt starre ich auf die Zeilen vor mir:
Podcast und Synchronisation
Dozent/in: Professor Dr. Dawson und Gast-Podcaster
Zeit: Vom 09/22/2024 bis zum 12/22/2024, Mittwoch und Donnerstag 12:15 Uhr – 16:45 Uhr
Anmeldefrist: 09/20/2024
Ein rascher Blick auf die Anzeige des Laptops verrät mir die Uhrzeit. Mir bleiben noch dreizehn Minuten, um mich anzumelden. In mir schießt die altbekannte Angst empor. Im Vergleich zu sonst brennt sie allerdings nicht alles nieder, sondern ähnelt eher einer winzigen Stichflamme. Aber der Funken Hoffnung, die Freude, mich beim Workshop anmelden zu können, ist glühender. Ein Lächeln zupft an meinen Mundwinkeln, und meine Finger lockern sich. In einer fließenden Bewegung stelle ich meinen Laptop auf den Boden, klettere aus dem Bett und schnappe mir den Flyer vom Hocker. Ich falte ihn auseinander, streiche ihn glatt.
Das ist sie: Die Chance, meinen Podcast und mich aus der Stille zu befreien.
»Heute«, sage ich leise. »Heute ist es anders.«
Kapitel 3
Ich bin nervös. Verflucht nervös. Im Sekundentakt schiebe ich die Puffärmel meines Pullovers hoch und runter, weil sich mein Körper nicht entscheiden kann, ob mir heiß oder kalt ist. Dazwischen, etwas zu beschließen und es tatsächlich umzusetzen, scheinen Welten zu liegen. Vierundzwanzig Stunden waren nicht annähernd genug, um mich an die Tatsache zu gewöhnen, dass ich ab sofort zweimal die Woche am Podcast-Workshop teilnehme und es sogar in Betracht ziehe, mich beim Wettbewerb von 101.1 BigBeat anzumelden. Der Drang, aufzuspringen und diesen Glaskasten voller Studierender zu verlassen, ist groß, trotzdem bleibe ich. Die Aussicht auf meine Chance hält mich in dem Seminarraum in schwindelerregender Höhe.
Unruhig lasse ich meinen Blick schweifen. Hinter mir befinden sich zwei Sitzreihen mit je fünf Plätzen, schräg gegenüber steht ein grellgrünes Pult, dessen Farbe an einigen Stellen abgesplittert ist und das helle Holz darunter preisgibt. Einige der Teilnehmenden tuscheln darüber, wer der Gast-Podcaster sein könnte, der den Workshop mit begleiten soll, weshalb ich versuche, rasch wegzuhören, um meine Nervosität nicht zusätzlich zu steigern. Doch die Neugierde siegt, als eine Frau mit Latzhose hinter mir Namen nennt, die mir allesamt unbekannt sind. Seit gestern schwirrt mir eine der erfolgreichsten True Crime-Podcasterinnen im Kopf herum. Stella Koenig. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet sie, die über eine Million Zuhörende hat, gleich vor uns stehen wird, bleibt der Wunsch. Ich horche auf, verfolge das halblaute Gespräch zwischen ihr und einem Kerl im Karohemd.
»Wenn sie schon jemanden herholen, dann hoffe ich auf jemand wirklich Erfolgreichen«, wischt er ihre Vorschläge beiseite.
»Matthew Mercy ist erfolgreich und auch noch Synchronsprecher. Es würde also passen«, widerspricht sie.
»Trotzdem ist er nur in der Gaming-Branche bekannt.«
Sie zuckt mit den Achseln. »Wir werden sehen.«
Sie schweigen, und einen Moment lang überlege ich, ob ich meine Favoritin ins Spiel bringe, aber lasse es sein. Mich einzumischen und mich mit ihnen über Podcasts zu unterhalten, überfordert mich. Ich habe es hierher geschafft. Ein Schritt nach dem anderen. Ich wende mich von ihnen ab, schaue umher und bleibe bei meiner neben mir sitzenden Kommilitonin hängen, die an den Steinchen auf ihren Fingernägeln knibbelt und durch ihren nervösen Gesichtsausdruck so wenig bereit wirkt wie ich. Sie verschränkt ihre Füße unter dem Stuhl. Das Pink ihrer Plateauschuhe passt perfekt zum Ton ihres Lippenstifts. Ein paar der anderen Anwesenden rutschen auf ihren Stühlen hin und her, die mit kleinen Rädern und Klapptischen verschraubt sind, wodurch sie bei ihren Bewegungen knarzen. Während bei jedem Geräusch peinlich berührte Blicke durch den Raum schießen, spähe ich über meine Schulter zum Eingang, weshalb mein über der Lehne hängender Parka und mein Rucksack rascheln und das Holz ächzt. Ich kann die Angst, dass jemand hereinkommt, den ich kenne, einfach nicht abschütteln. Denn hier zu sein, kommt meinem Geheimnis viel zu nahe. Mir und meinem Wörterwirbelsturm, meinen Gedanken. Ich bin, was ich dort sage.
Tief durchatmend lehne ich mich zurück, wobei der Stuhl unangenehm laut knarzt, und betrachte das gelb-orange Blätterdach. Wenn ich das Fenster öffnen würde, bräuchte ich meinen Arm bloß auszustrecken und könnte die Äste eines dicken Ahornbaums berühren. Ich stoße geräuschvoll einen Schwall Luft aus und zucke zusammen, als von der Studentin neben mir ein ersticktes Flüstern ertönt: »Oh. Mein. Gott. Das ist doch …«
»Hm?«, mache ich.
»Das kann nicht sein.«
»Was denn?«
Irritiert folge ich ihrem Blick zum Eingang. Bevor ich den schlaksigen Typen im Türrahmen richtig betrachten kann, tippt dieser zur Begrüßung an seine Schläfe, woraufhin ein Raunen durch den Raum geht. Alle Blicke kleben regelrecht an ihm. Sein Gang ist zielstrebig, selbstbewusst, ohne eine Spur von Unsicherheit, obwohl er innerhalb dieser vier Wände der momentane Fixpunkt ist. Während in meinem Rücken das Getuschel erneut startet und meine Sitznachbarin wie erstarrt auf ihrem Stuhl sitzt, mustere ich ihn stirnrunzelnd. Meiner gestrigen Internetrecherche nach zu urteilen, ist er nicht Professor Dr. Dawson, sondern muss der Gast-Podcaster sein. Außerdem klingelt da was bei mir, dass mir sein Foto vor einiger Zeit auf Spotify angezeigt wurde. Ich fange wieder an, meine Ärmel nervös hoch- und runterzuschieben, und mir bricht endgültig der Schweiß aus. Vor meinem inneren Auge erscheint Datei für Datei meiner aufgenommenen Folgen. Einem Podcaster gegenüberzusitzen, rückt meinen eigenen Traum in unmittelbare Nähe. Was er macht, möchte ich auch eines Tages tun. Genau deshalb bin ich hier.
Der Mann hängt seinen Rucksack an den angebrachten Haken am Pult auf und lässt sich auf einem schlammgrünen Hocker in der Ecke nieder. Hoch konzentriert blättert er durch eine Mappe auf seinem Schoß.