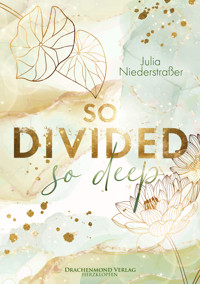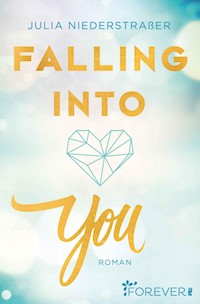3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe, die alles überwindet, und Freundschaft über alle Grenzen hinaus Lotte lebt ihr Leben für Max. Ihren großen Bruder, der viel zu früh gestorben ist. Der sie als einziger verstanden hat und der sie vor ihren strengen engstirnigen Eltern verteidigt hat. Jetzt ist er tot und Lotte lebt dort weiter, wo er aufgehört hat, selbst wenn sie im Grunde etwas ganz anderes in ihrem Leben tun will. Sie zieht zu Hause aus und studiert Medizin, genau wie Max. Sie nimmt einen Nebenjob in einer Tagespflege für alte Menschen an. Wie Max. Und sie lernt dort Nick kennen. Den ehemaligen besten Freund ihres Bruders. Doch sie wird nicht schlau aus ihm: Einmal ist er nett und hilfsbereit, dann wieder kühl und zurückweisend. Nur langsam kommen sie sich näher, doch schließlich vertraut sie ihm an, was wirklich in ihr vorgeht. Aber Nick erzählt ihr nicht die ganze Wahrheit über sich und sein Leben…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wenn ich dich sehe
Die Autorin
Julia Niederstraßer wurde 1992 in Norddeutschland geboren und studiert in Kiel momentan Deutsch und Philosophie. Zuvor hat sie eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation abgeschlossen. Sie sitzt aufgrund einer Muskelerkrankung im Rollstuhl und liebt es daher die Charaktere ihrer Texte die Dinge erleben zu lassen, die sie selber nicht machen kann.
Das Buch
Lotte lebt ihr Leben für Max. Ihren großen Bruder, der viel zu früh gestorben ist. Der sie als einziger verstanden hat und der sie vor ihren strengen engstirnigen Eltern verteidigt hat. Jetzt ist er tot und Lotte lebt dort weiter, wo er aufgehört hat, selbst wenn sie im Grunde etwas ganz anderes in ihrem Leben tun will. Sie zieht zu Hause aus und studiert Medizin, genau wie Max. Sie nimmt einen Nebenjob in einer Tagespflege für alte Menschen an. Wie Max. Und sie lernt dort Nick kennen. Den ehemaligen besten Freund ihres Bruders. Doch sie wird nicht schlau aus ihm: Einmal ist er nett und hilfsbereit, dann wieder kühl und zurückweisend. Nur langsam kommen sie sich näher, doch schließlich vertraut sie ihm an, was wirklich in ihr vorgeht. Aber Nick erzählt ihr nicht die ganze Wahrheit über sich und sein Leben…
Julia Niederstraßer
Wenn ich dich sehe
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinOktober 2018 (1)
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-95818-323-0
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Danksagung
Leseprobe: Bis zum Ende und darüber hinaus
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für all diejenigen, die sich auf der Suche nach beruhigender Sicherheit selbst verlieren. Was würdest du tun?
Prolog
Was passiert, wenn die eifrig um sich geworfenen Floskeln ihren Inhalt verlieren? Zu weniger als abgedroschenen Lückenfüllern verkommen? Nicht einmal ein mildes Lächeln hervorrufen, weil sie schon zu häufig verwendet wurden? Und ihre aufbauende Wirkung einbüßen? Was passiert, wenn »Du kannst alles schaffen, wenn du nur darum kämpfst« und »Die Liebe besiegt alles« keinerlei Bedeutung mehr in sich tragen und zu Worthülsen werden? Ganz genau, es wird merklich düsterer in der Welt, in dir und deinem Herzen. Plötzlich ist die Erkenntnis da, dass sich ein Mensch nicht gegen alles auflehnen kann, nicht alles niederringen wird. Manches kann nicht aufgehalten werden, selbst wenn wir uns anstrengen. Das Einzige, was bleibt, ist die Hoffnung selbst. Dass sie uns unaufhörlich antreibt, nach dem einen Funken zu suchen, der uns belebt. Der all den verdammten Floskeln den Sinn wiedergibt.
Kapitel 1
Im Hier und Jetzt
»Heute Abend müssen wir auf jeden Fall skypen, damit ich unsere Wohnung auch endlich mal sehe«, forderte meine beste Freundin Emilia Wagner am mindestens tausend Kilometer entfernten Ende der Leitung, während ich Kitty in ihre Transportbox lockte.
»Wenn ich deine liebreizende Katze endlich abfahrbereit bekäme, könnten wir das sogar machen.« Stirnrunzelnd drapierte ich ein Leckerli in der Box und hoffte inständig, dass sich dieses langhaarige weiße Fellknäuel bewegte. Meine Zeit bis zu der Abreise war genau geplant, widerwillige Katzen passten da gar nicht rein.
»Sie wird schon mitkommen. Das macht sie immer, also entspann dich.«
»Sicher nicht. Ich bin jetzt ihr Frauchen, da sage ich, wo es lang geht. Wir werden nicht zu spät zu der Schlüsselübergabe kommen.« Entschlossen baute ich eine kleine Straße aus Leckerlis bis zu der Transportbox und setzte mich auf den gepackten Koffer.
»Ganz ehrlich, Lotte, das schaffst du nicht. Lass sie in Ruhe. Sie ist eben eine echte Lady«, kicherte Lia und fügte traurig hinzu: »Ach Mann, ich vermisse euch zwei. Vielleicht sollte ich doch zurückkommen. So toll ist die Familie hier nicht. Und Sri Lanka ist auch nicht gerade tierisch spannend. Ich könnte dir beim Studieren zugucken und dafür sorgen, dass du dich nicht nur auf die Uni konzentrierst.« Ihr diabolisches Grinsen konnte ich förmlich sehen und mir gut ausmalen, wie sie beinahe täglich versuchen würde, mich auf Partys zu schleppen.
»Lia, du bleibst schön da. Du ziehst das durch. Und ich auch. Danach sind wir wieder zusammen. Wir leben sogar zu zweit in einer Wohnung. Da werden wir uns gegenseitig so nerven, dass wir die Einsamkeit vermissen werden.« Was unmöglich war, zumindest für mich. Ich brauchte Gesellschaft, Menschen, die ich kannte. Oder eben Katzen, bis Lia zurück war.
»Meinst du, du schaffst das? Allein in Anden?«, fragte sie zaghaft und sprach damit direkt mein mit Schmerz besetztes Herz an. Max. Morgen hätten wir zusammen zur Uni gehen sollen. Er wäre mit mir an der Seite in das vierte Semester seines Medizinstudiums spaziert und hätte mir wie am Anfang jedes neuen Semesters alles gezeigt. Bis auf seine Freunde, denn er wollte die kurze Zeit, die wir die nächsten paar Wochen miteinander verbringen würden, nur uns widmen.
»Den Haufen sehe ich jetzt ständig, da werde ich ja wohl einen Nachmittag mit meiner kleinen Nervschwester verbringen können«, hätte er ernst gesagt und mir kurz die Schulter gedrückt, bevor die Führung weitergegangen wäre. Ich hätte währenddessen gelächelt, mir die riesigen Säle angeguckt und mich dabei gewundert, wie Hunderte verschiedene Menschen sich für ein und dasselbe interessieren konnten. Mit ruhiger Stimme hätte er unaufgeregt die Seminare aufgezählt, die er besuchen würde, und anschließend unser völlig überfülltes Lieblingscafé angesteuert, um gemeinsam einen großen Kakao mit Sahne, auf der winzig kleine braune Flocken des Schokopulvers versanken, zu trinken. Wache, kristallklare blaue Augen würden sich damit begnügen, dem beinahe unsichtbar aufsteigenden Dampf zu folgen, statt sich zu unterhalten, damit ich das Geschnatter der umliegenden Tische aufsaugen konnte. Um den unstillbar neugierigen Kindern meiner Nachhilfegruppe in der Grundschule neue Geschichten präsentieren zu können, die ich mit abenteuerlichen Helden und tapferen Prinzessinnen ausschmückte. Dadurch konnten sie sich alle mathematischen Fragen besser vorstellen.
Diese Prozedur hatten wir in den letzten drei Semestern durchgezogen, damit ich mir bei unseren Telefonaten genau ausmalen konnte, wovon er sprach. Um ihn genau zu verstehen, wenn er von seinem Tag erzählte. Einzig und allein, um ein Teil seiner Welt zu sein, zeigte er mir alles und schwieg, damit ich jedes Detail verinnerlichte. Beim ersten Mal hatte Lia nur mit dem Kopf geschüttelt und grinsend gemeint, dass wir mit diesem »Geschwisterliebe-ich-weiß-genau-was-du-brauchst«-Ding absolut übertrieben. Das mochte sogar sein, doch Tatsache war, dass ich mich niemals so verstanden und sicher gefühlt hatte wie bei Max. Meinem Bruder, der mich, anders als die Jahre zuvor, in den nächsten Tagen nicht in seine Welt holen würde. Mir nicht stumm versichern würde, dass wir uns niemals verlieren würden. Auch wenn er in der fünfhundert Kilometer entfernten Großstadt Anden studierte und ich als erfolgreiche Abiturientin so langsam meinen Eltern mitteilen musste, dass ich nach wie vor an dem Plan festhielt, Tanzlehrerin zu werden. Und doch war genau das passiert und hatte mein Herz zu einem riesigen Klumpen Schmerz und Einsamkeit werden lassen. Weil er unbedingt waghalsige Stunts mit einem Longboard vollführen musste, die ihm das Leben gekostet hatten. Mit einem bleischweren Gefühl, das mich morgens weckte und den ganzen Tag begleitete, würde ich nun in die Fußstapfen meines brillanten Bruders treten. Weil er es so gewollt hätte. Genau wie meine Eltern. Und ich.
»Lotte?«
»Ich muss jetzt auflegen. Wir reden später«, wimmelte ich meine Freundin ab und konnte mich noch zusammenreißen, nicht einfach aufzulegen.
»Ist okay. Aber versprich mir, dass du dich den Leuten öffnest. Vergrab dich nicht. Du kannst nicht nur mit meiner Katze reden, bis ich wieder da bin. Such dir Freunde, wie früher. Das hilft dir.«
Gepresst erwiderte ich: »Dafür werde ich keine Zeit haben, das weißt du. Außerdem habe ich doch Kitty und dich. Noch mehr Freunde, die gleißendes Licht in mein Leben bringen, und ich explodiere als Stern.«
Hastig legte ich auf. Verdammt, jetzt hatte ich es doch getan. Ich war ein unmögliches Miststück. Lia versuchte zu helfen und ich kanzelte sie einfach ab. Wie jedes Mal, wenn ich Gefahr lief, den Vortrag über die Macht der Liebe und Freundschaft zu hören. Laut Lia hatte ich nämlich vor genau einem Jahr eine Festung um mich errichtet, durch die nur besagte Liebe und Freunde durchdringen konnten, da sie feine Risse entdeckten und durchbrachen. Wie gleißendes Licht. Tja, zu schade, dass ich ein sehr genauer Mensch war, der keine blöden Risse zuließ.
Sauer funkelte ich Kitty an, die mich aus dunklen Augen musterte, in denen für mich alle Lebensweisheiten der Welt verborgen lagen. Regungslos sah sie mir direkt in die Augen, als ob sie mir genau diese gern an den Kopf werfen würde. Als ich langsam nervös wurde, setzte sie eine Pfote voran und ging mit wippendem buschigen Schwanz gemächlich in die Box. Die Leckerlis rührte sie nicht an. Unheimlich.
Unpünktlichkeit, wie ich sie hasste. Minutenlang hatte ich meine Nerven und etliche Leckerlis geopfert, um das heiß geliebte Satansknäuel rechtzeitig in die Box zu verfrachten. Mit dem Resultat, dass Lias Katze kein einziges davon anrührte und wir gemeinsam vor verschlossener Tür standen. Auf den Hausmeister wartend, in einer Straße, die ungefähr genauso einladend wirkte wie die Orte, in denen ein einsamer Strohballen über die Prärie wehte. Mit dem Unterschied, dass mir die Sonnenstrahlen nicht wärmend die Nase kitzelten, sondern unzählige Regentropfen, keine Tröpfchen, auf die Haut klatschten. Wieso musste es selbst im Sommer noch so kalt sein, dass ich mir für die wenigen warmen Tage im Jahr eigentlich nie Sommerkleider kaufen brauchte?
Obwohl einige Klingelknöpfe in dieser Straße mit Namen versehen waren, wirkte sie wie ausgestorben. In den Fenstern der ebenerdigen Wohnungen hatte ich keine Dekorationen oder Licht gesehen, geschweige denn Menschen. Das war mir schon bei dem ersten Treffen mit dem Eigentümer aufgefallen und trotzdem hatte ich unterschrieben, obwohl Lia nichts von all dem je gesehen hatte. Lediglich hier und da hängende weiße Häkelgardinen bewiesen, dass an meinem neuen Wohnort Lebewesen hausten, in welcher Form auch immer. Die Haustüren strahlten allesamt in einem einladend abblätternden Grau, als ob die Bewohner bloß nicht auffallen wollten und auch niemanden hereinbeten würden. Die Schlösser waren von Rost zerfressen. Nur vor dem Eingang, vor dem ich stand, schien beinahe alles abzuweichen. Zwar hingen in den Fenstern auch leblos weiße Häkelgardinen, die Tür aber blinkte schon fast inmitten der grauen Tristesse. Hellgrün lackiertes Holz und ein glänzend goldenes Schloss waren wirklich eine schöne Abwechslung, doch es roch nur so nach Eigenartigkeit.
Kitty jaulte in ihrer Box, die von Minute zu Minute schwerer wurde. Sie einfach abzustellen, fand ich herzlos, immerhin teilten wir das gleiche Schicksal. Außerdem traute ich es ihr durchaus zu, sich für ein liebloses Abstellen zu rächen. Man bedenke ihren dramatischen Gang in die Box. Beherzt presste ich das harte Gehäuse an meine Brust und ließ mich auf meinem dicken Koffer nieder. Dann warteten wir eben gemeinsam auf den unglaublich pünktlichen Hausmeister, der bereits fünf Minuten auf sich warten ließ.
Wieso konnten sich Menschen nicht an Abmachungen halten? Konnte doch genauso gut sein, dass ich zu einem Vorstellungsgespräch musste oder einer Freundin helfen sollte. Was voraussetzen würde, dass ich, schon ohne hier zu wohnen, welche gefunden hätte, was bei einigen durchaus der Fall sein konnte. Von daher bewies es einmal mehr die Gleichgültigkeit vieler, wozu der Hausmeister offensichtlich ebenfalls gehörte, denn er versetzte mich. Genervt pustete ich eine blonde Strähne aus meinem Gesicht, die aus meinem zu langen Pony in mein Auge pikte. Einen neuen Friseur würde ich mir also auch bald suchen müssen.
»Na, ich hoffe, Sie ham das Viech auch angemeldet, sonst könn Sie gleich wieder ausziehn.« Eine brummige Stimme lenkte meine Aufmerksamkeit die Straße hinab, in der gut zehn Meter von mir entfernt ein dicker, glatzköpfiger Mann auf die verstaute Kitty deutete und mich ungemein freundlich begrüßte.
»Dafür müsste ich erst mal einziehen«, erwiderte ich patzig und laut genug, damit er mich hörte. Kam zu spät und entschuldigte sich nicht mal.
Schnaufend kam er bei mir an, betrachtete mich und zeigte erneut auf die Box. »Ham Sie jetzt oder nicht?«
»Selbstverständlich. Ich ziehe doch nirgendwo ein, ohne den Vertrag gründlich zu lesen. Katzen sind erlaubt, noch dazu habe ich sie extra erwähnt. Sie können mir also mit gutem Gewissen den Schlüssel geben.« Prüfend musterte er Kitty, während er sich über seinen grauen Schnauzer fuhr. Glaubte er mir etwa nicht? »Sie können gern den Eigentümer anrufen, was Sie Zeit kostet, die übrigens eh schon äußerst knapp ist, weil Sie zu spät waren«, gab ich spitz zu bedenken.
»Immer sachte mit die junge Pferde, junge Dame. Ich will nur keinen Ärger, für uns bede nicht.« Klimpernd zog er einen riesigen Schlüsselring von der Schlaufe seiner Hosentasche, mit dem er mir ohne Weiteres eins überbraten und mich ausknocken könnte. Gemächlich schob er einen messingfarbenen Türöffner nach dem anderen weiter und pfiff dabei. Mit jedem grellen Ton, der direkt von meinen Ohren in mein »Geduldsbecken« geleitet wurde, eine Erfindung seitens Lia, weil ich häufig zu ungeduldig war, schwappte immer mehr davon über. Meine Ungeduld stieg. Um den Hausmeister anzutreiben, starrte ich ihn an. Nonverbale Kommunikation, andernfalls hätte ich ihn nur noch mehr angeblafft.
»Da isser ja.« Triumphierend streckte er mir einen kleinen Schlüssel entgegen, nach dem ich greifen wollte, als ich zögerte. Eine feine Nervosität ergriff mich für den Bruchteil einer Sekunde. Mein neues Leben begann also genau jetzt. Allein. Hastig überging ich diesen Gedanken und schnappte mir den Schlüssel. Nuschelnd bedankte ich mich, stellte die Katzenbox kurz auf den Boden und wandte mich ab, um endlich reinzugehen.
»Wenn Sie immer so hektisch sind, kriegn Sie noch nen Herzkasper. Machn Sie ma langsam«, ertönte es hinter mir, was ich mit einer Handbewegung abtat.
»Ja. Danke, ich werde es mir merken«, antwortete ich möglichst neutral, schloss die Tür auf und hastete mit Kitty durch den Türrahmen. Umständlich versuchte ich, die Box abzustellen. Was durch den engen Flur erschwert wurde, da die Tür nicht bis zum Anschlag einladend aufschwang, sondern gerade breit genug war, um durchzugehen. Zeitgleich hievte ich meinen Koffer mit einer Hand über die niedrige Schwelle, denn natürlich war er nicht wie seine etwa zigtausend anderen Artgenossen mit kleinen geschmeidigen Rollen ausgestattet. Eklig quietschende hätte ich sogar liebend gern in Kauf genommen. Angestrengt bewegte ich ihn einen Millimeter, als mir die massige Hand des Hausmeisters federleicht meinen Koffer abnahm.
»Wieso sagn Sie denn nix? So kommn Sie auch nich schneller rinn.«
»Danke schön«, gab ich kleinlaut von mir und quetschte mich zügig an die Seite, damit er fast ungehindert an mir und Kitty vorbeikam, um den Koffer abzustellen.
Er musste sich mit stapfend winzigen Schritten auf der Stelle drehen, um sich mir zuzuwenden. Lia und ich würden in Zukunft schön nacheinander den Flur entlanggehen müssen, andernfalls würde eine von uns regelmäßig mit der Wand verschmelzen.
»Ham Sie noch mehr? Oder wars das?« Freundlich schaute er mich fragend an. Jap, ich hatte eindeutig wieder einmal einen Hirnaustausch nötig. Dieser merkwürdige Kauz, so spät er auch gekommen war, war nett und ich bombardierte ihn mit meiner schlechten Laune, nur weil ich mit Unpünktlichkeit nicht klarkam.
»Der Rest kommt morgen mit einem Transporter, aber danke. Und entschuldigen Sie bitte meine Laune, ich bin nur …« Ich stoppte unschlüssig, während der Hausmeister brummig lachte.
»Sehr genau, würd ich ja sagn. Schon gut, junge Dame, komm Sie ersma richtig an un entspann Sie sich. Wenn was is, einfach bei Bo Messner klingln, das bin ich.« Zwinkernd drängte er sich an mir vorbei, sodass ich krachend gegen die Tür geschoben wurde.
Von plötzlicher Stille umgeben, stellte ich Kittys Box so leise wie möglich ab und zuckte trotzdem zusammen, als das dumpfe Aufeinandertreffen von Plastik und Holz zu hören war. Mit einem Klicken öffnete ich die gitternde Versperrung, während Kitty sich nicht rührend geradeaus blickte und nicht einmal blinzelte. Kopfschüttelnd erhob ich mich und zerrte meinen Koffer in mein Zimmer. Diese Katze war noch wesentlich abgedrehter, als ich gedacht hatte. Eine menschliche Diva war nichts dagegen.
»So, pass auf, ich dreh jetzt den Schlüssel um und dann beginnt deine ganz persönliche Wohnungsbesichtigung. Ich hab bisher nur mein Zimmer eingerichtet, bei allem anderen warte ich. Also gebrauche deine Fantasie, sonst ist es wirklich ein bisschen kahl.«
Ich zelebrierte das Öffnen der Tür, indem ich enthusiastisch die Melodie von Our House summte und das Tablet so nah hielt, dass Lia per Videoübertragung quasi im Türschloss saß. Ganz langsam bewegte ich den Schlüssel, als meine beste Freundin aufgeregt quiekte: »Verdammt, Lotte, sieh zu! Ich will unser Lilo-Heim sehen.«
»Geduld ist eine unglaublich hilfreiche …«
»Mach schon! Scheiß auf deine blöde Geduld, die hast du selber nicht. Mein Geduldsbecken ist sogar noch größer als deins«, unterbrach Lia mich nervös, woraufhin ich schwungvoll die Tür öffnete und eintrat.
»Unser Flur, auch gut geeignet als Tanzsaal. Einen Gast hätten wir da schon.« Grinsend schwenkte ich von den beengenden weißen Wänden zu der nach wie vor majestätisch starrenden Katzenstatue in der Box. »Sie bewegt sich kein Stück«, erklärte ich dem tadelnden Blick im Tablet.
»Hast du die Decke etwa nicht ausgepackt? Erst dann fühlt Kitty sich wohl und kommt raus. Das hab ich dir doch gesagt. Oder? Hab ich doch?« Zweifelnd wischte sie sich eine rosa Haarsträhne aus dem Gesicht und klemmte sie hinter ihr Ohr, die jedoch sofort wieder entwischte, weil sie zu kurz war.
»Soll ich ihr die Decke als roten Teppich ausrollen oder reicht es, wenn ich das später erledige?«, schnaubte ich entrüstet und unterbrach Lias aufgebrachtes Mundöffnen, indem ich hastig hinterherschob: »Wohnung oder Kitty?«
Nickend stimmte sie zu und ich drehte das Tablet nach wenigen Schritten nach links. »Unser Spa-Bereich.« Auch hier waren die Wände in Weiß gehalten und erdrückten Besucher dieser Örtlichkeiten. Schlauchförmig bot dieser Raum lediglich Platz für eine Toilette, ein Waschbecken und eine kleine Badewanne, die zur Dusche umfunktioniert werden konnte, die ebenfalls allesamt weiß waren. So wenig Wellness diese paar Zentimeter auch versprachen, genau so wollten wir es. Wir legten mehr Wert auf die Küche und unsere eigenen Zimmer, da konnte man ruhig Abstriche im Badezimmer machen.
Stumm nahm Lia dieses unspektakuläre Zimmer auf, sodass ich mit ihr in den gegenüberliegenden Raum schritt. »Halt dich fest, jetzt kommt unsere Küche, und die ist wirklich …«
»Der absolute Wahnsinn«, kreischte sie und übertönte dadurch mein »richtig schön und praktisch«. Ich stellte mich in die Mitte des kreisrunden Raums und musste dabei auf der hellgrünen Kücheninsel Platz nehmen. Die Arbeitsoberfläche war in einem hellen Grau gestrichen, mit feinen Maserungen, die dem modernen Kochtraum ein edles Aussehen verliehen. Im Halbkreis ringsherum warteten hellgraue Küchenmöbel auf ihren Einsatz und ein noch hellerer grüner Kühlschrank auf seine Befüllung.
»Wir werden nur noch kochen, Lotte. Und jeden einladen, der uns gefällt. Wie früher. Es war so eine gute Idee von dir, dass wir die Küche übernehmen und nicht neu kaufen. Das Beste daran ist aber, dass ich jetzt schon sagen kann, dass das alles zu uns gehört. Ich weiß gar nicht, weshalb ich dich überreden musste, die Wohnung zu nehmen, ohne dass ich sie gesehen habe. War doch klar, dass ich sie mag, du kennst mich doch.« Mit großen begeisterten Augen sprudelte Lia los und forderte die Besichtigung unserer Zimmer ein.
Nie im Leben hätte ich mich darauf eingelassen, eine Wohnung zu mieten, ohne dass ich selber drin gewesen war. Abgesehen davon, dass im Original fast immer alles anders aussah, musste man den Ort, den man Zuhause nennen sollte, doch wenigstens einmal gesehen haben. Um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Ich trat aus der Küche hinaus, warf einen kurzen Blick auf Kitty, die immer noch in ihrer Box saß, und strebte die rechte Tür hinter der Küche an. Unsere eigenen Reiche lagen am Ende des Flurs, von denen das linke meins war. Zuerst würde ich also Lias betreten, ansonsten würde sie vor Aufregung bald durchdrehen. Das Licht, das bisher nur von einer herunterhängenden Glühbirne gespendet wurde, schaltete ich an und begab mich in die Mitte des Raums, wie zuvor in der Küche.
»Toll, jetzt bin ich enttäuscht«, kam es traurig von Lia, die sich auf ihr Lippenpiercing biss.
»Komm schon, was hatte ich dir gesagt? Fantasie! Wenn du in ein paar Wochen hier bist, krempelst du alles um. Dieser leere, langweilige weiße Raum wird dann explodieren, glaub mir. Du bist gar nicht in der Lage, unsere Wohnung in Ruhe zu lassen«, versuchte ich sie aufzubauen und ging extra aus ihrem kargen Zimmer. Im Flur drehte ich mich mit dem Tablet einmal um die eigene Achse, während ich vorsichtshalber die Arme einzog, um nicht wie eine Windmühle die Flügel von den Wänden gestutzt zu bekommen. »Du hast doch garantiert schon Pläne, wie unser Tanzsaal aussehen soll«, grinste ich sie an.
»Wir könnten Spiegel aufhängen, dann sieht alles größer aus«, überlegte sie und ihr Blick huschte hin und her. Das war hoffentlich nicht ihr Ernst. Das Einzige, was größer aussehen würde, waren unsere zerknautschten Gesichter am Morgen, die uns schlaftrunken von allen Seiten anstierten.
»Und ein wenig Farbe brauchen wir. Was auch definitiv in den anderen Räumen der Fall ist. Dieses permanente Weiß geht gar nicht. Ich hoffe, dein Zimmer ist schon etwas lebhafter.«
»Quasi. Der Kram kommt ja erst morgen, von daher erwarte nicht zu viel«, erwiderte ich zaghaft. Selbst wenn mir die Möglichkeiten sämtlicher Dekorations-, Möbel- und Malerläden zur Verfügung stünden, gäbe es keinen Farbtornado in meinem Zimmer.
Beherzt öffnete ich die Tür und lief einmal das kleine Viereck ab, das ab sofort mein neues Heim sein würde. Die Isomatte hatte ich bereits ausgerollt, für eine Nacht würde mein neunzehnjähriger Rücken Verständnis haben müssen, zwei Fotografien von Max und mir bei meiner ersten Party im dorfeigenen Club und von Lia und mir, auf einer Schaukel sitzend, zierten das Fensterbrett. Links daneben befanden sich zwei flauschige große schwarze Kissen, die ein kirschrotes umrahmten. Ich hatte sie mit Klettverschluss an die Wand gepappt. Darunter lag eine ebenso schwarze Kuscheldecke auf dem Boden, sodass ich dort gemütlich lesen und Kakao trinken konnte. Morgen würde dort noch ein niedriger dunkelroter Beistelltisch stehen. Ein schwarzes Bett mit leichten Schnörkeln am Gestell, eine schwarze Kleiderstange und ein Schreibtisch in derselben Farbe vollendeten mein Zimmer. Die Wände würden weiß bleiben, nur unzählige dunkle Regale für meine Bücher würden etwas Abwechslung reinbringen und die weißen Wände verdecken. Mein Bedarf an Einrichtung war damit gedeckt. Lia konnte dann noch ein paar farbige Accessoires reinstellen, wenn sie unbedingt wollte, alles andere ließ sie garantiert nicht zu.
Schweigend sah sie mich aus dem Tablet an und seufzte: »Liselotte, du hast dich wirklich verändert. Nur deine kleine Ecke, die übrigens nicht noch winziger hätte geraten können, schreit nach dir.«
Immer wenn mich jemand bei meinem vollen Namen nannte, hatte ich das Gefühl, gehorchen zu müssen, nicht mehr ich selbst zu sein. Innerlich wirbelten federleichte Schneeflocken durch meinen Körper, die merkwürdigerweise immer schon da waren. In den Untiefen meiner Zellen verbreiteten sie eine stetig feine Kühle, die jederzeit spürbar war. Bei der Erwähnung meines Geburtsnamens verursachten sie Schicht für Schicht eine stechende Kälte, die mich jemand anderes werden ließ. Ich fühlte mich dann nicht länger willkommen in meinem eigenen Körper und reagierte nur. Max hatte ich einmal versucht, dieses Gefühl zu beschreiben. Als ich dreizehn Jahre alt gewesen war, waren mir seine bedauernden Blicke aufgefallen, sobald mich unsere Eltern »Liselotte« nannten, und das geschah häufig. Eigentlich immer.
Sechs Jahre zuvor
Wieder einmal saß ich vor meinen Latein-Hausaufgaben und versuchte, die brennenden Tränen zu unterdrücken. Wenn sie nicht flossen, waren Mutter und Vater glücklich. Ein strebsames Mädchen lernte nun mal. Da konnte ich noch so gern zum Videoclip-Dancing gehen, Latein war einfach wichtiger. Schließlich sahen mich meine Eltern schon gemeinsam mit Max die Medizinwelt revolutionieren. Wenn meine sonst eher geradlinige und nüchterne Mutter beschrieb, was einmal aus ihren Kindern werden würde, konnte sie sogar sehr malerisch werden. Mit entzückten Augen schilderte sie uns beinahe täglich, wie wir wegen irgendeiner bahnbrechenden Entdeckung im Blitzlichtgewitter unsere funkelnden Preise entgegennahmen und strahlend dabei lächelten. Natürlich nicht halb so sehr wie unsere stolzen Eltern. Das war das Ziel. Mit jungen Jahren so erfolgreich zu sein, dass die Medizin durch uns in die Presse kam.
Max schien keinerlei Probleme damit zu haben, ihn mussten sie nicht Maximilian nennen. Gerade erst vor ein paar Minuten musste ich wieder daran erinnert werden, was wichtig war. Max schaute dann neuerdings ganz betrübt und entschied sich gleich darauf, den Boden anzustarren. Das regte mich so auf. Jedes Mal schnürte es mir noch mehr die Kehle zu als ohnehin schon. Wieso fiel es mir so schwer, zu sagen, was ich wollte und dachte? Dann könnte ich meinen Eltern sagen, dass ich Medizin zum Kotzen fand. Und Latein sowieso. Dann könnte ich Max anranzen, dass er gefälligst mit mir sprechen und nicht blöd weggucken sollte. Was mich aufhielt, waren die traurigen Gesichter. Die Enttäuschung in glanzlosen Augen, weil etwas anders lief als erhofft.
»Lotte?«
Max kam nach einem kurzen Klopfen herein und gab mir somit einen Moment Zeit, die Tränen erfolgreich zu unterdrücken. Langsam drehte ich mich in meinem pinken Drehstuhl um und sah in sein halb erwachsenes Gesicht, das einige Meter von mir entfernt war und viel älter als siebzehn aussah. Er hatte sich auf mein Bett gesetzt und die Tür geschlossen.
»Was ist? Ich mache Hausaufgaben«, teilte ich ihm neutral mit.
Er musterte mich und lächelte dann. »Komm, eine kleine Pause, um mit deinem Bruder zu reden, wird dich nicht Stunden zurückwerfen. Außerdem hast du eh keine Lust, Hausaufgaben zu machen. Wer will das schon? Von daher kannst du auch gut mit mir reden.«
Richtig. »Doch. Das ist wichtig.«
Ernst zog er meinen Stuhl zu sich und schüttelte den Kopf. »Wieder falsch. Weißt du, woran ich das sehe? Du wirst zu einer Eisskulptur, wenn du was machst, was du nicht willst.«
»Das passiert doch nur, wenn ich ›Liselotte‹ höre«, wisperte ich leise und sah ihn erschrocken an.
»Das ist ständig so. Klar, dann besonders, aber meistens rennst du wie leblos durch die Gegend. Das ist schlimm. Was ist mit dir? Wenn dich die Pläne unserer Eltern so stören, wieso änderst du es nicht einfach?«
Beinahe ätzend fanden die zahlreichen Tränen den Absprung über die Wimpern und flossen über mein Gesicht. Meine Lippen zitterten und meine Hand suchte hastig den Weg zu ihnen, um sie zu verstecken. Gequält schob Max sie beiseite und hielt sie in seiner.
»Rede. Ehrlich, du musst endlich reden. Ich bin dein Bruder, irgendwann ist eine Grenze erreicht, bis zu der ich mich nicht mehr nicht einmischen darf. Aber Lotte, die habe ich schon längst verpasst. Du bist schon immer so gewesen. Und jetzt musst du reden, damit ich dir helfen kann«, flüsterte er ruhig, während er weiter meine Hand hielt. Ängstlich schaute ich ihn an. Was ich gleich sagen würde, klang absolut bescheuert. Einweisungswürdig.
Zitternd holte ich Luft und erklärte: »In mir, da ist was. Immer. Ständig habe ich das Gefühl, nicht ich sein zu können. Nicht komplett. Weil da etwas in mir ist, was wirklich stört. Und wenn man mich Liselotte nennt, bin ich gar nicht mehr ich. Es ist, als würden mich kleine Schneeflocken vereisen. Sodass es mich gar nicht mehr gibt. Wenn ich irgendwas mache, was anderen nicht gefällt, dieser Blick. Max, das kann ich nicht. Vielleicht mag mich dann niemand mehr. Da bin ich lieber eine Eisskulptur.«
Entsetzt betrachtete er mein Gesicht, entschied sich aber offensichtlich, dass mir das nicht half. Er zog kurz an meiner Nase, was er häufig tat, und sagte leicht lächelnd: »Na dann muss ich dich eben zwischendurch erinnern, dass eigene Entscheidungen auch nicht übel sind. Um es mit deinen Worten zu sagen, du hast übrigens eine blühende Fantasie: Dann versuche ich halt, die lästigen Schneeflocken wegzukehren.« Fröhlich wuschelte er mir durch die Haare und drehte mich mit Schwung in meinem Drehstuhl herum.
Im Hier und Jetzt
»Max mochte es ein bisschen nüchterner. Und ich auch. Das Zimmer ist gut so«, antwortete ich knapp und versuchte, die Kälte zu verdrängen. Nur wie sollte das funktionieren, wenn der Schneeflockenschieber nicht mehr da war?
Unergründlich bohrten sich Lias hellbraune Augen in mein Hellblau. »Wenn ich wieder da bin, arbeiten wir an deiner halbneuen Identität, ja?«
Nachdrücklich entgegnete ich: »Was meinst du denn? So bin ich halt, das war doch immer in Ordnung für dich.«
Seufzend nickte meine beste Freundin und murmelte, dass sie jetzt losmüsse, die Kinder sollten geweckt werden. Zügig ging ich zu Kitty und hielt das Tablet vor die Box, damit Lia sie sehen konnte, verabschiedete mich und legte auf.
Kapitel 2
Mittlerweile war unsere Wohnung schon fast ansehnlich. Jedenfalls wenn sich der neugierige Blick auf mein möbliertes Zimmer, das ich mir mit der äußerst eigensinnigen Katze teilte, das Bad und die Küche beschränkte. Mit geschlossenen Augen konnte der Flur ausgespart werden und Lias Zimmer wurde bis zu ihrem Einzug einfach nicht betreten. Zwar waren alle Wände nach wie vor kalkweiß, aber immerhin hatte ich in der Küche auf der Kochinsel meinen Kaffee-Vollautomaten platziert, sodass ich nur wenige Schritte, genau fünf, von meinem Zimmer aus brauchte, um mir schokoladige Köstlichkeiten anzustellen. Sollte jemals der Fall eintreten, dass mich ein Mann, meinetwegen auch Lia, morgens überraschen wollte, konnte der süße Kakaoduft also ungehindert zu mir wehen und mich wecken. Einige Pfannen und Kochutensilien hatten ebenfalls ihre Aufbewahrungsorte gefunden und auch im Bad konnte Leben entdeckt werden. Zahnbürste, Handtücher und Beautykrimskrams zeugten von einer bewohnten Unterkunft, genau wie meine Jacke und mein dicker roter Schal, die an der Flurtür an einem Haken hingen. Lia würde bei so viel heimeliger Geborgenheit entrüstet durch die Zimmer toben. Ich dagegen konnte wirklich gut damit leben. Es erinnerte mich an Max’ Zimmer in unserem Elternhaus in Sankt-Lieshütte. Spärlich, pragmatisch, unaufgeregt. Erst der Bewohner hatte dem Zimmer Leben eingehaucht. Genau wie Kitty und ich. Wir waren die derzeitige Attraktion der Wohnung, wobei der divenhaften Katze ganz klar der aufregendere Part zugeschrieben werden musste. Für ein Tier wies sie erstaunlich viele Eigenarten der Menschen auf.
Als die Besichtigungstour für Lia gestern beendet gewesen war, hatte ich mich an die Erfüllung der Kitty-braucht-einen-würdevollen-Einzug-Mission gemacht und tatsächlich den roten Teppich für die erstarrte Katze ausgerollt. Hoheitsvoll begutachtete sie jede meiner Bewegungen, während der weiche Untergrund vorsichtig vor der Königin aller Samttatzen ausgebreitet wurde. Erst nachdem ich mich wieder erhoben hatte, blinzelte sie einmal, als wollte sie mir mitteilen, dass ich es nicht vollkommen versaut hatte. Mit einem hohen Mauzen setzte sie sich in Bewegung und testete zaghaft mit einer Tatze den Härtegrad des Teppichs, um dann geschmeidig hinüberzugleiten. Ich meinte, in der Ferne ein gewichtiges Fanfarenspiel zu hören. Einzig der Umstand, dass der ausgerollte Teppich in Wirklichkeit rosa war und mit kleinen weißen ›Miau‹-Schriftzügen versehen war, ließ mich davor zurückschrecken, einen kleinen Knicks zu vollführen. Ohne sich umzudrehen, strebte Kitty direkt auf mein Zimmer zu und rollte sich bequem auf meiner Isomatte ein. Die Frage war, hatte Lia dieses kleine Wesen bereits im zarten Babyalter zu einer echten Königin herangezogen oder war es Queen K., die Lia formte, wie es ihr beliebte?
Meiner besten Freundin hatte ich abends noch ein Foto von der sehr zufrieden aussehenden Katze geschickt. Nicht, dass sie noch dachte, dass ich ihr geliebtes Tier einfach seinem versteinerten Schicksal in der Transportbox überlassen hatte. Meinen Eltern schrieb ich eine kurze Nachricht, dass alles in Ordnung war, woraufhin lediglich ein ›Schön‹ als Antwort kam. Immerhin regten sie sich nicht wieder darüber auf, dass ich ihr Geld nicht angenommen hatte, um in einem schicken Penthouse zu wohnen. Schließlich hatte ich endlich den richtigen Weg eingeschlagen, indem ich mich jetzt auch auf die Medizin konzentrierte, da konnte das Kind ruhig finanziell unterstützt werden. Wahrscheinlich wäre unsere Diskussion niemals beendet gewesen, wenn ich nicht nach etlichen Streitereien eingewandt hätte, dass Max ebenfalls auf eigenen Beinen gestanden hatte. Max würde in meiner Situation auch kein Geld nehmen, weshalb es absolut irrsinnig war, wenn ich es tat. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, hatte sich meine Mutter dezent über die Augenwinkel getupft, das Lockenwickler-gewellte blond gefärbte Haar nach hinten gestrichen und war aus ihrem Wohnzimmer gegangen. Mein Vater indes klopfte mir einmal auf die Schulter, fuhr sich über die Glatze und verließ Sekunden später den Raum. Seitdem konnte ich zwar ihre Missbilligung spüren, aber niemand sagte etwas. Warum auch? Im Grunde genommen verhielt ich mich ihrem Plan entsprechend, der nun auch zu meinem geworden war und offiziell in zwei Monaten im Oktober an der Universität in Anden begann.
Vorher wollte ich die Stadt kennenlernen und die Bibliothek angucken, damit ich vorbereitet war. Zwar hatte ich schon einiges durch meinen Bruder gesehen, doch dieses Mal würde alles anders werden. Die breiten Gänge, vollen Hörsäle und schwer tragenden Bücherregale würde ich nicht als Besucherin wahrnehmen, nicht als kurzzeitige Betrachterin, sondern würden in wenigen Wochen zu meinem Leben gehören. Ich erwartete keine völlig neuen Eindrücke, aber das Gefühl würde anders sein. Bedeutender, denn die Welt von Max war nun meine.
In der Innenstadt, die einst ein schlaksiger Mann mit zielstrebigen Schritten auf dem Weg zu seinem Nebenjob durchquert hatte, fehlte dieser blonde Lockenschopf. Sein freundlicher Blick fehlte in den Straßen, mit dem er jedem Passanten ins Gesicht schaute, weil er ehrlich daran interessiert war, an den Mienen zu erkennen, was sie fühlten. Aberwitzig blinkende Reklameschilder für die neusten Superangebote im Fitnessbereich, zurückhaltend urige Klimbim-Läden und fulminant funkelnde Schmuckstücke konnten ihn auf seinem Weg über die engen Kopfsteinpflasterstraßen der Einkaufsgasse nicht ablenken. Mein Gang würde mit Sicherheit anders verlaufen, mein Blick würde abschweifen, meine Beine zwischendurch stehen bleiben. Und doch würde ich dasselbe Ziel verfolgen. Ab morgen würde ich bei der Tagesklinik ›Ankerplatz der alten Andener‹ als Hilfskraft arbeiten, um mir das Studium finanzieren zu können. Für Max. Für mich. Und das war gut so.
»Es wird morgen alles klappen. Ich werde zu allen nett sein und die Leute dort zu mir. Ganz bestimmt«, erklärte ich Kitty alias Queen K., die mir auf ihrer Decke gegenüberlag, während ich auf meinem Bett saß und einem leisen Pianostück auf meinem iPod lauschte. Stumm betrachtete sie mich und ich fragte mich ernsthaft, ob ich nicht lieber anfangen sollte, mir Dating-Profile anzulegen, um nicht mehr mit emotionslos starrenden Katzen zu sprechen.
7:30 Uhr, und somit ganz genau sechzig Minuten vor meinem Dienstbeginn, stand ich unschlüssig vor einem meterhohen gusseisernen braunen Tor, das pfeilspitze Enden an jeder einzelnen Strebe besaß. Als Vogel würde ich nicht auf ihnen landen wollen. Neben dem Eingang wuchs auf beiden Seiten eine undurchdringbare Hecke, die durch winzige Dornen nichts Beschützendes an sich hatte, wie es etwa wild wuchernde Gartenhecken taten, indem sie ihren Bewohnern Privatsphäre boten. Vor diesem besucherfreundlichen Empfangskomitee strich ich meine Übergangsjacke glatt und zupfte den dunkelroten Long-Pullover zurecht, der darunter hervorlugte, sodass er über der schwarzen Leggins lag, und überprüfte die Sauberkeit meiner schwarzen Chucks. Der erste Eindruck zählte, auch wenn ich momentan eher das ungute Gefühl hatte, einen tattrigen, uralten, unfreundlichen, stinkreichen Greis zu besuchen, der seiner ungeliebten Nichte noch ein paar letzte Worte mitgeben wollte. Vielleicht war im Inneren des Anwesens etwas mehr Willkommensluft zu spüren. Auf meinem Weg hierher, von dem ich mir plötzlich wünschte, ihn langsamer gegangen zu sein, stiegen Bilder auf, bei denen ich von freudestrahlenden älteren Herrschaften umzingelt war, denen ich galant das Essen reichte. Meine Kollegen bedankten sich bei mir für meine tatkräftige Unterstützung, ohne die sie nicht zurechtgekommen wären. Fröhlich zwitschernde Spatzen untermalten das seltene Schauspiel, das ihnen geboten wurde.
Stattdessen empfing mich ein Mini-Haus, weil es in der Ferne noch nicht mal wirklich sichtbar war, ein halbes Gefängnisgatter und Dornröschen-Gewächs. Eine Klingel, damit ich reinkam, konnte ich auch nicht entdecken, geschweige denn ein Namensschild der Einrichtung oder Ähnliches. Bisher konnte ich also nur hoffen, dass ich hier richtig war und die Hausnummer elf, die ich im Internet gefunden hatte, auch tatsächlich hier stand. Die Zahlen über dem Tor waren leider so minimalistisch und abgeblättert, dass ich nur erahnen konnte, dass eine zweite Eins an die erste gepresst war. Ein kühler Windstoß fegte durch meine dicken langen Haare, blies sie nach vorn und hinterließ eine Gänsehaut auf meinem Nacken. Der tattrige Greis rief mich zu sich, griff mit seiner knöchernen Hand ins Leere und stieß zwischen bläulichen Lippen kalte Luft aus. Schaudernd schüttelte ich das Bild ab, griff ruckartig nach der großen, geschwungenen Klinke und rechnete damit, dass sie verschlossen blieb. Quietschend öffnete ich das schwerfällige, eiskalte Tor und schritt hindurch. Weshalb ein Gelände auf so einfache Art und Weise zu betreten war, obwohl es von außen nach einem Hochsicherheitstrakt aussah und laut Internetseite unter anderem von demenzkranken Personen besucht wurde, war hoffentlich gut begründet. Vielleicht sollte niemand rein und gleichzeitig war es innen so gemütlich, dass keiner freiwillig ging.
Vor mir erstreckte sich ein schmaler, gewundener Kiesweg, der von großen Kastanien umsäumt war. Ein Haus konnte ich nur anhand einer Dachspitze erkennen, weshalb es für den Moment nach einem Miniatur-Haus aussah, das hinter einer Kurve versteckt lag. Bevor ich diesen Weg einschlagen konnte, gabelte sich der steinerne Pfad. Links führte offensichtlich zu dem Gebäude, rechts dagegen wirkte wie der nächste Spaziergang in einen Wald. Ob Märchen- oder Monsterwald, war nicht zu erkennen. Die Bäume wurden von einer fernen Dunkelheit verschluckt, was mir nach meinem Alter-reicher-Mann-Szenario doch zu unheimlich war. Nervös bog ich um die Ecke und sah mich verwirrt um. Eben noch war dieser Ort eine Pflanzenfestung gewesen und jetzt glich er einem weiten, offenen Fußballplatz. Lediglich die weißen Markierungen und Tore fehlten, wobei die riesigen Kastanien, die auch hier wuchsen, durchaus als Rahmen eines Feldes gezählt werden konnten. Penibel gestutztes Gras wurde nur durch den Kiesweg, auf dem ich ging, unterbrochen. Vereinzelte Buchsbäume standen im gleichen Abstand am Rand des Weges und wiesen mir die Richtung zu dem Gebäude, das ich aus der Ferne erahnt hatte. Gigantisch groß erhob sich ein weißes Backsteinmauer-Haus mit blauem Dach und Fenster- und Türrahmen. Definitiv freundlicher als das Eingangstor und wesentlich größer, als das Mini-Haus aus der Ferne erahnen ließ. Je näher ich dem Haus kam, desto besser war ein angemalter Anker auf der Tür ohne Klinke neben der Eingangstür zu sehen, der von kleinen bunten Fischen umschwommen wurde, die gleichfalls aufgemalt waren. Über der Tür hing ein blaues Schild mit weißer Schnörkelschrift an der Wand, auf dem ›Ankerplatz der alten Andener‹ stand. Auch hier konnte ich wieder keine Klingel finden. Wollten die Leute niemanden empfangen oder war ihnen die Angst vor Überfällen völlig fremd? Entschlossen klopfte ich hart gegen die Tür, um hoffentlich jemanden auf mich aufmerksam zu machen. Beim nächsten Mal sollte mir bitte irgendeiner meiner Kollegen den Angestellteneingang zeigen, so was gab es doch bestimmt. In der Dunkelheit konnte ich jedenfalls nicht über das ausgestorbene Gelände hetzen und darauf hoffen, dass mich keine raschelnd knorrigen Äste zu sich in die verwachsenen Ecken zogen. Viel zu gruselig.
»Herzlich willkommen beim Ankerplatz, wo möchten Sie hin?«, leierte eine monotone Frauenstimme, die mich erschrocken zusammenzucken ließ. Hastig folgte ich der Stimme mit meinem Blick zu einem dicklichen Fisch an der Tür. Der kleine Lautsprecher, der in dem gelben Bauch eingearbeitet war, war mir gar nicht aufgefallen. Eigentlich ganz süß.
»Sie müssen schon reden«, kam es genervt aus dem grinsenden Unterwasserwesen.
»Ähm, hallo.« Musste ich jetzt direkt in den Lautsprecher reden oder sollte ich winken, weil mich die ungemein begeisterte Dame sehen konnte? Eine Kamera konnte ich aber nicht erkennen, auch die farbenfrohen Tiere oder der Anker wirkten auffällig unauffällig. Daher fuhr ich schnell fort, um die Frau nicht noch mehr zu reizen.
»Ich bin Lotte Ludwigson. Ich bin die neue Hilfskraft, heute ist mein erster Tag. Könnten Sie …«
Summend schwang die Tür ohne Bemalung auf und der Lautsprecher knackte. Auch eine Art der nonverbalen Kommunikation: wenig charmant, aber effektiv. Rasch schaute ich noch einmal auf den Lautsprecher-Fisch, der mir mit seinem Grinse-Gesicht, ganz im Gegensatz zu der Empfangsdame, ein gutes Gefühl gab, einzutreten. Beinahe geräuschlos fiel die Tür ins Schloss und ich stand im hell erleuchteten Foyer. Hohe cremefarbene Wände rahmten vier verschiedene Gänge ein, die ich von der Mitte aus wählen konnte. Auf der großen Wand mir gegenüber war ein überdimensional riesiger blauer Anker gezeichnet und darüber sah ich eine hellere rechteckige Form mit jeweils einem Loch in jeder Ecke. Offenbar hing dort normalerweise etwas, was momentan abgehängt war. Ansonsten blieben jede Wand und auch der Raum selbst ohne jegliche Bemalung oder Beschriftung. Unschlüssig ging ich zu jedem der Anfänge der Wege, konnte aber nichts außer gähnender Leere finden. Nicht mal Geräusche waren zu hören, kein Klappern von Geschirr oder Gemurmel von Menschen. Großartig, wie sollte man hier irgendetwas finden? Max hatte nie von den komischen Verhältnissen gesprochen, die sein Nebenjob für ihn bereithielt. Nicht, dass er oft von seiner Arbeit erzählt hatte, aber die Tendenz zu gruseligen Schnitzeljagden am Arbeitsplatz hätte er doch wirklich mal erwähnen können. Außerdem: Waren an solch einem Ort nicht die meisten Menschen etwas verwirrt? Sollten dann nicht wenigstens Wegweiser vorhanden sein, damit die älteren Zeitgenossen auch wieder zurückfanden? Gestresst schob ich meinen Jackenärmel nach oben, um auf meiner zierlichen goldenen Uhr zu gucken, wie viele Minuten mir noch blieben, bis meine Schicht begann.
»Bis auf Frau Süß frühstücken schon alle im Wintergarten. Elfie meinte aber auch, dass sie heute nicht kommt, also brauchen wir nicht zu warten. Holst du schnell die Luftballons und Schwimmnudeln? Ich hab sie gestern wieder in den Sport-Raum gepackt«, erklang eine helle Frauenstimme, gefolgt von zügigen Schritten, die aus der Richtung des rechten Gangs von der Ankerwand kamen.
Endlich. Aufgeregt hastete ich der Stimme entgegen. Als ich schon halb im Gang angekommen war, blieb ich abrupt stehen.
Ach du meine Güte.
Eine gertenschlanke, kleine Frau, die drei, vier Jahre älter als ich sein musste, kinnlange braune Locken hatte und mich aus Teddybär-braunen Augen fragend ansah, stand neben einem Mann, der mich sogar von ihrer eckigen, großen pinken Brille ablenkte und mir mit seiner bloßen Anwesenheit sämtliche Zugänge zu meinem ordentlich funktionierenden Gehirn verstopfte. Es gelangte nicht ein klarer Gedanke von meinem Hirn auf meine Zunge, um irgendwas Geistreiches zu sagen. Noch nahm ich wahr, was für Worte diese vollen Lippen formten, die durch den Dreitagebart etwas Verwegenes ausstrahlten. Schwindelig wabernde Stille legte sich um mich und mein Blut rauschte durch meine Adern. Mein Gehör weigerte sich, jenes Rauschen weiterzuleiten, nur die Erscheinung des wild winkenden Mannes vor mir erreichte meinen Sehnerv, von dem in meinem Inneren das wahre Chaos ausgelöst wurde. Erst als der durchtrainierte, mich eine Handbreit überragende Kerl vor meiner Nase mit dem Finger schnipste, befreiten sich die verschlossenen Zugänge zu meinem Gehirn. Wie bei einer zuvor verstöpselten Badewanne wurde der gierig fließende Wasserstrom eifrig eingesogen. Die Masse an Eindrücken überflutete mich, als hätte jemand den Ton wieder eingeschaltet. In meinen Ohren rauschte immer noch das Blut, aber ich konnte wieder denken. Jedenfalls fühlte ich mich wieder meinem Hirn zugehörig. Weshalb ich auch leider nur allzu bewusst wahrnahm, wie sanft die Bewegung seiner breiten Hand aussah, obwohl sie energisch vor mir her schnipste. Und wie dämlich ich mich verhielt. In der abgeschotteten Besinnungslosigkeit war mir das gar nicht aufgefallen.
»Bist du eine Patientin?«
Verdammt. Seine Stimme war unglaublich tief, hatte etwas Beschützendes und zeitgleich signalisierte sie mir eine ruhelose Resignation. Der unterschwellig gereizte Unterton mündete in einer verhallenden Traurigkeit, die fast schon monoton wirkte. Als wäre sie sein ständiger Begleiter, als hätte er beinahe aufgegeben. Was war los mit ihm?
»Hallo?« Jetzt wandte er sich der Frau zu und meinte stirnrunzelnd: »Vielleicht sollten wir Irmgard holen.«
Behutsam hob er den Arm und bewegte ihn in meine Richtung. Oh Gott, nicht berühren! Das wäre zu viel, garantiert. Ich musste mich konzentrieren. Was würde Max tun? Abgesehen davon, dass er bei dem Kerl vermutlich weniger ausflippen würde, würde er Herr der Lage sein wollen. Er würde ruhig bleiben, cool bleiben.
»Ne. ’tschuldigung. Ich bin Lotte Ludwigson. Ich bin die neue Hilfskraft. Ich irre hier schon ein bisschen umher, konnte niemanden finden. Die Beschilderung ist für mich … na ja, nicht so hilfreich gewesen. Was natürlich auch an meinem Orientierungssinn liegen könnte«, sprudelte ich piepsend.
Nächstes Mal musste ich definitiv ein weniger manisches Mäusemädchen sein. Sein starrer Blick aus warmen flaschengrünen Augen, die dicht beieinanderlagen und das ohnehin schon schmale Gesicht noch kleiner wirken ließen, zeigte mir deutlich, dass er mich immer noch zu dieser Irmgard bringen wollte. Im Gegensatz zu seinen weichen Gesichtszügen muteten die harten Kanten seines Kiefers beinahe gefährlich an, die jedoch schlagartig von seinen Augen abgemildert wurden. Ein Grün, wie es die sorgfältig verkorkten Weinflaschen aufwiesen, wenn sie an einem aufregend romantischen Abend im Dämmerlicht mit einem leisen Plopp geöffnet wurden. Wohlbehagen versprühend und einladend, in den Untiefen zu versinken, um Verborgenes zu entdecken. Blinzelnd versuchte ich, das dunkler werdende Grün wegzuwischen. Es lenkte mich viel zu sehr ab.
»Du bist also Lotte. Ich bin Nick, auch eine Hilfskraft. Eine im Übrigen, die sich immer noch fragt, ob du Schmerzen hast. Deine Augen waren ziemlich weit aufgerissen und du sahst irgendwie erstarrt aus.«
Ich wusste nicht, was besser gewesen wäre: seine merkwürdige Deutung meines Benehmens oder wenn er bemerkt hätte, dass er daran schuld war. Selbst die Frau, die ich völlig vergessen hatte und die nach wie vor neben ihm stand, taxierte unbewegt mein Gesicht und verdrehte die Augen. Vielleicht hatte ich mir ihren Blick auch nur eingebildet, denn sie schob sich grinsend vor ihn.
»Hey, ich bin Victoria, Altenpflegerin. Willkommen bei uns. Es ist hier tatsächlich etwas schwierig durchzublicken, aber daran gewöhnst du dich bald.«
»Also gibt es hier keinen Angestellteneingang?«, fragte ich entsetzt, woraufhin ein breites Grinsen auf ihrem rundlichen Gesicht erschien.
»Nö. Ist das schlimm?«
»Quatsch. Ich werde mich schon zurechtfinden«, beeilte ich mich zu antworten. Wenn es niemanden störte und sich alle daran gewöhnt hatten, würde ich das auch.
»Na dann komm, wir bringen dich zu Elfie, das ist die Leiterin der Tagesklinik. Danach kannst du dich auch in diese totschicken Arbeitsklamotten werfen wie wir und wir zeigen dir dann später alles.« Sie zupfte an der hellblauen Strickjacke, die sie trug, auf der oberhalb des linken Schlüsselbeins eine kleine Variante des gezeichneten Ankers gedruckt war und ihr Name stand. Sie bedeutete mir, ihr und Nick zu folgen, der mich ab und zu von der Seite musterte. Nervös kaute ich auf meiner Unterlippe herum, um mich von dem immer penetranteren Rauschen in meinen Ohren abzulenken. Das Problem war, dass ich mich fühlte, als würden sich kaum sichtbare Flammen den klirrenden Schneeflocken nähern, sie beinahe berühren. Und das hinterließ ein beängstigend danach strebendes, verlangendes Gefühl über meiner Bauchnabelgegend, während unterhalb des Nabels ein flauer Druck entstand. Ich war mehr als verwirrt.
Victoria und Nick durchquerten das Foyer, bis sie nach links gingen und somit den der Eingangstür am nächsten Gang wählten. Folgsam hielt ich mit ihnen Schritt.
Plötzliche meldete sich Nick unvermittelt zu Wort: »Du bist über eine halbe Stunde zu früh da. Hast du nichts anderes zu tun? Schlafen zum Beispiel?« Seine dichten braunen Augenbrauen trafen sich fast am Ende seiner Stirn. Diese war gut sichtbar, weil seine Haare, die so dunkelbraun wie nassgeregnete Holzscheite waren, zwar wild durcheinandergewirbelt waren, die Haut der Stirn aber nicht annähernd berührten. Die Flammen touchierten einige zitternde Flocken, doch die vielen kleinen Eiskristalle zogen sich mit kameradschaftlicher Stärke enger und enger zusammen, um standzuhalten.
»Ich wollte einfach pünktlich sein«, erklärte ich schulterzuckend und konzentrierte mich auf den cremeweißen Laminatboden, obwohl ich ihm gern erläutert hätte, dass mich manche Menschen auch einfach gelobt hätten, da ich so früh war.
Mein Wunsch nach Pünktlichkeit war offensichtlich ungemein fehl am Platz, denn auch Elfie blickte zerstreut von ihrem überfüllten Schreibtisch auf, als Victoria und Nick mich in ihr kleines Büro führten, das als einziger Raum auf diesem Gang lag. In das Zimmer passten gerade so ein blauer Schreibtischstuhl, der überquellende Schreibtisch und ein Aktenschrank. Anders als im Eingang waren die Wände zartblau gestrichen, während hinter Elfie ein Anker in Weiß zu sehen war. Das maritime Thema wurde wohl überall durchgezogen.
»Elfie, das ist Lotte Ludwigson«, fing Victoria an, mich vorzustellen, als die Leiterin auch schon freudig Schwung nahm, mit dem Stuhl am Schreibtisch vorbeirollte und Sekunden später direkt vor uns stand. Bei der Größe des Raums war vermutlich jeder Schritt zu viel. Strahlend ergriff sie meine Hand und sagte ernst: »Es freut mich so, dich kennenzulernen, wobei die Umstände natürlich ganz, ganz schrecklich sind. Der Tod deines Bruders hat uns alle erschüttert. Er fehlt. Umso schöner ist es, dass du da bist. Fühl dich hier wie zu Hause, denn für uns gehörst du quasi schon zu unserer kleinen Familie, so oft hat Max uns allen von dir erzählt. Auch, dass du oft auf Nummer sicher gehst, deshalb sollte ich mich ja eigentlich nicht wundern, dass du früh dran bist.«
Zwinkernd ließ sie meine Hand wieder los und erhob sich schnaufend aus dem Stuhl. Mit den gräulichen Dreadlocks, die von einzelnen lila Färbungen unterbrochen wurden, wirkte sie jung und flippig. Auch ihr buntes Flatterkleid und die rote Baumwollstrumpfhose verliehen ihr etwas Jugendliches. Nur in ihrem Gesicht konnte ich die vergangenen Jahre erkennen. Abgeschlafft verwiesen einige Hautfältchen auf ihre Generation der Mittfünfziger. Eine dicke Brille mit lila Glitzer-Gestell ließ ihre dunkelbraunen Augen noch wärmer funkeln. Eine Frau, die ich mir merkwürdigerweise so gar nicht in einer Tagesklinik für ältere Menschen vorgestellt hatte. Wobei auch Nick nicht ganz in mein Bild solch einer Einrichtung passte.
»Hallo, danke. Max hat auch viel von euch erzählt, deshalb freue ich mich auch sehr, hier zu sein. Ich dachte nur, dass es besser wäre, wenn ich früher da bin. Man weiß ja nie, was noch dazwischenkommt«, versuchte ich, zu erklären und von meiner kleinen Lüge abzulenken, was Victoria und Elfie lauthals lachen ließ.
Nick hingegen schnaubte, was meinen Blick auf seine Nase lenkte. Eine feine Delle zeichnete sich etwa mittig ab, als wäre sie schon mal gebrochen gewesen, und verstärkte mein Gefühl der Verletzlichkeit, die ihn durch seine vielschichtige Stimmlage aus Gereiztheit, Resignation und Traurigkeit umgab. Vielleicht interpretierte ich auch einfach ein bisschen zu viel in eine kleine Unebenheit seines Aussehens hinein.
»Liebes, hier wirst du ständig improvisieren müssen. Pünktlich sind wir nur bei der Medikamentenvergabe«, gluckste Elfie und legte ihren Arm um meine Schultern.
Wieso hatte sich Max für diesen Job entschieden? Das entsprach gar nicht seinem Charakter. Wir waren strukturiert und organisiert. Warum also dieser plötzliche Umschwung? Und weshalb hatte er fast nie von all den Leuten hier gesprochen, wenn er doch anscheinend mit ihnen über mich geredet hatte?
Elfie dirigierte mich aus ihrem Büro, während ich grübelnd mit Max beschäftigt war. Sie gab Victoria und Nick ein Zeichen, woraufhin sie verschwanden.
Bei der Führung erklärte Elfie mir, dass sie zwar die Leiterin sei, dass sie sich aber kaum Gedanken um die Finanzierung machen musste. Ein reicher Sohn eines bereits verstorbenen Besuchers dieser Einrichtung übernahm die Bezahlung. Ob widerwillig oder nicht, konnte sie nicht sagen. Jedenfalls hatte es der gute Herbert im Testament festgelegt, wodurch für die nächsten zehn Jahre täglich fünfzehn Senioren kommen konnten. Das Besondere an diesem Ort sei die Modernität. Menschen, die zu fit waren, um ins Altersheim zu gehen, aber trotzdem etwas Hilfe benötigten, konnten hierherkommen und mit uns, sprich besonders mit mir, ihren Alltag möglichst frei gestalten. Man würde alles selbst machen, die Wandgestaltung war beispielsweise eine Idee von Frederike, wer auch immer Frederike war. Neben ihren Ausführungen zeigte Elfie mir die Räumlichkeiten, sodass ich jetzt wusste, dass sich in dem nächsten Gang neben dem, in dem Elfies Büro war, ein großer Sportsaal versteckte. Dort stapelten sich Unmengen von blauen und roten Turnmatten, zwei Boxsäcke baumelten von der Decke. Elfie berichtete stolz, dass diese etwas leichter als die gängigen Modelle waren, damit sie mit nicht allzu viel Frust weggehauen werden konnten. Auf einem Wagen lagen Badminton-Schläger, Schwimmnudeln, die Nick vorhin holen sollte, Springseile und Bälle in verschiedenen Größen. Auf dem schlauchförmigen Weg, in dem ich Victoria und Nick kennengelernt hatte, verbargen sich ein riesiges Esszimmer mit kleinen Gruppentischen und dahinter ein gemütlicher Bastelraum, in dem Stifte, Kleber, Staffeleien und Pinselsets aus den Boxen quollen. Der letzte Gang hatte drei Ruheräume, in denen jeweils fünf Betten standen und einige Matratzen mit unendlich vielen Kissen auf den Böden verteilt waren. Am Ende führte sie mich wieder zurück zu dem Gang ihres Büros. Nach etwa fünf Metern wies er noch drei weitere Türen auf, die mir vorher nicht aufgefallen waren, da sie so weit entfernt waren. Der erste der drei Räume beherbergte Spinde für das Personal und das zweite Zimmer war mit drei Toilettenkabinen ausgestattet. Hinter der dritten Tür fand ich den Materialraum, in dem medizinisches Equipment gelagert wurde, von dem mir nur der Erste-Hilfe-Kasten und der Defibrillator gezeigt wurden. Mein Aufgabenbereich beschränkte sich auf Hilfsarbeiten, wie etwa das Anreichen des Essens, oder auf Freizeitaktivitäten. Zum Glück. Das gesamte Gebäude war entweder in Cremeweiß mit blauem Anker gehalten oder umgekehrt. In den Gängen selbst fühlte ich mich etwas erschlagen von den vielen diagonal angebrachten kleinen Ankerausführungen. Elfie indes fuhr des Öfteren verzückt über die Zeichnungen und streckte mir beim ersten Mal begeistert den Daumen zu, was ich lächelnd erwiderte. Vielleicht würde ich ja noch zum Anker-Fan werden.
Im Umkleideraum entledigte ich mich meiner Sachen und zog die Strickjacke, die Victoria und Nick ebenfalls trugen, eine graue Jogginghose und blaue Crocks an. Ich band meine dicken Haare zu einem Dutt zusammen und kam mir augenblicklich fremd vor. Bei der Nachhilfe reichte es völlig aus, wenn ich nicht in Jogginghose auftauchte. Hier musste ich mich verkleiden, zu jemand Neuem werden. Ein paar Schneeflocken regten sich, was eine kühle Brise in mir auslöste und mir Gänsehaut verlieh. In dem Versuch, den neuerlichen Anflug nicht zuzulassen, rieb ich über meine Arme. Ein Stück des Ärmels rutschte dabei noch oben und entblößte die einzige Stelle an meinem Körper, an der zwei Leberflecken nah beieinander waren. Genau zwei Fingerbreit oberhalb meines linken Handgelenks, auf der Vorderseite meines Unterarms, verliefen die Strukturen der beiden Flecken beinahe ineinander. Sie waren gleich groß, gut sichtbar, aber nicht so, dass sie jedem sofort ins Gesicht sprangen. Der eine war eine Nuance heller als der andere, Vollmilch- und Zartbitterschokolade. Lächelnd strich ich über die Stelle, die auch Max’ Hautbild ausgemacht hatte. Die Kühle schob ich mühsam in die hintersten Ecken meines Körpers, damit es wenigstens nicht allgegenwärtig war. Ich durfte mich nicht davon einnehmen lassen. Mein Bruder hatte hier gearbeitet. Mit etwas Zeit konnte ich ja vielleicht sogar herausfinden, was ihm an der Arbeit so gefallen hatte. Außerdem sahen meine Kollegen genauso aus, wir trugen alle das gleiche Outfit. Es verband uns. Energisch zupfte ich den Ärmel nach unten, nachdem ich noch einmal kurz die Leberflecken berührt hatte, und schmiss die Spindtür zu. Ich würde es schaffen.