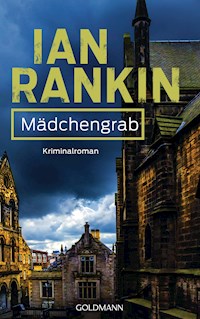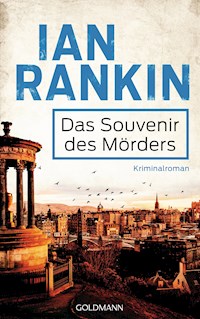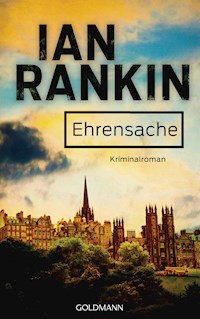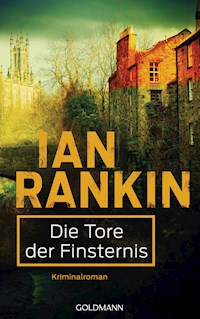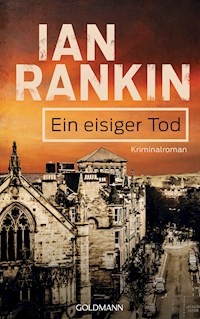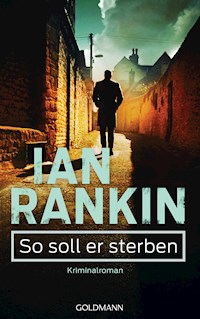
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Inspector-Rebus-Roman
- Sprache: Deutsch
In einer heruntergekommenen Sozialsiedlung wird ein Asylant tot aufgefunden. Ein Verbrechen aus rassistischen Motiven? Rebus findet bald Hinweise, dass die Täter eher in der Unterwelt von Edinburgh zu suchen sind, wo mit modernem Sklavenhandel viel Geld verdient wird. Auch im Fall eines vermissten Mädchens laufen alle Fäden im Rotlichtbezirk der Stadt zusammen. Nur die zwei Skelette, die man in einem Keller gefunden hat, scheinen nicht ins Bild zu passen – zumindest nicht auf den ersten Blick …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 747
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Ian Rankin
So soll er sterben
Roman
Aus dem Englischen von Heike Steffen und Claus Varrelmann
Copyright
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Fleshmarket Close« bei Orion Books, London
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © der Originalausgabe 2004 by John Rebus Limited
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
ISBN 3-89480-956-6
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
Erster Tag12Zweiter Tag345Dritter Tag678910Vierter Tag11121314Fünfter Tag1516171819Sechster und siebter Tag2021Achter Tag22232425Neunter Tag26272829Zehnter Tag303132EpilogDankÜber das BuchÜber den AutorCopyright
Im Gedenken
an Fiona und Annie,
zwei Freundinnen,
die mir sehr fehlen.
»Wenn es um unsere Vorstellung von der Zivilisation geht,
blicken wir nach Schottland.«
Voltaire
»Das Klima von Edinburgh ist so beschaffen,
dass die Schwachen jung dahingerafft werden…
und die Starken sie beneiden.«
Dr. Johnson zu Boswell
Erster Tag
Montag
1
»Was habe ich hier eigentlich verloren?«, sagte Detective Inspector John Rebus. Auch wenn ihm niemand zuhörte.
Knoxland war eine Hochhaussiedlung im Westen von Edinburgh, außerhalb von Rebus’ offiziellem Zuständigkeitsgebiet. Er war nur hier, weil die Kollegen im West End unterbesetzt waren und sein Chef nicht wusste, was er mit ihm anfangen sollte. Es war ein verregneter Montagnachmittag, und nichts an diesem Tag ließ für den Rest der Arbeitswoche etwas Gutes ahnen.
Rebus’ ehemaliges Revier, über acht Jahre lang sein hoch geschätztes Basislager, war Opfer einer Umstrukturierung geworden und verfügte seither nicht mehr über ein CID-Büro, was zur Folge hatte, dass Rebus und seine Kollegen heimatlos geworden waren und man sie auf andere Reviere verteilt hatte. Er war am Gayfield Square gelandet: ein ruhiger Job, wie manche meinten. Gayfield Square lag am Rand der vornehmen New Town, wo hinter den Fassaden aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert alles Mögliche passieren konnte, ohne dass etwas nach draußen drang. Die gefühlte Entfernung zu Knoxland war enorm, größer als die tatsächlichen fünf Kilometer. Hier herrschte eine andere Kultur, es war ein anderes Land.
Man hatte Knoxland in den 1960ern erbaut, wie es schien aus Pappmaché und Balsaholz. Die Wände waren so dünn, dass man seine Nachbarn beim Zehennägelschneiden hören konnte und ihr Abendessen roch. Auf den grauen Betonwänden prangten feuchte Flecken. Zahlreiche Graffiti hatten dem Viertel den Namen »Hard Knox« verliehen. Andere Wandverzierungen empfahlen »Pakis raus«, und ein Schriftzug, vermutlich kaum eine Stunde alt, verkündete: »Einer weniger.«
Die vereinzelten Geschäfte hatten Metallgitter an Fenstern und Türen, und niemand machte sich die Mühe, sie während der öffnungszeiten zu entfernen. Das ganze Viertel wirkte isoliert, im Norden und Westen wurde es von Schnellstraßen begrenzt. Wohlmeinende Stadtentwickler hatten Unterführungen graben lassen, die in den ursprünglichen Plänen wahrscheinlich sauber und gut beleuchtet gewesen waren, damit die Leute dort gelegentlich stehen blieben, um mit ihren Nachbarn übers Wetter oder die neuen Vorhänge in Nummer 42 zu plaudern. Im wirklichen Leben jedoch galten sie selbst tagsüber für alle, die nicht völlig lebensmüde waren, als Sperrgebiet. Andauernd hatte es die Polizei mit Fällen von Handtaschendiebstahl oder Straßenraub zu tun.
Vermutlich waren es dieselben wohlmeinenden Stadtentwickler gewesen, die auf die Idee verfielen, die zahlreichen Wohnblocks der Siedlung nach schottischen Schriftstellern zu benennen und das Wort »House« anzuhängen, damit die Leute immer wieder daran erinnert wurden, dass diese Gebäude mit echten Häusern rein gar nichts gemein hatten.
Barrie House.
Stevenson House.
Scott House.
Burns House.
Unaufdringlich wie ein einzelner Salutschuss ragten sie in den Himmel.
Rebus sah sich suchend nach einer Möglichkeit um, seinen halb leeren Kaffeebecher zu entsorgen. Er hatte bei einem Bäcker auf der Gorgie Road Halt gemacht, weil er wusste, dass seine Chancen auf einen halbwegs genießbaren Kaffee kontinuierlich abnahmen, je weiter er sich vom Stadtzentrum entfernte. Keine gute Wahl: Das Gebräu war erst brühend heiß gewesen und kurz darauf lauwarm, was das Fehlen jedweden Aromas nur noch unterstrich. Es gab keine Mülleimer in der Nähe, genau genommen keine Mülleimer weit und breit. Doch Bürgersteig und Grünstreifen boten bereitwillig an, die Aufgabe zu übernehmen. Also leistete Rebus seinen Beitrag zum Müllmosaik, richtete sich auf und vergrub die Hände tief in den Manteltaschen. Er konnte seinen eigenen Atem sehen.
»Ein gefundenes Fressen für die Presse«, brummelte jemand. In dem überdachten Verbindungsgang zwischen zwei hohen Wohnblocks liefen ein Dutzend Gestalten herum. Ein schwacher Geruch nach menschlichem oder nichtmenschlischem Urin hing in der Luft. Es gab jede Menge Hunde in dieser Gegend, und der eine oder andere trug sogar ein Halsband. Sie näherten sich schnüffelnd dem Verbindungsgang, bis sie von den Uniformierten verjagt wurden. Der Gang war an beiden Enden mit Absperrband gesichert. Ein paar Jugendliche auf Fahrrädern verrenkten sich den Hals, um einen Blick auf den Tatort zu werfen. Die Männer von der Spurensicherung in weißem Overall mit Kapuze und die Polizeifotografen machten sich gegenseitig den Platz streitig. Neben den Polizeiautos auf der matschigen Spielwiese parkte ein unauffälliger grauer Lieferwagen. Der Fahrer hatte sich bei Rebus beschwert, weil ein paar Halbwüchsige ihm Geld dafür hatten abknöpfen wollen, dass sie auf den Wagen aufpassten.
»Miese Ratten.«
In Kürze würde der Fahrer die Leiche zur Obduktion in die Gerichtsmedizin bringen. Aber es war bereits klar, dass es sich um einen gewaltsamen Tod handelte. Etliche Stichwunden, eine davon im Hals. Den Blutspuren nach zu urteilen, war das Opfer drei bis vier Meter vom einen Ende des Verbindungsgangs entfernt angegriffen worden. Wahrscheinlich hatte er zu fliehen versucht, war aber, ehe es ihm gelang, ins Freie zu kommen, von seinem Angreifer endgültig niedergestreckt worden.
»In den Taschen ist bloß ein bisschen Kleingeld, sonst nichts«, sagte ein anderer Polizist. »Hoffentlich kennt ihn irgendwer…«
Rebus wusste nicht, wer er war, aber er wusste, was er war: nämlich ein Kriminalfall, ein Teil der Verbrechensstatistik. Außerdem war er Nachrichtenmaterial, und die Journalisten hatten garantiert schon Witterung aufgenommen, so wie das Hunderudel bei einer Treibjagd. Knoxland war keine beliebte Wohngegend. Hier zogen nur Leute her, denen nichts anderes übrig blieb. In der Vergangenheit hatten die Behörden die Siedlung benutzt, um Leute abzuschieben, für die sich sonst keine Wohnung fand: Junkies und Geistesgestörte. In letzter Zeit waren vermehrt Einwanderer und Asylbewerber in die besonders verwahrlosten Häuserblocks einquartiert worden. Leute, mit denen niemand zu tun haben, geschweige denn sich ernsthaft befassen wollte. Als Rebus sich umsah, wurde ihm klar, dass sich diese armen Menschen wie Mäuse in einem Labyrinth vorkommen mussten. Nur mit dem Unterschied, dass es in Versuchslabors nur wenige feindlich gesinnte Lebewesen gab, sie hier, im wirklichen Leben, hingegen allgegenwärtig waren.
Sie waren mit Messern bewaffnet, trieben ungehindert ihr Unwesen, beherrschten die Straßen.
Und nun hatten sie getötet.
Ein weiteres Auto hielt am Straßenrand, und ein Mann stieg aus. Rebus kannte ihn: Steve Holly, ein Schreiberling in Diensten eines Glasgower Boulevardblatts. Dick und umtriebig, gegeltes, stachelig vom Kopf abstehenden Haar. Ehe er den Wagen abschloss, griff er nach seinem Notebook und klemmte es sich unter den Arm. Er mochte alles Mögliche sein, dieser Steve Holly, naiv war er nicht. Er nickte Rebus zu.
»Haben Sie was für mich?«
Rebus schüttelte den Kopf, woraufhin sich Holly nach einer ergiebigeren Informationsquelle umzusehen begann. »Wie ich höre, hat man euch aus St. Leonard’s rausgeschmissen«, sagte er, so als wollte er Konversation machen, den Blick dabei absichtlich nicht auf Rebus gerichtet. »Hat man Sie etwa hierher strafversetzt?«
Rebus ließ sich nicht provozieren, dennoch fuhr Holly genüsslich fort: »Hier zu arbeiten, muss eine echte Strafe sein. Verdammt übles Pflaster, was?« Holly zündete sich eine Zigarette an, und Rebus wusste, dass er sich im Geist mit dem Artikel beschäftigte, den er nachher schreiben und für den er sich griffige Formulierungen mit ein paar pseudophilosophischen Einsprengseln ausdenken würde.
»Ein Asiate, habe ich gehört«, sagte der Reporter schließlich, blies Rauch in die Luft und hielt Rebus die Zigarettenschachtel hin.
»Das steht noch nicht fest.« Rebus’ Kommentar war die Bezahlung für die Zigarette. Holly gab ihm Feuer. »Olivfarbene Haut… Könnte von überallher stammen.«
»Nur nicht aus Schottland«, erklärte Holly lächelnd. »Dürfte also ein Verbrechen aus Fremdenhass sein. War ja zu erwarten, dass so etwas irgendwann auch hier passieren würde.« Rebus wusste, wieso er das »hier« betont hatte: Er meinte »in Edinburgh«. In Glasgow hatte es schon mindestens einen Mord aus Fremdenhass gegeben, das Opfer war ein Asylbewerber gewesen, der versucht hatte, in einer der menschenfeindlichen Siedlungen jener Stadt sein Leben zu leben. Erstochen, genau wie das hiesige Opfer, das wenige Meter entfernt fotografiert und nach Spuren abgesucht worden war und nun in einen Leichensack gesteckt wurde. Während dies geschah, herrschte Stille: Man erwies dem Toten einen Moment lang die letzte Ehre, ehe man sich wieder der Aufgabe widmete, den Täter zu fassen. Der Sack wurde auf einen Rollwagen gehoben, der dann unter der Absperrung hindurch und an Rebus und Holly vorbeigeschoben wurde.
»Sind Sie hier der Boss?«, fragte Holly leise. Rebus schüttelte erneut den Kopf und beobachtete, wie die Leiche in dem Lieferwagen verschwand.
»Dann geben Sie mir einen Tipp – mit wem könnte ich reden?«
»Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein«, sagte Rebus, drehte sich um und ging zu seinem Auto, das zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit bot.
Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, dachte Detective Sergeant Siobhan Clarke, womit sie meinte, dass sie wenigstens über einen eigenen Schreibtisch verfügte. John Rebus – der einen höheren Rang hatte als sie – war nicht so gut dran. Allerdings hatten weder Glück noch Pech etwas damit zu tun. Sie wusste, dass Rebus es als einen Wink von oben betrachtete: Wir haben für Sie keinen Platz mehr; Sie sollten sich langsam aufs Altenteil zurückziehen. Er hatte Anspruch auf die volle Polizistenpension – Kollegen, jünger als er und mit weniger Dienstjahren, stiegen aus dem Spiel aus und lösten ihre Jetons ein. Ihm war sonnenklar, welche Botschaft ihm seine Vorgesetzten übermitteln wollten. Siobhan wusste es auch, dennoch hatte sie ihm ihren Schreibtisch angeboten. Er hatte natürlich abgelehnt, hatte gemeint, er sei mit jedem verfügbaren Arbeitsplatz zufrieden, woraufhin er nun an dem Tisch neben dem Fotokopierer saß, auf dem Becher, Kaffee und Zucker standen. Der Wasserkocher befand sich auf dem angrenzenden Fensterbrett. Unter dem Tisch wurde ein Karton mit Kopierpapier aufbewahrt, und der Stuhl, der davorstand, besaß eine kaputte Lehne und ächzte laut, wenn man auf ihm Platz nahm. Kein Telefon, noch nicht einmal eine Telefonbuchse. Kein Computer.
»Das ist natürlich nur vorübergehend«, hatte Detective Chief Inspector James Macrae erklärt. »Nicht so einfach, Platz für zwei Neuzugänge zu schaffen…«
Rebus hatte mit einem Lächeln und einem Achselzucken reagiert, und Siobhan war klar gewesen, dass er sich hütete, etwas zu sagen: Rebus’ spezielle Form von Konfliktmanagement. Erst einmal alles in sich hineinfressen. Das Platzproblem war auch der Grund, dass ihr Tisch zwischen denen der Detective Constables stand. Es gab ein extra Büro für die Detective Sergeants, das sie sich mit der Bürokraft teilten, aber Siobhan oder Rebus passten dort beim besten Willen nicht hinein. Der Detective Inspector hatte übrigens ein eigenes kleines Büro zwischen den beiden anderen. Tja, da lag der Hund begraben: Es gab am Gayfield Square schon einen DI; ein zweiter wurde nicht gebraucht. Der DI hieß Derek Starr, er war groß, blond und gut aussehend. Dummerweise wusste er Letzteres ganz genau. Er hatte Siobhan einmal zum Mittagessen in seinen Klub eingeladen. Der Klub war fünf Minuten zu Fuß entfernt und hieß The Hallion. Sie hatte nicht zu fragen gewagt, wie viel die Mitgliedschaft kostete. Wie sich herausstellte, hatte Starr auch Rebus dorthin eingeladen.
»Er tut’s, weil er’s tun kann«, hatte Rebus’ Zusammenfassung gelautet. Starr war auf dem Weg nach oben, und er wollte es den beiden Neuen deutlich vor Augen führen.
Siobhan war mit ihrem Schreibtisch zufrieden. Sie hatte einen Computer, den Rebus jederzeit benutzen konnte, und ein Telefon. Jenseits des Gangs saß Detective Constable Phyllida Hawes. Sie hatten bei einigen Ermittlungen zusammengearbeitet, obwohl sie verschiedenen Dienststellen angehörten. Siobhan war zehn Jahre jünger, hatte aber einen höheren Dienstgrad. Bisher schien Hawes damit kein Problem gehabt zu haben, und Siobhan hoffte, dass dies auch so blieb. Es gab noch einen DC in dem Büro. Er hieß Colin Tibbet: Mitte zwanzig, vermutete Siobhan, demnach ein paar Jahre jünger als sie. Nettes Lächeln, durch das seine relativ kleinen Zähne zum Vorschein kamen. Hawes hatte schon ein paar scherzhafte Bemerkungen gemacht, dass sie in ihn verschossen sei.
»Ich stehe nicht auf grüne Jungs«, hatte Siobhan erwidert.
»Sie haben also eine Vorliebe für reifere Herren?«, hatte Hawes grinsend gefragt, den Blick in Richtung des Fotokopierers gewandt.
»Reden Sie keinen Unsinn«, hatte Siobhan gesagt, da natürlich Rebus damit gemeint gewesen war. Ein paar Monate zuvor, kurz vor dem Ende der Ermittlungen in einem Fall, hatte Rebus sie plötzlich umarmt und geküsst. Niemand außer ihnen beiden wusste davon, und sie hatten nie ein Wort darüber verloren. Dennoch hing die Sache jedesmal wie ein vertrauter Geruch in der Luft, wenn sie allein waren. Na ja… sie hing über ihr. John Rebus war in dieser Hinsicht schwer durchschaubar.
Phyllida Hawes ging nun zum Fotokopierer und erkundigte sich, wohin DI Rebus verschwunden war.
»Er hat einen Anruf bekommen«, antwortete Siobhan. Mehr wusste sie tatsächlich nicht, aber Hawes’ Blick verriet, dass sie glaubte, Siobhan würde ihr etwas verschweigen. Tibbet räusperte sich.
»In Knoxland ist jemand umgebracht worden. Die Nachricht ist gerade im Computer aufgetaucht.« Er tippte wie zur Bekräftigung an den Bildschirm. »Hoffentlich nicht der Anfang von einem Bandenkrieg.«
Siobhan nickte. Knapp ein Jahr zuvor hatte eine Gang versucht, sich in das Drogengeschäft in dem Viertel zu drängen, woraufhin es zu einer Reihe von Messerstechereien, Entführungen und Vergeltungsaktionen gekommen war. Die Eindringlinge waren Nordiren, angeblich mit Verbindungen zu einer paramilitärischen Organisation. Die meisten von ihnen saßen inzwischen im Gefängnis.
»Das braucht uns doch nicht zu kümmern«, meinte Hawes. »Einer der wenigen Vorteile unseres Standorts… keine Siedlungen wie Knoxland in der Nähe.«
Damit hatte sie völlig Recht. Gayfield Square war ein ziemlich typisches Innenstadtrevier: Ladendiebe und Randalierer aus der Princess Street, Betrunkene am Samstag Abend, Einbrüche in der New Town.
»Für Sie ist das hier der reinste Urlaub, oder?«, fügte Hawes grinsend hinzu.
»Die Arbeit in St. Leonard’s war kein Zuckerschlecken«, musste Siobhan einräumen. Als die organisatorischen Veränderungen bekannt wurden, hieß es hinter vorgehaltener Hand, sie werde ins Präsidium umziehen. Sie wusste nicht, wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hatte, aber nach einer Woche glaubte sie es. Doch dann hatte Detective Chief Superintendent Gil Templer sie zu sich gebeten, und wenige Minuten später war sie an den Gayfield Square versetzt. Sie versuchte, das nicht als Kränkung zu empfinden, aber genau das war es. Templer selbst hatte nämlich sehr wohl einen Posten im Präsidium erhalten. Andere Kollegen landeten weit draußen in Balerno oder in East Lothian, einige reichten einen Antrag auf Pensionierung ein. Nur Siobhan und Rebus zogen zum Gayfield Square um.
»Ausgerechnet jetzt, wo wir gerade kapiert haben, wie hier der Hase läuft«, hatte sich Rebus beschwert, als er den Inhalt seiner Schreibtischschubladen in einen großen Pappkarton leerte. »Doch für Sie hat es ja auch was Positives: Sie können morgens länger schlafen.«
Das stimmte, ihre Wohnung lag nur fünf Gehminuten entfernt. Sie brauchte nicht mehr in der Rushhour quer durch die Innenstadt zu fahren. Das war einer der wenigen Vorteile, die ihr einfielen… vielleicht sogar der einzige. Sie waren in St. Leonard’s ein echtes Team gewesen, und das Polizeirevier dort hatte sich in einem wesentlich besseren Zustand befunden als das triste Gebäude, in dem sie nun arbeitete. Das CID-Büro war größer und heller gewesen, und hier gab es einen – sie atmete tief durch die Nase ein – einen bestimmten Geruch. Sie konnte ihn nicht genau definieren. Er stammte weder von Körperausdünstungen noch von den Käsesandwiches, die Tibbet sich jeden Tag mitbrachte. Das Gebäude selbst schien ihn abzusondern. Eines Vormittags, als sie allein gewesen war, hatte sie die Nase dicht an Wände und Fußboden gehalten, aber es gab keine erkennbare Quelle des Geruchs. Manchmal verschwand er sogar völlig, nur um dann langsam wieder zurückzukehren. Die Heizkörper? Die Wärmedämmung? Sie hatte aufgehört, nach einer Erklärung zu suchen, und auch mit niemand darüber gesprochen, nicht einmal mit Rebus.
Ihr Telefon klingelte. Sie nahm den Hörer ab. »CID«, sagte sie.
»Empfang hier. Vor mir steht ein Ehepaar, das mit DS Clarke sprechen möchte.«
Siobhan runzelte die Stirn. »Die beiden haben ausdrücklich nach mir gefragt?«
»Ja.«
»Wie heißen die Leute?« Sie griff nach Notizblock und Stift.
»Mr. und Mrs. Jardine. Ich soll Ihnen ausrichten, dass sie aus Banehall sind.«
Siobhan hörte auf zu schreiben. Sie wusste, wer die beiden waren. »Sagen Sie ihnen, ich komme gleich.« Sie legte auf und nahm ihre Jacke, die über der Stuhllehne hing.
»Verdrückt sich da etwa noch jemand?«, fragte Hawes. »Man könnte meinen, gewisse Leute haben etwas gegen uns, Col.« Sie zwinkerte Tibbet zu.
»Besuch für mich«, erklärte Siobhan.
»Bringen Sie ihn her«, erwiderte Hawes, die Arme weit ausgestreckt. »Je mehr Trubel, desto besser.«
»Mal sehen«, sagte Siobhan. Als sie hinausging, bearbeitete Hawes erneut eine Taste am Fotokopierer, während Tibbet etwas auf seinem Bildschirm las und dabei geräuschlos die Lippen bewegte. Sie würde die Jardines auf keinen Fall herbringen. Der unterschwellige Geruch, die muffige Atmosphäre und der Ausblick auf den Parkplatz… die Jardines hatten etwas Besseres verdient.
Und ich auch, dachte sie unwillkürlich.
Sie hatte die beiden zuletzt vor drei Jahren gesehen und stellte fest, dass sie seitdem sichtlich gealtert waren. Durch John Jardines mittlerweile spärliches Haar zogen sich graue Strähnen. Seine Frau Alice trug ihr ebenfalls grau meliertes Haar im Nacken zusammengebunden, sodass ihr Gesicht unverhältnismäßig groß und streng wirkte. Sie hatte zugenommen, und ihre Kleidung sah aus, als hätte sie das Erstbeste aus dem Schrank gezogen: ein langer brauner Cordrock mit dunkelblauer Strumpfhose und grünen Schuhen; karierte Bluse und darüber ein rot karierter Mantel. John Jardine war etwas sorgfältiger gekleidet: ein Anzug mit Krawatte und einem frisch gebügelten Hemd. Er streckte Siobhan die Hand entgegen.
»Mr. Jardine«, sagte sie. »Wie ich sehe, haben Sie immer noch Ihre Katzen.« Sie zupfte ein paar Haare von seinem Revers.
Er lachte verlegen und trat zur Seite, damit seine Frau Siobhan ebenfalls die Hand geben konnte. Aber statt Siobhans Hand nur kurz zu schütteln, hielt sie sie fest umklammert. Ihre Augen waren gerötet, und Siobhan schien, als hoffe die Frau, dass ihr Blick ihr etwas verriet.
»Wir haben gehört, dass man Sie zum Sergeant befördert hat«, bemerkte John Jardine.
»Ja, zum Detective Sergeant.« Siobhan hielt noch immer Alice Jardines Blick stand.
»Herzlichen Glückwunsch. Wir waren zuerst auf Ihrem alten Revier, und dort hat man uns gesagt, dass Sie hier sind. Irgendeine Umstrukturierung des CID, hieß es…« Er rieb sich die Hände wie beim Waschen. Siobhan wusste, dass er Mitte Vierzig war, aber er wirkte zehn Jahre älter, was auch für seine Frau galt. Drei Jahre zuvor hatte Siobhan Ihnen zu einer Familientherapie geraten. Falls sie der Empfehlung gefolgt waren, hatte dies nicht zum Erfolg geführt. Sie standen noch immer unter Schock, waren verwirrt und traurig.
»Wir haben schon eine Tochter verloren«, sagte Alice Jardine leise und ließ endlich Siobhans Hand los. »Wir wollen nicht auch noch die andere verlieren… Deshalb brauchen wir Ihre Hilfe.«
Siobhans Blick wanderte zwischen den Eheleuten hin und her. Sie war sich bewusst, dass der Constable hinter dem Tresen sie beobachtete; ebenso bewusst war sie sich der abblätternden Wandfarbe, der eingeritzten Graffiti und der Fahndungsplakate.
»Wie wär’s mit einem Kaffee?«, fragte sie lächelnd. »Gleich um die Ecke ist ein Lokal.«
Also gingen sie dorthin. Es war eines jener Cafés, die zusätzlich einen Mittagstisch anboten. An einer der Fenstertische saß ein Geschäftsmann, verzehrte die letzten Bissen seines späten Mittagessens, während er gleichzeitig in sein Handy sprach und in seiner Aktentasche kramte. Siobhan führte das Ehepaar zu einer Sitznische, die ein Stück von den an der Wand befestigten Lautsprechern entfernt war. Es lief irgendein Hintergrundgedudel, das die Stille kaschieren sollte.
»Wollen Sie auch was essen?«, fragte der Kellner, auf dessen Hemd ein großer Bolognesesaucenfleck prangte. Seine dicken Arme zierten verblassende Distel-und-Andreaskreuz-Tätowierungen.
»Nur Kaffee«, sagte Siobhan. »Es sei denn…?« Sie sah die ihr gegenüber sitzenden Eheleute an, aber die beiden schüttelten den Kopf. Der Kellner ging in Richtung Espressomaschine, machte dann aber einen Abstecher zu dem Geschäftsmann, der etwas von ihm wollte. Na ja, Siobhan hatte es nicht gerade eilig, an ihren Schreibtisch zurückzukehren. Allerdings bezweifelte sie, dass die bevorstehende Unterhaltung besonders vergnüglich verlaufen würde.
»Wie geht es Ihnen?«, fühlte sie sich verpflichtet zu fragen.
Die beiden sahen einander an, ehe sie antworteten. »Nicht allzu gut«, sagte Mr. Jardine. »Uns geht es… nicht allzu gut.«
»Ja, das kann ich mir vorstellen.«
Alice Jardine beugte sich vor. »Tracy ist nicht der Grund. Ich meine, sie fehlt uns immer noch…« Sie senkte den Blick. »Natürlich fehlt sie uns. Aber zurzeit machen wir uns Sorgen um Ishbel.«
»Große Sorgen«, fügte ihr Mann hinzu.
»Sie ist nämlich verschwunden. Spurlos.«
Mrs. Jardine brach in Tränen aus. Siobhan sah zu dem Geschäftsmann hinüber, aber er war einer jener Menschen, die nichts interessierte, was sie nicht selbst betraf. Der Kellner hingegen hatte an der Espressomaschine innegehalten. Siobhan funkelte ihn an, in der Hoffnung, dass er den Wink verstand und sich mit den Kaffees beeilte. John Jardine hatte den Arm um die Schultern seiner Frau gelegt, und Siobhan fühlte sich drei Jahre zurückversetzt, zu einer fast identischen Szene: ein Reihenhaus in dem Ort Banehall in West Lothian; John Jardine, der seine Frau tröstete, so gut es ging. Das Haus war sauber und aufgeräumt gewesen und in einem Zustand, auf den seine Besitzer, die von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hatten, es aus städtischem Besitz zu erwerben, stolz sein konnten. Die Nachbarschaft bestand aus fast identischen Häusern, doch man sah sofort, welche sich in Privatbesitz befanden: neue Türen und Fenster, gepflegte Gärten mit neuem Zaun und schmiedeeiserner Pforte. Einstmals hatte es Banehall dank eines Kohlebergwerks zu einem gewissen Wohlstand gebracht, aber die Zeche war schon vor längerer Zeit geschlossen worden, und die Stadt hatte sich von diesem Schlag nie richtig erholt. Beim ersten Entlangfahren der Main Street waren ihr die zahlreichen leer stehenden Läden und Zu-Verkaufen-Schilder aufgefallen; Menschen bewegten sich unter der Last von Einkaufstüten nur langsam vorwärts; am Kriegerdenkmal lungerten Kinder herum und zielten spielerisch mit Karatetritten aufeinander.
John Jardine arbeitete als Fahrer; Alice montierte in einer Fabrik am Rand von Livingston Elektrogeräte. Sie bemühten sich, ihren beiden Töchtern und sich selbst ein Leben in bescheidenem Wohlstand zu bieten. Aber eine ihrer Töchter war während eines abendlichen Ausflugs nach Edinburgh Opfer eines Verbrechens geworden. Sie hieß Tracy. Sie hatte mit einer Gruppe Freunden in einem Klub getrunken und getanzt, und später am Abend hatten sie ein Taxi angehalten, um zu einer Party zu fahren. Aber für Tracy war in dem Wagen kein Platz gewesen, und während sie auf ein zweites Taxi wartete, vergaß sie die Adresse, wo die Party stattfand. Da der Akku ihres Handys leer war, ging sie zurück in den Klub und bat einen der Jungen, mit denen sie getanzt hatte, ihr seines zu leihen. Er sagte, die Party sei ganz in der Nähe, und bot an, sie zu begleiten.
Dann fing er an sie zu küssen; ließ sich auch von ihrem Widerstand nicht davon abbringen; schlug auf sie ein, zerrte sie in eine schmale Nebenstraße und vergewaltigte sie.
All das wusste Siobhan bereits, als sie in dem Wohnzimmer des Hauses in Banehall saß. Sie war an den Ermittlungen beteiligt gewesen, hatte mit dem Opfer und den Eltern gesprochen. Den Vergewaltiger musste die Polizei nicht lange suchen; er stammte auch aus Banehall, wohnte nur drei oder vier Straßen von den Jardines entfernt, jenseits der Main Street. Tracy kannte ihn aus der Schule. Seine Verteidigungsstrategie war die übliche: zu viel getrunken, Erinnerungslücke… und außerdem war das Mädchen einverstanden gewesen. Die Gerichte taten sich mit Anklagen wegen Vergewaltigung oft schwer, aber zu Siobhans Erleichterung wurde Donald Cruikshank, von seinen Freunden Donny genannt, das Gesicht von tiefen Kratzern der Fingernägel seines Opfers für immer gezeichnet, schuldig gesprochen und zu fünf Jahren verurteilt.
Damit hätte Siobhans Kontakt zu der Familie enden sollen, aber ein paar Wochen nach dem Prozess erfuhr sie, dass die neunzehnjährige Tracy Selbstmord begangen hatte. Sie hatte zu Hause in ihrem Zimmer mit einer Überdosis Tabletten ihrem Leben ein Ende gemacht und war von ihrer vier Jahre jüngeren Schwester Ishbel gefunden worden.
Obwohl Siobhan klar war, dass es keine Worte gab, die sie trösten konnten, hatte sie das Bedürfnis, mit den Eltern zu reden. Ihnen war vom Leben übel mitgespielt worden. Eine Sache jedoch hatte Siobhan sich verkniffen, nämlich Cruikshank im Gefängnis zu besuchen. Sie hätte ihn nur zu gern ihren Zorn spüren lassen. Sie erinnerte sich an Tracys Auftritt vor Gericht, an ihre ersterbende Stimme, als sie stammelnd ihre Aussage machte. Sie hatte dabei ins Leere gestarrt; schien sich beinahe für ihre Anwesenheit zu schämen. Hatte sich geweigert, die Plastikbeutel mit den Beweisstücken zu berühren: ihr zerrissenes Kleid, die zerrissene Unterwäsche. Hatte schweigend ihre Tränen weggewischt. Der Richter war mitfühlend gewesen, während der Angeklagte versucht hatte, keinen schuldbewussten Eindruck zu erwecken, sondern die Rolle des eigentlichen Opfers zu spielen: verletzt, die eine Wange mit einem großen Stück Mull bedeckt. Hatte ungläubig den Kopf geschüttelt und die Augen zur Decke gedreht.
Nachdem die Geschworenen ihr Urteil gefällt hatten, wurden sie über seine Vorstrafen informiert: zwei wegen Körperverletzung, eine wegen versuchter Vergewaltigung. Donny Cruikshank war neunzehn Jahre alt.
»Das elende Schwein hat sein Leben noch vor sich«, hatte John Jardine zu Siobhan gesagt, als sie den Friedhof verließen. Alice hatte die Arme um die Tochter geschlungen, die ihr noch verblieben war. Ishbel weinte an der Schulter ihrer Mutter. Alice blickte stur geradeaus, und man sah an ihren Augen, dass in ihr gerade etwas starb…
Die drei Kaffees wurden serviert, und das brachte Siobhan in die Gegenwart zurück. Sie wartete, bis der Kellner gegangen war.
»Ich schlage vor, Sie erzählen mir, was passiert ist«, sagte sie.
John Jardine schüttete den Inhalt eines Zuckertütchens in seinen Kaffee und begann, ihn umzurühren.
»Ishbel hat letztes Jahr die Schule beendet. Wir wollten, dass sie studiert. Aber sie hatte sich in den Kopf gesetzt, Friseuse zu werden.«
»Das ist natürlich auch ein ehrenwerter Beruf«, unterbrach ihn seine Frau. »Und sie geht regelmäßig zur Berufsschule in Livingston.«
»Jedenfalls hat sie das bis zu ihrem Verschwinden getan«, stellte John Jardine leise fest.
»Seit wann ist sie weg?«
»Genau seit einer Woche.«
»Hat sie sich einfach so aus dem Staub gemacht?«
»Wir dachten, sie sei wie üblich zur Arbeit gegangen – sie ist in dem Friseursalon an der Main Street angestellt. Aber dann rief uns ihre Chefin an, um zu fragen, ob sie krank sei. Ein paar Anziehsachen waren weg, etwa so viel, wie in einen Rucksack passen. Außerdem Geld, Kreditkarte und Handy…«
»Wir haben sie dutzende Male auf dem Handy angerufen«, ergänzte seine Frau, »aber es ist ständig ausgeschaltet.«
»Haben Sie schon mit jemand anderem außer mir gesprochen?«, fragte Siobhan, während sie ihre Tasse an den Mund hob.
»Mit jedem, der uns eingefallen ist – ihre Freundinnen, ehemalige Schulkameraden, ihre Kollegin aus dem Friseursalon.«
»Die Berufsschule?«
Alice Jardine nickte. »Auch dort ist sie seit letzter Woche nicht mehr gewesen.«
»Wir sind zur Polizei in Livingston gegangen«, sagte John Jardine. Er rührte immer noch in seiner Tasse herum. »Man sagte uns, dass sie volljährig sei und kein Hinweis auf ein Verbrechen vorliege. Da sie Kleidung eingepackt hat, spricht nichts für eine Entführung.«
»Das stimmt.« Siobhan hätte noch einiges hinzufügen können: dass sie ständig mit jungen Leuten zu tun hatte, die ausgerissen waren. Dass sie, wenn sie in Banehall wohnen würde, möglicherweise auch von dort abhauen würde…»Haben Sie Streit mit ihr gehabt?«
Mr. Jardine schüttelte den Kopf. »Sie war dabei, Geld für die Anzahlung auf eine Wohnung zu sparen… hatte schon eine Liste mit den Sachen gemacht, die sie für einen eigenen Haushalt brauchen würde.«
»Ein fester Freund?«
»Bis vor ein paar Monaten hatte sie einen. Die Trennung war…« Mr. Jardine fiel das Wort nicht ein, das er suchte. »Die beiden sind nicht sauer aufeinander.«
»Eine freundschaftliche Trennung«, schlug Siobhan vor. Er lächelte und nickte. Sie hatte das passende Wort gefunden.
»Wir wollen ja bloß wissen, ob es ihr gut geht«, erklärte Alice Jardine.
»Daran zweifle ich nicht, und es gibt Leute, die Ihnen helfen können – Organisationen, die nach Personen suchen, die aus welchen Gründen auch immer von zu Hause verschwunden sind.« Siobhan merkte, dass ihre Worte zu routiniert klangen: sie hatte das Gleiche schon allzu oft besorgten Eltern gesagt. Alice sah ihren Mann an.
»Erzähl ihr, was du von Susie weißt«, forderte sie ihn auf.
Er nickte und legte endlich den Löffel auf der Untertasse ab. »Susie ist Ishbels Kollegin aus dem Friseursalon. Sie hat mir erzählt, dass sie Ishbel in einen teuren Wagen hat einsteigen sehen… wahrscheinlich ein BMW.«
»Wann war das?«
»Sie hat es ein paar Mal beobachtet… Der Wagen war immer ein Stück die Straße hinunter geparkt. Am Steuer saß ein älterer Mann.« Er schwieg kurz. »Na ja, mindestens so alt wie ich.«
»Hat Susie Ishbel gefragt, wer das war?«
Er nickte. »Aber Ishbel wollte es ihr nicht verraten.«
»Also hält sie sich vielleicht bei diesem Bekannten auf.« Siobhan hatte ihre Tasse geleert.
»Aber warum hat sie uns nichts gesagt?«, fragte Alice in klagendem Tonfall.
»Tut mir Leid, das weiß ich auch nicht.«
»Susie hat noch etwas erwähnt«, fügte John Jardine, noch leiser als zuvor, hinzu. »Sie sagte, dieser Mann… sie sagte zu uns, er habe ein bisschen zwielichtig ausgesehen.«
»Zwielichtig?«
»Genau genommen hat sie gesagt, er habe wie ein Zuhälter ausgesehen.« Er schaute Siobhan an. »Sie wissen schon, wie diese Typen aus Filmen und dem Fernsehen: Sonnenbrille, Lederjacke… teures Auto.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob uns das irgendwie weiterhilft«, entgegnete Siobhan und bereute das »uns« sofort, durch das sie das Anliegen der beiden auch zu ihrem gemacht hatte.
»Ishbel ist eine echte Schönheit«, sagte Alice. »Das wissen Sie bestimmt noch. Was für einen Grund kann sie gehabt haben zu verschwinden, ohne auch nur ein Wort zu sagen? Warum hat sie die Bekanntschaft mit diesem Mann vor uns verheimlicht?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, da steckt irgendwas dahinter.«
Einen Moment lang herrschte am Tisch Stille. Als der Kellner dem Geschäftsmann die Tür aufhielt, klingelte erneut dessen Telefon. Der Kellner machte eine leichte Verbeugung. Jetzt befanden sich nur noch drei Gäste im Café.
»Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen helfen könnte«, sagte Siobhan zu den Jardines. »Glauben Sie mir, ich würde, wenn ich könnte…«
John Jardine hatte die Hand seiner Frau ergriffen. »Sie waren damals sehr freundlich zu uns. Mitfühlend und so. Wir haben das zu schätzen gewusst, und Ishbel auch… Darum wenden wir uns an Sie.« Er musterte sie mit seinen trüben Augen. »Wir haben schon Tracy verloren. Ishbel ist das einzige Kind, das wir noch haben.«
»Nun…«, Siobhan holte tief Luft, »ich höre mich ein bisschen um, vielleicht weiß jemand etwas über Ishbels Verbleib.«
Seine Gesichtszüge entspannten sich. »Das ist wirklich großartig.«
»Großartig ist sicher eine Übertreibung, aber ich werde tun, was ich kann.« Da Alice Jardine Anstalten machte, wieder nach ihrer Hand zu greifen, stand Siobhan auf und schaute auf die Uhr, so als hätte sie gleich eine wichtige Verabredung auf dem Revier. Der Kellner kam, und John Jardine bestand darauf, die Rechnung zu bezahlen. Siobhan öffnete die Tür.
»Manchmal wollen Menschen eine Weile allein sein. Sind Sie sicher, dass sie nicht doch irgendwelche Probleme hatte?«
Die Eheleute sahen sich an. Es war Alice, die zu sprechen begann. »Er ist wieder in Banehall. Läuft großkotzig durch die Gegend. Vielleicht hat das etwas damit zu tun.«
»Von wem sprechen Sie?«
»Cruikshank. Er hat bloß drei Jahre abgesessen. Ich habe ihn neulich beim Einkaufen gesehen und bin schnell in eine Seitenstraße, weil ich mich übergeben musste.«
»Haben Sie mit ihm gesprochen?«
»Ich würde ihn noch nicht einmal anspucken.«
Siobhans Blick fiel auf John Jardine, aber der schüttelte den Kopf.
»Ich würde ihn umbringen«, sagte er. »Sollte ich ihm je über den Weg laufen, müsste ich ihn umbringen.«
»Seien Sie vorsichtig, zu wem Sie so etwas sagen, Mr. Jardine.« Siobhan überlegte einen Moment. »Wusste Ishbel davon? Dass man ihn entlassen hat, meine ich.«
»Die ganze Stadt weiß es. Und nirgendwo wird so viel getratscht wie in einem Friseursalon.«
Siobhan nickte. »Also… wie ich schon sagte, ich werde ein paar Leute anrufen. Ein Foto von Ishbel wäre hilfreich.«
Mrs. Jardine griff in ihre Handtasche und zog ein zusammengefaltetes Stück Papier heraus. Es war ein Computerausdruck eines auf A-4-Format vergrößerten Fotos. Ishbel saß auf einem Sofa, ein Glas in der Hand, die Wangen vom Alkohol gerötet.
»Das Mädchen neben ihr ist ihre Kollegin Susie«, erklärte Alice Jardine. »John hat es vor drei Wochen bei einer kleinen Feier aufgenommen. Ich hatte Geburtstag.«
Siobhan nickte. Ishbel hatte sich seit ihrer letzten Begegnung verändert. Ihr Haar war jetzt blond gefärbt und länger als damals. Außerdem schien sie stärker geschminkt zu sein und hatte trotz des Lächelns einen härteren Gesichtsausdruck. Man sah den Ansatz eines Doppelkinns. Das Haar trug sie in der Mitte gescheitelt. Es dauerte einen Augenblick, bis Siobhan begriff, an wen Ishbel sie erinnerte. An Tracy: die langen blonden Haare, der Scheitel, der blaue Eyeliner.
Sie sah genauso aus wie ihre tote Schwester.
»Danke«, sagte Siobhan und steckte das Foto in die Tasche.
Siobhan erkundigte sich, ob die Jardines immer noch unter derselben Telefonnummer zu erreichen waren. John Jardine nickte. »Wir sind in ein anderes Haus im selben Viertel gezogen, konnten aber die Nummer behalten.«
Selbstverständlich waren sie umgezogen. Wie hätten sie es auch ertragen können, in ihrem Haus wohnen zu bleiben, dem Haus, in dem Tracy die Überdosis genommen hatte. Fünfzehn Jahre alt war Ishbel gewesen, als sie den leblosen Körper gefunden hatte. Die Leiche der von ihr abgöttisch geliebten, idealisierten Schwester. Ihres großen Vorbilds.
»Ich melde mich bei Ihnen«, sagte Siobhan, drehte sich um und verschwand in Richtung Revier.
2
»Wo waren Sie eigentlich den ganzen Nachmittag?«, fragte Siobhan, als sie das große Glas India Pale Ale vor ihn auf den Tisch stellte. Sie nahm ihm gegenüber Platz, während er Zigarettenrauch zur Decke blies – sein maximales Zugeständnis, wenn er in Begleitung von Nichtrauchern war. Sie befanden sich im Nebenzimmer der Oxford Bar. Alle Tische waren von Büroangestellten besetzt, die einen Tankstopp einlegten, ehe sie nach Hause pilgerten. Siobhan war noch nicht lange zurück im Büro gewesen, als Rebus’ SMS auf dem Display ihres Handys erschien.
lust auf n glas bin im ox
Er war inzwischen in der Lage, eine SMS zu schreiben, zu verschicken und eingehende Nachrichten zu lesen, aber er musste noch lernen, wie man Satzzeichen einfügte.
Und Großbuchstaben.
»Draußen in Knoxland«, sagte er nun.
»Es gab dort heute eine Leiche, hat Col mir erzählt.«
»Gewaltsamer Tod.« Rebus nahm einen Schluck von seinem Bier und schaute missbilligend auf Siobhans schlankes Glas mit der alkoholfreien Mischung aus Soda und Lime Juice.
»Wie kommt’s, dass Sie da draußen waren?«, fragte sie.
»Bin angerufen worden. Jemand im Präsidium hat den Leuten von der West-End-Wache den Tipp gegeben, dass es am Gayfield Square überschüssige Ressourcen gibt.«
Siobhan stellte ihr Glas ab. »Hat man das etwa wörtlich so gesagt?«
»Es war in diesem Fall wirklich keine Lupe nötig, um zwischen den Zeilen zu lesen, Shiv.«
Siobhan hatte längst den Versuch aufgegeben, die Leute dazu zu bringen, statt dieser Kurzform ihren richtigen Namen zu benutzen. Zumal es anderen genauso ging: Phyllida Hawes war »Phyl«, Colin Tibbet »Col«. Angeblich wurde Derek Starr manchmal »Deek« genannt, aber in ihrer Anwesenheit war das bisher noch nicht passiert. Sogar DCI James Macrae hatte sie aufgefordert, ihn »Jim« zu nennen, sofern sie nicht in einer offiziellen Besprechung waren. Aber John Rebus… er wurde von allen »John« genannt, niemals Jock oder Johnny. Es schien, als wäre den Leuten auf den ersten Blick klar, dass er nicht der Typ war, der einen Spitznamen duldete. Ein Spitzname ließ einen Menschen netter und zugänglicher wirken. Wenn DCI Macrae beispielsweise sagte: »Haben Sie einen Moment Zeit für mich, Shiv?«, bedeutete es, dass sie ihm einen Gefallen erweisen sollte. Wenn daraus »Siobhan, bitte in mein Büro« wurde, hatte er ein Hühnchen mit ihr zu rupfen.
»Was denken Sie gerade?«, fragte Rebus jetzt. Er hatte bereits den größten Teil des von ihr gebrachten Biers intus.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe nur über das Opfer nachgedacht.«
»Asiatisches Aussehen oder wie auch immer die politisch korrekte Bezeichnung diese Woche lautet.« Er drückte seine Zigarette aus. »Womöglich Araber oder aus dem östlichen Mittelmeergebiet… ich bin nicht besonders nah herangekommen. War schon wieder eine überschüssige Ressource.« Er schüttelte seine Zigarettenschachtel. Als er feststellte, dass sie leer war, zerknüllte er sie und trank sein Bier aus. »Dasselbe noch mal?«, fragte er und stand auf.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: