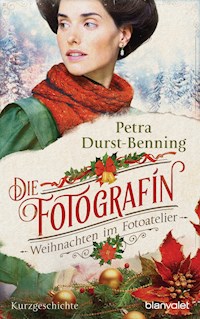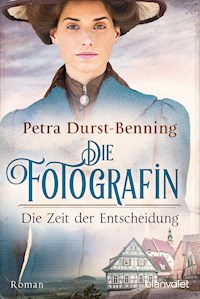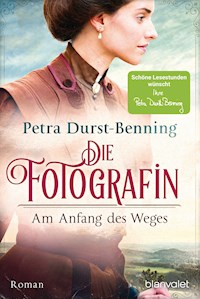9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Berlin, um 1890. Josefine, Tochter eines Berliner Hufschmieds, lernt auf einer Reise in den Schwarzwald die gefährliche, für Frauen geradezu skandalöse Leidenschaft des Radfahrens kennen. Zurück in Berlin, riskiert sie dafür alles. Und sie verliert alles – ihre Familie, ihre Freundinnen und fast sich selbst. Doch Josefines Kämpferherz ist groß! Und die Liebe eines Mannes ermutigt sie, ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Bei einem strapaziösen Radrennen will sie beweisen, was in ihr steckt. Am Ende erkennt sie, dass nicht der Sieg zählt, sondern ganz andere Werte: Freundschaft, Vertrauen und Liebe. Der Jahrhundertwind hilft drei Freundinnen, ihre Träume zu verwirklichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Solang die Welt noch schläft
Die Autorin
Petra Durst-Benning ist eine der erfolgreichsten und profiliertesten Unterhaltungsschriftstellerinnen. Ihre historischen Romane laden die Leser ein, mit ihren mutigen Frauenfiguren Abenteuer und große Gefühle zu erleben. Ob in der Glasbläser-Hütte oder im Stuttgarter Schloss, ihre Heldinnen begegnen den widrigsten Umständen und kämpfen für ihr ganz persönliches Glück im Leben. Petra Durst-Benning lebt mit ihrem Mann bei Stuttgart. Weitere Informationen finden Sie unter: www.durst-benning.deIn unserem Hause sind von Petra Durst-Benning bereits erschienen:Solang die Welt noch schläft – Die Champagnerkönigin – Bella ClaraDie Zuckerbäckerin – Die Zarentochter – Die russische HerzoginDie Samenhändlerin – Floras Traum (Das Blumenorakel)Die Glasbläserin – Die Amerikanerin – Das gläserne ParadiesAntonias Wille – Liebe des Kartographen – Die Salzbaronin – Die Silberdistel – Winterwind – Mein Findelhund
Das Buch
Auf einer Reise in den Schwarzwald lernt Josefine das Radfahren kennen. Nach dem ersten Fahrversuch steht fest: Josefine will die Geschwindigkeit spüren, den Wind in den Haaren und den Kitzel der Gefahr. Denn Radfahren ist gefährlich, nicht nur weil die ersten Velos keine Bremsen haben. Der Freizeitvertreib gilt für Frauen als völlig unangemessen und unsittlich. Zu Hause steckt Josefine mit ihrer Begeisterung die Freundinnen Clara und Isabelle an. Drei Freundinnen, die unterschiedlicher nicht sein können. Die unternehmungslustige Josefine, Tochter eines Hufschmieds, bricht in die Männerdomäne des Radfahrens ein. Die brave Apothekertochter Clara will endlich frei sein von der Tyrannei der Eltern. Und die Fabrikantentochter Isabelle sehnt sich nach der großen Liebe.Isabelles Vater besitzt ein neues Fahrrad, auf dem sie unter Aufsicht ein paar Runden drehen dürfen. Natürlich leihen sie es sich für heimliche Touren aus. Als Josefine dabei einen Unfall verursacht, lassen die Eltern sie in den Jugendarrest bringen. Nach harten Monaten wird Josefine entlassen und schwört sich, nie wieder von ihren Eltern abhängig zu sein. Ihr Wunsch nach Selbstbestimmung und Freiheit ist unbezähmbar. Mutig macht sich Josefine auf den Weg in eine neue, bessere Zukunft.
Petra Durst-Benning
Solang die Welt noch schläft
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage März 2020© Ullstein Buchverlage GmbH Berlin 2012 / List VerlagUmschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, MünchenTitelabbildung © Richard Jenkins PhotographyE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-0184-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Epilog
Anmerkungen
Empfehlungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1. Kapitel
Widmung
»I think the bicycle has done more to emancipate women than anything else in the world. It gives a woman a feeling of freedom and self-reliance. The moment she takes her seat she knows she can’t get into harm unless she gets off her bicycle.«
»Ich denke, das Fahrrad hat mehr zur Emanzipation der Frauen beigetragen als alles andere in der Welt. Es verleiht einer Frau das Gefühl von Freiheit und Selbstvertrauen. In dem Augenblick, in dem sie in den Sattel steigt, weiß sie, dass es ihr gutgeht, zumindest so lange, bis sie wieder absteigt.«
Susan B. Anthony, 1896, eine der führenden Suffragetten
1. Kapitel
Berlin, November 1891, Königlich-Preußisches Frauengefängnis Barnimstraße
Beklommen schaute sich Josefine um. Ein Bett reihte sich ans andere, insgesamt waren es dreißig an der Zahl. Die Eisenstäbe schimmerten kalt unter dem Licht der einzelnen nackten Glühbirne, die in der Mitte des Raumes von der Decke baumelte. Der Blick aus dem vergitterten Fenster verhieß nichts Besseres – ein dünner, schmutziger Vorhang verhüllte nur notdürftig die Aussicht auf brachliegende Öde, die von einer hohen Mauer eingefasst wurde.
Weiter hinten im Schlafsaal war leises Schluchzen zu hören. Jo drehte sich um und erblickte die abgezehrte Rothaarige mit dem typisch spitzen Bauch einer Schwangeren, die zeitgleich mit ihr eingeliefert worden war. Sie kauerte wie ein Häufchen Elend auf einer Pritsche am Ausgang und weinte vor sich hin. Einen Moment lang war Josefine versucht, zu dem Mädchen zu gehen und es zu trösten, überlegte es sich dann aber anders.
Sie hatte seit über achtundvierzig Stunden nicht mehr geschlafen. Ihre Augen brannten und ihr Kopf schmerzte. Ihre rechte Schulter, die sie sich bei dem Unfall verletzt hatte, war angeschwollen und tat höllisch weh. Vorsichtig hob Jo das Gelenk ein wenig an. Bewegen konnte sie die Schulter, wenigstens war nichts gebrochen.
Zögerlich ging sie auf das Bett mit der Nummer vierzehn zu, das die Gefängnisvorsteherin ihr genannt hatte. Sie schob das dünne Tuch, das als Bettdecke dienen sollte, zur Seite. Die Matratze wies unzählige Flecken auf. Als sich Josefine setzte, sackte die dünne Matratze in der Mitte zusammen, schlaff geworden von den vielen Jungmädchenkörpern, die sich Nacht für Nacht darauf in den Schlaf geweint hatten. In dem Schlafsaal war es so kalt, dass Josefines Atem als kleines Wölkchen in der Luft stehen blieb.
Hier also sollte ihr der »Hochmut« ein für alle Mal ausgetrieben werden. Josefine kämpfte mit den Tränen. Erschöpft legte sie sich auf das Bett, zog die Beine an und schlang die Arme um sich in dem hilflosen Versuch, sich gegen die Kälte zu schützen. Mit geschlossenen Augen wartete sie auf gnädigen Schlaf, doch stattdessen kamen die Erinnerungen an die vergangene Nacht zurück …
Am frühen Abend hatte sie noch kurz gezögert: Sollte sie aufbrechen oder doch lieber zu Hause bleiben? Den ganzen Tag über hatte richtiges Schmuddelwetter geherrscht, der Nieselregen und nasses Herbstlaub hatten die Straßen schlüpfrig gemacht, das hatte sie mit geübtem Blick erkannt. Der Wind trug eine erste winterliche Schärfe mit sich – nicht gerade die besten Bedingungen. Dennoch hatte sich Josefine für den Aufbruch entschieden. Ein Fehler, wie sich später herausstellte.
Trotz des schlechten Wetters und obwohl es weit nach Mitternacht gewesen war, hatten Anwohner ihren Unfall beobachtet. Eilig rannten sie aus ihren Häusern in den Regen hinaus. Jemand legte eine Decke über Josefine, die andern starrten sie an wie eine fremdartige Spezies aus dem Berliner Tiergarten.
»Wat bist denn du für eene?«
»Nee, hat man so wat schon jesehen?«
»Lasst se doch liegen! Wat hat die hier verloren?«
»Die Bullen! Jemand muss die Bullen rufen!«
Die meisten waren äußerst feindselig gewesen. Nur ein alter Mann hatte zu ihr gesagt: »Da haste Jlück im Unjlück jehabt, Mädel. Hättste die janze Nacht auf der eiskalten Straße jelejen, wärste womöglich erfroren.« Er trug eine Schlafjacke und sah aus, als wäre er direkt aus dem Bett gekommen. Neben ihm stand eine ältere Frau mit einem schreienden Säugling auf dem Arm und einem sensationslüsternen Blick im Gesicht. Mit spitzen Krallen hatte sie an Jos Kittel gezupft.
»Junges Frollein – wat hamse um diese Nachtzeit hier überhaupt zu suchen? Und dann noch in diesem Aufzug! Det jeht doch nich mit rechten Dingen zu.« Ihre Stimme war schrill und anklagend. Sie war es auch, die loszog, um einen Wachtmeister herbeizuholen. Kaum eingetroffen, hatte er sie mit argwöhnischem Blick betrachtet und mit Fragen bombardiert. »Wie heißt du?« »Was ist passiert?« »Warum die Männerkleidung?«
Sie hatte ihm lediglich ihre Adresse genannt. Von irgendwoher kam ein Fuhrwerk angefahren, in der Mähne des Zugpferdes hing noch Stroh. Josefine wurde zu dem Kutscher auf den Bock gehoben. Der Wachtmeister quetschte sich neben sie. Mit letzter Kraft schaffte sie es, sich auf dem Bock zu halten und nicht hinunterzukippen. Erst da sah sie, dass die Haut an ihrer rechten Hand völlig abgeschürft war. An ihrer linken Hand hatte sie sich alle Knöchel blutig geschlagen, und das Blut hatte sich mit dem Schmutz der Straße vermischt. Vielleicht würde sie an einer Blutvergiftung sterben. Am besten jetzt gleich.
Zu Hause angekommen, donnerte der Polizist mit seiner Faust gegen die Tür. Es dauerte einen Moment, dann wurde im ersten Stock ein Fenster geöffnet und ihre Mutter streckte unwirsch den Kopf heraus.
Josefine war so schlecht vor lauter Angst, dass sie sich beinahe übergeben hätte. Am liebsten wäre sie tot umgefallen. Stattdessen ließ sie sich mit hängendem Kopf und pochender Schulter von dem Polizisten in die Stube führen.
»Meine Tochter hatte was? Einen Unfall mit solch neumodischem Kram? So was gibt’s bei uns im Haus nicht, wir sind redliche Leute. Hufschmied bin ich, da werd ich einen Teufel tun und mir so etwas ins Haus holen!« Konsterniert hatte ihr Vater den Wachtmeister angestarrt, seine Augen quollen dabei fast aus ihren Höhlen. Der Blick, den der Hufschmied ihr, seiner Tochter, anschließend zuwarf, war voller Abscheu und Verachtung gewesen.
»Hier kann nur eine Verwechslung vorliegen. Es ist halb zwei Uhr in der Nacht, unsere Tochter treibt sich nicht herum«, hatte ihre Mutter barsch gesagt. Dann hatte Elsbeth Schmied ihren Morgenmantel über der Brust zusammengezogen und verkniffen ins Leere geschaut. Weder ihr Vater noch ihre Mutter hatten das Wort an sie gerichtet oder ihr gar eine Frage gestellt.
»Nun machen Sie mal kein Theater! Tatsache ist, dass Ihre Tochter auf der Landsberger Allee einen Unfall hatte«, hatte der Polizist ungeduldig erwidert. »Und verletzt ist sie auch, womöglich hat sie sich die Schulter gebrochen. Wollen Sie nicht einen Arzt rufen?« Elsbeth Schmied schaute den Mann aus biestigen Augen an. »Wenn wahr ist, was Sie sagen, können Sie das Luder gleich mitnehmen.«
Im Liegen rieb sich Josefine die lädierte Schulter, die nun, da sie zur Ruhe gekommen war, noch stärker zu schmerzen begann.
Ihre Eltern hatten keinen Arzt rufen wollen. Vielmehr hätten sie ihre Tochter dem Wachtmeister tatsächlich am liebsten sofort übergeben, doch der Mann ordnete an, dass Josefine bis zum Morgen im Haus bleiben und erst um elf Uhr in der Polizeiwache am Görlitzer Bahnhof eintreffen sollte.
Schweren Schrittes und noch schwereren Herzens hatte sich Jo in die Waschküche geschleppt. Als sie sich in der Spiegelscherbe an der Wand betrachtete, erkannte sie sich im ersten Moment gar nicht – der Schmutz und das getrocknete Blut hatten ihr sonst so apartes Gesicht mit den hohen Wangenknochen zu einer hässlichen Fratze werden lassen. Ihre schönen blonden Locken hingen wie eine schmutzige, stumpfe Matte herunter. Hektisch versuchte sich Josefine mit dem kalten Wasser zu reinigen.
In ihrem Zimmer war sie endlich in Tränen ausgebrochen. Alles war aus und vorbei! Sie hatte ihre Eltern angelogen, immer und immer wieder. Sie hatte gestohlen und betrogen. Isabelle würde durch sie in große Schwierigkeiten kommen, vielleicht sogar Clara ebenfalls. Die lebenshungrige Isabelle mit dem aufbrausenden Charakter. Und die schöne, zarte Clara. Ihre besten Freundinnen! All die Jahre waren sie gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Und nun hatte sie sie derart hintergangen. Wie sollte sie zudem jemals für den von ihr verursachten Schaden aufkommen? Wahrscheinlich würde sie für den Rest ihres Lebens verschuldet sein. Oder würde ihr Vater ihre Zeche begleichen müssen?
Von tausend Fragen gequält, hatte Josefine auf das Ende der Nacht gewartet.
Ohne Frühstück und stumm hatte sie sich am Morgen, begleitet von ihrer Mutter, auf den Weg zur Polizei gemacht.
Josefine stöhnte leise auf. War das wirklich erst vor wenigen Stunden gewesen? Ihr kam es wie in einem anderen Leben vor.
»Brauchst dich hier gar nicht erst breitzumachen«, hatte einer der Polizisten auf der Wache gesagt, als sie sich mit steifen Gliedern auf die schmale Holzbank setzen wollte. »Mit euch jungen Verbrechern wird kurzer Prozess gemacht!« Dann hatte er sie und ihre Mutter zum zuständigen Amtsgericht in der Parkstraße gebracht, wo die Verhandlung noch am selben Tag stattfinden sollte.
Von da an hatte Josefine – übermüdet, wie sie war – alles nur noch wie durch einen Nebel wahrgenommen. Der Richter war blass und jung gewesen und sehr beschäftigt. Jedenfalls stapelten sich die Akten in riesigen Bergen auf seinem Schreibtisch, er schob einen davon von links nach rechts, um sie besser sehen zu können.
»Die Frage ist, ob man im Fall der Josefine Schmied von mangelnder Einsichtsfähigkeit sprechen kann oder nicht«, hatte er gesagt, nachdem er sich den Bericht des Wachtmeisters angehört hatte. »Dann wäre bei einer Minderjährigen ein Freispruch durchaus möglich …«
Der Wachtmeister runzelte die Stirn. »Euer Ehren, die Angeklagte ist doch keine dreizehn oder vierzehn mehr, vielmehr erreicht sie in ein paar Monaten, mit achtzehn, die volle Strafmündigkeit! Und laut den Worten ihres Vaters – ein angesehener Hufschmied übrigens – war sie sich der Schwere ihres Vergehens durchaus bewusst.«
»Warum ist der Vater der Angeklagten eigentlich nicht mitgekommen, um uns seine Sicht der Dinge selbst zu schildern?«, hatte der Amtsrichter von Elsbeth Schmied wissen wollen.
»Mein Mann muss arbeiten«, antwortete sie spröde.
»Und wie kann es sein, dass Ihre Tochter nächtens das Haus verlässt und Sie das nicht merken? Noch ist Ihre Tochter minderjährig, Sie haben also eine gewisse Aufsichtspflicht.«
»Aufsichtspflicht, von wegen! Das Gör war schon immer eine Rumtreiberin!«, fuhr Josefines Mutter auf. »Um Verbote oder Anordnungen hat sich unsere Tochter noch nie geschert. Ihr eigenes Pläsier war ihr immer am wichtigsten«, fügte sie bitter hinzu. »Aber wie heißt es so schön – Hochmut kommt vor dem Fall. Nach allem, was geschehen ist, ist unsere Tochter für uns jedenfalls gestorben, das sage ich Ihnen.«
Josefine hatte krampfhaft nach Worten gesucht. Eine Entschuldigung, entlastende Worte – irgendetwas! Hatte sie nicht Tag für Tag bis zur völligen Erschöpfung geschuftet, um ihrem Vater die Arbeitslast zu erleichtern? Hatte sie ihrer Mutter nicht jede noch so beschwerliche Tätigkeit im Haus und ringsherum abgenommen? Aber sie wusste, dass all das nicht mehr zählte – noch nie gezählt hatte. So hatte sie geschwiegen.
Der Amtsrichter schob einen weiteren Aktenstapel über den Schreibtisch, dann richtete er sich auf. Wie auf ein geheimes Stichwort hin zückte seine Sekretärin ihren Stift, um die Urteilsverkündung schriftlich festzuhalten.
»Gemäß Reichsstrafgesetzbuch, § 56 Absatz 1 sowie § 57 Absatz 1 und 2 ordne ich aufgrund der Schwere des Vergehens die sofortige Unterbringung im Frauengefängnis Barnimstraße an. Aufgrund des jugendlichen Alters der Verurteilten und der Tatsache, dass ich ihr eine gewisse Besserungsfähigkeit nicht abspreche, erfolgt die Unterbringung in der neu geschaffenen Jugendabteilung. Die Unterbringung ist verbunden mit täglichem Arbeitsdienst sowie täglichem Unterricht. Die Dauer wird auf dreieinhalb Jahre festgelegt.«
Mit strengem Blick hatte er über seinen Schreibtisch hinweg Josefine angeschaut. »Das Frauengefängnis Barnimstraße ist eine große Chance für junge Menschen, die wie du vom rechten Weg abgekommen sind. Ich hoffe, du entwickelst dort die geistige Reife, die nötig ist, um ein ehrenwertes Leben in Freiheit und Demut führen zu können.«
Als die zwei Wachtmeister Josefine abführten, hatte ihre Mutter nicht einmal mehr den Kopf nach ihr umgedreht.
Man hatte ihr die Kleidung abgenommen und ihr ein grobes Wollkleid gereicht. Einzig ihre Unterwäsche und die Schuhe hatte sie behalten dürfen. Dann hatte eine Wärterin sie in diesen Schlafsaal gebracht und gesagt, dass sie fürs Abendessen zu spät dran sei und sie sich am besten gleich für die Nacht einrichtete.
Josefine war alles gleichgültig gewesen.
Fußgetrappel näherte sich, dann ertönte plötzlich hinter ihr eine Stimme, rau wie Schmirgelpapier: »Sieh mal an, eine Neue. Bestimmt trägt sie noch ihre eigene Unterwäsche und nicht die dünnen Fetzen, wie wir sie anhaben.«
Ein eigentümlicher Geruch nach schlechtem Essen und Schweiß stieg in Josefines Nase – offenbar hatten sich die anderen um ihr Bett geschart. Stur hielt Jo ihren Blick auf die Wand gerichtet. Sie wollte niemanden kennenlernen.
»Was glotzt du so blöde vor dich hin?«, sagte eine zweite Stimme. Jemand pikte ihr einen spitzen Finger in den Rücken. Mehrstimmiges Lachen folgte.
»He, was soll das?« Josefine fuhr wütend herum und setzte sich auf die Bettkante. Beim Anblick der zerlumpten Gestalten erschrak sie. Mit ihnen sollte sie fortan ihr Leben teilen?
Zehn, zwölf junge Mädchen und Frauen waren es, teilweise in ihrem Alter, teilweise jünger – Kinder noch. Ihre Gesichter wirkten jedoch auf unnatürliche Art verlebt und feindselig. Tiefe Furchen hatten sich dort eingegraben, wo rosige Frische ein Zeichen von Jugend sein sollte. Alle waren krankhaft blass, ein Mädchen hatte einen dicken roten Striemen auf der Wange wie von einem Peitschenhieb, ein anderes ein schorfiges Kinn und eine verschorfte Stirn wie nach einer gerade abgeklungenen Pockenerkrankung. Die Haare waren struppig und ungepflegt, die Hände schmutzig, teilweise sogar blutig und mit ungepflegten Fingernägeln. Die Mädchen erinnerten Jo an die vielen Horden von Gassenkindern, die überall in der Stadt unterwegs waren und sich einen Spaß daraus gemacht hatten, sie mit Steinen zu bewerfen oder zu bespucken. Isabelle und sie hatten bei ihrem Anblick stets das Weite gesucht. Ein gruseliger Schauer lief Jo über den Rücken. Dass keines der Mädchen älter als achtzehn Jahre sein sollte, fiel ihr schwer zu glauben.
»Nummer vierzehn ist mein Bett, also steh auf!«, herrschte eine große Hagere sie an und versetzte ihr mit dem Fuß einen schmerzhaften Tritt gegen das Schienbein. Sie hatte raspelkurze Haare wie nach einer Lausschur, tiefliegende graue Augen, und ihre Wimpern und Brauen waren hell, fast durchscheinend. Im Gegensatz zu den dumpfen Gesichtern der anderen wirkte ihr Mienenspiel intelligent. Und eiskalt. Das Mädchen sah aus, als hätte es sein dreißigstes Lebensjahr längst hinter sich.
»Aber die Aufseherin meinte –«, hob Josefine an.
»Das interessiert niemanden. Ich bin diejenige, die hier das Sagen hat! Und ich, Adele, sage, dieses Bett gehört mir«, stellte die Wortführerin kühl fest. Sie nickte zwei Mädchen zu, woraufhin diese sich links und rechts von Josefine platzierten. Doch bevor die beiden sie an den Armen packen konnten, stand Josefine freiwillig auf. Ein Streit war das Letzte, wonach ihr der Sinn stand.
»Und wo soll ich dann schlafen?«, fragte sie gereizt.
»Das schert mich überhaupt nicht«, erwiderte die Hagere.
Missmutig schaute sich Josefine in dem Schlafsaal um. Sie war müde, wollte sich nur hinlegen und die Augen schließen … Ihr Blick fiel erneut auf die Rothaarige, die am Ende des Schlafsaals kauerte und so tat, als wäre sie gar nicht da. Allem Anschein nach waren dort noch Betten frei.
Josefine hatte den Gang schon zur Hälfte durchquert, als sie merkte, dass Adele ihr folgte. Ruckartig drehte sich Jo um. »Was ist denn noch?«
Grinsend verstellte die Anführerin ihr den Weg. »Ich bin noch nicht fertig mit dir. Gib mir deinen Unterrock, bestimmt kann ich ihn gebrauchen.«
»Du spinnst wohl! Nichts dergleichen werde ich tun«, erwiderte Josefine scharf. »Wenn du etwas von mir willst, musst du es dir schon holen.« Herausfordernd baute sie sich vor der anderen auf.
Die Wortführerin zögerte, mit ihren blassen Augen taxierte sie ihr Gegenüber kurz, dann winkte sie ab. »Deine Klamotten würden mir eh nicht passen, wo du so ’ne lange Bohnenstange bist. Zeig mir lieber deine anderen Sachen!«
»Was für Sachen?«
»Na, so wie du ausschaust, hast du bestimmt eine Menge nützlicher Dinge mitgebracht. Seife, einen Kamm, Süßigkeiten – also los, her damit!«
Unter den Anwesenden machte sich eine seltsame Aufgeregtheit breit. Blicke wurden getauscht, die jungen Frauen stießen sich mit dem Ellenbogen an, manch eine schien die Luft anzuhalten. Man schien dieser Sache große Wichtigkeit beizumessen.
»Es ist besser, du tust, was Adele von dir verlangt«, piepste ein kleineres Mädchen am Rand der Gruppe.
Josefine überlegte kurz. Diese Adele schien es wirklich auf einen Streit anzulegen. Es war sicher klug, sich ihr zu stellen, damit sie ihre Ruhe bekam. Mit erzwungener Gelassenheit baute sich Jo vor ihrer Herausforderin auf, woraufhin diese erstaunt und auch ein wenig erschrocken zurückwich.
»Ich habe nichts. Heute früh blieb mir leider keine Zeit, die Kronjuwelen einzupacken.« Mit diesen Worten hob Jo die Hände in die Höhe und schob Adele dann zur Seite. »Und jetzt lass mich in Ruhe.«
Die Anführerin runzelte die Stirn.
Ein Raunen ging durch die jungen Frauen – es kam selten vor, dass sich jemand Adeles Anweisungen widersetzte, und dann noch in dieser Art!
Jo verzog den Mund. Sie hatte keine Angst. Sie war nicht nur einen Kopf größer als Adele, sondern dazu athletisch und gut trainiert: Sie hatte ein breites Kreuz, ihre Beine waren muskulös, ihre Arme sehnig und kraftvoll, dafür hatten die vielen Stunden in der Hufschmiedwerkstatt gesorgt. Ihr Training hatte ebenfalls seinen Teil dazu beigetragen. Im Bewusstsein, Adele und allen anderen körperlich überlegen zu sein, ging sie weiter.
»Glaub nicht, dass du mir so einfach davonkommst! Dafür wirst du noch bezahlen«, hörte sie Adele halbherzig hinter sich rufen.
Josefine hatte sich gerade auf einem neuen Bett niedergelassen, als sie aus dem Augenwinkel bemerkte, wie sich Adele und ihr Gefolge nun dem zweiten Neuzugang widmeten.
»Nein, bitte nicht … Die Haarspange gehörte meiner verstorbenen Schwester, sie ist meine einzige Erinnerung an sie!«, rief das etwa vierzehnjährige Mädchen, während es sich vergeblich gegen Adele zur Wehr setzte. Es hatte rote, struppige Haare und sah ziemlich verwildert aus. Ein lautes Aufheulen folgte.
Jo schloss die Augen.
»Und was hast du noch?«, hörte sie eines der Mädchen fragen.
»Nichts, so glaubt mir doch.« Die Stimme der Rothaarigen klang panisch.
»Nichts gibt es nicht. Deine Unterwäsche. Und deine Socken, her damit!« Diesmal war es wieder Adele selbst, die so sprach.
Ohne nachzudenken, stand Jo wieder auf. Ihre Müdigkeit war verflogen. Wütend stapfte sie auf Adele und ihre Gruppe zu.
Sie war eine verurteilte Diebin. Und sie mochte viel zu viele Fehler haben. Aber sie war kein Feigling! Jahrelang hatte sie sich den Launen und Schikanen ihres tyrannischen Vaters widersetzt, der es stets darauf anlegte, ihren Willen zu brechen. Dass es ihm nicht gelungen war, verdankte sie dem Schutzpanzer, den sie sich im Laufe der Zeit hatte wachsen lassen. Da würde sie sich von einem Biest wie Adele gewiss nicht gleich am ersten Tag den Schneid abkaufen lassen. Und sie würde auch verhindern, dass sich das Weib an Schwächeren verging – auch wenn sich Adele zehnmal einbildete, hier das Sagen zu haben!
Josefines Augen funkelten wütend, als sie Adele am Arm packte und ihr die Haarspange wieder abnahm. Ohne ihre Augen von der Widersacherin abzuwenden, gab sie das verbogene Stück Blech an die Rothaarige zurück.
»Lass die Kleine in Ruhe, sonst bekommst du es mit mir zu tun.« Ihre Stimme war leise und beherrscht, dafür umso bestimmter.
Adeles Fausthieb erfolgte unvermittelt, Jo hatte keine Zeit, sich dagegen zu wappnen. Der Schmerz, der sie durchfuhr, war so heftig, dass ihr einen Moment lang die Luft wegblieb. Im nächsten Moment prasselten weitere Schläge auf sie ein, von links, von rechts, von oben und unten. Stöhnend sackte Josefine wie ein Klappmesser auf dem Steinboden zusammen. Wohlige Befriedigung lag in der Luft, als die anderen jungen Frauen unter Gemurmel und Gekicher einen Schritt zurücktraten.
Sogleich war die Rothaarige bei ihr, mit erschrockener und entsetzter Miene strich sie ihr die Haare aus der Stirn. »Du bist verrückt. Mit so einer legt man sich doch nicht an …«, flüsterte sie, während sie Adele angstvoll im Blick behielt.
»Falls euch beiden immer noch nicht klar ist, nach wessen Pfeife hier alle tanzen, können wir diese Lektion jederzeit wiederholen«, zischte Adele, die noch immer in Siegerpose dastand.
Josefine stöhnte – einer der letzten Schläge hatte sie schmerzhaft mitten in die Rippen getroffen. Mit letzter Kraft schob sie sich an der Rothaarigen vorbei. Sie erwischte Adeles linkes Fußgelenk gerade noch, bevor diese sich entfernen konnte. Prompt verlor die andere das Gleichgewicht und stürzte der Länge nach zu Boden.
Jo rappelte sich auf und ließ sich mit ihrem ganzen Gewicht auf Adeles Brust fallen. Gleichzeitig drückte sie mit ihren Händen deren Arme nach unten. Schwer keuchend schaute sie Adele an und sagte: »Bisher wäre es mir nicht im Traum eingefallen, mich an Schwächeren zu vergehen. Aber du selbst hast mir gerade vorgemacht, wie es geht!« Sie presste ihr rechtes Knie fester auf Adeles Brust, die daraufhin einen Schmerzensschrei ausstieß. Jo lächelte. »Schmeckt dir deine eigene Medizin etwa nicht? Wenn du nicht mehr davon haben willst, dann lass das Mädchen in Ruhe. Und mich ebenfalls!« Abrupt gab sie die Arme der anderen frei und wandte sich mit einem letzten verächtlichen Schnauben ab.
2. Kapitel
Die Scheunentür knirschte, als der Junge sie hinter sich zuzog. Dunkelheit und der altbekannte Duft nach Leder, Hufspänen und Asche umfingen ihn. Seine Ohren lauschten wachsam. Weit und breit keine Menschenseele, nicht einmal eine Maus lugte an diesem sonnigen Sonntagmittag unter den Heu- und Strohballen hervor, die im hinteren Teil der Scheune aufgestapelt waren. Seine Eltern waren zu Besuch bei Verwandten, seine lästige Schwester Josefine hatte er vertrieben. Er hatte die Schmiedewerkstatt, in der sein Vater wochentags von acht Uhr am Morgen bis acht Uhr am Abend Pferde beschlug, für sich allein. Das Herz des Jungen machte einen übermütigen Hüpfer. Wie gut, dass es ihm gelungen war, den Schlüssel zu stibitzen! Bevor die Eltern zurückkamen, würde er ihn in die entsprechende Schublade zurücklegen.
Der Junge grinste, dann legte er den Riegel vor. Es war ihm natürlich verboten, sich allein hier aufzuhalten. Seine Mutter, sein Vater, seine Schwestern – sie alle wussten um seine Begeisterung für die Werkzeuge des Vaters und nannten sie gefährlich. Aber die Erwachsenen hatten keine Ahnung. Die scharfen Messer, mit denen Vater die Hufe ausschnitt, die mächtigen Raspeln zum Abtragen des Horns, die Nietklinge und die Hufnägel – aufregendes Spielzeug, alles miteinander.
Doch heute streifte der Junge die Werkzeuge mit keinem Blick. Stattdessen ging er sofort zur Feuerstelle, in der die Hufeisen so lange erhitzt wurden, bis das Eisen auf dem Amboss geschmiedet werden konnte.
Der Junge liebte Feuer. Die rotgoldenen Flammen, die Hitze, das aufregende Knistern. Feuer zu machen war natürlich auch verboten. Oder besser gesagt VERBOTEN – ein Wort mit acht Großbuchstaben!
Wenn man Zeitungspapier verbrannte, bestand die Kunst darin, eine einzelne Seite so lange wie möglich am Lodern zu halten. Dies konnte einem auf verschiedene Arten gelingen: indem man die Zeitung auf spezielle Weise zusammenknüllte oder sie mit einem kleinen Holzspan hin und her bewegte und während des Verbrennens in kleine Stücke zerriss. Gut war es auch, wenn man vorher Hufnägel in das Papier einwickelte. Noch besser branntenmit Zeitungspapier umwickelte dünne Hufspäne. Welche die besteMethode war, darüber war sich der Junge noch nicht im Klaren. Aber heute würde er ausgiebige Versuche dazu anstellen. In seiner eigenen Feuerstelle. In der Mitte der Scheune, auf dem Steinboden.
Freudig zog er die Schublade auf, in der sein Vater die Streichholzschachteln aufbewahrte.
Verbotenes.
»Felix? Felix, wo bist du? Du Lausbub, wo hast du dich versteckt?«
Die Miene des Jungen war angespannt. Ausgerechnet jetzt musste Josefine daherkommen und nach ihm suchen! Er brauchte doch nur noch ein paar Minuten, dann hatte er die Versuche seiner Testreihe für den heutigen Tag abgeschlossen. Ein weiteres Streichholz schon in der Hand, ging er mit flinken Schritten zur hinteren Scheunentür und verriegelte auch diese. So. Nun konnte sich seine liebe Schwester die Kehle aus dem Leib schreien!
Er grinste.
Nach seinem letzten Versuch würde er die Papierasche zusammenkehren, und wenn alles sauber war, würde er die Türen wieder öffnen. »Was ist denn?«, würde er lammfromm fragen und Josefine seine Holzpferde vorzeigen. »Ich habe doch nur ein wenig im Heu gespielt.«
Um seine Ausrede später glaubhaft untermauern zu können, zog er einen der Heuballen, die während des Beschlagens an unruhige Pferde verfüttert wurden, in die Raummitte. Dort hatte er auf den kalten Steinfliesen seine Feuerstelle eingerichtet. Oder besser gesagt sein »Labor«. Herr Günthner, sein Lehrer, hatte gesagt, dass überall im Kaiserreich Wissenschaftler in Laboren tätig waren, um bahnbrechende Erkenntnisse für neue Erfindungen zu erlangen. Vielleicht würde ihm das auch gelingen? Voller Eifer ging der Junge wieder in die Hocke.
Wenn er einen zusammengeknüllten Zeitungsbogen verbrannte, konnte er bis zwanzig zählen, ehe das letzte bisschen Glut erlosch. Ein Bogen gespickt mit Hufnägeln hielt die Hitze und somit die Glut länger in sich, er hatte dabei schon bis dreiundzwanzig gezählt. Die anderen Tests waren alle schlechter ausgefallen.
Nun galt es … Der Junge zündete einen neuen Bogen Papier an, dann nahm er zwei dünne, lange Holzspäne in je eine Hand. Vorsichtig zupfte er damit das Papier auseinander, bis er zwei brennende Teile hatte. Gut! In wie viele kleine Teile er den glühenden Bogen wohl würde trennen können? Und wie lange würden diese brennen?
Wie immer, wenn sich der Junge konzentrierte, schob er die Unterlippe über die obere. Vier Teile, fünf … Wie ärgerlich, die kleinen verglühten sehr schnell. Ein Ascheflöckchen segelte ihm in die Nase, kitzelte ihn. Er schnaubte heftig. Durch den Lufthauch flog einer der größeren brennenden Papierfetzen in die Höhe. Er landete genau am Fuß des Heuballens.
Erschrocken sprang der Junge auf. Ein Schauer durchfuhr den Körper des Zwölfjährigen. Heu brannte wie Zunder, das wusste jedes Kind! Nicht umsonst baute der Vater die Ballen immer ganz außen an der Wand entlang auf, weit entfernt von der Feuerstelle. Noch während der Junge nach etwas suchte, womit er den Feuerherd ersticken konnte, legte sich der brennende Papierfetzen wie Blattgold auf den Heuballen. Gelbglühende Zungen leckten am Heu, und der angenehme Geruch nach geräucherten Kräutern stand in herbem Kontrast zur Angst des Jungen.
Vaters Beschlagschürze! Das schwere Leder würde dem Feuer den Garaus machen! Der Junge riss die Schürze samt Haken von der Wand. Doch als er mit seiner schweren Last zu dem Heuballen zurückkehrte, brannte dieser schon lichterloh. Kleine schwarze Fetzen sprangen wie glühende Flöhe durch die Luft.
»Felix! Was ist da drinnen los? Mach sofort auf!«, kreischte es hysterisch vor dem Tor. Josefine. Sie ließ wieder einmal nicht locker.
»Gleich, ich komme sofort!«, rief der Junge und schlug hastig mit der Schürze auf den Heuballen. Geh aus! Geh aus! Im selben Moment spürte er in seinem Rücken Hitze auflodern. Die anderen Papierfetzen! Durch seine schnellen Bewegungen waren ein oder zwei davon zu nahe an den Stapel mit den Holzspänen geraten, und wenige Wimpernschläge später brannte das ausgedörrte Holz lichterloh. Dunkelgrauer Rauch stieg auf, vernebelte die Sicht des Jungen, verwirrte seine Sinne. Taumelnd versuchte er, sich in der aufsteigenden Hitze zurechtzufinden.
»Josefine … Hilfe!« Panisch schlug er mit der Lederschürze auf das brennende Holz ein, doch statt das Feuer zu löschen, verteilte er die Glut nur noch mehr. Um ihn herum sprühten nun überall Funken, verbanden sich kleine Brandherde zu größeren, wurde das Knistern des verbrennenden Heus immer lauter. Längst war der Weg zu beiden Türen durch das Feuer versperrt. Angstgelähmt starrte der Junge auf das brennende Inferno, in dem es nur eine einzige schwarze Stelle gab: die mit robusten Steinen ausgekleidete Feuerstelle seines Vaters. Wenn es ihm gelang, sich dorthinein zu retten, konnte er abwarten, bis sich das Feuer wieder beruhigt hatte. Blind vom Rauch tastete sich der Junge in diese Richtung vor. Ein Schritt. Nein, nicht zur Seite! Rasch schlug er auf seinen Ärmel, der fast Feuer gefangen hätte. Noch ein Schritt. Da, gleich hatte er es geschafft. Die unerträgliche Hitze. Nicht daran denken. Gleich, gleich …
Der Junge spürte, wie seine Knie nachgaben. Einen Meter von den schutzbietenden Steinen entfernt sackte er zu Boden …
Mit einem Aufschrei fuhr Josefine im Bett hoch, schaute sich konfus um. »Felix?«
»Was ist, hast du schlecht geträumt?«, murmelte jemand neben ihr.
Josefine blinzelte verwirrt. Die Rothaarige. Das Frauengefängnis Barnimstraße.
Schweißnass und zitternd sank sie auf ihr Lager zurück. Von weiter hinten war Schnarchen zu hören und ein leises Jammern, ansonsten war es im Schlafsaal still. Vor den vergitterten Fenstern dämmerte es schwach, ein Käuzchen oder ein anderes Tier stieß einen schrillen Schrei aus. Er erinnerte Jo an Freiheit und bessere Zeiten.
Schon immer war sie früher als alle anderen wach gewesen. »Solang die Welt noch schläft …« – wie oft hatte sie diesen Satz gesagt! Dann gehörte ihr die Welt allein. Dann war sie frei. Sie hatte sich stets auf jeden neuen Tag gefreut.
Nun versuchte sie krampfhaft, wieder in den Schlaf zu finden. Doch die Gedanken an ihren kleinen Bruder ließen sich nicht einfach verdrängen.
In der Anfangszeit nach Felix’ Tod hatte sie regelmäßig von ihm geträumt. Seltsame, verworrene Träume, in denen sie abwechselnd durch ihre oder seine Augen sah, so wie in dem Traum gerade eben. Schuldgefühle und ihr schlechtes Gewissen hatten sie damals bis in den Schlaf verfolgt. Doch irgendwann waren die Träume und Gedanken seltener geworden, viel zu sehr war sie damit beschäftigt gewesen, ihr Leben zu leben, intensiv und in vollen Zügen.
Ihr Bruder war im Frühjahr 1889 ums Leben gekommen, an einem herrlichen und für die Jahreszeit ungewöhnlich warmen Sonntag. Über zwei Jahre war das nun her. Nach dem Kirchgang hatte ihr Vater, der von allen nur »der Schmied-Schmied« gerufen wurde, ihr eröffnet, dass er und die Mutter einen Besuch bei Vaters Schwester machen wollten. Sie sollte währenddessen zu Hause auf Felix aufpassen. Josefine war wütend gewesen – als sie in Felix’ Alter war, hatte sich doch auch niemand um sie gekümmert, und ein Ausflug quer durch die ganze Stadt hätte ihr gut gefallen!
Eine Weile lang hatte sie lustlos zugeschaut, wie sich ihr kleiner Bruder über irgendwelchen Hausarbeiten abmühte, dann war sie zu ihrer Freundin Clara gegangen, die vier Häuser weiter wohnte.
Clara war wieder einmal krank gewesen. Wie eine Königin hatte sie inmitten ihrer blütenweißen bestickten Bettwäsche gethront. Zeitschriften, ein Glas tiefroter Beerensaft, eine Schale mit Gebäck aus der Konditorei Ratsmann – bei der Familie Berg wurde das Kranksein stets zelebriert, als handle es sich um eine Geburtstagsfeier. Seit Clara im Alter von sieben Jahren fast an einer Blinddarmentzündung gestorben war, hätte ihre Mutter Sophie sie am liebsten für immer in Watte gepackt. Josefine war deswegen fast ein wenig neidisch gewesen, denn bei ihr zu Hause hatte es immer nur geheißen: »Beeil dich mit dem Gesundwerden, vom faul im Bett Herumliegen wird die Arbeit nicht getan.«
Sie hatten die Zeitschriften angeschaut, und Clara hatte sich dabei in ein Modellkleid verliebt. Jo war es sehr schwer gefallen zu glauben, dass Clara und ihre Mutter extra in ein Atelier auf dem Boulevard Kurfürstendamm fahren würden, um solch ein Kleid zu erstehen. Die Schürzen und Kleider, die Josefine und ihre beiden älteren Schwestern trugen, gab’s im Kaufhaus Reutter gleich um die Ecke. Als »chic« konnte man sie weiß Gott nicht bezeichnen.
Bald wurden Josefine die Zeitschriften langweilig. Sie schlug Clara vor, Frieda zu besuchen. Die alte Nachbarin würde ihnen bestimmt eine Limonade anbieten, und sie konnten bei ihr im Garten sitzen. Außerdem war es bei Frieda immer interessant, denn die alte Witwe lebte ein Leben, von dem sie nur träumen konnten: ohne lästige Regeln und Pflichten, ohne einen starren Tagesablauf. Seit ihr Mann gestorben war, tat Frieda nur noch das, was ihr gefiel. Josefine bewunderte sie dafür sehr.
Doch Clara schüttelte nur mit dem Kopf. »Ich bin doch krank. Und davon abgesehen – Mutter sieht es nicht gern, dass ich Frieda so oft besuche. Sie ist jemand, der anderen schnell einen Floh ins Ohr setzt, hat sie erst gestern gesagt.« Es folgte das Schulterzucken, das für Clara so typisch war und nach dem man genauso schlau war wie zuvor.
Aus Mitleid mit der kranken Freundin war Josefine geblieben, doch sie hatte dabei das Gefühl gehabt, es keine Minute länger in Claras Zimmer mit seinem durchdringenden Lavendelgeruch und der Tapete mit dem auffälligen Blumenmuster auszuhalten. Abrupt war sie vom Stuhl aufgestanden und ans Fenster getreten, um es zu öffnen.
Die an Werktagen so belebte »Luisenstadt« war an diesem Tag wie ausgestorben gewesen. Das Viertel, das den Namen von Luise, der Gattin von König Wilhelm III., trug, grenzte im Westen an die Lindenstraße, im Süden an den Landwehrkanal und im Osten an eine Parkanlage mit dem Namen »Schlesischer Busch«. In Laufweite gab es alles, was die Bewohner fürs tägliche Leben benötigten: ganz vorn an der Ecke das große Kaufhaus Reutter, wohin man jedoch nicht alle Tage ging. Dazu Bäcker, Fleischer, Kolonialwarengeschäfte, ein Schuster und zwei Schneider. Die Apotheke von Claras Vater und die Hufschmiede vom Schmied-Schmied lagen, nur durch drei Häuser getrennt, in der langgezogenen Görlitzer Straße hinter dem Lausitzer Platz. Gegenüber der Apotheke standen ein paar schmale Wohnhäuser und dazwischen ein einzelnes kleines Häuschen, das jedoch den größten Garten in der ganzen Straße besaß. In diesem Häuschen wohnte die alte Frieda. Direkt an ihren Garten grenzte in südlicher Richtung der Görlitzer Bahnhof an – die Geräusche der an- und abfahrenden Züge waren im ganzen Viertel zu hören. Ging man weiter die Straße entlang, kam man an einer Seilerei vorbei, die zwei mürrischen alten Brüdern gehörte. Daneben gab es noch den Eisenwarenladen der Ottos, der von einem pompösen Schild geziert wurde. Das untere Ende der Straße wurde völlig von der Bekleidungsfabrik des Unternehmers Moritz Herrenhus eingenommen. Die verwinkelten Fabrikgebäude, die von Jahr zu Jahr größer wurden, reichten fast bis in den Schlesischen Busch hinein. Auch eine Wäscherei und eine kleine Fabrik, die Drahtbügel für Korsette herstellte, waren in diesem unteren Teil der Straße zu finden. Doch das Viertel vollzog einen Wandel, der niemandem, der Augen im Kopf hatte, entging: Immer mehr alte Handwerksbetriebe schlossen, weil sich die Arbeit nicht mehr rentierte, andere zogen an den Stadtrand, wo sie genügend Platz hatten, ihre Waren mit Hilfe großer Maschinen schneller und günstiger zu produzieren.
»Sollen sie nur alle gehen«, hörte man den Schmied-Schmied des Öfteren sagen. »Für Handwerksbetriebe wie eine Seilerei mag die Zeit in der Stadt abgelaufen sein, aber Pferde müssen immer beschlagen werden. Mir wird die Arbeit nicht so schnell ausgehen.«
Arbeit, Arbeit, von früh bis spät – das war alles, was Josefines Leben ausmachte! Missmutig hatte sie aus Claras Fenster gestiert und sich weit fortgewünscht.
Acht bis zehn Pferde beschlug ihr Vater jeden Tag. Montags waren es auch einmal zwei Tiere mehr, denn dann kamen die Droschkenpferde der Allgemeinen Berliner Omnibus-AG dazu, die übers Wochenende noch mehr Städter als sonst durch die Straßen kutschiert hatten. Montags wurde es oft zehn Uhr am Abend, ehe Josefine mit dem Aufräumen und Saubermachen in der Schmiede fertig war. Dass Felix dabei half, erwartete niemand. Niemand fand etwas dabei, wenn er sich mit seinen Holzpferden und Kutschen beschäftigte, die echten Pferde und die Arbeit, die sie machten, jedoch ignorierte. Felix war schließlich der kleine Prinz. Sie nur die Magd. Und wegen ihm hatte sie nun auch noch auf den Besuch beim Onkel verzichten müssen …
Josefines Kopf war voller griesgrämiger Gedanken gewesen, als Sophie Berg in Claras Zimmer erschien. »Aus der Werkstatt deines Vaters steigt Rauch auf, und das an einem Sonntag – was hat das zu bedeuten?«, hatte sie stirnrunzelnd gefragt.
Josefine schloss die Augen. Sie wollte sich nicht erinnern. Nicht hier und nicht jetzt. Aber ihre Gedanken ließen sich nicht aufhalten, wie wild gewordene Pferde stürmten sie durch ihren Kopf.
Das Scheunentor war verriegelt gewesen. Felix’ Namen schreiend, konnte sie bereits den Geruch nach Feuer und verbranntem Horn riechen. Der Spitzbube! Wie oft hatten die Eltern ihm verboten, an die Streichhölzer zu gehen? Wenn sie herausbekamen, dass der Junge schon wieder gezündelt hatte, würde man dies ihr anlasten! Angstvoll und verärgert zugleich trommelte sie mit der rechten Faust so fest gegen das Tor, dass ihre Hand schmerzte. Wut und Angst wuchsen. »Mach auf!« Doch erneut geschah nichts. Sie glaubte jedoch, ein leises Lachen zu hören.
»Na warte!« Ihren Rock zusammenraffend, rannte sie in den Geräteschuppen. Eine Axt. Sie brauchte ein Werkzeug, groß und schwer, mit dem sie die Tür aufbrechen konnte. Schnell hatte sie gefunden, was sie suchte. Josefine donnerte die Axt mit einer solchen Wucht gegen die Scheunentür, dass sie ihr aus der Hand fiel. Die Tür gab zwar nicht nach, aber zwei ihrer Bretter hatten sich durch die Kraft des gewaltigen Schlags gelockert. Sogleich drang die Hitze machtvoll nach außen, das Feuer nährte sich durch die frische Luft und loderte in der Nähe der Tür hellgelb auf.
Josefines Handgelenke brannten, Splitter trieben sich in ihr Fleisch, als sie die Holzbretter mit bloßen Händen herausriss.
Lieber Gott, pass auf meinen Bruder auf. Er ist doch noch ein Kind, er weiß nicht, was er tut. Lieber Gott, nimm mir alles, aber pass auf meinen Bruder auf.
Sie hatte zu Gott gebetet wie noch nie in ihrem Leben. Aber Gott war nicht anwesend an jenem Sonntag. Das Feuer jedoch … Es hatte ihre Gedanken und Gebete ausgelöscht. Und Felix’ Leben noch dazu.
»Felix! Wo bist du?« Ihre Stimme klang gedämpft, als würde sie durch einen dicken Stofflappen sprechen. Heftig blinzelnd schaute sie in das glühend heiße Flammenmeer, und in ihren Ohren pochte ein bohrender Schmerz, während sie sich blind in die brennende Hölle vortastete.
Sie war zu spät gekommen. Ihr kleiner Bruder war in den Flammen jämmerlich verbrannt.
3. Kapitel
Das Frühstück war eine karge Angelegenheit, die unter der Aufsicht von zwei mürrischen Aufseherinnen in einem düsteren, kalten Saal stattfand. Auch hier gab es nur im oberen Drittel der Wände schmale Fenster, durch die wenig Licht fiel. Wie in einem Keller, dachte Jo und setzte sich an einen der äußeren Tische. Vielleicht lagen die Räume, in denen sich die Jugendabteilung des Frauengefängnisses befand, tatsächlich unter der Erde? Als sie eingeliefert worden war, hatte sie auf solche Dinge wie Treppenstufen nicht geachtet, aber »lebendig begraben wie in einer Gruft« – so fühlte sie sich schon jetzt, nach nur einer Nacht. Am liebsten wäre sie aufgestanden und einfach gegangen.
Während sie eine trockene Schrippe kaute und dünnen Tee dazu trank, spürte sie immer wieder Adeles feindseligen Blick. Die Wortführerin tuschelte mit den um sie herumsitzenden Mädchen und deutete immer wieder in ihre Richtung. Ein, zwei Mal trafen sich dabei ihre Blicke. Jo nahm sich vor, auf der Hut zu sein.
»Und? Weswegen bist du hier?«
Unwillig schaute Josefine die Rothaarige an, die neben ihr Platz genommen hatte. Auch das noch. Sie wusste nicht einmal, wie das Mädchen hieß. Ob es wirklich schwanger war oder nur eine seltsame Figur hatte. Und sie wollte all das auch gar nicht wissen.
»Diebstahl«, antwortete sie kurz angebunden.
»Wenn’s mehr nicht ist …« Die Rothaarige wirkte enttäuscht. »Ich bin reingelegt worden!«, fügte sie hinzu und begann eine langwierige Geschichte zu erzählen, in der drei Freundinnen, ein altes Ehepaar und Geld unter einer Matratze eine Rolle spielten. Dass am Ende der Geschichte das alte Ehepaar tot in seinen schmalen Betten lag, schien die Rothaarige nicht sonderlich zu verstören. Sie habe damit nichts zu tun, betonte sie mehrmals.
Als ob sie, Josefine, das alles interessierte! Sie kaute stumm und wünschte sich, die Ohren so schließen zu können, wie man es mit Augen machen konnte.
»Und genauso bin ich hiermit reingelegt worden.« Das Mädchen schlug mit ihrer rechten Hand grob auf ihren Bauch. »Er würde aufpassen, hat er gesagt. Und dass wir beide Spaß haben würden. Von wegen Spaß! Aber ein Gutes hat die Sache: Ohne Bauch hätten sie mich nach Moabit gesteckt, hierher hat man mich nur gebracht, weil das Weibergefängnis eine Entbindungsstation hat.« Die Rothaarige streckte Josefine eine Hand entgegen. »Ich heiße übrigens Martha!«
Josefine blieb nichts anderes übrig, als die Hand zu ergreifen. Sie war feucht und es klebten ein paar Brotkrümel daran.
»Jo.«
»Zu lang ist dein Name jedenfalls nicht!« Martha lachte. »Und er hört sich eher nach einem Mann an. Aber so, wie ich dich kennengelernt habe, passt er zu dir. Er wirkt sehr … robust.«
Zum ersten Mal, seit sie in diesen Alptraum geraten war, wanderte ein leises Lächeln über Josefines Gesicht. »Das hat schon einmal jemand zu mir gesagt.«
Martha, die Jos Lächeln offenbar als persönlichen Erfolg verbuchte, strahlte. »Eine Freundin? Hast du eine?«
Jo biss schweigend von ihrer Schrippe ab. Und ob sie Freundinnen hatte, sehr gute sogar – die besten, die man sich denken konnte! Mit Clara war sie von Kindesbeinen an befreundet, Isabelle kannte sie ebenfalls von klein auf. Aber richtig angefreundet hatten sie sich erst vor zwei Jahren. Und dann gab es noch Lilo im Schwarzwald.
»Die wollen bestimmt nichts mehr von mir wissen«, sagte sie missmutig. »Wo ich doch den Vater meiner Freundin Isabelle bestohlen und geschädigt habe.« Jo wurde jetzt noch schlecht beim Gedanken daran, wie der Bekleidungsfabrikant Moritz Herrenhus sich in der besagten Nacht aufgeführt hatte. Statt mit ihr zu reden, hatte der Unternehmer sofort Anzeige erstattet.
»Oh«, sagte Martha und sah nicht so betroffen aus, wie sie klang. »Freundinnen!« Sie winkte ab. »Wahrscheinlich haben sie dich auch irgendwie reingelegt und du hast es nicht gemerkt! Das ist schon die zweite Gemeinsamkeit, die wir haben. Die erste ist, dass wir beide gestern hier ankamen.«
Josefine schaute Martha entsetzt an. Was redete sie für Blödsinn? Nichts, aber auch gar nichts hatten sie gemeinsam!
Martha ergriff unbekümmert Josefines rechte Hand und drückte sie fest. »Wenn du magst, kann ich ja deine Freundin sein.«
Josefine riss ihre Hand los. »Nur weil ich dir gestern aus der Patsche geholfen habe, brauchst du nicht anhänglich zu werden wie eine Klette! Dass eines klar ist: Zukünftig kannst du selbst auf dich aufpassen, ich habe nämlich keine Lust –«
Eine schrille Glocke ertönte und hielt Josefine davon ab, Martha weitere Bosheiten ins Gesicht zu schleudern.
Karlheinz Krotzmann hatte das Torhaus des Frauengefängnisses Barnimstraße gerade passiert, als das altbekannte Rumoren in seiner Magengegend begann. Mit verzerrtem Gesicht, als habe er Zahnweh, ließ er seinen Blick über die Anlage schweifen, die vor nicht allzu vielen Jahren auf Beschluss des Königlichen Justizministeriums von namhaften Architekten am Rand des Volksparks Friedrichshain gebaut worden war. Das Königlich-Preußische Weibergefängnis! Ein U-förmiger Bau, der etliche Hundert Insassen beherbergte. Im linken Flügel lagen die Wohnungen der Beamten sowie die Küchenbauten. Das Frauengefängnis hatte sogar ein eigenes Kessel- und Maschinenhaus, das den Gebäudekomplex mit Strom und Licht versorgte. Hinter dem Hauptgebäude gab es einen Obst- und Gemüsegarten, der von den Insassen gepflegt wurde. Sogar an den Bau einer Anstaltskapelle im obersten Stock des Hauptgebäudes hatten die Herren Architekten gedacht.
Karlheinz Krotzmann schnaubte. Er hätte wetten können, dass so gut wie niemand je einen Fuß in das Herrgottshaus setzte.
Das Gefühl des Unwohlseins wuchs mit jedem Schritt, den er durch die desolate Anlage machte. Obwohl das Gebäude kaum älter als zwanzig Jahre war, mutete alles abgenutzt und verkommen an. Das Pflaster des Weges, der auf das Haupthaus zuführte, war löchrig und uneben, nirgendwo gab es eine Mauer, die nicht fleckig war oder einen moosigen Belag aufwies, die Fenster waren stumpf, die Gitter verrostet …
Diese Menschen waren wie Tiere! Sie demolierten alles ohne Rücksicht auf Verluste, dachte Karlheinz Krotzmann und war froh, dass sein Unterrichtsbeginn nicht mit dem Freigang der Insassen zusammenfiel. Der Gedanke, dieselbe Luft zu atmen wie Mörderinnen und Diebinnen, beunruhigte ihn.
Er hatte den Haupttrakt fast erreicht, als er den Hausmeister mit einem Leiterwagen, auf den Werkzeuge aller Art getürmt waren, um die Ecke kommen sah. Er wohnte in einer kleinen Wohnung auf dem Gelände und war von früh bis spät mit Reparaturen beschäftigt. Was für ein Leben!, dachte Krotzmann schaudernd und nickte dem Hausmeister mitleidig zu. Nach einer kurzen Begrüßung sagte der Mann: »Ich brauche eine neue Gehilfin. Möchte zur Abwechslung eine von den Jungen nehmen, die sind vielleicht noch nicht gar so verkommen wie die Erwachsenen. Können Sie mir am Ende Ihres Unterrichts jemanden schicken?«
Krotzmann, der dafür zuständig war, die jugendlichen Strafgefangenen der Wäscherei, den Putzkolonnen oder der Küche zuzuteilen, nickte.
»Hatten Sie nicht in der vorigen Woche ein älteres, hageres Weib an Ihrer Seite, das Ihnen half, den Zaun vom Hühnerstall zu flicken? Was ist mit der Frau geschehen?«
Der Hausmeister schnaubte. »Wollte mir den Fäustel über die Rübe schlagen, hab’s im letzten Moment gemerkt und konnte gerade noch ausweichen. Jetzt haben sie die Alte in eine Einzelzelle gesteckt. Schade, ich hätte gedacht, dass was Besseres in ihr steckt.«
Etwas Besseres in ihr steckt! Der Mann war wirklich ein Trottel, wenn er an so etwas glaubte. Krotzmanns Magengrimmen wurde heftiger. »Ich schaue, was ich machen kann«, sagte er, dann drückte er das schwere Eisentor des Haupttraktes auf. Dessen unangenehmes Quietschen war das tägliche Startsignal für die dreistündige Qual, die er in der neu geschaffenen Jugendabteilung durchleben musste.
Eine Jugendabteilung – Geldverschwendung wie die Gefängniskapelle! Seiner Ansicht nach machte es keinen Unterschied, ob man die Huren und Diebinnen erst ein paar Jahre gesondert einsperrte oder ob man sie gleich mit den erwachsenen Straftätern wegsteckte. Von wegen: »Sind vielleicht noch nicht ganz so verkommen!« Wenn er nur an diese Adele mit den eiskalten Augen dachte, wurde ihm ganz anders. Hinterrücks den eigenen – trunkenen – Vater zu erschlagen, das musste man sich mal vorstellen!
Was für eine Schande, dachte Krotzmann nicht zum ersten Mal und spürte, wie ihm bei diesem Gedanken die Galle hochkam. Eine abgrundtiefe Schande, dass ausgerechnet er vom Schulamt dazu verdammt worden war, hinter den Gittern des Frauengefängnisses Barnimstraße »Unterricht« abzuhalten. Natürlich hatte der Herr der Oberschuldirektion es anders genannt: »Ein Versuch, auf Abwege geratene junge Mitglieder der Gesellschaft wieder auf den rechten Weg zu führen. Eine erzieherische Herausforderung, die Strenge und Güte zugleich erfordert.« Es hatte geheißen, dass man ihm, Karlheinz Krotzmann, diese Tätigkeit zutraute. Ihm war nichts anderes übriggeblieben, als sich zu fügen, in der Hoffnung, dass ein, zwei Jahre im Weibergefängnis seinem Streben nach höheren Ämtern hilfreich sein würden. So fuhr er nun seit gut einem Jahr mit der Straßenbahn durch die halbe Stadt, Tag für Tag, in diesen Höllenpfuhl. Und von Tag zu Tag wuchsen seine Abscheu und sein Hass auf seine Schülerinnen. Wie es ihn allein anwiderte, sie so zu nennen …
Nicht, dass er anfänglich nicht die besten Absichten gehabt hätte! Da es keine Unterrichtspläne für diese Art von »Schule« gab, hatte er eigene entwickelt. Lektionen, die vor allem die Disziplin und Ausdauer der Schülerinnen forderten statt ihren Intellekt: das kleine Einmaleins, Lesen, Schreiben und das Auswendiglernen von Texten.
Doch schon nach kürzester Zeit war er zur Überzeugung gelangt, dass seine so klug erdachten Pläne bei dem dummen, undisziplinierten Haufen für die Katz waren. Ein Arbeitslager wäre für die faulen Schlampen seiner Ansicht nach wesentlich geeigneter gewesen als das große Einmaleins oder Goethes Gedichte.
Karlheinz Krotzmann holte ein letztes Mal tief Luft, dann riss er die Tür des sogenannten »Klassenzimmers« auf – lediglich ein weiterer schlecht belüfteter, düsterer Raum.
»Guten Morgen, Herr Krotzmann!«, ertönten fast dreißig junge Mädchenstimmen.
Wenigstens die Begrüßung funktionierte. Aber wie sie auf ihren Stühlen lungerten! Schon an ihrer Körperhaltung konnte man das Ausmaß ihres schlechten Charakters erkennen, dafür bedurfte es nicht einmal eines Blickes in ihre boshaften Augen.
Er sah die zwei Neuzugänge sofort. Eine rothaarige Schlampe, ängstlich dreinschauend. Entweder gehörte sie zu denen, die hier nichts zu lachen hatten. Oder sie hatte es besonders faustdick hinter den Ohren. Daneben saß noch eine junge Frau –
Krotzmann stutzte. Was hatte so eine hier verloren? Sie war groß und schlank, hatte einen ebenmäßigen Teint und gepflegte lockige Haare. Im Gegensatz zu den anderen Weibsbildern mit ihren gekrümmten Schultern saß diese junge Frau aufrecht und mit einer natürlichen Eleganz da. Krotzmann spürte, wie sich innerlich Stacheln in ihm aufstellten. Aus der Gosse stammte so jemand nicht. War es schon so weit gekommen, dass nun auch Mädchen aus besserem Hause nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden konnten? Was hatte sie wohl verbrochen? Einen gutmütigen Trottel übers Ohr gehauen? Ein armes Mütterlein bestohlen? Oder jemanden erschlagen? Die Tatsache, dass die Neue so gut aussah wie die Schauspielerinnen auf den Plakaten des Berliner Schauspielhauses, nährte seine Feindseligkeit ihr gegenüber nur noch.
Ungeduldig klopfte er mit seinem Holzstock auf das Pult. Mit zusammengekniffenen Augen schaute er über die Zöglinge hinweg.
»Wenn ich euch herumlungern sehe, wird mir schlecht! Wie oft muss ich euch die gewünschte Haltung noch erklären? Die Füße müssen mit ihrer ganzen Sohle auf dem Boden stehen! Die Oberschenkel müssen ihrer Länge nach auf der Bankfläche aufliegen! Ihr hingegen lungert auf der Kante der Bank herum, pfui Teufel!« Er nahm seinen Stock, schlug damit einer Schülerin in der ersten Reihe auf den Rücken. Ein klatschendes Geräusch entstand.
»Und du, halte den Kopf gerade! Das Kinn darf die Brust nicht berühren.« Ein weiterer Schlag, diesmal auf den Rücken der Nachbarin. Keins der Mädchen zuckte auch nur mit der Wimper. Einstecken konnten sie, das musste man ihnen lassen. Aber warum kassierten sie lieber Hiebe, statt seinen Anweisungen zu folgen?, fragte er sich, während er auf die hinteren Reihen zuging.
»Und jetzt alle: die Füße parallel nebeneinander und flach auf den Boden! Die Oberschenkel ihrer Länge nach auf der Bank. Eure Oberkörper dürfen nur wenig nach vorn geneigt sein, und wehe, ihr lehnt auch an die Tischkante! Und dann eure Schultern! Wie oft muss ich euch noch sagen, dass sie sich in gleichlaufender Richtung mit der Tischkante befinden müssen? Die rechte Schulter darf weder höher noch niedriger stehen als die linke.« Grimmig beobachtete er, wie sich die jungen Frauen plagten, die von ihm gewünschte Haltung einzunehmen. Der schlanke Neuzugang schien besondere Mühe zu haben. Bei näherer Betrachtung sah Krotzmann, dass sie ein ziemlich breites Kreuz hatte. Dieser Ausdruck körperlicher Stärke ärgerte ihn, er hätte nicht sagen können, warum. Sogleich war er bei ihr.
»Du!« Er schlug mit seinem Stock vor ihr auf den Tisch. »Dein Name!«
»Josefine Schmied«, kam es leise, aber bestimmt.
Josefine. Er hatte es gewusst. Dieses Gewächs war keine Martha oder Karla, so wie alle anderen. Was tat sie hier? Zornig funkelte er sie an.
»Die Haltung deiner Arme ist einfach jämmerlich! Das hier ist ein Klassenzimmer und keine Bahnhofshalle oder wo ihr sonst herumlungert!« Schon landete sein Stock auf ihrer Hand. Sein rechtes Auge zwinkerte nervös, als er das Blut sah, das aus den Knöcheln ihrer Finger quoll. Hellrotes Blut. Er zog den Stock zurück und fühlte sich auf angenehme Art erleichtert. Ein paar Lacher ertönten, er erkannte Adeles raue Stimme wie immer aus allen heraus. Warnend schaute er in die Runde, dann wandte er sich wieder dem Neuzugang zu. »Dein linker Vorderarm soll ganz, der rechte wenigstens mit seiner vorderen Hälfte auf der Tischplatte liegen.«
»Ich hatte einen Unfall. Meine Schulter ist verletzt, ich kann leider nicht anders sitzen«, sagte die junge Frau und strich sich eine Locke aus der Stirn.
Was war denn das für eine herausfordernde Geste? Warum schaute sie an ihm vorbei? Bildete sie sich ein, jemand Besseres zu sein? Wollte sie mit ihm kokettieren? Er spürte, wie die Anspannung erneut in ihm wuchs. »Glaubst du tatsächlich, ich würde eine solch läppische Ausrede gelten lassen?«, zischte er.
Schon ließ er seinen Stock auf ihre andere Hand prasseln. Einmal. Zweimal. Die Neue erbebte in einer Art, die nicht vom Schmerz allein geprägt war, sondern von etwas anderem, Unterschwelligem. Einen Moment lang befürchtete er, die junge Frau würde von ihrem Stuhl hochschießen und sich gegen ihn wehren. Doch der Moment ging vorüber und nichts geschah. Er atmete aus. So etwas würde sie nicht wagen! Hochmütig schaute er sie von oben herab an.
»Das wird dich hoffentlich lehren, mir keine Widerworte zu geben. Und damit du gleich Bescheid weißt: Für dich wird es hier kein gemütliches Kartoffelschälen in der Küche oder Bügeln in der Wäscherei geben. Ich teile dich unserem Hausmeister zu. Wollen wir doch mal sehen, was deine Schulter zu ein bisschen harter Arbeit sagt …«
Obwohl es kurz vor Mittag war, brannten in allen Häusern der Luisenstadt die Gaslampen – es war einer dieser Novembertage, an denen es nicht hell werden wollte. Isabelles Lippen waren weiß vor Kälte, ihre Augen tränten vom eisigen Ostwind, und fröstelnd zog sie ihren Mantelkragen enger um sich.
»Wo bleibst du denn? Seit nunmehr zehn Minuten stehe ich mir hier die Beine in den Bauch – das nächste Mal gehe ich gleich allein!«, sagte sie, als Clara endlich aus der Apotheke trat.
»Beklag dich nicht, ich hatte größte Mühe, überhaupt wegzukommen!«, antwortete Clara atemlos und rückte den Schulterriemen ihrer Tasche zurecht, in der neben ein paar Medizinfläschchen auch noch eine Tafel Schokolade und Pfefferminzbonbons für Josefine lagen. Ihren Eltern hatte sie gesagt, dass sie die Medizin an ein paar fußkranke ältere Kunden ausliefern wollte. Bevor Fragen nach dem Wie und Wem gestellt werden konnten, war sie zur Tür hinausgeschlüpft.
Im Eilschritt gingen die beiden jungen Frauen zur Stadtbahn und konnten gerade noch aufspringen, bevor sich diese in Bewegung setzte.
»Wenn ich an den Ärger denke, den ich wegen Jo mit meinem Vater bekommen habe, vergeht mir die Lust auf diesen Ausflug«, sagte Isabelle, als sie zusammengepfercht mit den anderen Fahrgästen auf den harten Holzbänken saßen. »In Teufels Küche hat sie mich gebracht! Und wenn meine Eltern wüssten, dass ich sie besuche, wäre gleich wieder etwas los.«
»Warum bist du dann nicht einfach zu Hause geblieben?«, fragte Clara gereizt und wandte den Kopf ab. Auch ihre Mutter würde ihr die Hölle heiß machen, wenn sie wüsste, wohin sie unterwegs war. Aber als sie im vergangenen Jahr mit gebrochenem Bein im Krankenhaus lag, hatte Josefine sie auch jeden Tag besucht. Da konnte sie doch jetzt nicht kneifen …
Clara lief ein Schauer über den Rücken. Josefine im Frauengefängnis Barnimstraße – allein den Satz zu denken fiel ihr schwer. Dort landeten Prostituierte, Trickdiebinnen und anderes Gesindel, aber doch nicht Josie, ihre beste Freundin aus Kindertagen!
»Außerdem«, fuhr sie Isabelle an, »bist du doch mit schuld daran, dass Josefine jetzt im Gefängnis ist! Durch dich ist sie doch erst auf all die dummen Gedanken gekommen. Du warst diejenige, die vor lauter Langeweile ständig neue Flausen im Kopf hatte.«
»Das ist ja … die Höhe«, antwortete Isabelle empört. »Ich habe Josefine gewiss nicht dazu angehalten, meinen Vater zu bestehlen! Ganz im Gegenteil, ich wollte sie von ihrem Plan sogar noch abhalten. Du hingegen hattest nur deine Arbeit im Kopf, was Jo trieb, war dir doch völlig egal.«
Clara schaute betroffen beiseite. Den Vorwurf, dass sie Jo nicht genug ins Gewissen geredet hatte, machte sie sich selbst oft genug – Isabelle brauchte sie dazu gewiss nicht.
»Und diese alte Nachbarin, diese Frieda, auf die Josefine so große Stücke hält – sie hätte Jo ruhig auch einmal ins Gewissen reden können«, trumpfte Isabelle weiter auf. »Sie wusste doch von ihrer Besessenheit. Aber allem Anschein nach waren der Alten ihre diversen Steckenpferde wichtiger!«
An der nächsten Haltestelle stiegen sie in eine andere Bahn um. Kaum dass sie saßen, nahm Isabelle mit gesenkter Stimme das Gespräch wieder auf. »Aber selbst wenn wir alle mit Engelszungen auf Jo eingeredet hätten, es hätte keinen Unterschied gemacht – sie war unersättlich und gegen gute Ratschläge völlig immun.«
»Warum hast du dann zugelassen, dass es überhaupt so weit kam? Gelegenheit macht Diebe – so heißt es doch, nicht wahr?«, fauchte Clara. »Außerdem hättest du dich stärker bei deinem Vater für Jo einsetzen können, vielleicht hätte er dann von einer Anzeige abgesehen.«
Isabelle lachte schrill auf. »Woher willst du wissen, ob und wie sehr ich mich bei meinem Vater für Jo eingesetzt habe?! Ich …«
Hin und her ging das Gespräch, weder Clara noch Isabelle sparten mit gegenseitigen Vorwürfen. Als sie nach mehrmaligem Umsteigen und einer guten halben Stunde Fahrzeit an der Haltestelle Landsberger Allee endlich aus der Stadtbahn stiegen, war die Stimmung zwischen ihnen so eisig wie der Ostwind.
»Wie beklemmend der Volkspark Friedrichshain im Winter aussieht«, murmelte Isabelle und wies in Richtung des einsamen Parks, in dem lediglich ein paar streunende Hunde unterwegs waren. Sie blickte ungewohnt beklommen drein.
Schweigend und mit bangem Herzen stapfte Clara neben ihr durch die frühwinterliche Einöde. Ein gutes Stück entfernt erhob sich ein düsteres kastenartiges Gebäude mit vielen kleinen Fenstern – das Frauengefängnis Barnimstraße. Der Bau strahlte Kälte und Bedrohung aus. Claras Schritt wurde immer schwerer.
Der Mann in dem kleinen Pförtnerhäuschen rechts neben dem Tor schaute unwirsch von seiner Zeitung auf. Mit zusammengekniffenen Augen ließ er seinen Blick erst über Isabelle, dann über Clara schweifen.
»Was wollt ihr?« Mit jedem Wort wehte eine Woge Fäulnis durch die Fensterlade. Statt Zähnen hatte der Mann nur noch schwarze, verfaulte Stummel im Mund.
Clara schauderte es, dennoch zwang sie sich zu einem Lächeln. »Wir wollen eine Freundin besuch-«
»Das hier ist kein Hotel, Besuche gibt’s nicht. Macht, dass ihr davonkommt!«, unterbrach der Mann sie barsch.
»Aber …«, hob Clara an. »So können Sie mit uns nicht umspringen …« Im nächsten Moment wurde sie von Isabelle zur Seite gedrängt.