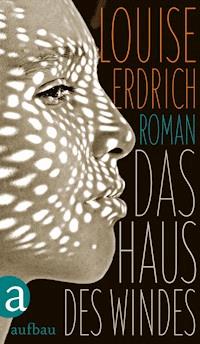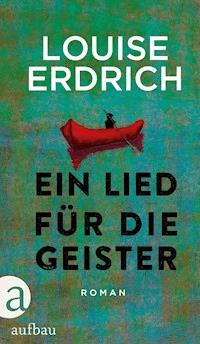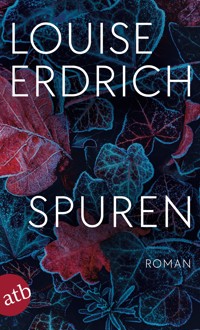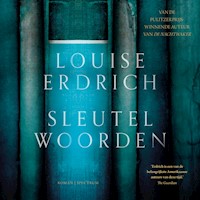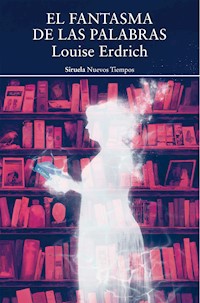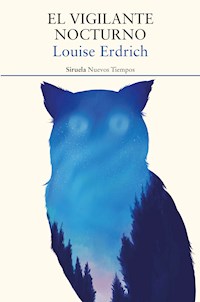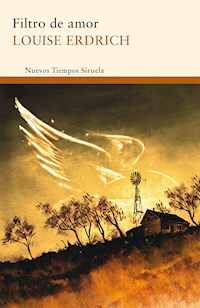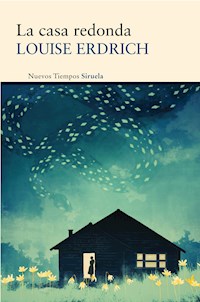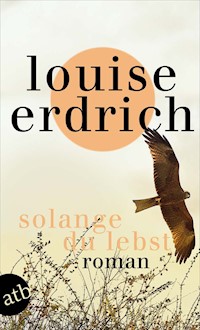
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Louise Erdrichs leuchtendes Meisterwerk.« Philip Roth. Die kleine Stadt Pluto in North Dakota scheint am Rande des Universums zu liegen. Hier ist jeder mit jedem verbunden – durch Liebe, Freundschaft oder Blutsbande. Und vor allem durch eine dunkle Geschichte, die seit fast einhundert Jahren auf den Menschen lastet ... »Ein chorisches Gesamtwerk, dessen erstaunlicher Registerreichtum Witz und Poesie, Lakonie und Pathos gleichermaßen einschließt, derart raffiniert, dass wir am Schluss das Buch sofort noch einmal lesen wollen. Mag Pluto noch so weit entfernt und unwirtlich erscheinen – in diesem Geschichtenkosmos fühlt man sich dort plötzlich seltsam heimisch.« Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Louise Erdrich
Louise Erdrich, geboren 1954 als Tochter einer Ojibwe und eines Deutsch-Amerikaners, ist eine der erfolgreichsten amerikanischen Gegenwartsautorinnen. Sie erhielt den National Book Award, den PEN/Saul Bellow Award und den Library of Congress Prize. Louise Erdrich lebt in Minnesota und ist Inhaberin der Buchhandlung Birchbark Books.
Im Aufbau Verlag ist ihr Roman »Der Gott am Ende der Straße« und im Aufbau Taschenbuch ihre Romane »Liebeszauber«, »Die Rübenkönigin«, »Der Club der singenden Metzger«, »Der Klang der Trommel«, »Solange du lebst«, »Das Haus des Windes« und »Ein Lied für die Geister« lieferbar.
Informationen zum Buch
»Louise Erdrichs leuchtendes Meisterwerk.« Philip Roth
Die kleine Stadt Pluto in North Dakota scheint am Rande des Universums zu liegen. Hier ist jeder mit jedem verbunden – durch Liebe, Freundschaft oder Blutsbande. Und vor allem durch eine dunkle Geschichte, die seit fast einhundert Jahren auf den Menschen lastet.
»Ein chorisches Gesamtwerk, dessen erstaunlicher Registerreichtum Witz und Poesie, Lakonie und Pathos gleichermaßen einschließt, derart raffiniert, dass wir am Schluss das Buch sofort noch einmal lesen wollen. Mag Pluto noch so weit entfernt und unwirtlich erscheinen – in diesem Geschichtenkosmos fühlt man sich dort plötzlich seltsam heimisch.« Frankfurter Allgemeine Zeitung
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Louise Erdrich
Solange du lebst
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Chris Hirte
Inhaltsübersicht
Über Louise Erdrich
Informationen zum Buch
Newsletter
Solange du lebst
Solo
Evelina
Die Taubenplage
Millionenmal
Eine Erscheinung
Der glühende Blick
Mustache Maude
Eine Geschichte
Nur eine Kleinigkeit
Sister Godzilla
Holy Track
Die Stiefel
Die Wäscheleine
Die Korbflechter
Die Lochren-Farm
Der Beichtstuhl
Die Schwestern
Die Meute
Das Kind
Vogeli
Das Sterbelied
Himmelsflügel
Bitterer Tee
Linien
Richter Antone Bazil Coutts
Wie die Dinge stehen
Gründerfieber
Die Expedition
Der große Vorstoß
Batners Pulver
Der Sendbote
Millionen
Lafayette Peace
Der Heilige
Der Wolf
Komm herein
Der Lebkuchenmann
Mach mich fertig
Murdo Harp
Die Geste
Die Löwen
Die Garage
Der Hauseingang
Ein Schauder der Erwartung
Marn Wolde
Satan: Entführer eines Planeten
Die Daniels
Die Gemeinde
Evelina
Die 4-B’s
Richter Antone Bazil Coutts
Shamengwa
Die erste Geige
Stummes Solo
Das gewisse Feuer
Brief
Evelina
Der Reptiliengarten
Warren
Nonette
Der Kuß
Nonettes Bett
Das Konzert
Laufen in der Luft
Allerseelen
Die Straße im Himmel
Richter Antone Bazil Coutts
Der Schleier
Der Abriß
Doktor Cordelia Lochren
Die Unglücksmarken von Pluto
Impressum
Solange du lebst
Solo
Beim letzten Schuß klemmte das Gewehr. Das Kind stand in seinem Bettchen, weinend, ans Gitter geklammert. Um nachzuschauen, warum das Gewehr streikte, setzte sich der Mann in einen Sessel und nahm es auseinander. Das Weinen ging ihm auf die Nerven. Er legte das Gewehr hin und hielt Ausschau nach einem Hammer, da entdeckte er das Grammophon und stand auf. Eine Platte lag schon auf dem Teller, er drehte die Kurbel und setzte die Nadel auf. Während Musik den Raum durchflutete, kehrte er zum Sessel zurück und fuhr mit seiner Arbeit fort. Das Kind beruhigte sich. Ein überirdisches Violinsolo in der Mitte der Platte ließ den Mann innehalten, die Gewehrteile in der Hand. Er erhob sich, als die Musik zu Ende war, zog das Grammophon auf und spielte die Platte erneut. Das geschah dreimal. Das Kind schlief ein. Inzwischen hatte der Mann das Gewehr repariert, die Patrone glitt ohne Widerstand in die Kammer. Er lud mehrere Male durch, dann stand er auf und stellte sich an das Kinderbett. Die Violine steigerte sich zu einem Klang von fremdartiger Schönheit. Er hob das Gewehr. Blutdunst erfüllte den Raum.
Evelina
Die Taubenplage
Im Jahr 1896 rief mein Großonkel, einer der ersten katholischen Pfarrer indianischer Herkunft, die Mitglieder seiner Gemeinde auf, sich mit ihren Skapulieren und Meßbüchern vor Sankt Joseph zu versammeln. Von dort wollten sie in einer weiten Kette über die Felder ausschwärmen und die Tauben wegbeten. Seine Gemeindekinder hatten zum Pflug gegriffen und beackerten ihr Land wie die deutschen und norwegischen Siedler. Anders als die Franzosen, die sich mit meinen Vorfahren vermischt hatten, zeigten diese Siedler wenig Interesse an indianischen Frauen und heirateten sie nicht. Die Norweger zumal behandelten jeden mit Verachtung außer sich selbst und hielten fest zusammen. Aber die Tauben fraßen auch ihre Felder kahl.
Wenn die Vögel kamen, zündeten die Indianer und die Weißen große Feuer an und versuchten sie in Netze zu treiben. Die Tauben fraßen die Weizensaat und den Roggen und machten sich über den Mais her. Sie vertilgten die sprießenden Blumen, die Apfelknospen, die harten Eichenblätter, selbst die vorjährige Spreu. Geräuchert schmeckten die fettgefressenen Tauben köstlich, aber man konnte ihnen zu Hunderten oder Tausenden den Hals umdrehen, ohne ihre Zahl merklich zu verringern. Die Lehmkaten der Mischlinge und die Rindenhütten der traditionellen Indianer brachen unter der Last der Vögel zusammen. Sie wurden in der Pfanne und am Spieß gebraten, zu Pasteten und Suppen verarbeitet, in Fässern gepökelt oder mit Knüppeln erschlagen und liegengelassen. Aber die toten Tauben dienten den lebenden zum Fraß, und jeden Morgen wurden die Leute erneut vom Scharren, Flügelschlagen und dem fürchterlichen Gemurre, Geraune und Gegurre der Tauben empfangen, und diejenigen, die noch ein intaktes Fenster besaßen, von den neugierigen, sanften Blicken dieser Kreaturen.
Mein Großonkel hatte in aller Eile ein Gitter aus Stöcken gebastelt, um die Scheiben seiner hochtrabend als Pfarrhaus bezeichneten Hütte zu schützen. In der Ecke schlief sein kleiner Bruder, den er vor einem allzu ungebundenen Lebenswandel bewahren wollte, auf einem Strohsack und einem Lager aus Tannenzweigen. Ein so weiches Bett hatte der Junge noch nie besessen, und er weigerte sich, es zu verlassen, doch mein Großonkel warf ihm die Roben der Chorknaben an den Kopf und befahl ihm, den Leuchter zu putzen, den er bei der Prozession tragen sollte.
Aus dem Jungen wurde später der Vater meiner Mutter, mein Mooshum. Getauft war er auf den Namen Seraph Milk, und da er über hundert wurde, hatte ich mit meinen etwa elf Jahren immer mal wieder Gelegenheit, mir die Geschichte vom folgenschwersten Tag seines Lebens anzuhören, der mit dem Versuch begann, die Tauben zu vertreiben. Er saß auf einem harten Stuhl zwischen unserem ersten Fernseher und der kleinen Büchernische, die in die Wand unseres Hauses eingelassen war, das der Regierung gehörte und auf dem Reservatsgebiet des Büros für Indianische Angelegenheiten stand. Mooshum also erzählte uns, wie er die Tauben, die auf den Fenstergittern seines Bruders herumkletterten, mit den Füßen kratzen hörte. Ihm graute vor dem Gang zum Klohäuschen, weil viele Vögel in den Kot unter dem Loch gefallen waren und so verzweifelt um Hilfe schrien, daß sich ihre Artgenossen von außen gegen das Häuschen warfen, um sie zu retten. Doch er wagte nicht, sich woanders zu erleichtern. Also bahnte er sich einen Weg durch das Geflatter, mit schlurfenden Schritten, um nicht auf Füße oder Leiber zu treten, und erledigte sein Geschäft mit geschlossenen Augen im Klohäuschen. Hinterher machte er die Tür fest zu, damit nicht noch mehr Tauben in die Falle gerieten.
Das Drama im Klohäuschen, mit dem er den Bericht vom folgenschwersten Tag seines Lebens stets begann, enthielt all die Details, die meinen Bruder und mich interessierten. Obwohl wir inzwischen Kanalisation hatten, war uns das Häuschen wohlbekannt, und die Schrecken eines Todes in der Kloake sowie andere Details seiner Geschichte fanden wir sehr fesselnd. Was Spannung und Unterhaltung betraf, kam Mooshum gleich nach dem Fernsehen. Doch unser Vater hatte die Knöpfe vom Fernseher abgezogen und versteckt. Vergeblich durchsuchten wir das ganze Haus und fanden uns schließlich mit dem Gedanken ab, daß er sie ständig bei sich trug. Fortan hielten wir uns an Mooshum und seine Geschichten. Er erzählte, und wir saßen auf den Küchenstühlen und zwirbelten unser Haar. Unsere Mutter hatte ihm eine rote Kaffeedose hingestellt, in die er seinen Tabaksaft spuckte. Er trug alte grüne Arbeitskleidung von Sears, ausgelatschte braune Schnürstiefel und eine Baseballkappe, auch im Haus. Seine Augen leuchteten aus Schlitzen hervor, die sich tief in sein Gesicht einkerbten. Die obere Hälfte seines linken Ohrs war ihm abhanden gekommen, weshalb er ein wenig schief aussah. Er war krumm und ausgemergelt, weiße Strähnen wucherten ihm um die Ohren und in den Nacken. Wenn er sprach, sahen wir manchmal seine braunen Zahnstummel. Doch seine Geschichte erzählte er mit einer solchen Überzeugungskraft, daß es uns nicht schwerfiel, in ihm den zwölfjährigen Jungen zu sehen.
Sein großer Bruder kleidete sich ins Ornat, das beste, das er besaß – gebraucht bekommen von einer Gemeinde in Minneapolis. Da an echten Weihrauch nicht zu denken war, füllte er das Rauchfaß mit trockenem, zu Kugeln gerolltem Salbei. In der Hütte gab es eine Handpumpe mit Ausguß, und Mooshums Bruder oder Halbbruder, Father Severine Milk, befeuchtete einen Kamm und kämmte erst sein Haar zurück, dann das Haar seines kleinen Bruders. Seit etwa einer Stunde schon trafen die Pferdewagen ein. Die Kirche war eine große Hütte auf der anderen Hofseite, in der jetzt die Gemeinde wartete, und der ganze Hof stand voller Pferdewagen, und auf jedem waren ein oder zwei Hunde angebunden, damit sie die Vögel und ihre Exkremente von den Strohballen fernhielten, auf denen die Leute saßen. Das ständige Hin und Her der Vögel machte die Pferde nervös. Viele trugen Scheuklappen und außerdem Kamillesträußchen am Geschirr, damit sie ruhig blieben. Als unser Mooshum den Hof überquerte, sah er die Tauben auf dem Kirchendach, die immerfort wie im Spiel zum heiligen Kreuz aufflogen, das die Hütte als Kirche kenntlich machte, um den Vogel, der es gerade besetzte, von seinem Platz zu vertreiben und gleich darauf vom nächsten vertrieben zu werden. Mein Großonkel war ein hagerer, furchtsamer Mensch von über einem Meter achtzig, der den allgemeinen Lärm mit gereizter Stimme übertönte, als er seine Gemeinde Aufstellung nehmen ließ. Die beiden Brüder bildeten die Mitte, und die lieben Gemeindeglieder schwärmten zu beiden Seiten aus, während sich die Kette langsam den Hang hinabbewegte, auf das erste Feld zu, das von den Tauben befreit werden sollte.
An dem Tag war die Sonne in Dunst gehüllt und matt, es herrschte drückende Windstille, der beißende Qualm aus dem Weihrauchfäßchen stand unbewegt in der Luft. Zügig schritten die Leute voran. Doch schon auf dem ersten Acker saßen die Tauben so dichtgedrängt, daß Unruhe unter den Frauen ausbrach, weil sie nicht weiterkamen, ohne daß ihnen die Tiere unter die Röcke gerieten. Die Vögel in ihrer Panik verfingen sich in den Unterkleidern. Abrupt kam die Kette zum Stehen, und die Frauen begannen – vor Mooshums Augen – mit einem wilden Tanz. Sie wirbelten herum, stampften mit den Füßen, schlugen um sich, schüttelten die Röcke, jede auf ihre Weise. Von einer solchen Urgewalt war der Tanz, daß die Tauben ringsumher erschrocken aufflogen, andere Tauben mitrissen und sich das ganze Feld mitsamt dem angrenzenden Wald in einen einzigen Vogelsturm verwandelte, der mit Getöse auf die Gemeinde herniederfuhr. Die jedoch hielt stand, indem alle ihre aufgeschlagenen Meßbücher über den Kopf hoben. Ihren Anstand vergessend, banden sich die Frauen die Röcke hoch. Rosenkränze oder Skapuliere vorgestreckt, schritten sie voran und sangen das Ave Maria in den Sturm der Flügelschläge. Mooshum, der die unteren Gliedmaßen einer Frau nur selten zu Gesicht bekam, machte sich zunutze, daß sein Bruder vollauf damit beschäftigt war, das Weihrauchfaß am Brennen zu halten, und blieb hinter den anderen zurück. Entzückt vom Anblick der nackten, strammen, stampfenden braunen Frauenbeine, ließ er den Leuchter sinken, der keine Kerzen trug und den ihm der Bruder nur deshalb gegeben hatte, damit er sein Gesicht schützen konnte. Und kaum hatte er den Leuchter sinken lassen, wurde er von einer Taube an der Stirn getroffen, die mit einer solchen Wucht vom Himmel fuhr, als wäre sie von Gott gesandt, um ihn mit Blindheit zu schlagen und fürderhin vor der Sünde des Glotzens zu bewahren.
An diesem Punkt seiner Geschichte geriet Mooshum so in Fahrt, daß er uns die Gottesstrafe vorführte und sich zu unserem großen Vergnügen auf den Boden warf. Er spielte uns seinen Zusammenbruch vor, dann öffnete er die Augen, hob den Kopf und starrte ins Leere, wo er erneut sah, wie ihm der Heilige Geist erschien – offenbar nicht als weiße Taube unter all den braunen, sondern in der irdischen Gestalt eines Mädchenkörpers.
Unsere Familie steht im Ruf, zu unsterblichen Romanzen zu neigen. Selbst mein Vater, ein eher gesetzt wirkender Naturkundelehrer, ließ sich von einem einzigen verheißungsvollen Blick meiner Mutter durch den ganzen Zweiten Weltkrieg tragen. Ihre Schwester Geraldine wurde vom Lächeln eines jungen Mannes überwältigt, der im Zug an ihr vorüberfuhr. Sie winkte ihm aus dem Graben zu, in dem sie Beeren pflückte, und obwohl sie nicht einmal wußte, ob er zurückgewinkt hatte, trieb sie irgend etwas dazu, bis zum Dunkelwerden weiterzupflücken, an Ort und Stelle zu schlafen und einen weiteren Tag geduldig auf ihrem Campinghocker auszuharren, bis der Mann von der sechzig Meilen entfernten Bahnstation zurückgelaufen kam. Mein Onkel Whitey liebte die Indianerprinzessin von der Haskell University, die ihre Zöpfe abschnitt und ihm in der Nacht, als sie an Tuberkulose starb, zum Geschenk machte. Ihr zum Gedenken blieb er Junggeselle, bis er mit über fünfzig Jahren eine Kleinstadtstripperin heiratete. Agathe, die Cousine meiner Mutter, auch Happy genannt, floh aus dem Kloster, weil sie einen Pfarrer liebte, und ward nicht mehr gesehen. Meinem Bruder Joseph reichte eine Anwandlung von Verliebtheit aus, um einer Kommune beizutreten. John, ein entfernter Cousin meines Vaters, entführte seine eigene Frau und benutzte das Lösegeld, um sich in Fargo eine Geliebte zu halten. Von einer Frau zur Verzweiflung getrieben, ertränkte sich Octave Harp, der Onkel meines Vaters, im knietiefen Wasser. Und so weiter und so fort. Wie schon an meinem Vater ersichtlich, standen diese hochdramatischen Verstrickungen stets im krassen Gegensatz zur Gewöhnlichkeit der Ehen und Schicksale, die aus ihnen hervorgingen. Wir sind eine Sippe von Büroangestellten, Bankkassierern, Bücherwürmern und Bürokraten. Der wildeste von uns (Whitey) ist Koch in einem Schnellimbiß, und der heldenhafteste (mein Vater) ist Lehrer. Und doch, so glaube ich zumindest, bildet dieser Hang zur Romanze ein Bindeglied zwischen den Generationen. Mein Bruder und ich, wir lauschten Mooshum nicht nur zum Vergnügen, sondern auch, um zu lernen, wie wir uns zu verhalten hatten, wenn der Moment der Erkenntnis oder gar der Heimsuchung kam.
Millionenmal
In Wirklichkeit war ich überzeugt, daß meine Heimsuchung längst stattgefunden hatte, denn selbst während ich Mooshum zuhörte, schrieben meine Finger unablässig den Namen meines Geliebten auf meinen Arm, in meine Handfläche oder auf mein Knie. Wenn ich seinen Namen millionenmal auf meinen Körper schrieb, würde er mich küssen, glaubte ich. Ich wußte, daß er mich liebte, und er konnte sicher sein, daß ich seine Gefühle erwiderte, aber in einer römisch-katholischen Grundschule der Mittsechziger redeten Jungs und Mädchen, die als verliebt galten, kaum miteinander und berührten sich nie. Wir spielten Softball und Kickball und hielten Verbindung über andere Kinder, die sich darum rissen, unsere Botschaften zu überbringen. Eine ganze Reihe solcher Liebeserklärungen zweiter Hand hatte ich in mein winziges leopardengemustertes Notizbuch mit dem goldenen Schloß eingetragen, dessen Schlüssel ich im hohlen Knauf meines Bettpfostens versteckte. Außerdem hatte ich den Namen meines Geliebten mit dem Blut eines aufgekratzten Mückenstichs an die Innenwand meines Schranks geschrieben. Dieser Name hatte für mich den heiligen Klang der Wörter, die im Alten Testament von unsichtbarer Hand mit Feuer an die Wand geschrieben waren: Mene mene tekel upharsin. Laut aussprechen konnte ich ihn nicht. Ich konnte ihn nur mit den Fingern auf meine Haut schreiben, und das tat ich so lange, bis meine Mutter glaubte, ich hätte Läuse. Sie schmierte mir den Kopf mit Mayonnaise ein, setzte mir eine Duschkappe auf und befahl mir, mich in die Wanne zu setzen und heißes Wasser nachlaufen zu lassen, so heiß, daß ich es gerade noch aushalten konnte.
Das Badezimmer, die Wanne, die ganzen Installationen waren nagelneu. Weil mein Vater in der Schule und meine Mutter in der Stammesverwaltung arbeiteten, hatte man uns an die Wasserversorgung angeschlossen. Ich verriegelte die Badezimmertür, prüfte das heiße Wasser mit dem großen Zeh und beschloß, da ich sonst nichts zu tun hatte, den Namen noch ein paar tausendmal zu schreiben. Unter dieser Beschäftigung fand ich Stellen an meinem Körper, die sich bei wiederholtem Schreiben der Buchstaben erregten und erhitzten, und ohne zu wissen, wie mir geschah, verpaßte ich mir lauter alphabetische Orgasmen – so schockierend in ihrer Intensität, daß mir die Mayonnaise auf dem Kopf zerlaufen sein muß. Mit dem Schreiben hörte ich dann auf. Ich war mir sicher, die Millionengrenze erreicht zu haben, und traute mich nicht, dasselbe noch einmal zu probieren.
Das geschah um den Aschermittwoch, der mich daran erinnerte, daß ich nur aus Staub gemacht war und wieder zu Staub werden würde. Dieser Körper, über und über mit dem heiligen Namen Corwin Peace (jetzt kann ich’s ja verraten) beschriftet, war ein vergängliches Medium, er würde zergehen wie Eis, zerfallen wie Laub. Wie immer waren wir bei Beginn der Fastenzeit auf unsere Vergänglichkeit hingewiesen worden, auch darauf, daß unser Heißhunger auf Süßigkeiten oder Salzbrezeln nur ein Phantomhunger war. Allein der Hunger des Geistes war real. Zum Glück wußte ich nicht, daß es eine unreine Handlung war, sich den Namen des Geliebten auf den Leib zu schreiben. Daher hatte ich nichts Schlimmeres zu sühnen als die Komplizenschaft mit meinem Bruder, der herausgefunden hatte, daß sich der Fernseher mit der Zange aus dem Werkzeugkasten genausogut bedienen ließ wie mit den Knöpfen. Und kaum waren meine Eltern aus dem Haus, konnten wir die von unseren Eltern verabscheuten 3 Stooges gucken, die auch Mooshum immer gern sah. So ging das bis Palmsonntag, als mein Vater von irgendeiner Besorgung nach Hause kam und zufällig die Hand auf den glühheißen Fernseher legte. Er durchbohrte uns mit einem Blick, den seine Schüler sicherlich an ihm fürchteten. Im Handumdrehen holte er die Wahrheit aus uns heraus. Die Zange wurde ebenfalls beschlagnahmt, und Mooshums Geschichte ging weiter.
Eine Erscheinung
Das Mädchen, das später meine Großmutter wurde, war hinter den anderen Frauen auf dem Feld zurückgeblieben, weil sie zu verschämt war, um sich die Röcke hochzubinden. Ihr Name war Junesse. Wie sie herausfand, mußte man nur langsam genug gehen, damit die Tauben Zeit fanden, höflich Platz zu machen, statt erschrocken aufzuflattern. Junesse trug ihr langes weißes Kommunionskleid, das aus mehreren Schichten hauchdünnen Musselins genäht war. Sie hatte darauf bestanden, dieses Kleid anzuziehen, und die Tante, die für sie sorgte, war von ihrer Hartnäckigkeit schon so zermürbt, daß sie es erlaubte, ihr aber Schläge androhte, falls sie das Kleid zerriß oder schmutzig machte. Außer ihrem Schamgefühl hatte sie auch diese Drohung davon abgehalten, den wilden Tanz mit den Tauben unterm Rock mitzumachen. Doch jetzt, beim Versuch, den niedergestreckten Leuchtenträger ins Leben zurückzuholen, setzte sie sich über alle Bedenken hinweg und nahm ihr Schicksal in die eigene Hand, indem sie sich mitten in den Vogeldreck kniete und es damit besiegelte, daß sie ihre Schärpe benutzte, um das Blut von Mooshums Stirn zu wischen – und von seinem Ohr, das ihm zur Hälfte von den Tauben weggehackt worden war, als er bewußtlos am Boden lag. Doch dann wachte er auf.
Und erblickte sie! Mooshum unterbrach seine Erzählung. Er breitete die Hände aus, die tausend Fältchen seines Gesichts formten sich zu einer Grimasse höchster Glückseligkeit. Es gab ein Bild von ihr, das wenig später entstanden war, und sie sah wirklich wunderschön aus. In ihr schwarzes Haar hatte sie ein weißes Band geflochten, das Mieder ihres weißen Kleids war mit weißen Blüten und Blättern bestickt, und sie hatte die blasse Haut und die schwarzen Mandelaugen der Métis- oder Michif-Frauen. Nicht ohne Grund hatte der Bischof jener Diözese seine Pfarrer per Hirtenbrief angewiesen, in der Gegenwart von Mischlingsfrauen ohne Unterlaß zu beten und stets daran zu denken, daß diese Frauen trotz ihrer liebreizenden Gestalt in ihrem Innersten Wilde seien, anfällig für alles Böse, ja, der Teufel gehe nach Belieben in ihnen ein und aus. Junesse Malaterre natürlich war unschuldig, aber einen scharfen Verstand besaß sie allemal. Ihr Nachname, der von irgendeinem französischen Pelzhändler zu uns kam, steht für die zerklüfteten, gottverlassenen Felsschluchten und die labyrinthartig aufragenden Schichtungen aus rosa, grauem, braunem und rotem Gestein, die für die Badlands von North Dakota charakteristisch sind. Dorthin machten sich Mooshum und Junesse auf.
»Wir haben tief in uns reingeguckt«, formulierte es Mooshum in seinem sanften alten Reservatsdialekt, und wir schwiegen zu dritt, während sich das Bild vor unserem inneren Auge entfaltete. Mooshum sah alles genau vor sich. Was mein Bruder sah, weiß ich nicht – nach seinem Kommune-Abenteuer blieb er lange Zeit immun gegen jede Art von Romantik. Er wurde dann Naturkundelehrer wie unser Vater, und nach einem harmlosen Verkehrsunfall endete er mit seiner Schadensreguliererin im dumpfen Glück einer Routinebeziehung. Ich jedenfalls sah sie beide – den niedergestreckten, fassungslosen Jungen und das Mädchen in Weiß, das sich kniend über ihn beugte, die Schärpe ihres Kleids graziös umfaßte und auf die Stirnwunde preßte, um sein Blut zu stillen. Vor allem aber stellte ich mir den Blick vor, den die beiden wechselten. Der Heilige Geist schwebte über ihnen. Die Schärpe rötete sich. Das Blut trotzte der Schwerkraft und strömte ihren Arm hinauf. Dann öffnete sich ihr Mund. Ob sie sich küßten? Das konnte ich Mooshum nicht fragen. Vielleicht hat sie gelächelt. Aber sie hatte nicht die Zeit, seinen Namen auch nur ein einziges Mal auf ihren Körper zu schreiben, und überhaupt kannte sie seinen Namen nicht. Sie blickten sich gegenseitig in die Seele, da waren Namen ohne Belang. Bevor sie auch nur daran gedacht hatten, sich nach ihrem Namen zu fragen, waren sie schon auf und davon – und hatten beschlossen, noch eine Weile namenlos zu bleiben. Wichtig war nur, daß sie den Schlingen und Korsetts entkamen, die ihre Familien schon zugezogen hatten.
Junesse floh vor der Tracht Prügel, die sie von ihrer Tante zu gewärtigen hatte, und vor der endlosen Plackerei mit den sechs kleinen Kindern der Tante, die im nachfolgenden Winter alle an Keuchhusten starben. Mooshum floh vor der geistlichen Laufbahn, zu der ihn sein Halbbruder ausersehen hatte. Die zwei weißgekleideten Kinder verschmolzen mit der Wand aus Tauben, und da ihre Kleider bald so schmutzig waren wie der Ackerboden, verschmolzen sie mit der Erde, als sie die Feldraine entlangliefen, bis das Farmland endete, der Untergrund aufbrach und die kahle Felsregion der Badlands in ihrer ganzen Schönheit vor ihnen lag. Obwohl es noch etliche Jahre dauerte, bis sie auch körperlich vollzogen, was sie miteinander verband (hier beließ Mooshum es bei vagen Andeutungen), waren sie ein Liebespaar. Und Überlebenskünstler waren sie auch. Ohne daß es ihnen jemand gezeigt hatte, wußten sie, wie man Feuer machte, und ein paar Tage lang konnten sie sich von gebratenen Tauben ernähren. So früh im Jahr gab es noch nicht allzuviel Eßbares, aber sie suchten Vogeleier und gruben Wurzeln aus, fingen Kaninchen und erbettelten sich auf einsamen Gehöften, was sie bekommen konnten.
Der glühende Blick
An dem Montag, als wir in der Schule die gesegneten Palmzweige flochten, bekam ich Zahnspangen eingesetzt. Anders als heute, wo die meisten Kinder irgendeine Gebißkorrektur bekommen, waren die Spangen damals eine Seltenheit. Und ich finde es schon erstaunlich, daß sich meine Eltern bei ihren bescheidenen Verhältnissen überhaupt dazu entschlossen, meine Zähne zu begradigen. Unser Nichtreservatszahnarzt in der Stadt Pluto war so altmodisch zu glauben, daß man die Zähne mit Gold überkronen mußte, damit der Zahnschmelz nicht geschädigt wurde. Am nächsten Tag kam ich also mit zwei langen, glänzenden Vorderzähnen und einem Mundvoll Metall in die Schule. Daß man mich aufziehen würde, hatte ich nicht bedacht, aber dann flüsterte jemand »Osterhase!«, und in der Mittagspause war ich schon von Jungs umringt, die mich kitzelten, um mich zum Lachen zu bringen. Plötzlich wehte ein Sturmwind alle anderen vom kahlen Schulhof, und ich stand allein vor Corwin Peace. Er schubste mich und lachte mir frech ins Gesicht. Gleich darauf kamen die anderen zurück und rannten mit ihm weg. Ich lief hinüber zur einzigen geschützten Stelle des Spielplatzes, einer Nische in der südlichen Ziegelmauer, die gerade so hoch war, daß man die Autowracks hinter der Tankstelle sah. Hier stand ich, auf meiner Insel der Ruhe, rieb mir das Schlüsselbein, wo mich seine Hände gestoßen hatten, und fragte mich, was das nun zu bedeuten hatte. Unsere Liebe war in Gefahr, vielleicht sogar am Ende. Bloß wegen der goldenen Zähne. Schon damals hielt ich es kaum für möglich, daß man solche radikalen Gefühlsumschwünge verkraften konnte. Doch wegen unserer Familiengeschichte stellte ich mich der Herausforderung. In all diesen dramatischen Geschichten gab es schließlich auch Rückschläge und Niederlagen. Ich war diejenige, der Unrecht geschehen war, und außerdem würde ich, waren die Klammern erst abgelegt, zu voller Schönheit erblühen, da war ich mir sicher. Also stellte ich mich neben ihn, als wir nach der Pause in Zweierreihen antraten, ich in der Mädchenreihe, er in der Jungenreihe, und boxte ihn kräftig gegen den Arm. »Lieb mich oder laß mich«, sagte ich und ging davon – mit weichen Knien und klopfendem Herzen. So etwas hatte noch niemand gewagt, bald wußte es die ganze Schule. Mein kühner Spruch aus der Seifenoper brachte mir Ruhm ein, sogar bei den Mädchen der achten Klasse, und eine von ihnen, Beryl Hoop, bot mir an, Corwin zu verdreschen. Die Macht war auf meiner Seite, und das in der Karwoche. In der Kirche wurden sämtliche Statuen in Purpur gehüllt, nur unsere besonders drastisch geratenen Kreuzwegstationen blieben frei.
Was man heutzutage in den Kirchen zu sehen bekommt, ist geschmackvoll in Holz geschnitzt oder auf andere Art abstrakt. Aber die Stationen in unserer Kirche waren aus Mörtel geformt und mit geradezu blutrünstiger Hingabe bemalt. Verdrehte Augen, verzerrte Münder, verrenkte Gliedmaßen – es fehlte nichts. Die Kirche mit ihren breiten Seitengängen bot uns Schulkindern reichlich Platz, auf dem Terrazzofußboden zu knien und den Leidensweg Christi zu verinnerlichen. Die empfindsamsten Mädchen sowie einer der Jungen, den aber nicht die Priesterlaufbahn, sondern ein spektakulärer Burnout im Stadttheater erwartete, weinten offen und hemmungslos. Wir anderen, durchdrungen von Schuldgefühlen oder heimlicher Freude am blutigen Getümmel, versuchten unauffällig, auf dem Hintern zu sitzen und die Knie zu schonen. Irgendwann durften wir dann auf den Bänken Platz nehmen, und in den drei heiligsten Stunden des Karfreitags, während Christus unter seinem Purpurtuch langsam dahinschied, waren wir gehalten, Ruhe zu bewahren. In diesen Stunden beschloß ich, Corwins Namen von meinem Körper zu tilgen, indem ich ihn einmillionenmal rückwärts schrieb: ecaepniwroc. Mit der Handfläche beginnend und dann zum Knie übergehend, hatte ich es gerade hundertmal geschafft, als ich feststellte, daß Corwin verzweifelt bemüht war, einen Blick von mir zu erhaschen. Das war nie zuvor geschehen, denn wie schon erwähnt, wurde unsere Liebesaffäre durch Boten ausgetragen. Mit meinem Fausthieb hatte ich ihn zum ersten Mal berührt, mit meinem inzwischen berühmt gewordenen Spruch zum ersten Mal angesprochen. Doch der Fausthieb mußte irgendein Feuer in ihm entfacht haben. Woher sonst der Mut, die Verzweiflung, mich direkt anzuschauen? Vor Schreck und Scham blieb mir die Luft weg. Ich wollte ihm ein Zeichen geben, aber es ging nicht, und ich blieb starr sitzen, bis wir gehen durften.
Ostersonntag. Ich trage ein blaugetupftes Kleid aus Schweizer Musselin. Es kratzt an den Säumen und juckt am Hals, aber der Gesamteindruck ist hervorragend. Ein geknotetes Kleenex als Haarschleife kommt für mich nicht in Frage, denn ich habe einen Hut mit künstlichen Veilchen und Gummizug, der sich in mein Kinn gräbt. Doch in letzter Minute bettle ich meiner Mutter den Spitzenschleier ab, der so aussieht wie der von Jackie Kennedy und den nur die allerschicksten von den großen Mädchen tragen. Ich bin also bestens ausstaffiert, aber trotzdem völlig unvorbereitet auf das, was passiert, nachdem ich vom Empfang der Heiligen Kommunion auf meinen Platz zurückgekehrt bin. Ich knie am Ende der Bank. Wir sind angewiesen, uns ganz still zu verhalten, damit Jesu Gegenwart in uns Einzug halten kann. Ich gebe mein Bestes. Aber dann entdecke ich Corwin auf meiner Seite der Kommunionsschlange, was bedeutet, daß er bei der Rückkehr auf seinen Platz ganz dicht an mir vorbeikommen wird. Soll ich züchtig den Kopf senken, oder soll ich ihn ansehen? Allein die Wahl macht mich schwindeln. Und natürlich sehe ich ihn an. Er umrundet die vordere Bank, bemerkt, daß ich ihn ansehe – dunkles, feucht zurückgekämmtes Haar, schmale Augenschlitze –, und wendet den Blick nicht von mir ab. Meine erste Liebe, die Hostie der Auferstehung auf der Zunge, sendet mir einen Blick von glühender Leidenschaft, der eine Million unsichtbare Namen zu Feuer entfacht.
Mustache Maude
Einen ganzen Sommer lang zehrten meine Großeltern von einem Sack erbeuteter Pintobohnen. Sie erschlugen die Klapperschlangen, die zur Jagd ins Flußbett kamen, brieten sie und würzten sie mit dem Salz einer kleinen Mineralquelle. Gesammelte Beeren kamen hinzu, hin und wieder eine Taschenratte oder ein Kaninchen, doch der Geschmack der Freiheit wurde allmählich von der Sehnsucht nach einer warmen Mahlzeit überlagert. Trotz ihrer Unwirtlichkeit waren die Badlands zu jener Zeit keineswegs menschenleer, sondern von irrlichternden Strolchen und Verbrechern bevölkert, aber auch von ehrsamen Farmern.
Eines Tages hörten die beiden lautes Quieken aus dem Dickicht, in dem sie Fallen ausgelegt hatten. Sie schauten vorsichtig nach und stellten fest, daß sich ein Schwein mit dem Hinterlauf verfangen hatte. Während sie noch berieten, wie sie es töten sollten, zeigte sich auf dem nahen Hügel die hünenhafte Gestalt eines Reiters mit breitkrempigem Hut. Sie hätten weglaufen können, aber dafür waren sie viel zu verblüfft, denn bei näherem Hinsehen entpuppte sich der Reiter als Frau in Männerkleidern. Sie hatte kleine, listige Augen, ein rundes Gesicht mit schmalen Lippen, und neben ihrem gewaltigen, mütterlichen Busen hing ein langer Zopf herab. Sie trug eine derbe Hose; Reitschurz, Handschuhe und Gürtel waren aus Leder, ihr Hutband bestand aus Schlangenhaut. Das braune Rassepferd blieb vor ihnen stehen, wohlerzogen und gehorsam. Die Frau spuckte eine Ladung Tabaksaft auf eine dösende Eidechse und lachte, als die Eidechse zuckte und davonhuschte. Den beiden befahl sie, stillzustehen, während sie abstieg, das Schwein anleinte, den Strick mit geübten Griffen am Sattelknauf festband und den Hinterlauf befreite.
»Aufsitzen!« befahl sie den beiden und zeigte auf das Pferd. Die Kinder gehorchten, sie griff nach dem Zügel und marschierte los. Das angebundene Schwein trottete hinterher. Als sie nach mehreren Meilen die Ranch erreichten, waren die beiden auf dem gutwilligen Pferd eingeschlafen. Die Frau befahl einem Knecht, die Schlafenden in das große, windschiefe Haus zu tragen, das aus Grasbatzen und Gebälk bestand. Im Schlafzimmer standen zwei kleine Betten sowie ein Rollbett, auf dem sie manchmal schlief, schnarchend wie ein Sägewerk, nämlich immer dann, wenn sie Krach mit ihrem Mann hatte, dem berüchtigten Ott Black. In diesem Haus wohnten mein Mooshum und seine zukünftige Braut sechs Jahre lang – bis die Ranch gestürmt wurde und Mooshum beinahe gelyncht worden wäre.
In Erling Nicolai Rolfsruds Handbuch bedeutender Männer und Frauen North Dakotas wird »Mustache« Maude Black, denn so hieß die Wohltäterin meiner Großeltern, als keineswegs unweiblich beschrieben, obwohl sie rauchte und soff, schoß und kommandierte wie ein Kerl. All das stimmte, versicherte mein Mooshum, genauso wie der Hinweis auf ihr sanftes Wesen und ihre Neigung zum Viehdiebstahl. Letzteres sei für sie eine Art Sport gewesen, sagte Mooshum, sie habe keinem damit schaden wollen. Manchmal stahl sie Schweine, und auch das Schwein im Dickicht hatte nicht ihr gehört. Mal trug sie einen Schnurrbart, mal nicht, nämlich dann, wenn sie ihn ausgezupft hatte. Sie schloß Mooshum und Junesse ins Herz, brachte ihnen Reiten, Lassowerfen und Schießen bei und die Zubereitung eines schmackhaften Hühnergerichts mit Klößchen. Da sie den beiden ihre Verliebtheit ansah, verbannte sie Mooshum ins Männerquartier, wo er umgehend in Erfahrung brachte, auf wie viele Arten er dereinst mit Junesse Kinder machen konnte. In Gedanken übte er schon und konnte es kaum erwarten. Aber Maude wollte die beiden erst heiraten lassen, wenn sie siebzehn wurden. Und als der Tag gekommen war, veranstaltete sie ein Hochzeitsmahl, von dem man noch lange sprechen sollte, denn die köstlich zubereiteten Tiere entsprachen in Sorte und Größe genau denen, die vielen der geladenen Gästen in letzter Zeit abhanden gekommen waren. Das führte zu einiger Aufregung, aber nach dem Festschmaus waren nur noch Knochen übrig, und Maude geizte nicht mit Whiskey, so daß die meisten benachbarten Farmer gelassen abwinkten. Was ihnen aber nicht paßte, im Gegenteil ihre Empörung und ihren schwelenden Argwohn weckte, war der Umstand, daß Mustache Maude eine so prächtige Feier für ein Indianerpärchen ausrichtete. Oder Mischlinge, ganz egal. Die Sache spielte sich schließlich im westlichen North Dakota ab, um die Wende des vorigen Jahrhunderts. Jahre später, als bei Pluto eine ganze Familie ermordet wurde, bezichtigte man vier Indianer der Tat, darunter einen halbwüchsigen Jungen namens Holy Track, und überließ sie dem Lynchmob.
In Mooshums Geschichte gab es noch einen anderen brutalen Mord, begangen an einer Frau auf einer westlich gelegenen Farm. Die Nachbarn ignorierten das plötzliche Verschwinden ihres Ehemannes und machten sich auf die Suche nach dem nächstbesten Indianer. Und der war ich, sagte Mooshum. Eines Nachts füllte sich der Hof zwischen Maudes Haus und dem Männerquartier mit Reitern, die brennende Pechfackeln schwenkten. Das Gebrüll riß Maude aus dem Schlaf, und das paßte ihr gar nicht. Da sie schon wußte, daß er gesucht wurde, hatte sie Mooshum mit einer Decke in ihren Küchenkeller geschickt, und er erfuhr erst später von seiner lieben Frau, was passiert war, weil er nichts gehört und sich über die Gefahr hinweggeträumt hatte.
»Gib ihn raus«, brüllten die Männer, »oder wir holen ihn uns.«
Maude stand im Schlafrock in der Tür, das Halfter umgeschnallt, eine entsicherte Pistole in jeder Hand. Sie konnte es einfach nicht leiden, geweckt zu werden.
»Ich erschieße die zwei, die zuerst vom Pferd steigen«, sagte sie. Dann zeigte sie auf den verschlafenen Mann, der neben ihr stand. »Und Ott Black durchlöchert die nächsten zwei.«
Die Männer konnten sich kaum auf den Pferden halten, so betrunken waren sie. Einer fiel herunter, worauf Ott ihn ins Bein schoß. Der Mann quiekte noch lauter als das Schwein in der Falle.
»Wer von euch ist der nächste?« dröhnte Maude.
»Gebt den verdammten Indianer raus!« Aber das Gebrüll klang schon etwas zaghafter und wurde von den heiseren Schreien des Angeschossenen übertönt.
»Welchen Indianer?«
»Den jungen.«
»Das ist kein Indianer«, sagte Maude. »Das ist ein Jude aus dem Lande Galiläa! Einer vom verlorenen Stamm Israels!«
Ott Black erstickte fast vor lauter Stolz auf seine kluge Frau. »Sie hat einen Schrank voll Bücher, ihr blöden Idioten!« rief er und nahm alle der Reihe nach aufs Korn.
Die Männer lachten nervös, aber blieben bei ihrer Forderung.
»Das war nur ein Scherz von mir«, sagte Maude. »In Wirklichkeit ist er Ott Blacks leiblicher Sohn.«
Das warf die Männer zurück in ihre Sättel. Ott blinzelte verdutzt, dann begriff er und brüllte: »Wer Maude Black nicht kennt, der kennt die Weiber nicht!«
Die Männer verloren sich in der Nacht und ließen ihren angeschossenen Möchtegern-Lyncher zurück, der strampelnd im Dreck lag und Gott um Gnade anflehte. Vielleicht hatte Otts Kugel einen Nerv oder einen Knochen erwischt, denn dafür, daß er nur von einer Kugel getroffen war, schien er ungewöhnlich starke Schmerzen zu leiden. Als er zu delirieren begann, mit Schaum vorm Mund, flößte ihm Maude Schnaps ein, band ihn auf seinem Sattel fest und machte sich mit ihm zum Arzt auf, weil sie ihn nicht im Haus haben wollte. Auf dem Weg zum Arzt starb er am Blutverlust. Noch vor Morgengrauen kehrte Maude zurück, gab meinen Großeltern ihre zwei besten Pferde und befahl ihnen, sich schleunigst dorthin zu verziehen, wo sie hergekommen waren. So landeten sie gerade noch rechtzeitig in ihrem Heimatreservat, um ihr Land zugewiesen zu bekommen, auf dem sie Saatgut der Regierung ausbrachten und mit Regierungsgeräten beackerten, auf dem sie ihre fünf Kinder großzogen, darunter auch Clemence, meine Mutter, und auf dem uns meine Eltern jeden Sommer reiten ließen, kurz nachdem dort der Holzbock Einzug gehalten hatte.
Eine Geschichte
Die Geschichte konnte durchaus stimmen, denn wie ich schon erwähnte, gab es Mustache Maude Black und ihren Ehemann Ott wirklich. Nur sagte sie in Mooshums Geschichte nicht jedesmal dasselbe. Mal gab sie ihn als ihren leiblichen Sohn aus und behauptete, sie hätte ein Verhältnis mit Häuptling Gall gehabt, mal hatte Ott Black den Mann nicht ins Bein, sondern in den Bauch geschossen. Schon möglich, daß er die Geschichte ein bißchen aufgebauscht hat, aber wenn, dann nur in einigen Einzelheiten. Unsere Kirche Sankt Joseph war nach dem Zimmermann benannt, der seiner Frau vertraute und einen Sohn großzog, der nicht von ihm stammte. Und dieser Zimmermann wird als Schutzpatron unseres kühnen und leidenschaftlichen Volks der Métis verehrt. Die Tauben waren mit Sicherheit die Botentauben, die man aus Legenden und Geschichten kennt, und sie traten in solchen Massen auf, daß man nicht glaubte, sie könnten jemals ausgerottet werden.
Mooshum wurde in dem Frühjahr schwerfälliger und hatte Mühe, den Garten zu bestellen. Da er sich auf seinem Stuhl wohler fühlte, lockerten unsere Eltern ihr Verbot. Jetzt schob unser Vater öfter mal die magischen Plastikknöpfe auf die Metallstutzen und drehte sie, bis das Bild aufklarte. Manchmal schauten wir die 3 Stooges alle zusammen. Der mit den schwarzen Haaren sehe aus wie Maude, behauptete Mooshum und zeigte nickend auf den Fernseher. Ich weiß noch, daß ich seinen knorrigen braunen Finger ansah und mir die Hand vorstellte, mit der er als kräftiger junger Mann den Pflug geführt oder als Junge den Leuchter gehalten hatte, den meine Großeltern übrigens in die Badlands mitnahmen, wo er ihnen beim Erschlagen der Schlangen und Taschenratten gute Dienste leistete. Zum Zeichen ihrer Dankbarkeit hatten sie ihn, ihren einzigen Besitz, an Maude überreicht – die ihnen das gute Stück in der Nacht ihrer Flucht hastig zuschob.
Der schlanke, sechsarmige Kandelaber mit seiner stellenweise abgewetzten Versilberung nahm jetzt einen Ehrenplatz in der Mitte unseres Eßzimmertischs ein. In ihm steckten Bienenwachskerzen, die erst kürzlich beim Ostermahl angezündet worden waren. Am Tag nach Ostermontag küßte ich Corwin Peace in der kleinen Nische auf dem Schulspielplatz. Unser Kuß war intensiv, leidenschaftlich und seltsam erwachsen. Danach ging ich allein nach Hause. Ich lief sehr langsam. Auf halbem Weg blieb ich stehen und starrte eine Platte auf dem Gehsteig an, die ich schon tausendmal passiert hatte und genau kannte. In ihr war ein Riß – tief, lang, zerklüftet und dunkel. Es war der Tag, an dem die riesigen alten Pappeln ihre Wolle abwarfen. Die Luft war voll davon, in den Rinnsteinen wuchsen Polster aus lichtem Schnee. Eigentlich hatte ich ein Glücksgefühl erwartet, aber statt dessen befiel mich eine undefinierbare Trauer oder vielleicht Angst, denn mir war, als wäre mein Leben eine hungrige Geschichte und ich ihre Nahrung. Als hätte ich mit diesem Kuß begonnen, mich den Wörtern auszuliefern.
Nur eine Kleinigkeit
An der Küchenwand, neben der schwarzen Blechuhr, deren mit Radium vergiftete Zeiger im Dunkeln leuchteten, hingen drei Bilder. John F. Kennedy, Papst Johannes XXIII. und Louis Riel. Die ersten zwei waren Farbfotos, die meine Eltern über die Schule und die Kirche bezogen hatten, das dritte ein Zeitungsfoto, alt und vergilbt. Meine Mutter hatte es ausgeschnitten und sorgfältig in einen einfachen Wechselrahmen eingesetzt. Auf dem Bild sah Riel mürrisch und zerzaust aus, ein bißchen verschwommen. Doch er war der visionäre Held unseres Volkes, der Beinahe-Führer unserer Nation der Michif – wenn es sie denn gegeben hätte. Mooshum und unsere Mutter verehrten ihn, obwohl Riel die Ursache dafür war, daß Mooshums Eltern ihre riesige Farm bei Batoche, Saskatchewan, von der sie prächtig gelebt hatten, nicht an ihre Söhne hatten vererben können. Besagte Farm wurde niedergebrannt, bevor Mooshum die Gabe des Sprechens erwarb, weil die Familie Milk vom Geiste Riels beseelt war, seinen Kampf mit Geld unterstützte, seine Frau und sein Kind beherbergte, seine Offiziere verpflegte, an seiner Seite focht und die Pfarrer erzürnte, welche Riels Anhängern mit Exkommunikation drohten und sie schließlich an ihre Mörder verrieten.
Nach dem Debakel bei Batoche waren die Milks südwärts geflohen und hatten bei Dunkelheit die Grenze überquert, ohne genau zu wissen, wo sie sich befanden. Als sie geeignetes Land gefunden hatten, versuchten sie eine neue Existenz aufzubauen, aber der Mut hatte sie verlassen. Sie verloren ein Baby, lebten in Trübsal und Armut und waren vernichtet, als sie erfuhren, daß Riel zum Tode verurteilt und gehängt worden war. Riel ging in Mokassins in den Tod und hielt ein silbernes Kruzifix in der Hand. Seine letzten Worte, gerichtet an den anwesenden Geistlichen, lauteten Courage, mon père. Mein Urgroßvater Joseph Milk hatte den launischen Propheten des neuen, gemischtblütigen Katholizismus besonders verehrt, und er verfluchte den Klerus, obwohl sein Sohn Severine gerade zum Priester geweiht worden war.
Mooshum hatte einen jüngeren Bruder. Er hieß Shamengwa, war Geigenspieler und zeichnete sich durch ein würdevolles Benehmen aus, während Mooshum auf fröhliche Weise chaotisch und ordinär war. Von seinem verkrümmten Arm einmal abgesehen, war Shamengwa ein Muster an Eleganz. Als letzte Vertreter ihrer Generation saßen sie oft und gern zusammen, obwohl sie gegensätzlicher nicht hätten sein können. Die traurige Geschichte ihrer Eltern hatte sie in verschiedener Weise geprägt. Shamengwa zog es zur Musik, Mooshum zu den Geschichten. Beide waren ihrem Elternhaus so früh wie möglich entflohen, aber die Vergangenheit verfolgte sie natürlich, und jetzt als alte Männer suchten sie ihren Trost darin, die alten Geschichten wiederzukäuen. Kam Shamengwa zu Besuch, setzte er sich kerzengerade auf einen harten Küchenstuhl, und oft spielte er die alten Lieder, während Mooshum am liebsten entspannt dasaß oder -lag und auf dem Knie den Takt schlug. Im Sommer benutzte Mooshum den alten Autositz auf dem Hof, den Mama nicht wegräumen durfte. Drinnen war die durchgesessene Couch sein Refugium. Manchmal saßen die beiden Brüder am Küchentisch und tranken heißen, süßen Tee, in den Mooshum »ein bißchen was reingetan« hatte. Aber nichts erfreute sie so sehr wie die Gelegenheit, einem der verhaßten Schwarzröcke ihre Geschichtsbrocken an den Kopf zu werfen. Und so war die Aufregung groß, wenn der alte pensionierte Pfarrer, der einsam und gebrechlich auf seinem Berg lebte, unter Mühen angewackelt kam, um den Brüdern einen Besuch abzustatten, oder wenn er in einem Gefährt, das aussah wie ein riesiger Kinderwagen, von einer hilfsbereiten Franziskanerin herangekarrt wurde. Sie überschlugen sich förmlich, um ihm Whiskey anzubieten, und bedrängten Mama oder Tante Geraldine, Fleischklößchensuppe zu kochen oder eine luftige Galette zu backen, die Spezialität ihrer Mutter Junesse. Andere Speisen lagen ihnen schwer im Magen, aber alle drei Männer behaupteten, daß die Suppe mit Brot wundervoll abführend wirkte, wenn sie nur mit reichlich Fett versehen war. Für die schlechte Straße benutzte der Pfarrer einen polierten Weidenstock mit Kristallknauf, den er fest zwischen den Füßen aufpflanzte, wenn er sich in den weindunklen Wogen der Couch niederließ. Von dorther steuerte er, mit dem eierschalendünnen Schädel nickend, seine sanft geflüsterten Ansichten bei, welche die Brüder jedoch kaum zum Widerspruch zu reizen vermochten. Manchmal verstummten sie vor Enttäuschung, weil ihnen der Pfarrer nicht genügend Paroli bot, aber die Besuche endeten stets in einer Abfolge höflich ausgebrachter Toasts. Dann starb der gute Mann, und die beiden hatten keinen Geistlichen mehr, an dem sie sich austoben konnten, bis ein dicker, blaßgesichtiger, aufgeblasener und auf peinliche Weise betulicher Pfarrer aus Montana zu uns versetzt wurde. Er bekam den Spitznamen Father Hop Along, weil er aus Cowboyland kam, weil er mit richtigem Namen Cassidy hieß und weil er die unglückliche Neigung besaß, ein wenig zu geziert zu hüpfen, wenn er die Gemeinde bei der Heiligen Messe mit seinem Weihwedel besprenkelte.
Im Sommer nach meinem ersten Kuß machte der Fernseher schlapp, auch der Ton blieb weg. Wir bekamen nur vereinzelte Brummtöne aus ihm heraus, und das Bild lief so schnell, daß uns schlecht wurde. Aber wir wohnten ohnehin draußen. Joseph und ich durften die Schecken von Tante Geraldine einfangen und reiten, soviel wir wollten. Beide Pferde waren flink und sehr lauffreudig. Das schwarzweiße verhielt sich recht brav, aber das braunweiße, ein Pinto, neigte zum Beißen, wenn man in den toten Winkel geriet. Wir ritten sie ungesattelt mit dem Seilzügel und banden sie auf dem Hof fest, wenn wir zum Essen hineingingen. Eines Tages, wir saßen Mooshum und Shamengwa gegenüber und löffelten unsere Suppe, setzte ein leichter Regen ein. Die Pferde hatten wir unter den Bäumen angebunden. Geschützt vom dichten Laub, fraßen sie munter das hohe Gras in ihrem Umkreis. Wegen des Regens nahmen wir nicht Reißaus, als Father Cassidy eintraf und von Mama hereingebeten wurde, sondern beschlossen, vor der Tür Rommé zu spielen, bis der Himmel aufklarte.
Die zwei Alten begrüßten den Pfarrer mit heller Begeisterung. »Tawnshi! Tawnshi ta sawntee, Père Cassidy! Wie nett, daß Sie uns besuchen! Gut sehen Sie aus! Setzen Sie sich doch, setzen Sie sich zu uns, essen Sie einen Happen, einen Teller Suppe, einen Kanten Brot.«
»Hätten wir auch einen guten Schluck, Clemence?«
»Ich wäre nicht abgeneigt«, sagte Father Cassidy und zitterte ein bißchen – aber wohl eher vor Gier, denn kalt war es nicht. »Nur eine Kleinigkeit, und ich wäre das Frösteln los.«
Joseph warf mir einen Blick zu, auf seine typische Art, mit hochgezogenen Augenbrauen und heruntergezogenen Mundwinkeln. Der Regen brachte keine Abkühlung, sondern ließ das Gras dampfen, was eindeutig bewies, daß wir einen durstigen Pfarrer vor uns hatten. Mooshum krähte vor Vergnügen und drückte von unten gegen Mamas Hand, weil sie beim Einschenken knauserte.
»Ein bißchen gastfreundlicher, meine Tochter!«
Mama zog ein Gesicht und räusperte sich laut, doch sie ließ die Flasche auf dem Tisch zurück.
»Also, Father Cassidy, Sie sind ja nun schon eine Weile hier. Was halten Sie eigentlich von unserem Lebenswandel?«
Der Pfarrer legte den Kopf in den Nacken, um den letzten Tropfen aus seinem Glas zu holen.
»Oh yai! Es gab Zeiten, da haben die Pfarrer ihren Whiskey mit Wasser verdünnt, aber dieser hier, der trinkt das Feuerwasser pur. Mein Bruder, laß uns desgleichen tun!«
»Ich bin eben ein echter Montana-Boy«, sagte Father Cassidy und tat, als hätte niemand gemerkt, daß er sein Glas viel zu schnell hintergekippt hatte. »Wir machen keine Umstände und verwässern unsern Whiskey nicht, aber wir legen Wert auf den Besuch der Heiligen Messe. Also, Clemence kommt regelmäßig und bringt auch Edward mit, und die Jüngeren sind natürlich verpflichtet, jeden Freitag die Heilige Beichte abzulegen und wöchentlich an mindestens drei Messen teilzunehmen. Aber ihr? Seit ich hier bin, habt ihr euch kein einziges Mal in der Kirche blicken lassen. Und das heißt zumindest, daß eure Beichte seit langem überfällig ist.«
»Tawpway, Père Cassidy, Sie sprechen die Wahrheit. Aber alte Männer haben wenig Gelegenheit zu sündigen«, sagte Mooshum bedauernd und wandte sich an Shamengwa. »Bruder, hattest du dieses Jahr schon Gelegenheit zu sündigen?«
Shamengwa setzte eine Unschuldsmiene auf und seufzte vorwurfsvoll. »Frère, dir würde ich’s doch sofort erzählen, schon um dich eifersüchtig zu machen. Hiyn, nein, ich bin sauber geblieben.«
»Ich auch. Völlig sauber«, sagte Mooshum. Sein Kinn zitterte.
»Seid ihr da sicher?« fragte Father Cassidy und richtete den Blick auf die Flasche. Seine Hand umfaßte das leere Glas. Er hob das Glas der Flasche entgegen. »Großartige Sünden sind gar nicht mal vonnöten. Habt ihr vielleicht den Namen des Herrn unnütz gebraucht?«
»Mon Dieu! Niemals!« Allein der Gedanke schockierte die Brüder. Hastig schenkten sie dem Pfarrer eine doppelte Portion ein und füllten die eigenen Gläser nach.
Father Cassidy wirkte ein wenig enttäuscht, aber nach einem kräftigen Schluck hellte sich seine Miene auf. »Es gibt so viele Sünden, die nicht offen zutage treten. Ihr könnt zum Beispiel an der Sünde eines anderen mitschuldig werden, indem ihr darüber schweigt. Hat vielleicht einer aus eurem Bekanntenkreis gesündigt?«
Verdutzt schüttelten die beiden den Kopf. Der Pfarrer wedelte mit der molligen Hand, um seiner Phantasie nachzuhelfen. »Ihr könnt euch am Heiligen Geist versündigen, indem ihr zum Beispiel am Nutzen der Heiligen Messe zweifelt und so eure Seele gegen das Einwirken der Gnade verhärtet.«
Father Cassidy war hochzufrieden mit sich, aber die Brüder zeigten sich gekränkt, weil er ihre Seele für verhärtet hielt, und legten die Hand schützend auf ihr pulsendes Herz. Der Pfarrer gab jedoch nicht auf, sondern betete ein ganzes Register läßlicher Sünden herunter. »Anwandlungen von Neid oder Hochmut oder … nein? Übellaunigkeit oder eine kleine Unwahrheit, nein? Oder gar, ich wage es kaum zu sagen …« Seine weiche Hand zitterte ein wenig, als sie sich ums Glas schloß. Behutsam und mit mildem Entzücken ließ er die goldene Flüssigkeit kreisen. Jetzt wirkte er schon ein wenig verträumt. »Unreine Gedanken«, flüsterte er. »Sehr verbreitet.«
Mooshum wechselte einen gekränkten Blick mit seinem Bruder und schaute suchend an die Decke. Shamengwa bekreuzigte sich mit seinem gesunden Arm und nahm einen kleinen Schluck.
Mooshum zupfte an seinem verstümmelten Ohr. »Eigentlich müßten wir wissen, wovon er redet«, sagte er. »Aber leider sind uns solche Dinge völlig fremd.«
»Unreine Gedanken«, sagte Joseph versonnen, der mit mir in der Tür saß. Mit finsterer Miene studierte er sein Blatt.
»Rommé!« rief ich.
»O weh.«
»Unreine Gedanken«, meldete sich jetzt Shamengwa zu Wort. »Lieber Herr Pfarrer, können Sie uns bitte genauer erklären, was Sie damit meinen? Wenn die so verbreitet sind, müssen wir sie ja kennen, aber bis jetzt sind uns keine begegnet.«
»Vielleicht sündigen wir ja unwissentlich«, sagte Mooshum. Über sein erhobenes Glas hinweg fixierte er den Pfarrer. Er wollte Würde ausstrahlen, aber mit seinem abgebissenen Ohr wirkte das immer nur lächerlich. »Das wäre ja …«
»Tragisch«, ergänzte Joseph und mischte eifrig die Karten, um sein Lachen zu verbergen.
»Tragisch … weil wir ohne Vorwarnung in der Hölle landen könnten, wenn’s ans Sterben geht.«
»Kommt man denn von unreinen Gedanken in die Hölle?«
Starr vor Schreck richteten sich die beiden Alten kerzengrade auf. Der Pfarrer schielte in sein leeres Glas, und Mooshum füllte kräftig nach.
»Kupidität«, sagte Father Cassidy, hob das Glas und reckte zur Bekräftigung den Zeigefinger in die Höhe. Mit der Linken zerrte er an seinem zu eng gewordenen Priesterkragen. »Aus dem Lateinischen, von cupissidas, glaube ich, was soviel bedeutet wie äh, sich an unreine Ergüsse zu erinnern oder sich welche vorzustellen … also jeder Akt von eingebildetem oder ejakulatorischem Koitus, grob gesprochen.«
»Ah! Koitus!« Die Brüder wurden munter und stießen miteinander an, dann mit Father Cassidy, der aus reiner Geselligkeit sein Glas ebenfalls hinterkippte und zerstreut murmelte: »Aus dem lateinischen …«
»Aus dem lateinischen coex wie in Koexistenz, das heißt Beziehungen mit Ausländern!« krähte Joseph.
»Ho, ho!« jubelten die Brüder und stießen ein weiteres Mal an. Joseph legte die Karten hin und ergriff die Flucht.
Ich folgte ihm auf der Stelle, aber Father Cassidy und Mama waren schon hinter uns her, und Mama rief: »Bleibt sofort stehen, ihr zwei, und entschuldigt euch bei Father Cassidy!«
Doch der, vielleicht um sich als waschechter Pferdekenner zu beweisen, lief uns mit großen Schritten nach. Sein Doppelkinn quoll bedrohlich über den Kragenrand. »Keine Ursache, keine Ursache«, rief er. »Das sind wohl eure, was? Brave kleine Pferdchen, leider ohne Rasse. Furchtbarer Anblick natürlich, ausgesprochen x-beinig, und bräuchten dringend den Striegel.« In den Augen der langhalsigen Pinto-Stute zeigte sich ein bösartiges Glitzern. Father Cassidy stellte sich genau in den toten Winkel, blitzschnell wie eine Klapperschlange drehte die Stute den Kopf und verbiß sich in seinen massigen Oberarm. Er schrie und hüpfte, aber die Stute hielt ihn gepackt wie eine Mutter ihr unartiges Kind. Father Cassidy versuchte, ihr mit der flachen Hand auf die Nase zu schlagen. Die Stute verdrehte ihre Augen nach hinten, stieß ein hustendes Grunzen aus, das wie Gelächter klang, und biß noch einmal kräftig zu, bevor sie den Arm freigab. Father Cassidy war starr vor Schock.
»Oh«, sagte Mama. »Das tut mir aber leid, Father Cassidy. Kommen Sie wieder rein, ich tue Ihnen Eis drauf. Ist ja nur eine Kleinigkeit.«
»Nur eine Kleinigkeit?« schrie Father Cassidy. Er umklammerte seinen Arm, als müßte er eine klaffende Fleischwunde zusammenpressen, und floh rückwärts zu seinem Auto, das vor unserem Haus parkte. »Auf Wiedersehen, Clemence, sehr zu Dank verpflichtet. Der Tropfen hat mir nicht geschadet. Daß ich ein Anästhetikum brauche, konnte ich ja nicht ahnen.«
»Aus dem lateinischen anaesthed, bedeutet soviel wie Dummkopf«, flüsterte mir Joseph zu.
Father Cassidy stieg in sein Auto. »Sagen Sie Ihrem Vater und seinem Bruder, daß sie ihre Verdammnis riskieren, wenn sie der Messe fernbleiben.«
»Keine Sorge, Father Cassidy, ich werd’s ausrichten.«
Mama ging vors Haus, um ihm höflich nachzuwinken. Als sie zurückkehrte und auf uns losgehen wollte, waren wir schon aufgesessen und über alle Berge. Daher vermute ich, daß sie ihren Ärger an ihrem Vater und ihrem Onkel ausließ, obwohl sie die beiden Alten, die sie genauso liebte wie uns, normalerweise nett behandelte. Beim Abendessen waren sie dann still und brav. Shamengwa blieb über Nacht, weil sie ihm nicht erlaubte, sich »davonzuschleichen«, wie sie es nannte. Der Fernseher dröhnte, das Bild wanderte langsam nach oben und verharrte auf halber Höhe, so daß die Beine der Ansagerin über ihrem Kopf schwebten. Dann bewegte sich der Kopf nach oben, und die Beine ruckelten für einen Moment unter ihr, bis ihr Kopf am oberen Rand verschwand und unten wieder auftauchte. Die beiden Alten wandten sich ab und machten die Augen zu, weil sie diesen Anblick nicht ertrugen. In tiefer Unschuld schnarchten sie leise vor sich hin.
Aber damit war die Sache nicht ausgestanden. Mooshum und sein Bruder gingen ein paarmal zur Messe und schwänzten dann absichtlich, um Father Cassidy zu einem Besuch zu provozieren. Die beiden alten, der Ewigkeit so nahen Männer vor sich in der Kirchenbank zu sehen hatte seine Hoffnungen genährt, sich ihrer Seelen versichern zu können. Sein zweiter Besuch verlief nicht viel anders als der erste. Mooshum versprach, endlich eine ordentliche Sünde zu begehen, damit er etwas zu beichten habe. Und Joseph verfolgte das Geschehen mit der leidgeprüften Allwissenheit eines Teenagers.
Als Junge hatte es mein Bruder nicht leicht. Daß sein Vater Lehrer in einer Reservatsschule war, machte ihn nicht gerade beliebt, während ich die Vorteile genoß. Für ein Mädchen war es immer gut, den Vater in Reichweite zu haben. Erschwerend für Joseph kam hinzu, daß er sich für Naturkunde begeisterte und sogar die lateinischen Bezeichnungen auswendig lernte. Um das wieder wettzumachen, ritt er mit den Pintos von Tante Geraldine durch die Gegend, bis tief in den Busch, und betrank sich mit Schwarzmarktwein, sooft sich die Gelegenheit bot. Freunde hatten wir beide, dazu kamen acht oder neun Verwandte aus der Peace-Familie – Nichten und Vettern ersten bis dritten Grades und etwa sechzehn andere, soweit wir zählen konnten, sowie Corwin. Ich hatte Freundinnen, und ich hatte nichts gegen die Schule, aber außerhalb des Klassenzimmers reichten mir schon meine familiären Bindungen. Sehr gesellig waren wir also nicht. Dazu kam, daß sich Joseph und unser Vater mit ihren Hobbys ein bißchen isolierten – sie sammelten natürlich Briefmarken, denn das war wie Reisen ohne Wegfahren, interessierten sich aber auch für Sterne und Himmelserscheinungen, Gräser, Bäume, Vögel, Reptilien und alle möglichen Insekten, die sie systematisch sammelten, mit Nadeln auf weiße Pappe spießten und etikettierten.
Josephs Spezialgebiet war eine Sorte dicker schwarzer Salamander, die es nur in unserer Gegend gab, wie er behauptete. Durch Beobachtung in freier Natur wollte er ihren jährlichen Lebenszyklus verfolgen, und er hatte Dad überredet, ihm dabei zu helfen. Daher fuhren sie selbst im tiefsten Winter los, mit Schaufel und Spitzhacke, um in Tante Geraldines Sumpfland ein im Winterschlaf befindliches Exemplar aus dem steinhart gefrorenen Schlamm herauszubefördern. Oder sie legten – wie jetzt im Sommer – eingezäunte Spielwiesen für die Salamander an, verfolgten jede ihrer Bewegungen und notierten alles in sauberer Blockschrift. Aus irgendeinem Grund hatten sie sich darauf geeinigt, Schreibschrift zu vermeiden.
Daß Joseph netter zu mir war, als es Brüder meistens sind, lag vielleicht daran, daß ich ihn immer bewundert hatte. Außerdem wußten wir, daß wir keine Geschwister bekommen würden. Das hatte Mama durchblicken lassen, und wenn wir uns stritten, brachte sie uns zum Schweigen, indem sie sagte: »Stellt euch mal vor, wie euch zumute wäre, wenn irgendwas passierte.« Sich den anderen tot vorzustellen half uns irgendwie dabei, uns besser zu vertragen. Ich half Joseph, Salamander zu sammeln und in den geklauten Einmachgläsern zu verstauen und lernte ein paar lateinische Bezeichnungen, nur um ihm eine Freude zu machen. Daß ich die Salamander – oder mud puppies, wie sie allgemein hießen – ebenfalls mochte, kam mir dabei zugute. Sie waren wie Erdklumpen, dunkel mit gelben Flecken, und ganz hilflos, wenn sie aus dem Wasser kamen. Bei starkem Regen kamen sie in Schwärmen aus ihren nassen Erdspalten hervorgekrochen, langsam und gravitätisch. Die stummen Heerscharen hatten etwas Großartiges, aber auch Erschreckendes an sich. Mooshum sagte, die Nonnen hielten sie für Sendboten der unerlösten Toten, die der Teufel schicke, und die Hölle sei voll davon. Wir schlurften vorsichtig durchs Gras und kippten die rundlichen Viecher mit dem Fuß auf die Seite. Dann lasen wir sie auf, verfrachteten sie auf trockenen Grund und bedeckten sie mit nassem Laub. Sie fanden sich zuhauf in den feuchten Senken um die Schulgebäude – manchmal saßen zehn oder zwanzig in den Fensterschächten. Spät im Frühjahr, wenn die starken Regenfälle kamen, weckte mich Joseph immer vor der Zeit, damit wir als erste in der Schule waren und die Salamander herausholen konnten, bevor die anderen Jungs kamen und sie tottrampelten.
In jenem Sommer hatten Joseph und mein Vater mit Schaufel und Spitzhacke einen tiefen Tümpel im Hof gegraben, der sich sofort füllte, weil der Grundwasserspiegel so hoch war. Sie bepflanzten die Ränder mit Schilf und Weiden, dann taten sie Frösche und Salamander hinein. Für Fische, die Feinde der neotenischen Larven, war der Tümpel nicht gedacht. Aber sie bestückten ihn reichlich mit Chorfröschen und Leopardfröschen aus Geraldines Sumpf – und mit Salamandern, die wir im Eimer nach Hause schleppten. Zu Josephs Enttäuschung schienen die Salamander spurlos in der Erde zu verschwinden. Auch wenn er welche fand, war es schwer, sie zu beobachten, weil sie sich so gut wie gar nicht rührten. Es konnte den ganzen Tag dauern, bis sie auch nur das Maul aufmachten. Joseph wurde daher ungeduldig und stibitzte bei Dad ein Sezierbesteck. Die Schachtel enthielt ein Skalpell, Pinzetten, Nadeln, Glasplättchen, ein Fläschchen Chloroform und mehrere Wattebäusche. Beigelegt war die graphische Darstellung eines aufgeschnittenen Froschs mit genau bezeichneten Organen.
Joseph breitete die Instrumente sorgfältig auf dem Fensterbrett des kleinen Zimmers aus, das wir uns teilten. Dann holte er ein Glas unter dem Bett hervor, es enthielt ein Exemplar des Ambystoma tigrinum oder Östlichen Tigersalamanders. Er warf einen mit Chloroform getränkten Wattebausch ins Glas und stellte es zurück unters Bett. Unser Vater war eigentlich kein Freund des Sezierens.
An dem Abend hielt ich die Kerze, um Joseph bei Bedarf mehr Licht zu spenden. Ich schaute zu, wie er den Bauch des Salamanders aufschlitzte und das glitschige Gekröse freilegte – ein Gewirr aus schleimigen, durchsichtigen Schläuchen.
»Er war kurz davor, die Spermatophore zu entleeren«, sagte Joseph ehrfürchtig und stocherte in einem weißen Klümpchen. Im Flur nahten Schritte. Ich blies die Kerze aus. Dad öffnete die Tür.
»Keine Kerzen«, sagte er. »Feuergefahr. Her damit.«
Ich griff unters Bett und rollte ihm die Kerze vor die Füße. Er sagte: »Evey, komm raus hier und geh ins Bett.«
Am nächsten Morgen stand ich vor Joseph auf und sah, daß der Salamander noch einmal zu sich gekommen war und versucht hatte, davonzukriechen. Die Eingeweide, von Joseph ans weiche Holz der Kommode gepinnt, hatten sich aufgedröselt und zogen sich bis zum Fensterbrett, wo der Salamander dann, die Nase ans Fliegengitter gepreßt, verendet war. An dem Tag begrub Joseph das Sezierbesteck zusammen mit dem Salamander. Er seufzte ständig, während wir das mollige Tierchen, das langsam grau wurde, mit Erde bedeckten, aber er sagte kein Wort und ich auch nicht. Erst Monate später buddelte er das Sezierbesteck wieder aus, und es verging bestimmt ein Jahr, bevor er es für etwas anderes benutzte.
Alles wäre anders gekommen, behaupteten Mooshum und Shamengwa, hätte Louis Riel seinem unerschrockenen Kriegshäuptling Gabriel Dumont vor und während der Schlacht von Batoche den Oberbefehl übertragen. Nicht nur, daß er den Mischlingen und Indianern eine einflußreichere Stellung in der Welt gesichert hätte. Ein Sieg hätte auch die Indianer südlich der Grenze ermutigt, sich an einem entscheidenden Wendepunkt der Geschichte zu vereinen. Oft spekulierten die beiden Brüder auch darüber, welche Form der Métis-Katholizismus angenommen hätte, ob auch eigene Priester berufen worden wären. Mooshum beharrte darauf, daß man den schismatischen Priestern die Heirat hätte erlauben sollen, während Shamengwa meinte, selbst Métis-Priester hätten keusch zu bleiben. Beide waren sich aber einig, daß der Offenbarung, die Louis Riel empfing, als er und seine Anhänger exkommuniziert wurden, ein folgerichtiger und vernünftiger Gedanke zugrunde lag. Nach längerer Meditation hatte der Mystiker Riel verkündet, die Hölle könne nicht ewig dauern und auch nicht allzu heiß werden.
»Das glaube ich auch«, bekräftigte Mooshum. »Nicht nur, weil Riel von den Engeln erquickt wurde, sondern weil es logisch ist.«