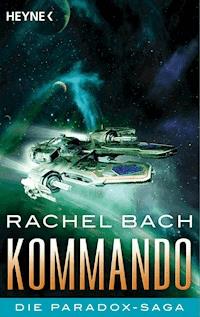9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Paradox-Saga
- Sprache: Deutsch
Action-Science-Fiction ohne Kompromisse
In ihrem Job als Sicherheitsoffizierin macht Devi Morris so leicht keiner etwas vor. Nach ihrem letzten Einsatz auf dem unscheinbaren Handelsschiff Glorreicher Narr hat sie jedoch nicht nur ihren Partner, sondern auch die Erinnerung an das verloren, was genau eigentlich passiert ist – und sie ahnt auch, dass da draußen im All eine Macht auf sie wartet, die größer ist als jede Vorstellungskraft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Die Sicherheitsoffizierin Devi Morris hat eine Menge Probleme. Und die meisten lassen sich nicht mal eben so aus dem Universum schießen. Dort wimmelt es zwar von feindlichen Fraktionen, gefährlichen Mutanten und korrupten Politikern, aber jetzt muss sich Morris erst einmal um sich selbst kümmern. Nachdem ein heftiger Angriff ihr ein paar Gedächtnislücken verpasst und einen Partner genommen hat, will sie fürs erste lieber den Kopf unten halten und wieder mit ihrem Job und Alltag zurechtkommen. Vergebens. Irgendwie scheint Devi Morris die Probleme magnetisch anzuziehen: Sie sieht Dinge, die nicht da zu sein scheinen, sie lässt sich auf ein Techtelmechtel mit dem Bordkoch ein, von dem sie dachte, dass sie ihn hasst – und jetzt gerät sie mit ihrem Schiff, der Glorreicher Narr, in noch größere Probleme als zuvor. So langsam wird es also Zeit, die Kanonen wieder auszupacken. Denn offenbar wartet da draußen im All ein Gegner auf sie, dessen finstere Macht alles zu zerstören vermag, was ihr lieb und teuer ist.
Die Autorin
Rachel Bach wuchs in Atlanta auf und wollte schon früh Schriftstellerin werden. Sie entschied sich für das Schreiben, und lebt mit ihrem Sohn, ihrem Mann, ihrem Hund und einer von Büchern berstenden Bibliothek zurzeit in Athen.
Mehr über Rachel Bach und ihre Romane erfahren Sie auf:
Rachel Bach
DIE PARADOX-SAGA
Söldnerehre
Roman
Deutsche Erstausgabe
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Gewidmet der ursprünglichen Besatzung
der Glorreicher Narr
Prolog
»Du hast Nein gesagt?«, kreischte das Mädchen und zerknüllte den Brief in seiner Hand. »Hast du nicht einmal daran gedacht, mich zuerst zu fragen?«
Ihr Vater verschränkte die Arme vor der Brust und fixierte sie mit dem Blick, der seine Rekruten früher immer zum Zittern gebracht hatte. »Nein. Die Entscheidung lag nicht bei dir.«
Das Mädchen warf ihm den zerknüllten Brief an die Brust. »Ich fasse es nicht, Papa! Die beste Plasmex-Schule in der ganzen Galaxie schickt mir eine Einladung, und du machst alles kaputt! Du fragst mich nicht einmal, wie ich darüber denke, und sagst einfach Nein, als könntest du für mich sprechen!«
»Das kann ich auch, Yasmina«, erwiderte er ruhig. »Du bist zwölf, noch ein Kind. Kinder sollten nicht so weit von Zuhause weggehen.«
»Ich werde nie irgendwo hingehen«, wimmerte Yasmina. »Für den Rest meines Lebens werde ich hier mitten im Nirgendwo festsitzen!« Sie drehte sich weg und rannte zu ihrem Zimmer. »Ich hasse dich!«
»So sprichst du nicht mit mir!«, schrie ihr Vater zurück, aber es war zu spät. Das Mädchen hatte die Tür bereits hinter sich zugeknallt.
Er machte Anstalten, ihr zu folgen, dann blieb er stehen und fuhr sich mit der Hand durch die dichten schwarzen Locken, die von Tag zu Tag grauer zu werden schienen. Aus Erfahrung wusste er, wenn er sie jetzt zur Rede stellte, würde sie nur noch wütender. Das war nur normal. Yasmina war jung. Er nicht. Es lag in seiner Verantwortung, die Ruhe zu bewahren und das Richtige zu tun. Allerdings war das ein schwacher Trost, wenn er seine Tochter weinen hörte.
Der Mann seufzte und ließ sich in den abgewetzten Stuhl neben dem Panoramafenster sinken. Sein Blick schweifte über die weitläufigen Felder rings um das Farmhaus. In Wahrheit gefiel es ihm hier draußen genauso wenig wie ihr. Die Weite hatte er noch nie gemocht. Zu wenig Deckung, zu viele Möglichkeiten, sich unbemerkt anzuschleichen, aber ihm war keine Wahl geblieben.
Yasmina war plasmexempfänglich. Als sie noch klein war, war es noch nicht so schlimm gewesen, aber als ihre Kräfte von Jahr zu Jahr stärker wurden, konnte sie nicht mehr in der Stadt mit all ihren Stimmen bleiben. Also gab er seine Stellung beim terranischen Militär auf und zog mit seiner Familie in die Kolonien, weit weg von allem, das Yasmina schaden konnte. Als seine Frau noch lebte, war die Einsamkeit erträglich gewesen, aber jetzt waren die Dinge … nicht mehr so einfach. Jetzt, da sie nur noch zu zweit waren, musste er Yasmina sorgsamer schützen denn je und sie möglichst nah an seiner Seite behalten.
Er spürte, wie er mit der Schuhspitze gegen etwas stieß, und blickte nach unten. Es war der zerknüllte Brief, den seine Tochter nach ihm geworfen hatte. Er bückte sich, hob ihn auf und strich das Papier auf seinem Knie glatt. Der Brief war von der Plasmex-Schule und besagte, dass Yasmina aufgenommen war. Er war auf dickes, altmodisches Papier gedruckt. Eine Masche, da war er sicher, die Ehrwürdigkeit und Qualität suggerieren sollte, wovon er aber nichts bemerkt hatte, als er die Schule besichtigte. Er hatte seine Absage über ein weit weniger prestigeträchtiges Droidenrelais geschickt und verspürte keinerlei Bedauern darüber, trotz Yasminas Tränen. Solange er atmete, würde sein kleines Mädchen auf keinen Fall eine Schule am anderen Ende der Galaxie besuchen.
Unbarmherzig knüllte er den Brief wieder zusammen und stand auf, um ihn in die Verbrennungsanlage zu werfen, da hörte er ein Klopfen an der Tür.
Der Mann erstarrte. Er erwartete keinen Besuch, und so weit draußen kam niemand einfach mal so vorbei. Noch beunruhigender war, dass der Näherungsalarm nicht angeschlagen hatte. Dabei hatte er überall um die Farm Sensoren aufgestellt. Wer immer das war, musste aus der Luft gekommen sein, aber er hatte auch kein Schiff landen gehört.
Das Klopfen ertönte erneut, lauter diesmal, und der Mann handelte. Er nahm seine ehemalige Dienstpistole von der Ablage über dem gemauerten Kamin und lud das Magazin mit Betäubungsmunition aus der Schachtel auf dem Sims. Dann verbarg er die Pistole hinter seinem Rücken und öffnete die schwere Eingangstür einen Spaltbreit. Draußen standen zwei Fremde, eine Frau und ein Mädchen.
Der Mann zögerte. Die Frau war mittleren Alters und eindeutig eine hochrangige Offizierin. Niemand sonst konnte so gefährlich aussehen, indem er einfach nur dastand.
Ganz anders das Mädchen. Die Kleine konnte nicht älter als sechzehn sein und war viel zu dünn, das dunkelbraune Haar war auf Höhe der hochgezogenen Schultern waagrecht abgeschnitten, doch was ihn noch weit mehr beunruhigte als ihre Magerkeit, waren die Augen. Der Blick des Mädchens war glasig und leer, als stünde es unter Drogen. Der Mann verstärkte den Griff um die Pistole hinter seinem Rücken. »Kann ich Ihnen irgendwie …«
Er hatte die Worte noch nicht zu Ende gesprochen, da packte ihn die Frau. Die Bewegung war so schnell, dass ihm keine Zeit zum Nachdenken blieb, aber er war selbst viele Jahre Soldat gewesen und brauchte nicht erst nachzudenken. Noch bevor ihre Finger sich um sein Handgelenk schlossen, riss er die Pistole hoch, um der Fremden ins Bein zu schießen, doch noch während er die Waffe hob, ging eine zweite Hand dazwischen.
Der Griff war so fest, dass er glaubte, es wäre die Frau, doch ein kurzer Blick zeigte ihm, dass er sich getäuscht hatte. Es war das Mädchen. Das eigenartige Mädchen mit dem ausdruckslosen Gesicht hielt seinen Unterarm gepackt wie ein Schraubstock, und während seine Finger sich in sein Fleisch gruben, hörte er ein Wort in seinem Geist.
Schlaf.
Der Befehl senkte sich auf ihn herab wie Blei. Von einem Moment auf den anderen sackte er in sich zusammen, die Pistole fiel klappernd zu Boden. Einen Sekundenbruchteil, bevor seine Schulter auf die Dielen schlug, hatte er schon das Bewusstsein verloren.
Der Mann wachte mit einem Schnauben auf. Er saß in seinem Stuhl und starrte durch das dunkle Fenster nach draußen. Er blinzelte benommen und rieb sich das Gesicht, dann warf er einen Blick auf die Uhr. Es war fast neun. Er musste eingeschlafen sein.
Der Mann stand auf, reckte die steifen Glieder und ging zur Tür. Er hatte das vage Gefühl, dass jemand hier gewesen war, aber das Haus lag vollkommen still, der Riegel an der Tür war vorgeschoben wie immer. Er schüttelte den Kopf über seine verflixte Paranoia, dann blickte er den Flur entlang zum Zimmer seiner Tochter. Ihr Streit lag mittlerweile Stunden zurück, aber der Anblick der verschlossenen Tür tat immer noch weh.
Mit einem niedergeschlagenen Seufzen machte er sich auf den Weg über den Flur. Er wusste, er gab nach, war zu weich, aber Yasmina war der einzige Mensch, den er noch hatte. Zum Glück drang noch Licht durch den Türspalt, also klopfte er leise. Als sie nicht reagierte, lehnte er sich gegen das kühle, lackierte Holz.
»Yasmina«, sagte er leise. »Es tut mir leid. Ich weiß, wie einsam du dich hier draußen fühlst, aber du musst verstehen, dass wir hergekommen sind, damit du in Sicherheit bist. Ich hätte dich fragen sollen wegen der Schule, bevor ich das Angebot ablehnte, aber ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dich gehen zu lassen.« Er sprach immer schneller, und seine Stimme begann zu zittern. »Jetzt, da Mama nicht mehr da ist, bist du alles, was ich noch habe. Wenn dir irgendetwas zustößt, würde ich das ganze Universum kurz und klein schlagen.«
Er verstummte und hielt den Atem an, aber von drinnen kam kein Laut. Er runzelte die Stirn und klopfte noch einmal. »Yasmina?«
Keine Antwort. Von plötzlichem Zorn gepackt, drückte er die Tür auf. »Yasmina! Ich weiß, du bist sauer auf mich, aber du antwortest mir gefälligst, wenn ich …«
Er erstarrte. Das Zimmer seiner Tochter sah aus wie immer, unaufgeräumt, die Wände über und über mit Postern von Orten bedeckt, die sie besuchen wollte, aber es war niemand da. Das Zimmer war leer.
Yasmina war fort.
Das war alles, was er sah, bevor er durch das Haus nach draußen in die Nacht stürmte und ihren Namen in den kalten Wind brüllte, der über die kahlen Felder fegte.
Yasmina machte sich so klein wie möglich, zog die Schultern hoch und presste die gefesselten Hände an den Rücken. Die fremde Frau ging direkt neben ihr und zerrte sie mit. Der andere Fremde, ein groß gewachsener Mann in einem dunklen Anzug, ging mit dem Mädchen ein ganzes Stück hinter ihnen, und das war gut so. Die Erwachsenen machten Yasmina Angst, aber das war normal. Ihr Vater machte ihr auch manchmal Angst, wenn er mit seiner Pistole herumfuchtelte, aber dieses Mädchen … Ihre glasigen Augen und der leere Gesichtsausdruck erfüllten Yasmina mit einer tiefen Furcht, die sie sich nicht erklären konnte. Manchmal hatte sie das Gefühl, als wäre der Körper des Mädchens nur eine leere Hülle. Als wäre das seltsame stumme Wesen gar kein Mensch.
Vor zwei Tagen hatten die Fremden sie entführt. Seither ließ man sie nicht einen Moment aus den Augen, nicht einmal zur Toilette durfte sie allein. Der Mann und die Frau behandelten sie wie ein Gepäckstück und weigerten sich, ihr zu sagen, wer sie waren und weshalb sie sie mitgenommen hatten. Das Mädchen mit den glasigen Augen schien Yasminas Anwesenheit überhaupt nicht zu registrieren. Sie saß einfach in ihrem Stuhl, während sie einen Hyperraumsprung nach dem anderen machten, und spielte Schach, als wäre es für sie das Einzige im Leben, was zählte.
Als sie die riesige schwarze Raumstation erreichten, spürte Yasmina ihren eigenen Schrecken nicht mehr. Sie weinte nicht einmal, als man sie wie eine Gefangene in den Hangar brachte. Stattdessen versuchte sie, sich auf ihre Umgebung zu konzentrieren, suchte nach irgendeinem Hinweis auf ihren Aufenthaltsort, damit sie ihren Vater wissen lassen konnte, wo sie war. Aber die Station war vollkommen kahl. Keine Abzeichen oder Embleme an den Wänden, nicht einmal Richtungsweiser gab es. Die Station war ein einziges Labyrinth aus Gängen, in dem der fremde Mann und die Frau sich zurechtfanden, als hätten sie ihr gesamtes Leben hier verbracht. Die nackten Korridore waren derart trostlos, dass Yasmina bereits alle Hoffnung aufgegeben hatte, als ihre Häscher sie durch eine schwere Stahltür in einen großen, fensterlosen Raum führten, der aussah wie ein Labor. Es waren Leute hier. Sie waren die ersten anderen Menschen, die Yasmina seit ihrer Entführung zu Gesicht bekam.
Es waren zwei Männer, beide schon älter und tief in ein Gespräch versunken. Der eine, ein ernst dreinschauender Mann mit weißem Bart und grauem Haar, trug Uniform und Stiefel eines Offiziers, aber Yasmina konnte nirgendwo Abzeichen entdecken. Die Uniform hatte sie noch nie zuvor gesehen. Ganz anders sein Gegenüber: Der Kerl sah aus wie ein Raumfahrer, abgetragene lederne Fliegerweste, Pilotenstiefel und eine schwere Pistole am Gürtel.
Als sie eintraten, blickten beide auf, und Yasmina ergriff ihre Chance. Da der Pilot ihr wahrscheinlich nicht helfen konnte, stürzte sie sich auf den Mann in der Offiziersuniform. Auf dem Schiff war Yasmina so folgsam gewesen, dass ihre Wächter nicht vorbereitet waren und sie mehrere Schritte weit kam, bevor man sie wieder einfing.
»Helfen Sie mir!«, schrie sie den Offizier an, während die Frau sie schon wieder nach hinten zog. »Mein Vater ist ein sehr wichtiger Mann! Er wird …«
Jemand schob ihr einen Knebel in den Mund, und Yasmina verstummte. Sie versuchte zu schreien, aber es war zwecklos. Die Frau machte den Knebel nur noch fester, hob Yasmina mit einer Hand hoch und klemmte sie sich unter den Arm wie ein ungezogenes Kind. Yasmina brüllte gegen das Stück Stoff in ihrem Mund an, bis ihre Kehle wund war, trat und wehrte sich genauso heftig, wie sie sich vor zwei Tagen gegen ihre Entführung gewehrt hatte. Sie versuchte sogar, Plasmex einzusetzen, und stieß mit aller Kraft nach der Frau, doch die schien es nicht einmal zu bemerken. Tränen strömten Yasmina übers Gesicht. Hätte ihr Vater sie die Schule besuchen lassen, wäre sie jetzt nicht so schwach und hilflos. Sie wäre überhaupt nicht hier.
Der Gedanke machte ihre Verzweiflung nur noch schlimmer. »Papa«, schluchzte sie in den Knebel. Ihr Vater hatte auf dem Boden gelegen, als ihre Entführer sie aus dem Haus zerrten. Er hatte um sie gekämpft, das wusste sie, und doch nichts ausrichten können. Yasmina hatte ihren Vater immer für unbesiegbar gehalten. Aber wenn diese Leute ihn besiegt hatten, welche Hoffnung gab es dann noch?
»Sehen Sie jetzt, was ich meine?«
Yasmina schluckte ihre Tränen hinunter und blickte auf. Die beiden Männer, die gerade noch miteinander gesprochen hatten, gingen nun auf sie zu. Die Frau salutierte und stellte Yasmina wieder auf die Füße, hielt sie aber mit beiden Händen an den Schultern fest.
Yasmina wusste, dass sie gegen diesen eisernen Griff nichts ausrichten konnte, aber sie weigerte sich, klein beizugeben, und schaute die Männer trotzig an. Die beiden erwiderten ihren Blick mitleidig.
»Sie ist labil«, sagte der Offizier. »Wehrt sich gegen jeden äußeren Einfluss. Auf dem Weg hierher konnten Sie sie nicht einmal zum Schlafen bringen.« Seine Stirn legte sich in tiefe Falten, dann wanderte sein Blick weiter zu dem Raumfahrer. »Sie sind der Experte auf diesem Gebiet, Caldswell, aber sie wird Ihnen da draußen nur Ärger machen.«
»Keine Sorge«, erwiderte der Mann namens Caldswell. »Dafür habe ich schließlich die Narr, nicht wahr?«
»Ach, natürlich«, antwortete der Offizier und schaute wieder Yasmina an. »Ihr kleines Experiment.«
»Mein erfolgreiches Experiment«, berichtigte Caldswell ohne jede Selbstgefälligkeit, als spreche er lediglich eine nüchterne Tatsache aus. »Die Zahlen beweisen es. In der Gesellschaft der Mannschaft bleiben meine Töchter doppelt so lange stabil wie bei der üblichen Methode. Ren hat beinahe fünf Jahre durchgehalten. Das ist Rekord.«
Der Mann in der Offiziersuniform wirkte nicht überzeugt, doch Yasmina beachtete ihn gar nicht mehr, denn Caldswell stand nun direkt vor ihr. Er war nicht sonderlich groß, aber breit gebaut und bullig, das kurze, rötlich-braune Haar verfärbte sich an den Schläfen bereits silbrig, genau wie bei ihrem Vater. Außerdem lächelte er sie genauso an wie ihr Vater. Keiner der anderen hatte das auch nur ein einziges Mal getan. Aber sein Lächeln war so traurig, dass Yasmina wünschte, er würde aufhören. Sie wollte nicht wissen, warum er sie so traurig anschaute.
»Hallo«, sagte er leise. »Ich bin Brian Caldswell, und es tut mir unendlich leid, dass dir all das passiert. Ich bin sicher, du hasst uns, aber du sollst wissen, dass das, was du tust, dich zur Heldin macht, auch wenn es nicht deine freie Entscheidung war.« Er streckte die Hand und drückte mit schwieligen Fingern sanft ihren Arm. »Danke. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Opfer nicht umsonst ist, das schwöre ich.«
Als Caldswell geendet hatte, runzelte der Offizier die Stirn. »Ich wünschte, Sie würden damit aufhören«, sagte er kalt. »Uns andere demoralisiert es, und sie wird sich nicht mehr daran erinnern.«
»Trotzdem verdient sie, es zu hören«, erwiderte Caldswell.
Der Blick des Offiziers wurde noch finsterer. »Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie es nicht einmal überleben. Die Übereinstimmung beträgt lediglich achtundneunzig Prozent. Erst gestern hat Maat eine mit neunundneunzig Prozent einfach verschlungen.«
Yasmina begann erneut zu wimmern, aber Caldswell schüttelte den Kopf. »Sie wird es schaffen. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihr. Schickt sie rein, dann werden wir es ja sehen.«
Der Offizier stieß einen langen, gequälten Seufzer aus und machte ein Zeichen mit der Hand. Eine Sekunde später stieß Yasminas Bewacherin sie so heftig an, dass sie beinahe hingefallen wäre, dann wurde Yasmina auf eine Tür am gegenüberliegenden Ende des Raums zugeschoben.
Die Tür war kleiner als die, durch die sie gekommen waren, aber schwer gepanzert und von einem dicken, schimmernden Schild umgeben, wie die Banken sie in ihren Tresorkellern verwendeten. Als Yasmina die Tür sah, begann sie sich so heftig zu wehren wie noch nie. Nach Caldswells geheimnisvollen Worten wollte sie nichts mit dem zu tun haben, was in diesem Raum war, aber wie zuvor war jede Gegenwehr zwecklos. Die Frau zerrte Yasmina hinter sich her wie ein kleines, ungezogenes Hündchen. Als sie die Tür erreichten, verschwand der Schild, der schwere Stahl hob sich mit einem leisen Zischen, und dahinter kam etwas zum Vorschein, das aussah wie eine weiß gekachelte Toilette. Das war alles, was Yasmina erkennen konnte, bevor die Frau ihr den Knebel aus dem Mund riss und sie vorwärts schubste.
Yasmina taumelte durch die Tür, stolperte über den Rahmen und konnte sich gerade noch rechtzeitig mit den Händen abstützen, um nicht mit dem Gesicht auf den Boden zu schlagen. Das überraschte sie, denn noch vor wenigen Momenten waren ihre Arme auf dem Rücken gefesselt gewesen. Offensichtlich hatte die Frau ihr auch die Handschellen abgenommen, ohne dass sie es bemerkt hatte. Zum ersten Mal seit ihrer Entführung war Yasmina frei, doch ihr blieb keine Zeit, etwas mit ihrer neuen Freiheit anzufangen; die Tür in ihrem Rücken senkte sich bereits wieder und sperrte sie in die weiße Kammer.
Yasmina wirbelte herum und hämmerte mit den Fäusten gegen das Metall, doch ihre Schläge machten nicht das kleinste Geräusch, und sie sank schluchzend auf die Knie. Sie wollte zu ihrem Papa, sie wollte nach Hause. Nie wieder würde sie sich beklagen, weil sie so abgeschieden auf dem Land lebten, wenn sie nur wieder hier rauskam.
Fünf Minuten später schluchzte Yasmina immer noch, da hörte sie ein leises Rumpeln. Yasmina riss den Kopf hoch und hielt Ausschau nach dem Schrecken, der sie als Nächstes erwarten mochte, konnte aber nichts erkennen außer konturlosem Weiß. Doch sie spürte die Vibrationen im Boden. Etwas war im Gange.
Sie stand auf, drehte sich mit dem Rücken zur Tür. Sie versuchte gerade herauszufinden, ob das Geräusch vom Boden kam oder von der Decke, da hörte es plötzlich auf. Eine Sekunde lang war alles still, dann glitt die Wand ihr gegenüber zur Seite.
Der Anblick war so eigenartig, dass Yasmina mehrere Momente brauchte, bis sie begriff, dass es sich bei dem Gewirr aus Metallstangen und Gelenken, das dahinter zum Vorschein kam, um eine Art bewegliche Plattform handelte. Das Rumpeln, das sie gehört hatte, war von dem Gestell ausgegangen. Es hatte sich bewegt. Das Metall glänzte wie medizinisches Gerät in einem Operationssaal, was nur passend war, denn in der Mitte der Konstruktion befand sich ein Mensch.
Etwas, das aussah wie ein Krankenhausbett, stand senkrecht in der Mitte der Plattform. Der Mensch darin wurde von Gurten gehalten, damit er nicht herausfiel, so viele Gurte, dass Yasmina nicht einmal erkennen konnte, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Nur der Kopf war nicht von Gurten bedeckt, sondern von einer Maske aus glänzendem Metall. Sie reichte von knapp oberhalb der Schultern über den Hals bis hinauf zum Scheitel und umschloss den gesamten Schädel. Die Maske war vollkommen glatt, kein Sehschlitz, ja nicht einmal eine Atemöffnung. Allein vom Anblick wurde Yasmina übel, aber sie beherrschte sich, da riss die Gestalt abrupt den Kopf hoch und schaute sie an.
Yasmina schrie auf vor blankem Entsetzen. Sie warf sich gegen die Tür und kratzte verzweifelt über das kalte Metall. »Lasst mich raus! Lasst mich raus!«
Niemand reagierte. In ihrem Rücken ertönte ein Klicken wie von einem aufspringenden Schloss, dann das Krachen, mit dem die Maske auf den harten Kunststoffboden fiel. Das Geräusch war so laut, dass Yasmina sich beinahe umgedreht hätte, aber ihr Verstand schritt gerade noch rechtzeitig ein. Sie wollte nicht wissen, was unter dieser Maske steckte. Wollte nicht sehen …
Was sehen?
Yasmina hielt inne. Die Stimme sprach sehr leise, aber trotz ihrer Panik hatte Yasmina sie deutlich gehört. Denn sie war in ihrem Kopf. Gleichzeitig spürte sie eine sanfte Berührung auf der Wange, beinahe wie von einer zärtlichen Hand.
Hab keine Angst.
Die Stimme war so weich, so traurig und voller Ernst, dass Yasmina aufhörte zu weinen und sich umdrehte. Was sie dann sah, brachte ihr Herz fast zum Stillstand. Direkt gegenüber, an das Gestell gefesselt wie eine Mumie, war das Mädchen, das Yasmina hierherbegleitet hatte. Nein, das stimmte nicht. Das Mädchen sah genauso aus, hatte die gleichen feinen Gesichtszüge, die gleiche olivbraune Haut und das gleiche, auf Schulterhöhe abgeschnittene dunkle Haar, doch während das Mädchen auf dem Schiff wie eine leere Hülle gewesen war, schien dieses hier kurz vorm Bersten.
»Wer bist du?«, fragte Yasmina mit zitternder Stimme.
Das gefesselte Mädchen warf ihr einen traurigen Blick zu. Armes kleines Häschen, ich bin dein Tod.
Die Worte waren so nüchtern und sachlich, dass Yasmina einige Sekunden brauchte, um die Bedeutung zu begreifen. Und als es so weit war, presste sie sich so flach gegen die Tür in ihrem Rücken, dass sie kaum noch Luft bekam.
Die Gefesselte beobachtete sie nur mitleidig. Jetzt.
Yasmina reckte den Hals und schaute in alle Richtungen, aber es war niemand in der Kammer außer ihnen beiden. Da hörte sie ein Heulen von irgendwo hinter diesen Wänden, ein hohes Summen wie von einer riesigen Maschine, die hochgefahren wurde.
»Was ist das?«, kreischte sie und starrte das Mädchen an. Der Lärm wurde immer lauter, das Heulen höher und noch höher. »Mach, dass es aufhört!«
Das Mädchen begann zu lachen, ein schreckliches, verrücktes Lachen, das Yasmina das Blut in den Adern gefrieren ließ. Das kann ich nicht. Der Mund des Mädchens verzog sich zu einem Grinsen, und Yasmina wurde von nackter Panik gepackt. In ihrem ganzen Leben, die letzten beiden Tage mit eingeschlossen, hatte sie noch nie etwas so Grässliches gesehen wie dieses wahnsinnige, hoffnungslose Grinsen. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Als Yasmina den Mund zu einem Schrei öffnete, erreichte das Heulen den Höhepunkt. Eine schreckliche Sekunde lang erfüllte das Geräusch die gesamte Kammer, als würde direkt neben ihrem Ohr eine Alarmsirene heulen, dann hörte es abrupt auf, und das Mädchen begann von Krämpfen gepackt zu zucken. Sie zerrte an ihren Gurten und öffnete den Mund zu einem markerschütternden Brüllen, aber es kam kein Laut aus ihrer Kehle, nicht einmal ein Krächzen. Ihr Gesicht verzerrte sich in Höllenqualen, die braunen Augen traten hervor, sodass Yasmina trotz ihrer Furcht mit einem Mal Mitleid empfand. Noch bevor sie wusste, was sie tat, ging sie auf das Mädchen zu und streckte die Arme, um ihm irgendwie zu helfen.
Sie hatte kaum einen Schritt gemacht, da spürte sie die Hand an ihrem Rücken.
Es war ein höchst absonderliches Gefühl, als würde die unsichtbare Berührung, die sie vor nur wenigen Augenblicken auf der Wange gespürt hatte, nun unter ihre Haut greifen und ihre Wirbel umfassen. Fünf Sekunden lang stand Yasmina wie erstarrt da und versuchte das Gefühl zu verstehen, dass eine Hand sie an einer Stelle berührte, die noch nie berührt worden war. Dann fuhren die Finger ihre Wirbelsäule entlang nach oben und schlangen sich um ihr Gehirn.
Die Zuckungen des Mädchens auf der anderen Seite des Raums hörten schlagartig auf, doch Yasmina bekam es gar nicht mit. Ihre gesamte Welt bestand nur noch aus diesen Fingern, die sich um ihr Gehirn legten. Yasminas Schrei zerriss die Stille, dann drückte die Hand zu.
Brian Caldswell stand wenige Zentimeter vor der gepanzerten Tür zur Umwandlungskammer und lauschte. Das Mädchen war nun seit etwas über einer Stunde da drinnen. Laut den Vorschriften durfte er erst nachsehen, wenn die Prozedur abgeschlossen war, aber es sah nicht gut aus. Seiner Erfahrung nach kamen die Mädchen nicht mehr heraus, wenn es länger als eine Stunde dauerte. Er wollte Truppführer Martin schon zu sich rufen, um über das nächste Mädchen auf der Kandidatinnenliste zu sprechen, als der Alarm ertönte.
Seine Hand schnellte nach vorn und drückte den Knopf, der die Rückwand der Kammer wieder verriegelte. Er hörte, wie Maats Schluchzer hinter dem dicken Metall verhallten, als die Medikamente sie zurück in den Schlaf zwangen. Das Schluchzen war ein gutes Zeichen. Normalerweise lachte Maat, wenn die Mädchen starben.
Die beiden Detektive hinter ihm, die das Mädchen hergebracht hatten, musterten ihn nervös. Caldswell ignorierte sie und wartete, bis sich endlich die Panzertür vor ihm hob.
Das Mädchen, das nun vor ihm stand, hatte nichts mehr mit dem gemein, das die Kammer vor einer Stunde betreten hatte. Die Zwölfjährige, die die Detektive hergebracht hatten, hatte gebräunte Haut gehabt, sie war groß gewesen für ihr Alter, das Gesicht von dickem, gewelltem Haar umrahmt. Das Mädchen, das nun vor ihm stand, war einen Kopf kleiner, hatte olivfarbene Haut und glattes schwarzes Haar, das exakt bis zu den Schultern reichte, außerdem sanfte, braune Augen wie alle von Maats Töchtern.
Caldswell ergriff sofort ihre Hand. Bei einer gerade erst erschaffenen Tochter musste er schnell sein, damit sie ihm gehorchten. Trotz Truppführer Martins Bedenken, dass sie nur Ärger machen würde, nahm die neue Tochter die Berührung demütig hin und ließ sich von ihm vorwärtsziehen, bis sie einander direkt gegenüberstanden. Dann beugte er sich hinunter und blickte ihr unverwandt in die leeren Augen.
»Mein Name ist Brian Caldswell«, sagte er mit fester Stimme. »Du bist meine Tochter, Ren Caldswell. Sag Guten Tag.«
»Guten Tag«, flüsterte das Mädchen, seine Stimme kaum mehr als ein Hauch.
Caldswell nickte und nahm auch noch die andere Hand hinzu, klemmte die zarten Finger des Mädchens regelrecht zwischen seinen ein. »Uns stehen bittere Aufgaben bevor, Ren«, sagte er leise. »Aber ich werde die ganze Zeit an deiner Seite sein. Ich werde mich bis zum Ende um dich kümmern, und wenn es so weit ist, werde ich es selbst tun. Das verspreche ich.«
Das Mädchen reagierte nicht, aber das taten sie nie. Caldswell drehte sich seufzend um und bedeutete ihr, ihm zu folgen. Ren gehorchte stumm und trottete, ohne ihre Umgebung wahrzunehmen, durch die leeren Korridore der Raumstation Dunkelsternhinter ihm her zu dem Dock, wo das kleine Shuttle darauf wartete, sie zurück zur Glorreicher Narr zu bringen.
Hinter ihnen, eingesperrt von dem ausgeklügeltsten Sicherheitssystem im gesamten Universum, gehalten von Fesseln, die stark genug waren, um selbst einen wütenden Symbionten im Zaum zu halten, gingen Maats stumme Schluchzer weiter, weiter und immer weiter.
1
Drei Jahre später.
Wenn mich jemand gefragt hätte, wie ich dazu kam, in einer glühend heißen Wüste auf einer halb fertigen terranischen Kolonie zu stehen und mit einem Anfall von Sentimentalität zu kämpfen, während ich einen Totenschädel beerdigte, hätte ich nicht recht gewusst, was ich antworten sollte.
In der Tat wusste ich in diesem Moment auf eine Menge Dinge keine rechte Antwort. Zum Beispiel darauf, wie ich mir beide Arme gebrochen und mir die schweren inneren Verletzungen zugezogen hatte, die Hyrek gerade erst für weit genug verheilt erklärt hatte, dass ich wieder aufstehen durfte. Ich wusste weder, wer unser Schiff auf diesem kahlen Felsen mitten im Nirgendwo angegriffen hatte, noch warum. Ich konnte nicht einmal mit Sicherheit sagen, weshalb ich meinen Helm abgenommen hatte, sodass ich diesen Schlag auf dem Kopf abbekam, der die Ursache für all dieses Nicht-Wissen war. Trotzdem, es hätte schlimmer sein können. Immerhin war ich diejenige, die das Grab schaufelte, nicht die, die hineingelegt wurde.
Cotter hätte sofort mit mir getauscht, auch wenn er sich bestimmt über die harte Arbeit mit einer geliehenen Spitzhacke beklagt hätte. Totenschädel beklagten sich ständig.
Ich wusste, ich konnte mich glücklich schätzen, noch am Leben zu sein, trotzdem hatte ich nur einen Gedanken, während ich unter der sengend heißen Sonne und vom sandigen Wind malträtiert ein Loch in den felsigen gelben Boden schlug: Irgendetwas war hier falsch.
Totenschädel oder nicht, Cotters zerstörte Rüstung und das leer geschossene Magazin bewiesen, dass er wie ein echter Paradoxier gestorben war und dem Feind bis zum letzten Moment getrotzt hatte. Er hatte etwas Besseres verdient als ein namenloses Grab in einer Einöde, ausgehoben von einer Frau, die sich an nichts erinnerte.
Leider war ein namenloses Grab alles, was ich ihm bieten konnte, und selbst dafür hatte ich mit allen Mitteln kämpfen müssen. Caldswell hatte es kaum erwarten können, hier wegzukommen. Wäre es nach ihm gegangen, wären wir schon seit zwei Tagen wieder im Weltraum. Allerdings war die Narr so zerschossen gewesen, dass Mabel bis jetzt gebraucht hatte, um sie wieder flugtauglich zu machen. Nur wegen dieser Verzögerung hatte ich überhaupt herausgefunden, dass der Kapitän Cotters Leiche der Terraformingzentrale überlassen wollte – zur Entsorgung wie ein Stück Abfall.
Als ich es erfuhr, ging ich derart in die Luft, dass sich meine Wunde beinahe wieder geöffnet hätte. Normalerweise kümmerte den Kapitän meine Meinung nicht sonderlich, aber er schien nicht auch noch seinen zweiten Sicherheitsbegleiter verlieren zu wollen, also gab er nach. Zehn Minuten später stapfte ich mit einer geliehenen Spitzhacke auf der einen Schulter und Cotters Leiche auf der anderen hinaus in die Wüste. Schon nach wenigen Minuten fand ich eine geeignete Stelle mit einem schönen Ausblick, aber das Graben dauerte weit länger als gedacht. Die Spitzhacke war nicht für Rüstungen gemacht, und Cotter war ein Riese von einem Kerl. Bis ich sie so weit aufgeschlagen hatte, dass er durch die Öffnung passte, hatte ich Caldswells Frist schon um dreißig Minuten überschritten.
Mir war es egal. Ich mochte keine Priesterin sein, aber ich war seit neun Jahren Panzersöldnerin und hatte schon viele meiner Kameraden beerdigt. Für mich gehörte es zur Berufsehre, diese Aufgabe ordentlich zu erfüllen. Also ließ ich mir Zeit und richtete Cotters Füße mithilfe einer Sternenkarte exakt auf Paradox aus, damit er bereit wäre, wenn der König ihn rief. Außerdem packte ich eine ordentliche Menge Salz in jede seiner Hände – Trinkgeld für den Fährmann, der seine Seele zum Krieger-Himmelstor geleiten würde. Schließlich wickelte ich ihn in ein weißes Tuch und streckte mich nach der Whisky-Flasche, die ich aus der Küche gestohlen und neben dem Grab abgestellt hatte.
Ich schraubte den Deckel ab, klappte mein Visier hoch und trank zügig, bevor zu viel von der dünnen, staubig-heißen Atmosphäre auf Falke 34 in meinen Anzug gelangte.
Der Whisky begann bereits, in der trockenen Hitze zu verdunsten, während ich den Rest über Cotters Leichentuch ausgoss und die alten Gebete sprach, mit denen die Gebeine der Gefallenen standesgemäß der Erde überantwortet wurden. Bei dem Teil, in dem von sanften grünen Hügeln und rauschenden Flüssen die Rede war, zögerte ich kurz, dann sagte ich mir, dass es auf Falke 34 auch das geben würde, wenn das Terraforming abgeschlossen war. Somit waren die letzten Worte, die ich je zu Cotter sprechen würde, wenigstens nicht gelogen.
Als der Whisky alle war, stellte ich die leere Flasche zu seinen Füßen ab und kletterte aus dem Grab. Die Erd- und Gesteinsbrocken zurück in die Grube zu werfen ging viel schneller, als sie herauszubrechen, und sie bildeten einen angemessen großen Hügel für meinen toten Partner. Ein großes Grab für einen großen Mann. Hätte ihm bestimmt gefallen. Schließlich beschwerte ich den Hügel mit ein paar kleineren Felsbrocken, damit der Wind nicht alles davonwehte, dann machte ich mich auf den Rückweg zum Schiff.
Die Narr war nie ein beeindruckender Anblick gewesen, aber im Moment sah sie ganz besonders erbärmlich aus. Wer auch immer für den letzten Angriff verantwortlich war, hatte ganze Arbeit geleistet. Die Nase der Narr war beinahe vollständig weggesprengt, die dahinterliegende Brücke so stark beschädigt, dass eine Reparatur unmöglich war. Eine weitere, noch stärkere Explosion hatte die Seitenwand des Frachtdecks auf- und die nagelneue Ladeluke komplett herausgerissen. Mabel hatte die zahllosen Löcher in der Außenhülle mit Plasmaflicken verschlossen, sodass der Rumpf unseres Raumfahrzeugs zu großen Teilen aus gehärtetem Plasma bestand statt aus Metall. Die Narr sah aus wie ein von weißlich schimmernden Sechsecken überzogenes unförmiges Etwas.
So schlimm die Außenhülle auch zugerichtet war, drinnen sah es noch schlimmer aus. Schon vor dem Überfall hatte die Narr zahlreiche Einschusslöcher vorzuweisen gehabt, aber nun war das obere Stockwerk auch noch schwarz vom Ruß der Granateinschläge, und im Boden steckten so viele Kugeln, dass ich in meinen Stiefeln das Gefühl hatte, auf Kies zu laufen. Der erste Preis ging allerdings eindeutig an die Mannschaftsmesse mit ihren völlig verbeulten Wänden und dem mannsgroßen Loch in der Sprengschutztür. Ich hatte keine Ahnung, welche Waffe so etwas anrichten konnte, auch wenn ich es eigentlich hätte wissen müssen, denn immerhin war es mein Blut, das den großen roten Fleck auf dem Boden hinterlassen hatte. Was immer hier passiert war, ich hatte es mit angesehen, aber ich konnte mich an absolut nichts erinnern, und da es keine Videoaufnahmen gab, konnte ich meinem Gedächtnis auch nicht auf die Sprünge helfen.
Man konnte meinen, auf einem Schiff, das mit so vielen Kameras ausgestattet war, hätte irgendwelches Beweismaterial überleben müssen, aber die Explosion, die die Brücke in Schutt und Asche gelegt hatte, hatte auch die Aufnahmen vernichtet. Alle. Den Kameras in meinem Kampfanzug war es nicht besser ergangen. Was auch immer während des Überfalls passiert war, hatte mich aus meiner Rüstung herausgeschält und alle Aufzeichnungen zerstört. Selbst das Letztwortschloss und die Söldnerversicherung waren gelöscht, was ohne meine aktive Mithilfe vollkommen unmöglich war, doch ich weigerte mich, eine Kollaboration mit dem Feind als Erklärungsmöglichkeit auch nur in Betracht zu ziehen.
All diese Gedanken verdarben mir gehörig die Laune, weshalb ich froh war, dass mir keine Zeit zum Nachgrübeln blieb. Ich war bereits fünfundvierzig Minuten zu spät, und Caldswell schien schon mit der Hand am Startknopf gewartet zu haben, denn die Triebwerke heulten los, kaum dass ich an Bord war. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig zu den Haltegriffen im Frachtraum, da hob die Narr auch schon ab und ließ die karge Oberfläche von Falke 34 hinter sich. Hoffentlich für immer.
Da die Brücke zu nichts mehr zu gebrauchen war, mussten Caldswell, Nova und Basil das Schiff vom Maschinenraum aus steuern. Dort drinnen war es auch so schon eng genug, weshalb der Kapitän, statt mich zu ihm zu zitieren, zu mir in den Frachtraum kam, als wir den Orbit erreichten.
»Sie haben sich viel Zeit gelassen, Morris.«
Das geschlossene Visier verbarg mein Gesicht, und ich verdrehte die Augen. Der gute alte Caldswell war nie um ein paar mitfühlende Worte verlegen. »Ich habe die Angelegenheit anständig erledigt, Sir.«
Der Kapitän nickte knapp, dann musterte er mich von oben bis unten. »Sind Sie schon so weit, den Dienst wieder aufzunehmen?«
»Ja, Sir.« Hyrek hatte mir zwar noch kein offizielles Okay gegeben, aber wenn ich gesund genug war, ein Grab auszuheben, sollte ich erst recht in der Lage sein, hier auf dem Schiff im Kreis zu laufen.
»Wir erreichen das Hyperraumtor erst in drei Tagen«, warnte mich Caldswell. »Der Flug dorthin könnte ungemütlich werden.«
Ich zuckte die Achseln. »Gibt es sonst noch was Neues?«
Der Kapitän lachte tatsächlich über meine Bemerkung. »Gut, machen Sie sich nützlich. Wir haben eine lange Nacht vor uns.«
»Ja, Sir«, erwiderte ich und lief im Trab zu Mabel, die bereits den Plasmasprüher warmlaufen ließ, um alles wieder zu befestigen, was sich während des Starts gelöst hatte.
In der Rückschau hätte ich die Dinge nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollen. In meiner Laufbahn hatte ich schon einige Scheißschichten absolviert und glaubte zu wissen, was mich erwartete, aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was mir als die schlimmsten drei Tage meines Lebens in Erinnerung bleiben sollten.
Es fing mit den Flicken an. Gehärtetes Plasma ist nur ein provisorisches Dichtmaterial, kein ordentliches Ersatzteil für einen Schiffsrumpf. Wir hatten den Orbit von Falke 34 kaum verlassen, da bekamen die Flicken, die das Schiff überhaupt raumtauglich machten, schon die ersten Risse. Da Mabel den schweren Plasmasprüher nicht tragen konnte, blieb diese Aufgabe mir überlassen. Wie ein selbstfahrender, sprechender Gerätewagen folgte ich ihr durch das gesamte Schiff. Eigentlich war diese Arbeit unter meiner Würde, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, wegen der ständig größer werdenden Risse in der schützenden dünnen Plasmaschicht nicht in Panik auszubrechen, um mir Sorgen wegen meines Images zu machen.
Die Risse waren allerdings nicht das einzige Problem. So zusammengeflickt, wie die Narr war, würde jeder Idiot, der einen Dichtescanner bedienen konnte, sofort das Ausmaß der Beschädigungen erkennen, und ein beschädigter Frachter ist für Raumpiraten so etwas wie eine verwundete Robbe für einen Hai. Das allein wäre noch gar nicht so schlimm gewesen, wenn wir durch einen zivilisierten Teil des Universums geflogen wären, aber der Sektor, in dem wir uns befanden, war noch nicht einmal zur Hälfte terraformt. Die Trupps, die das Gebiet erschlossen, wurden über ein einziges Sprungtor versorgt und taten nichts anderes, als teures Gerät in diesen unterentwickelten und nicht verteidigten Sektor zu schaffen. Ich hätte mir keine besseren Jagdgründe für Piraten ausdenken können, selbst wenn ich es versuchte, und wir flogen in einem kaum manövrierfähigen Handelsschiff mit nur noch einer funktionierenden Kanone und einem einzigen Sicherheitsoffizier an Bord mitten hindurch. Unsere Lage war so lächerlich aussichtlos wie die Pointe in einem schlechten Witz. Wäre der Witz nicht auf meine Kosten gegangen, hätte ich mich wahrscheinlich totgelacht.
Damit beschäftigt, mit Mabel die Flicken auszubessern und gleichzeitig nach möglichem Ärger Ausschau zu halten, bekam ich während des dreitägigen Flugs zum Sprungtor ganze fünfundvierzig Minuten Schlaf. Aber wenigstens war ich mit meinem Leid nicht allein. Bis zu dem Tag, an dem ich Mabel auf Schritt und Tritt durchs gesamte Schiff folgte, war mir nie klar gewesen, was es bedeutete, Bordingenieur auf einem fliegenden Schrotthaufen wie der Narr zu sein. Caldswells Schwägerin war überall gleichzeitig, setzte neue Flicken ein, hielt die Triebwerke am Laufen und kroch mit dem Geschick eines jungen Schimpansen durch die Wartungstunnel. Noch beeindruckender war allerdings die gute Laune, die sie dabei behielt. Während ich schon nach zwei Stunden kurz davor war, jemandem den Kopf abzureißen, beklagte Mabel sich nicht ein einziges Mal. Sie arbeitete einfach weiter und behielt Hunderte technischer Probleme derart mühelos im Blick, dass ich es schließlich nicht mehr aushielt und fragte: »Was tun Sie eigentlich hier?«
Mabel saß gerade rittlings auf einem geborstenen Träger und sprühte einen zerfetzten Kabelbaum mit Plasma ein. »Ungeschützte Kabel vertragen das All nicht«, antwortete sie. »Die Kälte würde die Isolierung …«
»Nicht hier«, verbesserte ich mich. »Ich meine, warum sind Sie überhaupt auf diesem Schiff? Ich weiß, der Kapitän gehört zu Ihrer Familie, aber Sie müssten doch jederzeit etwas Besseres bekommen können. Eine hervorragende Ingenieurin wie Sie würde überall Arbeit finden. Warum fliegen Sie immer noch mit dieser alten Mühle durchs All?«
»Ich erhielt das ein oder andere Angebot«, erwiderte Mabel gut gelaunt, »aber auf neuen Schiffen gibt es kaum was zu tun. Außerdem bin ich zu alt, um noch einmal ganz von vorne anzufangen. Brian und ich fliegen schon sehr lange zusammen. Er ist ein guter Kapitän und ein guter Mensch, der immer versucht, das Richtige zu tun. Es ist mir eine Ehre, unter ihm zu dienen.«
Ich runzelte die Stirn. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das schon einmal gehört zu haben.
»Wie dem auch sei«, fuhr Mabel fort, brachte den letzten Flicken an und sprang dann zu mir herunter. »Ohne mich würden Sie alle im Tiefraum sterben. Und jetzt kommen Sie, der Flicken über dem Triebwerksraum wird bald undicht …« Sie zog ihr abgewetztes Handset heraus. »Genauer gesagt: jetzt.«
Sie hatte kaum zu Ende gesprochen, da heulte auch schon der Alarm. Ich zuckte zusammen, da lief Mabel schon grinsend die Treppe hinauf, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als den Plasmasprüher zu schultern und ihr hinterherzustolpern.
Und so ging es Stunde um Stunde weiter. Die ständige Panik überlagerte meine Erschöpfung, aber sobald ich nur ein wenig langsamer machte, schlug die Müdigkeit umso heftiger zu. In Anbetracht der Umstände hielt ich mich aber wacker, und dann, gerade als ich glaubte, ich wäre endlich wieder in der Spur, tauchte der Koch auf.
Ich hatte ihn nur einmal kurz gesehen, als ich nach dem Angriff im Lazarett wieder aufwachte. Ehrlich gesagt war ich schockiert, dass er überhaupt noch an Bord war. Im Lazarett war der Kapitän so wütend auf ihn gewesen, dass es mich nicht überrascht hätte, wenn ich neben Cotters namenlosem Grab auf Falke 34 noch ein zweites entdeckt hätte. Aber der Koch schien lediglich Stubenarrest bekommen zu haben, denn als ich in die Mannschaftsmesse ging, um mir etwas zu essen zu holen, während Mabel den Plasmasprüher nachfüllte, stand er direkt vor mir, als wäre er nie fort gewesen.
Ich war so überrascht, dass ich ihm direkt in die Augen schaute, und das war ein Fehler. Unsere Blicke waren sich kaum begegnet, da wurde mir derart übel, dass ich buchstäblich ins Wanken geriet. Der Ekel war genauso stark wie in dem Moment direkt nach dem Aufwachen im Lazarett, eine Mischung aus heftiger Übelkeit, Abscheu und Widerwillen, als hätte ich gerade in ein verdorbenes Stück Fleisch gebissen. Ich wusste genauso wenig, woher das Gefühl kam, wie beim ersten Mal, aber was immer mit mir nicht stimmte, es wurde eindeutig nicht besser. Wenn ich den Koch auch nur verstohlen aus dem Augenwinkel betrachtete, überfiel mich diese Übelkeit, was in Anbetracht der Tatsache, wie oft ich die Mannschaftsmesse jeden Tag durchqueren musste, wirklich nervte.
Also beschloss ich, einfach nicht hinzusehen, doch egal, wie demonstrativ ich wegschaute, der Koch beobachtete mich weiter. Nicht anzüglich, und er versuchte auch nichts, wofür ich ihn hätte zur Rede stellen können, aber jedes Mal, wenn mein Blick zufällig in seine Richtung ging, merkte ich, wie er mich anschaute. Ich hätte ihn natürlich trotzdem anpfeifen können, aber gegen ungebetene Blicke gab es leider kein Gesetz, und er sagte ja nichts Ungehöriges. Er sagte überhaupt nichts, und das belastete mich noch mehr.
Die Narr war zu klein, um anderen Mannschaftsmitgliedern aus dem Weg zu gehen, und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was ich getan hatte, um den Koch so gegen mich aufzubringen. Ich konnte mich ja nicht einmal mehr an seinen Namen erinnern. Zu meinem Glück war ich so erschöpft, dass es mir bald egal war. Nach zweiundsiebzig Stunden am Rand des Nervenzusammenbruchs und im ständigen Einsatz hatte ich gerade noch genug Energie, mich ein bisschen darüber zu freuen, dass wir es lebendig zum Sprungtor geschafft hatten.
Nova und ich halfen Mabel gerade, die Flicken ein letztes Mal zu erneuern, bevor wir in den Hyperraum eintraten, als die Stimme des Kapitäns über die Sprechanlage kam und mich in seine Kabine befahl. Dass mich die überraschende Vorladung nicht einmal beunruhigte, spricht Bände darüber, wie am Ende ich war. Ich ließ den Sprüher Sprüher sein und ging nach unten, um zu sehen, was Caldswell von mir wollte.
Ich konnte mich nicht erinnern, schon einmal in der Kapitänskajüte gewesen zu sein, aber das lag womöglich an meiner Müdigkeit, denn als ich durch die Tür trat, hatte ich ein eigenartiges Déjà-vu. Caldswells Kajüte hatte zwei separate Räume, ein Badezimmer und einen Aufenthaltsbereich mit Sitzecke vor einem riesigen Fenster, das Richtung Schiffsnase blickte. Genau da saß er jetzt und stützte erschöpft die Ellbogen auf den Tisch.
Ich blieb direkt hinter der Tür stehen, nahm Haltung an und verriegelte die Gelenke meiner Rüstung, um nicht vor Müdigkeit umzukippen. »Sie wollten mich sprechen, Sir?«
»Ganz recht«, erwiderte der Kapitän. »Ich wollte mich bei Ihnen für Ihren außerordentlichen Einsatz während der letzten Tage bedanken.«
Ich blinzelte verdutzt. Ich konnte mich nicht erinnern, wann sich ein Offizier das letzte Mal bei mir bedankt hatte, und von Caldswell hatte ich dergleichen schon gar nicht erwartet.
»Schauen Sie mich nicht so überrascht an, Morris. Ich halte mich für einen fairen Kapitän, und Sie haben unter schwierigsten Bedingungen für fünf gearbeitet, ohne zu murren. Das kann ich kaum ohne ein Dankeschön übergehen. Oder ohne eine Entschädigung.«
»Entschädigung?« Das Wort platzte aus mir heraus, bevor ich etwas dagegen tun konnte.
Caldswell warf mir ein verschmitztes Lächeln zu. »Ich habe bereits eine Woche Extrasold auf Ihr Konto überwiesen. Außerdem beabsichtige ich, für das Schwert aufzukommen, das Sie eingebüßt haben. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn Sie etwas gefunden haben, das Ihnen gefällt, dann kaufe ich es für Sie. In einem vernünftigen Preisrahmen, natürlich. Betrachten Sie es als Prämie für Durchhaltevermögen in harten Zeiten.«
Ich starrte ihn mit großen Augen an.
Ich hatte keine Ahnung, warum der Kapitän auf einmal so nett zu mir war, aber ich wollte es auch nicht vermasseln, indem ich die falschen Fragen stellte. Einen Ersatz für Phoebe konnte ich hervorragend gebrauchen, aber ich hatte all mein Bargeld schon für die Reparaturen an der Lady ausgegeben, die nach dem hässlichen Zwischenfall auf dem Xith’cal-Geisterschiff notwendig geworden waren. Wenn ich zurückdachte, wusste ich nicht recht, wie ich mein Schwert überhaupt verloren hatte. Die ganze Episode auf dem Stammesschiff war ein einziger dunkler Fleck, was umso seltsamer war, da mein Bewusstsein eigentlich von den Kampfdrogen hätte geschärft sein müssen. Ich versuchte kurz, darüber nachzudenken, beschloss dann aber, dass ich schlichtweg zu müde war. Mein Schwert war fort, und wenn Caldswell mir ein neues besorgen wollte, würde ich es ihm bestimmt nicht ausreden.
»Danke, Sir«, sagte ich schließlich. »Ich werde mich gleich bei der nächsten Gelegenheit nach einem neuen Schwert umsehen.«
»Diese Gelegenheit werden Sie gleich nach dem Sprung haben«, erwiderte er. »Die schweren Schäden an meinem Schiff kann ich hier in der Kolonie keinesfalls reparieren lassen. Wir fliegen nach Wuxia. Ich weiß, Wuxia ist nicht Paradox, aber ich denke, dort müssten Sie etwas Passendes finden.«
Das war eine glatte Untertreibung. Wuxia war eine Kernwelt der Terranischen Republik und außerdem eines der größten Handelszentren im ganzen Universum. Wenn ich dort keinen Ersatz für Phoebe fand, dann nur, weil es keinen gab. »Danke, Sir«, sagte ich noch einmal.
Caldswell nickte und wandte sich dem Fenster zu. Ich wartete einen Moment lang darauf, dass er mich entließ, aber er blieb stumm. Gerade als ich fragen wollte, ob das alles sei, sprach er weiter.
»Ist irgendeine von Ihren Erinnerungen inzwischen zurückgekehrt?«
»Nein, Sir.« Hyrek hatte mir versichert, dass mein Gedächtnis früher oder später zurückkommen würde, aber der dunkle Fleck in meinem Gehirn war genauso schwarz wie direkt nach dem Aufwachen im Lazarett. Wenn ich allerdings bedachte, wie ich während der letzten drei Tage geschuftet hatte, überraschte es mich, dass ich überhaupt noch meinen Namen wusste. Caldswell schien meine Antwort auch nicht zu beunruhigen. Er nickte lediglich und sagte, ich solle mir etwas Schlaf gönnen.
Aus reiner Gewohnheit machte ich eine Verbeugung, dann schleppte ich mich die Treppe hinauf zu meiner Koje, während Basils pfeifende Stimme über die Bordlautsprecher den Countdown bis zum Sprung herunterzählte.
Ein leichtes Ruckeln zeigte den Eintritt in den Hyperraum an, aber selbst wenn die Narr mit voller Fahrt gegen das Sprungtor geknallt wäre, hätte ich es wahrscheinlich nicht einmal mitbekommen. Ich war so erschlagen, als hätte ich Fieber. Ich ließ mich einfach auf die Pritsche fallen und vergrub das Gesicht im Kissen, ohne Nova, die gleich hinter mir hereinkam, auch nur zu begrüßen. Als ich in der Waagrechten war, schlief ich sofort ein und bewegte mich erst wieder, als ein Signal die Landung auf Wuxia ankündigte.
Wuxia lag tiefer in der Terranischen Republik, als ich je zuvor gewesen war. Während meiner Zeit bei den Schwarzdrosseln hatte ich nur die gesetzlosen Randzonen gesehen, und jetzt, da der Krieg vorbei war, betraten die paradoxischen Streitkräfte den Raum der Terraner überhaupt nicht mehr. Daher hatte ich noch nie den Fuß auf eine Kernwelt der Republik gesetzt, aber ich hatte viel über sie gehört, vor allem über Wuxia. Angeblich war sie eine der ältesten Kolonien überhaupt, gegründet von den ersten Springern, noch bevor die Alte Erde kollabierte.
Angesichts dieser Vorgeschichte hätte ich eigentlich etwas Majestätisches erwartet, geschichtsträchtig und beeindruckend, aber was ich sah, war nichts als Smog.
Als die Narr in die Atmosphäre eintauchte, konnte ich nicht einmal die Oberfläche sehen, nur schwarze Wolken mit fahlen Lichtern darunter, und nachdem wir die Wolkendecke durchstoßen hatten, wurde der Blick nicht viel besser. Wuxia war eine sehr alte Kolonie, der größte Teil der Landmasse war von Städten bedeckt, was mir normalerweise nichts ausgemacht hätte, aber ich war große, schöne Städte wie Kingston gewohnt. Wuxia hingegen sah verfallen aus, übervölkert und dreckig.
Die Atmosphäre war braun von Industrieabgasen, und die Gebäude, selbst die etwas neuer wirkenden Wolkenkratzer, waren wie von einer schmierigen Schicht überzogen. Eigentlich befanden wir uns auf der Tageslichtseite des Planeten, aber wegen des dichten Smogs machte das nicht den geringsten Unterschied. Die Sonne hatte nicht den Hauch einer Chance gegen den Dreck in der Luft und die hohen Gebäude. Hell war es trotzdem, denn am Himmel flimmerten riesige Werbeprojektionen. Sie übergossen die dicken Wolken mit ihrem gleißenden Neonleuchten, dessen Widerschein nun statt der Sonne die Straßen erhellte.
Ich ging gerade lange genug nach draußen, um den Blick einmal über das Panorama schweifen zu lassen, dann kehrte ich zurück ins Schiff. Selbst in meinen schwächsten Momenten hatte ich mir nicht viel aus terranischen Städten gemacht, nun hatte eine einzige Minute auf Wuxia genügt, um die Luftfilter meiner Lady hoffnungslos zu verstopfen. Das und die riesigen Himmelstaus, die ich selbst von hier unten hatte erkennen können, sagten mir, dass dies kein Ort für vernünftige Leute war. Beim König, es war wahrscheinlich nicht einmal ein Ort für Terraner.
Wegen der strengen Waffengesetze in der Republik durfte ich meine Rüstung nur tragen, solange ich mich auf dem Schiff aufhielt. Da ich nicht vorhatte, irgendwohin zu gehen, störte mich das nicht weiter. Die terranischen Arbeitertrupps allerdings, die kurz nach der Landung an Bord kamen, um die nötigen Reparaturen vorzunehmen, schienen zutiefst beunruhigt darüber, dass ein Paradoxier in voller Rüstung sie beobachtete. Auch das war mir recht. Der Krieg mochte vorbei sein, aber Terraner zu Tode zu erschrecken gehörte schon immer zu den kleinen Freuden in meinem Leben. Noch dazu Kernweltler, die paradoxische Kampfanzüge nur aus Filmen kannten. Ich brauchte nur Saschas Sicherungshebel klicken zu lassen, und schon schreckten sie alle hoch wie aufgescheuchte Kaninchen – Unterhaltung auf höchstem Niveau.
Leider sah Caldswell, der selbst Terraner war, das anders. Die Arbeiter hatten kaum angefangen, die von Mabel angebrachten Flicken vom Rumpf zu reißen, da schickte er mich auch schon in meine Kabine, wo ich mir einen geeigneten Ersatz für das verlorene Thermitschwert aussuchen sollte. Normalerweise ließ ich mich nicht einfach auf mein Zimmer schicken wie ein ungezogener Teenager. Nach drei Tagen mörderischer Schufterei war ich allerdings mehr als zufrieden damit, mich mit einem kalten Bier und einem Stapel Waffenkatalogen, der für ein ganzes Jahr gereicht hätte, aufs Bett zu legen, während zur Abwechslung mal andere arbeiteten.
»Wie wär’s mit etwas, das fest mit meiner Rüstung verbunden ist?«, überlegte ich laut und blätterte durch die Seiten auf dem Display. »Ich möchte mein neues Schwert nicht gleich wieder verlieren.«
»Das klingt vernünftig«, sagte Nova, meine Kojennachbarin, die ebenfalls dienstfrei hatte. Für eine Sensortechnikerin gab es schließlich nichts zu tun, solange das Schiff am Boden war. Während ich mich also damit vergnügte, mir scharfe Sachen anzusehen, saß sie auf dem Boden und wühlte sich durch die grellbunten Kleider in ihrer Kommode. Schließlich zog sie ein hübsches, aber vollkommen überdrehtes Kleid hervor, das mit so vielen sternförmigen Goldpailletten besetzt war, dass man den Stoff darunter nicht mehr sah.
»Schön«, sagte ich, als sie es hochhielt.
Nova strahlte und streifte sich das Kleid über. »Leuchtet dein neues Schwert genauso wie das alte?«
»Selbstverständlich«, antwortete ich und nahm einen Schluck von meinem Bier. »Brennendes Thermit ist das einzige Klingenmaterial, das Panzerplatten durchschneiden kann. Aber diesmal hätte ich gerne eines, das sich an der Lady befestigen lässt.«
So nützlich Phoebes große Reichweite und die austauschbaren Klingen auch gewesen waren, diesmal erwog ich ernsthaft eine Stichwaffe. Etwas, in das ich bei jedem Schlag die geballte Kraft meiner Lady legen konnte. Ich überlegte gerade, wie ich Nova das erklären sollte, ohne allzu blutrünstig zu klingen, da holte sie einen kleinen Spiegel hervor und fing an, ihre Lider dick mit glitzernder Silberfarbe zu bepinseln. Das überraschte mich. Das Sternchenkleid war nichts Ungewöhnliches, aber ich hatte noch nie gesehen, dass Nova Make-up benutzte.
»Und?«, fragte ich beiläufig, ließ meinen Kommunikator aufs Kissen plumpsen und wandte ihr grinsend den Kopf zu. »Gibt’s heute Abend was Besonderes?«
Ich sah Novas aufgeregtes Lächeln im Spiegel. »Mein Bruder ist hier! Ich treffe ihn zum Abendessen.«
Ich machte ein enttäuschtes Gesicht. Ich hatte etwas Aufregenderes erwartet als einen Bruder. In Anbetracht der Tatsache allerdings, wie wenig Ausgang die Besatzung der Narr bekam, war ein Abendessen mit dem eigenen Bruder wahrscheinlich immer noch ein echtes Ereignis.
»Ich habe Copernicus seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen«, sprach sie weiter und streifte sich einen silbernen Reif über das kurze blonde Haar. »Ich schreibe ihm jedes Mal, wenn wir landen, aber ich hätte nie damit gerechnet, dass er zur gleichen Zeit auf Wuxia ist wie wir. Was für ein wunderbarer Zufall!«
»Auf euch beide«, sagte ich und prostete ihr zu. »Ich hoffe, ihr amüsiert euch gut.«
Nova schenkte mir ein strahlendes Lächeln. »Ich wäre sehr erfreut, wenn du dich unserem Beisammensein anschließen würdest, Deviana.«
Es dauerte ein paar Momente, bis ich begriff, dass Nova mich soeben eingeladen hatte. »Danke für das Angebot«, erwiderte ich, »aber ich bleibe lieber auf dem Schiff. Außerdem möchte ich nicht noch einmal raus in diesen Smog. Vielleicht ist er giftig.«
»Mit größter Sicherheit sogar«, stimmte Nova zu und rückte den Haarreif zurecht. »Nic hat versprochen, dass wir uns oberhalb der verpesteten Ebenen treffen.«
Ich runzelte die Stirn. »Nic?«
»Eine Abkürzung für Copernicus. Genauso wie ich Nova gerufen werde und nicht Novascape.«
Ich nickte geistesabwesend und versuchte, mich zu erinnern, wo ich jemandem namens Nic schon einmal begegnet war. Mir fiel nichts ein, trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass es da etwas gab, woran ich mich eigentlich erinnern sollte. Aber je mehr ich mich anstrengte, desto verschwommener wurde das Bild, und schließlich gab ich es auf.
»Bist du sicher, dass du uns nicht begleiten willst?«, fragte Nova, während sie ein letztes Mal ihr Sternenkleidchen glatt strich. »Basil kommt auch mit.«
Wäre ich noch unentschlossen gewesen, hätte das die Sache endgültig entschieden. Mit dem pingeligen Vogelwesen durch überfüllte und dreckige Straßen zu ziehen war das Letzte, was ich wollte. »Danke der Nachfrage, aber ich passe.«
Als ich Novas enttäuschtes Gesicht sah, bekam ich ein schlechtes Gewissen und wollte mich schon entschuldigen, da meinte sie: »Und wenn ich Mr. Charkow einlade?«
Ich hob den Kopf. »Wen?«
Nova blinzelte mich ungläubig an. »Rupert Charkow? Unseren Koch!«
»So heißt er?« Ich überlegte, ob ich den Namen schon einmal irgendwo gehört hatte.
Nova starrte mich noch einen Moment lang verwirrt an, dann schaute sie weg. Ihre blassen Wangen liefen rot an. »Verzeihung. Ich hatte geglaubt, du und er wärt …« Sie verstummte und wurde noch röter, dann drehte sie sich weg und tat, als müsste sie ihr kurzes Haar kämmen. »Mach dir nichts draus. Es ist nur … seine Aura ist noch schwächer als sonst, und ich dachte … Wie gesagt, mach dir nichts draus.«
Am Schluss sprach sie so schnell, dass sich die Worte beinahe überschlugen. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redete. Wenn die Aura des Kochs schwach war, konnte das kaum meine Schuld sein. Abgesehen davon, dass er mich ständig anstierte, war weniger als nichts zwischen mir und …
Ich hielt inne. Nova hatte es mir gerade gesagt, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie der Koch hieß. Der Name war durch mein Gehirn gefallen wie durch ein Sieb. Das war eigenartig. Normalerweise vergaß ich solche Dinge nicht. Wie hieß er noch mal? Ich wollte Nova gerade fragen, da krähte Basil durch die Sprechanlage, sie seien schon spät dran.
Nova schoss zur Tür, wünschte mir über die Schulter hinweg noch einen schönen Abend und ging nach draußen. Allein und mit so vielen Fremden an Bord war mir nicht recht wohl, also stand ich auf und folgte Nova in die Mannschaftsmesse, wo Basil sie bereits erwartete. Dieses Abendessen schien wirklich etwas ganz Besonderes zu sein, denn sogar unser Äon-Navigator hatte sich herausgeputzt. Ich hatte Basil noch nie in etwas anderem als seinem Federkleid gesehen, doch heute hatte er sich eine Art Seidenumhang über Rücken und Flügel gehängt. Das kleine quadratische Stück Stoff wirkte an dem übergroßen Vogel-Strauß-Alien so lächerlich, dass ich den Koch vollkommen vergaß, weil ich so sehr damit beschäftigt war, nicht in schallendes Gelächter auszubrechen.
»Gibt es etwas Komisches, Morris?«, keifte Basil. Sein langer Hals schwang zu mir herab, sodass der spitze gelbe Schnabel fast meine Nasenspitze berührte.
»Nein, Sir«, erwiderte ich mit gepresster Stimme. »Ich habe lediglich Ihren Umhang bewundert.«
Basil verdrehte die riesigen gelben Augen. »Er ist ein Zeichen des Respekts. Ich werde mich nicht selbst beschämen, indem ich am Tag des Gedenkens ohne ihn ausgehe.«
»An welchem Tag?«
Basil klappte den Schnabel auf und zu. »Sie haben jahrelang in der Terranischen Republik gearbeitet und wissen nicht, was der Tag des Gedenkens ist?«
»Sehe ich vielleicht aus wie eine Terranerin?«, fragte ich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Die Schwarzdrosseln haben in der Republik gearbeitet, aber wir sind immer noch Paradoxier. Wir haben die fünf heiligen Tage begangen und den Geburtstag von König Stephen gefeiert. Außerdem haben die Terraner Tausende von Feiertagen. Sie können kaum von mir erwarten, dass ich sie alle auf dem Schirm habe.«
»Es sind in der Tat viele«, räumte Nova ein. »Aber der Tag des Gedenkens ist etwas Besonderes. Anders als die regionalen Feierlichkeiten gehört er zu den siebenunddreißig gesetzlichen Festtagen, die auf jedem Planeten der Republik begangen werden.«
Ich schüttelte den Kopf. Gesetzliche Festtage? Typisch Terraner. »Und an was wird da gedacht?« Falls es sich um eine vernichtende Niederlage gegen die Paradoxier handelte, würde ich mir noch ein weiteres Bier genehmigen.
»Man gedenkt des Untergangs von Svenya«, erklärte Basil mit einer Stimme, die wohl besonders getragen klingen sollte. »Es war eine Kolonie, sogar noch älter und größer als Wuxia. Vor etwa sechzig Jahren wurde die Umlaufbahn plötzlich instabil, und der Planet zerbrach.«
Jetzt, da Basil es erwähnte, erinnerte ich mich dunkel daran, in der Schule von der Tragödie gehört zu haben. Uns war sie als Beispiel verkauft worden, was passierte, wenn ein Planet keinen lebenden Heiligen als Herrscher hatte. »Sind nicht absurd viele Menschen dabei gestorben?«
»Milliarden«, antwortete Nova traurig. »Die Wissenschaft hat immer noch nicht herausgefunden, was genau passiert ist, aber die Feierlichkeiten tragen Sorge dafür, dass Svenya niemals in Vergessenheit gerät.« Mit fahlem Gesicht betrachtete sie ihr glitzerndes Sternenkleid. »Vielleicht sollte ich etwas anderes anziehen.«
»Auf keinen Fall«, widersprach ich. »Die Geister von Sven-wie-auch-immer werden es dir bestimmt nicht verübeln, wenn du ihnen zu Ehren etwas Fröhliches trägst. Und jetzt fort mit euch.« Ich deutete mit dem Kinn auf das offen stehende Frachtraumtor. »Es kommt zu viel Dreck rein.«
Die beiden eilten über die Rampe zu einem wartenden Taxi. Ich schaute ihnen hinterher, bis das knallblaue Fahrzeug zwischen den Hunderten anderen Frachtern auf unserem Dock verschwunden war, dann ging ich in die Kabine zurück, um mich wieder der wichtigen Frage zu widmen, um wie viel Geld ich Caldswell wegen meines neuen Schwerts erleichtern würde.
Die Reparaturen an der Narr dauerten die ganze Nacht hindurch bis zum nächsten Morgen. Der Kapitän und Mabel überwachten die Arbeiten abwechselnd. Als Nova un