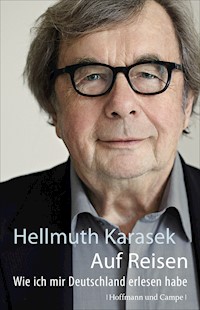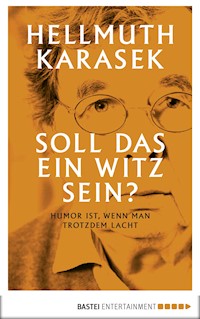
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Seit seiner Jugend sammelt Hellmuth Karasek, Journalist und Schriftsteller, Witze in allen Varianten. Diktatorenwitze, jüdische Witze, Arztwitze, Irrenwitze, Männerwitze, Frauenwitze, Elefantenwitze - kein Lebensbereich, der nicht als Witz taugt. Viele davon gibt er in seinem Buch preis. Natürlich interessiert er sich dabei auch für den geistigen Hintergrund, für Freuds psychoanalytische Deutung, für die Psychologie hinter der Pointe: Was macht Witze witzig? Gibt es ganz neue oder nur immer wiederkehrende Varianten? Ist der Witz eine wirksame Waffe der Unterdrückten? Unterscheidet sich der Humor von Frauen und Männern? So macht er sich stark für eine fast vergessene Kultur, die angeblich keine ist. Er versteht den Witz als die kürzeste und präziseste Form von erzählter Literatur. Romanautoren brauchen Hunderte Seiten, um die Realität zu erfassen, ein Witz kann dies in wenigen Zeilen auf den Punkt bringen. Angeregt wurde Karaseks Buch von gemeinsamen Auftritten mit dem Arzt, Bestsellerautor und erfolgreichen Komiker Eckart von Hirschhausen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
HELLMUTH KARASEK
SOLL DAS EIN WITZ SEIN?
HUMOR IST, WENN MAN TROTZDEM LACHT
MIT EINEM VORWORT VON ECKHART VON HIRSCHHAUSEN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2011 by Quadriga Verlag, Berlin, in der Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Uwe C. Beyer, Hamburg
Umschlagmotiv: Christian Geisler, Wohltorf
Abbildung S. 14: Frank Eidel, Berlin / Christian Geisler, Wohltorf
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1199-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
INHALT
Eckart von Hirschhausen
Vorwort
Warum im Himmel nicht gelacht wird – aber auf Erden schon
Wie wird man Witzeerzähler?
Ist Lachen die beste Medizin?
Schlechte Witzeerzähler
Der jüdische Witz
Der Freud’sche Versprecher
Das »alte Rein-Raus-Spiel«
Als das Wünschen noch geholfen hat
Alles, was da kreucht und fleucht.Von Löwen, Affen, Papageien und Elefanten und unseren gefiederten Freunden
Ich bremse auch für Tiere
Auf den Hund gekommen
Affe unter Affen Oder: Darwin, Brehm und Busch
Von Löwen und Stieren
Das Tier mit zwei Rücken
Groß und klein – Mücke und Elefant
Papagei und Kakadu Oder: der Witz als Tourette-Syndrom
Sigmund Freud und die Fünfzigerjahre
Trauring, aber wahr
Politik im Witz
Der Fall Guttenberg
Tu felix Austria
Der Führer und die Autobahn
Die Glienicker Brücke
Witze aus der Besatzungszeit Schwimmen und Nichtschwimmen
Die Ostzone und das Strickzimmer
Struwwelpeter und Co.
Von Fröschen, Blondinen, Porschefahrern, Mantafahrern, von Ostfriesen, Ösis, Schweizern und Schotten – Kurz: Sogenannte »rassistische« Witze
Vom Alter und von den Ärzten
ECKART VON HIRSCHHAUSENVORWORT
Kennen Sie den? Kommt ein Literaturkritiker zum Arzt …
Klingt wie der Einstieg in einen Witz. Und so ist die Idee zu diesem Buch auch entstanden: Von Wein und Pasta beflügelt, in einer Kneipe auf Sylt, wo Hellmuth Karasek und ich im Lauf eines langen Abends eine gemeinsame Leidenschaft entdeckten: das Witzeerzählen.
Und wenn man, wie wir beide, schon seit Jahren auf der Suche nach guten Witzen ist, freut es jeden von uns umso mehr, auf einen Kenner und Sammler zu stoßen, der noch andere seltene Kostbarkeiten in seinem Repertoire hat. Bis spät in die Nacht hauten wir uns die Pointen um die Ohren und hatten samt allen anderen Anwesenden an unserem Tisch sehr viel Spaß. Im Nachhinein heißt es bei solchen Gelegenheiten stets: »Man hätte dabei sein müssen.« Deshalb haben wir unser nächtliches Treffen noch einmal aufleben lassen, in Berlin in der »Bar jeder Vernunft«. Und jetzt kann jeder nachträglich noch »live« dabei sein, denn wir haben es aufgenommen und zugunsten der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN eine CD daraus gemacht: Ist das ein Witz?
Als Arzt hat mich die Wirkung von Humor schon immer fasziniert: Genauer gesagt war ich erst Komiker und dann Arzt, nicht umgekehrt. Denn schon in der Schulzeit sammelte ich Witze und trat als kabarettistischer Zauberkünstler auf.
Wenn man die Physiologie des Lachens betrachtet, erkennt man, dass Humor das natürlichste Anti-Stress-Mittel ist, das es überhaupt gibt. Wenn wir Angst haben, weil wir nicht wissen, ob etwas Bedrohliches auf uns zukommt, dann spannen wir unsere Muskeln an. Aber was tun wir, wenn wir lachen? Wir entspannen unsere Muskeln, lassen sie gewissermaßen los, denn im Lachen können wir die Muskelspannung gar nicht aufrechterhalten. Kinder wälzen sich vor Lachen auf dem Boden, lachende Erwachsene krümmen sich, können manchmal gar Muskeln entspannen, die sie eigentlich seit ihrem vierten Lebensjahr ganz gut unter Kontrolle hatten. Daher kommen auch Redewendungen wie: Man lacht sich krumm, kaputt oder gar krank.
Nach dem Lachen sinkt der Blutdruck, und das Immunsystem verbessert sich. Gut belegt ist die schmerzhemmende Wirkung des Lachens. Das kann jeder selbst überprüfen: Hauen Sie sich mit einem Hammer auf den eigenen Daumen! Einmal alleine, und dann noch einmal in Gesellschaft, Sie spüren den Unterschied. Alleine tut es lange weh, in Gesellschaft muss ich über mein Missgeschick lachen, und der Schmerz lässt nach. Deshalb sollten Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und etwas zu lachen bekommen. Bis es Humor auf Krankenschein gibt, ist es sicher noch ein weiter Weg, aber man darf ja wohl träumen von einer neuen Kultur, die sich mehr damit beschäftigt, was der menschlichen Seele guttut und sie vor Stress schützt. Im Gesundheitswesen und in der Gesellschaft.
Ein verbreitetes Vorurteil verbannt das Lachen ins Reich des Oberflächlichen. Unsinn, im Gegenteil: Die Psychologie des Humors stößt zu den grundlegendsten Menschheitsfragen vor – wie ticken wir, warum täuschen wir uns so leicht, wie kommen wir der Wirklichkeit näher, woran halten wir gedanklich fest, und wann sind wir bereit, die Kontrolle abzugeben, loszulassen, uns im Lachen hinzugeben und zu ergeben?
Bei aller Übereinstimmung gibt es zwischen Hellmuth Karasek und mir naturgemäß auch Auffassungsunterschiede: Er bezieht sich gern auf Sigmund Freud und die Psychoanalyse, die ich arg verquast finde. Das ganze Gedankengebäude in einem Aphorismus zusammengefasst: Wenn jemand eine Schraube locker hat, liegt es an der Mutter. Und wenn man den Freudianern mit vernünftigen Argumenten kommt, lautet ihre stereotype Antwort: Da hast du etwas verdrängt.
Ich bin überzeugt, dass es zeitgemäßere und wirksamere Ideen in der Psychotherapie gibt. So arbeitet man in der Hypnotherapie, den systemischen Ansätzen und auch in der provokativen Therapie nach Frank Farrelly mit der heilenden Wirkung von humorvollen Geschichten. Da kann eine Geschichte, zum richtigen Zeitpunkt in einer tragfähigen Beziehung erzählt, mit einem Gedanken ein ganzes Lebensprinzip verdeutlichen. Und hinter diese Erkenntnis des anderen Blickwinkels kommt man auch nicht mehr zurück. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass es besser ist, eine offenkundige Schwäche gar nicht erst zu verstecken, sondern aus der Schwäche eine Stärke zu machen:
Ein Stotterer bewirbt sich als Vertreter, er will Bibeln von Tür zu Tür zu verkaufen. Der Vertriebsleiter der christlichen Firma ist skeptisch, erbarmt sich jedoch: »Na gut, hier haben Sie eine Bibel, probieren Sie mal Ihr Glück.« Eine halbe Stunde später ist der Stotterer wieder da. Verkauft! Der erstaunte Vertriebsleiter gibt ihm jetzt drei Bibeln – nach einer Stunde sind auch die verkauft. Um es kurz zu machen: In zwei Tagen sind dreißig Bibeln verkauft, da nimmt der Vertriebsmann den Stotterer zur Seite und sagt: »Guter Mann, ich mache das seit zwanzig Jahren, habe aber noch nie erlebt, dass jemand so erfolgreich Bibeln verkauft. Ich verrate Ihren Trick nicht, aber sagen Sie mir bitte, wie Sie das machen.«
»G-g-ganz einfach. Ich k-klingel und sag, hier ist die Bi-Bibel, wollen S-S-Sie k-k-kaufen, oder soll ich vo-vo-vorlesen?«
Eine große Leitfigur dieser Art moderner Psychotherapie ist Viktor Frankl, der aus seiner eigenen Biografie eine unglaubliche Wende im therapeutischen Denken entwickelt hat. Im KZ hat er mit anderen jüdischen Häftlingen verabredet, jeden Tag einen Witz zu erzählen. Im Nachhinein sagte er, dass dieses Festhalten an der Freiheit im Kopf ihm in der verzweifelten Situation immer wieder Kraft gegeben habe. Aus seinen traumatischen Erfahrungen hat Viktor Frankl später die Logotherapie entwickelt, die davon ausgeht, dass Menschen das Erlebnis von Sinn, von Sinnhaftigkeit dringender benötigen als alles andere. Wenn ein Patient sich beispielsweise umbringen wollte, hat er ihn gefragt, warum er es bisher nicht getan hat! Er drehte also die Perspektive um und fragte sein Gegenüber nach dem, was ihm bisher Halt gegeben hat, um daran zu arbeiten.
Humor ist das bewährte Gegengift gegen irrsinnige Annahmen und felsenfeste Überzeugungen. Instinktiv lieben wir alle diese unumstößlichen Gewissheiten, aber der Humor kann sie ins Wanken bringen und die Perspektiven verändern. Wenn wir uns von dem Schock erholt haben, sehen wir klarer als vorher: Vielleicht ist alles ganz anders, nicht schwarz oder weiß, sondern bunt.
Ein Beispiel: Ein betrunkener Mann tastet sich um eine Litfaßsäule herum, läuft dabei immer im Kreis und schreit: »Hilfe, ich bin eingemauert!« Durch das Fassungsvermögen seines Magens ist das Fassungsvermögen seines Hirns eingeschränkt, er versteht nicht, dass er sich nur umdrehen müsste, um schlagartig frei zu sein.
Diese subversive Sprengkraft des Witzes erklärt auch, warum sämtliche Diktaturen, alle Herrschaftssysteme, die auf brutaler Unterdrückung und totalitärer Ideologie beruhen, ungeheure Angst vor Komik und Satire haben. Eines meiner großen Vorbilder, Werner Finck, hat in den Zeiten der Naziherrschaft beispielhaften Mut bewiesen. Zu einem Gestapo-Spitzel, der versuchte, seine Witze mitzuschreiben, sagte er: »Kommen Sie mit, oder soll ich mitkommen?« Und er fügte hinzu: »Ich stehe hinter jeder Regierung, unter der ich nicht sitzen muss, wenn ich nicht hinter ihr stehe.«
Die widerständige Tradition von Witzen setzte sich dann in den Zeiten des Kalten Kriegs im Ostblock fort. In der DDR erzählte man sich, Willy Brandt habe zu Walter Ulbricht gesagt: »Mein Hobby ist, Witze zu sammeln, die die Leute über mich erzählen.« Dazu Ulbricht: »Ich habe ein ganz ähnliches Hobby: Ich sammle Leute, die Witze über mich erzählen.«
Witze zünden im Kopf, wenn Bilder entstehen, die nicht zusammenpassen, und wir uns nicht entscheiden können, was denn nun »richtig« ist. Unser Verstand möchte so gerne immer alles verstehen und in Gut und Böse einteilen. In ihrer Komplexität und ihren Paradoxien sträubt sich die Welt indes gegen derart eindeutige Zuordnungen; damit wir daran nicht verzweifeln, wurde uns das Lachen geschenkt. Unser Geist kennt drei Zustände, in denen Widersprüche auftauchen und stehen bleiben können: der Traum, die Psychose und das Lachen. Unter ihnen ist das Lachen eindeutig der heilsamste Geisteszustand. Lassen Sie sich also anstecken von der gesündesten Infektionskrankheit der Welt: dem Lachen!
Schopenhauer meinte, jedes Lachen sei eine kleine Erleuchtung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen Vergnügen, Aufklärung und Erkenntnis bei der Reise meines Freundes Hellmuth Karasek durch die Welt der Witze. Und wenn Ihnen einer besonders gut gefällt, erzählen Sie ihn weiter. Glück kommt selten allein. Lachen auch. Gemeinsam zu lachen ist das, was uns Menschen erfolgreich macht. Statt uns die Köpfe einzuschlagen, lassen wir lieber den Geist Funken schlagen. Humor ist vor allen Dingen ein soziales Phänomen, das Aggressionen mindert, Menschen zu Gruppen zusammenfügt und Stress abbaut. Was will man mehr? Jede Frau sucht einen Mann mit Humor. Und umgekehrt. Konkret will die Frau einen, der witzig ist, der Mann eine, die ihn witzig findet. Und Hellmuth ist wirklich witzig! Doch urteilen Sie selbst.
Goethe hat schon erkannt, dass nichts den Menschen so treffend charakterisiert wie das, worüber er lacht. Jeder Witz, den ein Mensch erzählt, ist also auch eine Art Persönlichkeitstest für sein Gegenüber, ebenso wie für den Erzähler selbst. Von peinlich berührt, im Tiefsten bewegt bis lustvoll gekitzelt ist alles drin. In diesem Sinne, viel Freude, erkenne dich selbst
– und lache auf!
WARUM IM HIMMEL NICHT GELACHT WIRD – ABER AUF ERDEN SCHON
Es gibt eine auf den ersten Blick höchst befremdliche Einsicht des großen amerikanischen Erzählers, Humoristen und Satirikers Mark Twain. Sie lautet: »Im Himmel wird nicht gelacht.«
Wie bitte? Ist das nicht eine extrem abtörnende Vorstellung, dass an dem Ort, den wir uns als den schönsten vorstellen, als den absoluten Gegenpol zur Erde, dem irdischen Jammertal und dem Anti-Ort zur Hölle, wo nach allen Vorstellungen permanente Folterqualen herrschen, Sünder die furchtbarsten, vor allem nie endenden Strafen erleiden, dass also in der hellsten, heilsten, friedvollsten, heitersten aller möglichen Welten, eben im Himmel, nicht gelacht wird. Ausgerechnet dort, wo wir die größte Heiterkeit erwarten!
Nun könnten Agnostiker die Achseln zucken und sagen: So what! Was soll’s! Da es den Himmel ohnehin nicht gibt und wir infolgedessen auch nicht dorthin kommen können, ist es uns egal, ob dort gelacht wird oder nicht. Wir werden uns höchstens darüber streiten, wenn wir uns darüber keine Gedanken mehr machen können.
Denn wir leben ja auf der Erde, die das Gegenteil zum Himmel ist, und kommen aus dem Paradies, aus dem wir vertrieben wurden, dank Eva und dank dem verbotenen Apfel, und über diese Vertreibung gibt es eine Schilderung, abseits und jenseits der Bibel, aber auf dieser fußend. Mark Twain schildert in den Tagebüchern von Adam und Eva und in Evas Tagebuch aus zwei Perspektiven, wie wir aus dem Himmel (respektive dem Paradies) auf der Erde gelandet sind.
Adam, inzwischen Vater von zwei Jungen, hat die Einsicht: »Es lebt sich besser außerhalb des Gartens (gemeint ist der Garten Eden) mit ihr als drinnen ohne sie.« Über diesen Ehewitz lässt sich lachen. Und am Ende von Evas Tagebuch, vierzig Jahre später, sitzt Adam an Evas Grab und sagt: »Wo immer sie war, da war das Paradies.« Auch hier gibt es wieder Grund zum Lachen. Dabei hatte Adam, in der Friedfertigkeit des Paradieses, also im Himmel auf Erden, auf einer Reise, erfahren, wann seine lebendige Rippe von der verbotenen Frucht der Erkenntnis gegessen hatte – als nämlich die wilden Tiere, die in totaler Harmonie nebeneinander grasten und ästen, übereinander herfielen, sich zerfleischten, ihm sein Pferd töteten, sodass er nur mit Mühe und Not mit dem Leben davonkam.
Jonathan Swift, wie Mark Twain als Kinderbuchklassiker ausgewiesen, ein Humorist von misanthropischen Gnaden, hat eine Kannibalengeschichte geschrieben, die während des ewigen Kolonialkriegs zwischen England und Irland im 17. Jahrhundert spielt. Darin macht er einen bescheidenen Vorschlag: »a modest proposal«. Die Briten, die reichen Gutsbesitzer, mögen doch als kulinarische Abwechslung die von Hungertod bedrohten irischen Babys der Tagelöhner verspeisen, sie würden sicher köstlich schmecken.
Mit diesem extremen Beispiel will ich deutlich machen, warum auf Erden (im Unterschied zum Himmel oder zu jedem vorstellbaren Paradies) gelacht wird, ja gelacht werden muss – weil nämlich das Elend dieser Welt ohne Lachen nicht auszuhalten wäre.
Im Himmel braucht man kein Lachen. Auf der Erde aber haben wir es bitter nötig. Wie das Sprichwort weiß: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Trotzdem. Auf das Trotzdem kommt es an. Wir brauchen das Lachen, um die Welt aushalten zu können. Das klingt zwar pathetisch, ist aber zweifellos wahr.
Man kann es auch mit einem Witz verdeutlichen, der davon handelt, wie man – wäre man im Paradies oder im Himmel, also wunschlos glücklich, ruhig, zufrieden in sich selbst ruhend, ohne Hunger und Durst – eigentlich nicht nur auf das Lachen verzichten könnte, sondern sogar auf das Sprechen.
Eltern machen sich um ihren kleinen Sohn Sorgen. Zwar isst er brav, schläft gut, wächst und gedeiht, aber er bleibt stumm. Will und kann nicht reden. Die Eltern suchen Ärzte auf, holen Gutachten ein. Keine Ursache für irgendeine Krankheit ist zu entdecken. Die Eltern sind ratlos.
Eines Mittags bringt die Mutter die Suppe auf den Tisch, um den die Eltern und ihr Sohn vor ihren Tellern sitzen. Die Mutter tut die Suppe auf. Alle fangen an zu essen.
Auf einmal sagt der Sohn: »Salz!«
Die Eltern schauen sich fassungslos an. Starren auf ihren Sohn.
»Du kannst ja sprechen!«, sagen sie zu dem Kleinen. »Warum hast du denn bisher nichts gesagt?«
»Bisher hat ja auch kein Salz gefehlt«, antwortet der Junge.
Ein Witz ist immer auch eine Geschichte. Und das auf zweierlei Art: etwas, das etwas erzählt, was sich zu erzählen lohnt, weil es unerhört ist. Und etwas, das erzählt wird, ist wie im Märchen: »Es war einmal«.
Witze soll man grundsätzlich »erzählen«. So wie man, eigentlich, Märchen vorlesen soll und auch Geschichten, wie die berühmten aus Tausendundeiner Nacht grundsätzlich erzählt werden sollten. Bei der Scheherazade ist das »fiktive« Erzählen, das der Leser liest, sozusagen die konstitutionelle Voraussetzung.
Sehr deutlich wird das bei folgendem Witz:
Zwei Freunde treffen sich im Tennisclub. Sagt der eine zum anderen: »Sag mal, du hast ja richtig zugenommen.«
Sagt der andere: »Du, ich weiß auch nicht. Aber beim Einschlafen liege ich immer neben meiner Frau, strecke die Hand nach ihr aus und berühre sie. Und sie schreckt hoch und sagt: ›Is was!‹ Ja, und dann stehe ich auf im Dunkeln, tapse in die Küche zum Kühlschrank und esse was!«
Diesen Witz sollte man streng genommen immer erzählen, weil er nur beim Erzählen funktioniert. »Is was!«, das muss das verschliffene »Ist etwas?« sein, das der Hörer, der Mann im Halbschlaf, der Tastende, der die Hand vergeblich und verdrossen und eher aus Verlegenheit nach seiner Frau im Dunkeln ausstreckt, als »Iss was!« versteht, also als Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen und besser stattdessen etwas zu essen.
Dieser Witz, über den wir lachen, weil er eine überraschende Verwechslung parat hält, erzählt von einem Paar, Herrn Jedermann und Frau Jederfrau, wie es in voller Ausführlichkeit in zahlreichen Romanen, Erzählungen, Novellen vorkommt, hier verknappt auf eine Pointe, die im Missverständnis die Dunkelheit des Schlafzimmers im Licht der Wahrheit wie ein Blitzlicht beleuchtet. Etwas geschwollen ausgedrückt? Zugegeben. Aber es gibt Romane, Erzählungen, vornehmlich von Updike oder Walser oder Flaubert oder Tschechow, oder Dramen wie Gesellschaftskomödien, die von nichts anderem handeln. Ausführlicher. Aber, so paradox es klingt, die Ausführlichkeit dieses Witzes ist gerade seine Verknappung. Nachdem man ihn gehört hat, entfaltet die Geschichte ein Eigenleben, wie eine ins Wasser geworfene japanische Muschel, die sich nach und nach zu einer schönen Papierblume entfaltet. Nur dass diese Papierblume nicht die Schönheit der Poesie entfaltet, sondern dass sich die zynische Wahrheit der Realität in der winzigen Spitze einer Pointe, paradox gesagt, breitmacht.
Eine Vierzeilengeschichte als Verlaufsgeschichte einer Ehe. Der Ehe. Im Zeitalter des Frustfressens, des Kummerspecks, des Nachts-zum-Kühlschrank-Gehens, dort, wo bei Axel Hacke der Bosch brummt, wenn sich der Erzähler sein Bier holt und die Zwiesprache des nächtlich Alleingelassenen mit dem technischen Gerät sucht.
Wir wollen das alles nicht überstrapazieren. Aber Witze sind gesellschaftliche Momentaufnahmen, die Lebenslügen offenlegen, oder etwas bescheidener, eine Nummer kleiner: Ein Witz zeigt, was unsere Gewohnheiten über uns sagen.
Und noch etwas zeigt sich an diesem Witz. Er hat einen Rahmen, eine Rahmenerzählung: Zwei Freunde, die einander länger nicht gesehen haben, treffen sich im Club. Der eine stellt eine gewisse Verfettung an dem anderen fest. Dieser Rahmen federt den Witz ab. Denn der Witz transportiert auch eine Art Beichte: Wir, sagt der Witzeerzähler, werden alle ein bisschen fett, weil uns das Leben faul, träge und zu Gewohnheitstieren macht.
Solche Beichten wären, in »Alltagsprosa« erzählt – du, weißt du, dass ich zu Hause immer öfter aufstehe, um in der Nacht noch etwas aus dem Kühlschrank zu holen? –, ziemlich ermüdend. Es ist die Pointe, die die Wahrheit erträglich macht. Ich, der ich viel auf Reisen zu Lesungen und Vorträgen bin, ertappe mich dabei, dass ich des Nachts Toblerone oder Bounty aus der Minibar verzehre. Niemand außer meiner Alleinsein-Routine muss dabei zu mir »Is was« oder »Trink was« sagen.
Das nächste Beispiel spielt an der Bar. Der Barkeeper ist ein Tröster der einsamen Geschäftsreisenden, der Gruppen, in der die Unermüdlichen und Schlaflosen, die scheinbar noch Aufgekratzten, die aus Angst vor dem Zubettgehen noch einen nehmen. Einen Absacker. Barkeeper sind oft die letzten Gesprächspartner, die Beichtväter der Moderne, man kommt sich mit ihnen über Gespräche über das Wetter, die Politik, die Lage näher, probiert einen neuen Drink, und schon geht das Beichten los. Hemingway hat sie geliebt, in Paris, in Madrid, in Venedig, auf Kuba. Es gibt berühmte Bars, und in Las Vegas oder Atlantic City haben sich ganze Generationen von Gangstern, Stars, Schriftstellern, Pianisten an der Bar das Hirn aus dem Kopf gesoffen. Die Bar war der Ort der »Lost Generation«, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Philip Roth. Es gibt einen unsterblichen Frank-Sinatra-Song von dieser Welt: »One for My Baby, One More for the Road«.
Hier der Witz:
In der Bar des Hamburger Hotel Atlantic oder der des Berliner Adlon oder der des Münchener Vier Jahreszeiten sitzt am Tresen ein einzelner Gast und bestellt zwei einfache Whiskys. On the rocks! Nach geraumer Zeit: Noch mal zwei Whiskys. Auf Eis. Und dann, nach etwa einer weiteren Stunde: »Noch zwei, bitte! Mit Eis!«
Der Barmann sagt zu dem einsamen Gast: »Entschuldigung! Es geht mich ja nix an. Aber warum bestellen Sie nicht statt der zwei Einfachen einen Doppelten? Das wäre doch logischer.«
»Nein, nein«, sagt der einsame Trinker. »Das verstehen Sie falsch. Jetzt, wo ich hier meinen Whisky trinke, sitzt mein bester Freund in London im Carlton, bestellt sich auch zwei und wir prosten uns zu!«
»Ach, das ist aber eine schöne Geschichte«, sagt der Keeper. Und der Mann zahlt und geht.
Eine Woche später kommt er wieder. Setzt sich, und als der Kellner sich ihm zuwendet, sagt er: »Einen einfachen Whisky. Auf Eis.«
Der Barkeeper schaut ihn kurz verdutzt an und stellt ihm dann einen einfachen Whisky hin. Nach einer Weile bestellt der Mann wieder einen Einfachen. Mit Eis. Und als das zum dritten Mal passiert, sagt der Keeper wieder:
»Entschuldigung, es geht mich wieder nichts an! Aber ist Ihrem Freund in London im Carlton etwas passiert? Etwas Schlimmes?«
»Nein, nein«, beruhigt ihn der Mann. »Keineswegs. Es geht ihm gut. Nur ich habe mir das Trinken abgewöhnt.«
Auch dieser Witz hat einen überraschenden Dreh, eine Pointe, die alle Erwartungen auf den Kopf stellt. »Gott sei Dank«, denkt der Barkeeper und mit ihm der neugierige Zuhörer, »ist dem Freund in London, dem der Freund in Hamburg aus der Distanz kumpelhaft zuprostet, nichts passiert.«
Doch das ist nicht einmal die halbe Wahrheit der Pointe. Im Gegenteil. Der Witz erzählt, während er scheinbar eine rührende Freundschaftsgeschichte von zwei getrennt Vereinten vorträgt, davon, dass Freundschaft in Wahrheit nur ein Vorwand für das Saufen ist. Wie Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt (Vatertag), Betriebsfeiern (wenn sie nicht, wie im Gellért-Bad in Budapest, für eine Versicherungssause die Gartenlaube zum Puff machen), Karneval, Geburtstage. Alles endet in der fröhlichen Gewissheit: Darauf müssen wir noch einen trinken. Prost, Gerd! Sehr zum Wohl, Paul! So jung kommen wir nicht mehr zusammen! Der Witz vom Gast in der Atlantic-Bar entlarvt die Männerfreundschaft als pure Ausrede für das Sich-allein-Besaufen.
Auch dies ist eine Geschichte, die, mit schöner Kunstfertigkeit erzählt, die gefühlige Scheinwelt eines Freundschaftsrituals zum absurden Ende bringt. Es ist die Lumpazivagabundus-Pointe Nestroys: »Wann ich mir meinen Verdruß nit versaufet, ich müßt mich grad aus Verzweiflung dem Trunk ergeben.«
Im garantiert alkoholfreien Himmel würde darüber niemand lachen.
So unsicher man darüber sein kann, ob es den Himmel überhaupt gibt, so sicher ist es, dass dort keine Witze über Religionen mehr erzählt werden – erzählt werden müssen. Zumindest nicht der folgende, in dem es um Religion und Atheismus geht und der einen kämpferischen Atheisten und einen altersmüden Bischof zu Protagonisten hat.
Die beiden gehen, in einen »Gibt es Gott? Gibt es Gott nicht?«-Disput verwickelt, am Wiener Ring entlang. Und man hört Fetzen ihres erregten Dialogs.
Der Atheist sagt: »Ich glaube nicht an Gott!«
Und der Bischof: »Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen mir und Ihnen. Ich glaube nicht einmal das!«
Das ist eine witzige Variante des Bekenntnisses von Augustinus, der da schrieb: »Credo, quia absurdum est.« – Ich glaube, weil es unvernünftig ist. Umso unvernünftiger ist es, dass sich Menschen deswegen oder unter dem Vorwand des Glaubens bis heute die Köpfe einschlagen, dass es Männer gibt, die sich und andere für das Versprechen umbringen, im Paradies dafür von willigen Jungfrauen empfangen zu werden. Der Glaube kann eben nicht nur Berge versetzen. Sondern auch die Erde mit Himmelversprechen zur Hölle verwandeln. Aber auch das ist nicht neu und bestenfalls ein schlechter Witz.
In Zeiten der Schlachten des Feminismus und der Kämpfe gegen die Diskriminierung von Schwarzen gab es in den USA einen Witz von einem Mann, der aus dem Todeskoma wieder erwacht und, nachdem er zurück auf Erden ist, gefragt wird, ob er denn Gottes Antlitz gesehen habe.
»Yes«, antwortet er. »She is black.«
Damals gab es auf Erden weder Obama als Präsidenten noch Angela Merkel als Kanzlerin. Aber von Vater und Sohn im Himmel war nicht die Rede.
WIE WIRD MAN WITZEERZÄHLER?
Wie ergreift man diesen Beruf, der zur fixen Idee werden kann und sich manchmal vom Menschheitssegen zur Menschheitsplage auswächst, wenigstens was die Opfer des Witzeerzählers betrifft. Die Antwort muss lauten: aus Mangel oder, freudianisch gesprochen: aus Substitution. Der Witz ist eine Ersatzhandlung.
Vielleicht erinnern sich manche noch an den Sportunterricht, wenn in der Klasse zwei Fußball- oder Volleyball- oder Völkerballmannschaften per Zuruf ausgesucht wurden. Die zwei Sportcracks der Klasse wählen sich ihr Team. Wer zu den zuletzt Ausgerufenen gehört, hat nur eine Chance, in der Klasse zu überleben: Er muss Klassenclown werden. Er muss durch Witz kompensieren, was er an Muskelkraft und Mut vermissen lässt.
Ich erinnere mich an die öffentliche Turnprüfung an Geräten, vor dem Abitur, als meine mir gewogene Russischlehrerin, bevor ich zur Tat schritt und ans Reck oder den Barren musste, mir beruhigend die Hand auf den Arm legte, bevor ich aufstand und losschritt: »Keine Angst, Hellmuth, ich werde bei Ihrer Übung die Augen zumachen.« Anderes als Witzeerzählen bleibt einem da nicht mehr.
Das gilt auch später noch, wenn die betuchteren Klassenkameraden in schickeren Klamotten oder gar mit dem eigenen Moped, Motorrad oder Auto vorfahren. Auch dagegen hilft nur Witze erzählen, Spaß machen! Die Lacher auf seiner Seite haben! Wer erzählt, braucht nicht zu handeln. Der gibt vor, schon gehandelt zu haben, und wer gehandelt hat, der hat anschließend was zu erzählen. Witze zum Beispiel.
Witzeerzähler wird man auch aus Überfluss, also dem Gegenteil von Mangel. Ein gewitzter Kopf hat so viel Verstand, dass er wenigstens etwas davon als Witz abgeben kann. Er kann sich den Witz leisten, er braucht sein bisschen Verstand nicht nur für die Realität. Es ist wie mit dem Klavierspieler, von dem es in dem Lied heißt: »… wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frau’n.« Ich habe Geige spielen gelernt, das ist ähnlich unattraktiv wie Blockflöte und klingt, vor allen Dingen bei Anfängern, gar nicht gut. Ich habe es nur auf zwei Jahre Geigenunterricht gebracht. Auch aus diesem Grund musste ich aufs Witzeerzählen ausweichen. Eine Zeit lang dachte ich, ich könnte meine »Mängel« auch mit Singen kompensieren, und heimlich glaube ich das immer noch, aber meine Familie hat mir längst den Schneid abgekauft. Was also bleibt mir? Das Witzeerzählen.
Dazu fällt mir auch gleich die Geschichte von dem Barpianisten ein, der den verliebten Paaren was ins Ohr spielt und säuselt.
Er hat als Attraktion einen kleinen Affen bei sich. Dieser Affe ist ein possierliches Tier, und ein junges Paar bemerkt auf einmal, dass der Affe sein Genital in ein Cocktailglas der beiden senkt. Der Mann schämt sich und flüstert dem Pianisten leise ins Ohr: »Ihr Affe hat sein – äh – in meinem Whiskyglas.« Der Pianist spielt weiter und fragt nur: »Hä?«, weil er nichts versteht. Wieder flüstert der junge Mann. Und als sich das dreimal wiederholt, sagt der Pianist: »Okay, summen Sie es, dann werde ich es spielen.«
Der Witzeerzähler – Frauen erklären in absoluter Mehrheit kategorisch: Ich kann keine Witze erzählen –, der Witzeerzähler also geht häufig eine Kumpanei mit einer bevorzugten Zuhörerin ein, der er besonders imponieren will. Sigmund Freud hat beschrieben, dass Männer beim Stammtisch schlüpfrige Witze oder doppeldeutige Witze oder auch Zoten mit Vorliebe dann erzählen, wenn eine weibliche Bedienung noch in Hörnähe ist. Sie brauchen auch unter Witzebrüdern das Gefühl, dass sie einen erotischen Kurzschluss zu einem weiblichen Wesen herstellen können. Nach dem Motto: Summen Sie es, ich werde es spielen. Besonders Witze mit absteigender Tendenz sind hierfür ein gutes Beispiel. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren, als ich noch jung und schuldig war, besonders gern den folgenden Witz erzählt habe. Es handelt sich um einen Graf-Bobby-Witz:
Graf Bobby unterhält sich mit seinem Freund Freddy darüber, wie viel Positionen es beim Lieben gibt. (Da drängt sich mir der Arbeitslosenwitz in den Kopf, wo ein Arbeitsloser fröhlich nach Hause kommt und ruft: »Ich hab ’ne neue Stellung!«, und die Frau antwortet: »Du Schwein, hättest dich besser um Arbeit kümmern sollen.«)
Bobby also denkt kurz nach und sagt: »Es gibt neunundneunzig Stellungen.« »Nein, hundert«, sagt Freddy.
Bobby rechnet wieder kurz im Kopf nach und sagt: »Nein, neunundneunzig.« Bis die beiden beschließen zu wetten, standesgemäß um eine Flasche Champagner. »Gut«, sagt Bobby nach dem Handschlag zu Freddy, »fang an aufzuzählen!.«
Immer wenn ich damals so weit mit dem Witz gekommen war, bemerkte ich eine gewisse Unruhe in den Augen der von mir angepeilten Zuhörerin. Was sie empfand, würde man heute wohl als Vorausschämen bezeichnen. Oh Gott, der nette Herr K. wird doch jetzt nicht mit einer schrecklichen Zote aufwarten und ekligen Details. Sie rutschte unruhig auf dem Stuhl hin und her und hüstelte. Ich fuhr unerbittlich fort:
»Also«, sagt Bobby zu Freddy, »fang an aufzuzählen!« Darauf sagt Freddy: »Erstens, normal.« Bobby unterbricht ihn und sagt: »Du hast gewonnen, das hatte ich ganz vergessen.«
Große Erleichterung und Gelächter, auch bei meiner Zuhörerin. Gleichzeitig hatte ich sie sozusagen in eine Geheimverbindung mit meinen schmutzigsten Gedanken, die sie mir zutraute, gebracht. Wir waren gewissermaßen über etwas Unausgesprochenes verkuppelt. Wenn ich etwas übertrieb, so schämte sie sich sogar ein bisschen, weil sie mir so etwas Schmutziges zugetraut hatte. Ich war sicher, dass sie, in Gedanken wenigstens, tätige Reue übe. Viele Witze sind schlüpfrig, was nicht nur an die Flüssigkeit des Humors erinnert, sondern auch an das Ausrutschen auf dem doppelten Boden des Witzes, der ja, wenn er gut ist, das Zweideutige eindeutig macht und, indem er es verbessert, verschlimmert.
Es gibt das entwaffnende Frage-und-Antwort-Spiel mit Woody Allen: »Muss Sex eigentlich immer schmutzig sein?« – »Wenn er gut ist, schon.«
Die im Witz außer Kraft gesetzte Zensur, die für einen Moment den Blick auf die schmutzige beziehungsweise als schmutzig verschriene Wahrheit lenkt, erinnert an die Polizei, und zwar an die Sittenpolizei (die ja laut Freud auch im Hirn tätig ist). Im Witz findet das statt, was Karl Kraus für den Sittenskandal gesagt hat: »Der Skandal fängt an, wenn die Polizei ihm ein Ende bereitet.«
Labiche und Feydeau, die großen französischen Salonkomödienschreiber des 19. Jahrhunderts, stellten ihre Helden in zwei beliebten komischen Konstellationen dar, die für den Helden tragisch und für den Zuschauer komisch waren. Die erste Situation war die In-flagranti-Situation. Überraschend kommt der Ehemann nach Hause, der Liebhaber muss im Schrank oder im Kabinett verschwinden, es geht zu wie im zweiten Akt von Mozarts Figaros Hochzeit. Dieser Mechanismus schnurrt wie ein Maschinchen ab und erfüllt die Bergson-Definition von Komik: Komik ist Mechanik.
Witzeerzähler sind immer auch Geschichtenerzähler. Dazu hat mir Reich-Ranicki, mit dem mich eine lange kollegiale Freundschaft verbindet, ein schönes Beispiel erzählt. Er hat in Polen, nach der Flucht aus dem Getto mit seiner Frau, bei einem polnischen Paar überlebt, das ihn unter Lebensgefahr versteckte. Die Reichs mussten tagsüber im Keller bleiben, wo sie für die Hausbewohner Zigaretten drehten. Der Pole, der sie versteckte, hat den kühnen faustischen Pakt mit trotzigem Heldenmut beschrieben: »Hitler hat vor, euch zu vernichten. Ich setze dagegen und werde euch zu überleben helfen.« Um den Polen in der Dunkelheit wegen der Stromsperre die Zeit angenehm zu vertreiben, erzählte Reich jeden Abend Geschichten. Er benutzte dazu sein ganzes klassisches Repertoire. Machte aus Hamlet und Othello, aus Don Carlos und aus Faust spannende Geschichten, eine Art Scheherazade im Überlebenskampf, »Tausendundeine Nacht« in lebensrettenden Geschichten. Ein makabrer Witz ist, dass Reichs Lebensretter erst nach seinem Tod in Israel, in Yad Vashem, mit einem Baum in der »Allee der Gerechten unter den Völkern« geehrt werden wollte. Wegen des in Polen damals noch latenten Antisemitismus hatte er Reich gebeten, seine »Gastfreundschaft« doch bitte nicht zu seinen Lebzeiten bekannt zu machen.
Ich erinnere mich an einen Witz, den Reich erzählt hat. Er spielt im Tschechow-Russland, wo die Frau ihrem Hausfreund ein Telegramm folgenden Inhalts schickt:
»Mein Mann fährt als Arzt für ein halbes Jahr nach Sachalin. Dann kannst du herkommen, und wir können uns ungestört mit Vögeln beschäftigen.«
Darauf telegrafiert der Hausfreund zurück: »Anspielung verstanden, komme nächste Woche.«
Wobei Reich sich beim Erzählen des Witzes das Wort »Anspielung« gestattete, es heißt auf Russisch »Allusio«. Da war er wieder in seinem Element, beim Theater, bei den Illusionen, bei Illusionen und Allusionen.
Ein wunderbarer Witzeerzähler war auch der Theaterkritiker Georg Hensel, dessen Spielplan wohl die letzte zum Buch geronnene Theatergeschichte des Welttheaters ist, zwei gewichtige Bände. Eine Heidenarbeit. Hensel schrieb in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine großartigen Kritiken und liebte es, sich vor dem Theater oder in der Pause oder auch nach dem Theater mit ein paar Witzen zu entspannen. Damals war gerade der Ayatollah nach dem Sturz des Schahs im Iran an die Macht gekommen, bald sollte es dort nichts mehr zu lachen geben. Also erzählte mir Hensel den folgenden Witz:
Ayatollah Khomeini geht in Zürich durchs Rotlichtviertel. Da öffnen sich die Fenster und Türen, und mehrere Prostituierte rufen: »Komm eini!« Darauf schüttelt der Ayatollah den Kopf, zeigt mit beiden Händen in Richtung seines Schoßes und sagt: »Geht nicht. Is lam.« Ihm folgt unerwartet der Papst, der mit einer siegessicheren Geste fröhlich ausruft: »Vati kan!«
Das ist ein Witz der totalen Regression in eine kindische Laune, die einen Haufen Unsinn in einen zu großem Gelächter animierenden Sinn verbindet. Schon die Situation ist völlig idiotisch, dass ausgerechnet der Ayatollah, gefolgt vom Papst, durchs Zürcher Rotlichtmilieu schlendert, wobei die Stadt Zürich sich als Schauplatz nur aus dem Umstand herleitet, dass der Name des Ayatollah, Khomeini, nur in Zürich in etwa an ein »Komm herein« heranreicht. Wobei das bescheuerte Wortspiel »Vati kann« nur in diesem Nest von Blödsinn überhaupt gedeihen kann.
Der Witz war wohltuend in einer religiös fanatisierten Welt, weil er absolut kindisch mit den Widersprüchen der Religion spielte, kindisch (und also anarchistisch und doch blasphemisch). Witze sind dann gut, wenn sie sich in einer spontanen Situation auf einmal wieder als aktuell und passend erweisen.
Neulich saß ich mit ein paar Juristen zusammen, unter anderem mit Maja Stadler-Euler, die als Rechtsanwältin 1983 den Sieg vor dem Verfassungsgericht gegen die Volkszählung herbeigeführt hatte. Da fiel uns die jetzige Volkszählung ein, und wir sprachen darüber, dass Volkszählungen heute natürlich anders ablaufen. Man muss nicht mehr unendlich viele Haushalte befragen, sondern kann, ähnlich wie bei Wahlprognosen oder Kaufverhalten, hochrechnen. Bei der letzten Volkszählung ging es vor allen Dingen um die Angst vor dem Verlust privater Daten. Und mir fiel ein Witz von damals ein:
Da kommt ein Volkszähler zu einer Vier-Parteien-Villa, ein nackter Mann öffnet ihm die Tür. Der Volkszähler tut so, als bemerke er es nicht, und fragt: »Entschuldigung, ich muss die Menschen zählen, die hier in diesem Haus wohnen. Wer wohnt hier unten in der rechten Wohnung?« Darauf sagt der Mann: »Da wohne ich mit meiner jetzigen Familie mit drei Söhnen und vier Töchtern.« Der Volkszähler notiert das und sagt: »Aha. Und wer wohnt in der linken Wohnung?« »Da wohnen meine Freundin und ihre sieben Kinder, vier Töchter und drei Söhne.« Wieder notiert der Volkszähler und nickt: »Und oben in der rechten Wohnung?« Der Mann: »Meine Frau aus erster Ehe mit ihren acht Kindern, vier Mädchen, vier Jungs.« »Und oben links?« »Meine Frau aus zweiter Ehe: fünf Kinder, zwei Mädchen, drei Jungs.« Der Volkszähler sagt: »Vielen Dank. Übrigens noch eine private Frage: Sie sind wohl Nudist?« Antwortet der Mann: »Keineswegs. Ich habe nur keine Zeit zum Anziehen.«
Ein großer Witzeerzähler war auch Ignatz Bubis, der seiner Frau immer vorsichtig einen Blick zuwarf, bevor er loslegte. Geradezu begnadet als Witzeerzähler waren der Kanzler Willy Brandt, der spätere Präsident Johannes Rau und sein Schwiegergroßvater Gustav Heinemann, die beim Skatspiel immer einen Witz auf Lager hatten. Ich erinnere mich an einen von Helmut Schmidt, als der Kanzler war und sozusagen die übersteigerten Ansprüche an den Sozialstaat per Witz geißeln wollte. Es ist ein Hamburger Witz.
Bitterkalt ist es, und der vierjährige Junge, der mit seiner Mutter an der Alster entlanggeht, läuft aufs Eis und bricht ein. Kühn kommt ein junger Mann, stürzt in das Wasser und rettet den Jungen. Als er ihn zur Mutter zurückbringt, guckt die das Kind an und sagt: »Und wo ist die Mütze?«
So kann man soziale Ansprüche auch umschreiben.
Theaterleute sind oft großartige Witzeerzähler, besonders gern erzählen Schauspieler nach der Vorstellung, wenn sie sich an hohen Texten abgearbeitet haben, blödsinnige Witze. Zur Entspannung sozusagen. Als Jürgen Flimm Intendant der Salzburger Festspiele wurde, hat er mir in der ersten Spielzeit den folgenden Witz erzählt (Flimm ist durch seine Kölner Herkunft schon von Geburt an zum Witzeerzählen prädestiniert):
Zwei Ösis gehen in ein Beisl, wo sich jeder ein Tellergulasch bestellt. Sie bekommen das Gulasch, kosten es und merken, dass es zu wenig gesalzen ist. Also greifen sie nach dem Salzfass und versuchen es zu salzen, aber die Löcher des Salzstreuers sind verstopft. Also essen sie missmutig das ungesalzene Gulasch vor sich hin. Als ein Piefke das Lokal betritt und sich auch ein Tellergulasch bestellt, werden sie aufmerksam. Schadenfroh beobachten sie, wie auch ihm Salz zu fehlen scheint, wie auch er den Salzstreuer nimmt, wie auch er bemerkt, dass nichts rauskommt. Dann aber sehen sie, wie er zu einem Zahnstocher greift, die Löcher des Streuers frei macht und sich sein Gulasch entsprechend nachwürzt. Daraufhin guckt einer der Ösis den anderen an und sagt: »Ich kann die Piefkes
nicht leiden. Owa technisch san’s uns überlegen.«
Billy Wilder wusste zu jeder Situation einen passenden Witz. Als sich in den Sechzigerjahren eine Zeitenwende, die der sexuellen Revolution, ankündigte, hatte er folgende Geschichte parat:
Vor dem Himmel steht eine lange Schlange. An der Eingangspforte werden die weißen und die schwarzen Schafe voneinander geschieden. Auf einmal bricht vorne Jubel aus, wildfremde Seelen umarmen einander, die Männer werfen ihre Hüte in die Luft, die Frauen beginnen zu tanzen, und schließlich spricht es sich durch die kilometerlange Schlange nach hinten durch:
»Sex doesn’t count.« –Sex zählt nicht.
Damals hatte Billy Wilder schon zwei seiner moralischen Komödien über Sex gedreht, Das verflixte siebente Jahr und Manche mögen’s heiß. Die dritte, Das Appartement mit Shirley MacLaine, fällt in die Zeit, als Sex nicht mehr zählte. Es ist bezeichnenderweise die erste der drei Komödien, in der ein Selbstmordversuch vorkommt. So viel zur schönen neuen Zeit!
Ich habe Billy Wilder einmal gefragt, wie es denn um seine Gemütsverfassung als Komödienschreiber stehe, als Filmemacher von unendlich lustigen Geschichten und als Causeur, der seinen Zuhörern stets einen Witz, zum Gesprächsthema passend, beisteuern könne, dessen Pointe haarscharf das Problem trifft? Eigentlich wollte ich wissen, ob Witzeerzähler lustige Menschen sind, sein können.
Der über Achtzigjährige sah mich einen Moment lang nachdenklich an und sagte: »Ich will dir eine Geschichte erzählen.« (Der Zufall will es, dass sie auch in Zürich spielt.)
In Zürich kommt ein Herr zu einem Psychiater und sagt, es gehe ihm so schrecklich schlecht, er drohe in eine Depression zu fallen, und was der Doktor ihm raten könne. Der Arzt guckt aus dem Fenster seiner Praxis, sagt: »Da liegt der Zürisee, es ist herrliches Wetter, man kann bis zu den Bergen sehen, der Himmel ist blau, die Luft lau. Gehen Sie da spazieren, Sie werden lauter fröhliche, gut gekleidete Menschen treffen, die den Frühling genießen.« Er macht eine Pause, dann fährt er fort: »Dann ist es Mittag, Sie gehen in eines der hervorragenden Restaurants, etwa in die Kronenhalle, essen Sie dort ein Zürcher Geschnetzeltes, trinken einen schönen Wein.« Wieder setzt er neu an: »Und am Nachmittag, da schlendern Sie die Bahnhofstraße entlang, gucken in die Schaufenster der wunderbaren Bekleidungsgeschäfte, in die Confiserien, wo es die beste Schokolade, das beste Konfekt und sehr guten Kaffee gibt.« Nach einem Moment sagt der Arzt auf einmal: »Ah, und am Abend, da müssen Sie unbedingt in den Zirkus gehen! Der wird Ihnen Ihre melancholische Laune sofort vertreiben. Dort tritt Grock auf, der große Clown Grock« Darauf blickt ihn der Mann traurig an und sagt: »Aber ich bin Grock.«
Mit ein bisschen Koketterie war das schon die Wahrheit. Wilder hat sich, als er mit der Monroe Some Like It Hot drehte, mit folgendem Galgenhumor über die immer schwierigere Dreharbeit mit dem Star gerettet: »Früher kam sie am Donnerstag, wenn am Dienstag gedreht werden sollte, jetzt kommt sie im Herbst, wenn die Dreharbeiten im Frühling sind.« Dann erzählte er viele unendlich lustige Schnurren über die Monroe und sagte: »Ich konnte während der ganzen Dreharbeiten nicht schlafen, weil ich vor lauter Stress Rückenschmerzen hatte.«
Beim Witzeerzählen kommt es allerdings auch auf die Zuhörer an. »Ein guter Witz braucht nicht nur einen guten Erzähler, sondern auch einen guten Zuhörer.«
IST LACHEN DIE BESTE MEDIZIN?
Der Volksmund sagt: »Lachen ist die beste Medizin.« Oder: »Lachen ist gesund!«
Stimmt denn das? Ist es denn so, dass gleich der Sonne, die den Trübsinn vertreibt, das Lachen schlechte Laune, Schwermut, Depression und damit Krankheiten im Keim erstickt? Als noch die Lehre von den vier Temperamenten galt, die Menschen in Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker und Sanguiniker einteilte und Lebenssäfte für seelische und körperliche Eigenarten verantwortlich gemacht wurden, war der aufbrausende Choleriker noch von der gelben Galle und der triste Melancholiker von der schwarzen Galle bestimmt, der träge Phlegmatiker von Schleim, und der Sanguiniker mit seiner Springlebendigkeit und dem frisch pulsenden Blut verkörperte Leben und Gesundheit, Fröhlichkeit, Energie und Lachen.
Lachen ist gesund, und Eckart von Hirschhausen hat, wenn er durch Witze zum Lachen inspiriert, durchaus auch therapeutische Ziele.
Bei den Diskussionen vor dem gemeinsamen Abend »Ist das ein Witz?« habe ich dazu eingewandt, dass sich das Lachen in der Sprache eher zerstörerisch, krankmachend, schwächend, ja todbringend manifestiert:
Man lacht sich tot, krank, kaputt, schief, scheckig, krumm, man lacht sich einen Ast (was das Gleiche wie bucklig ist), man »kann nicht mehr« vor Lachen, man platzt vor Lachen.
Und Hirschhausen gab eine »ärztliche« Antwort: Das sei auch richtig, denn beim Lachen würde die Kontrolle über die Muskeln sozusagen außer Kraft gesetzt, sie entgleisen. Deshalb, er gab ein drastisches Beispiel, sei es nicht gut, wenn man zwei Möbelpackern, während sie ein Klavier die Treppe hoch ins dritte Stockwerk schleppen (in meinem Hinterkopf blitzte kurz ein Nebengedanke an Loriots Sketch »Ein Klavier, ein Klavier!« auf), einen Witz erzählen würde, sodass beide lachen müssten. Das würde dazu führen, dass sie die Kontrolle über das schwere, sperrige Klaviermöbel verlören, ein Unfall wäre die Folge.
Wie gut, dass es inzwischen Kräne und Möbellifte gibt, auf die Möbelpacker sich beim Lachen verlassen können, dachte ich kurz. Aber zur Mechanik der Komik, also zu Henri Bergsons Theorie des Lachens, komme ich später.
Ich denke, dass bei aller anatomischen Wahrheit über das Schieflachen, das Kranklachen, das Kaputtlachen die Sprache mit ihrer Treffsicherheit auch etwas berührt, was auf das psychologische »Außer-Rand-und-Band-Geraten«, das gesellschaftliche »Ich platze vor Lachen« zielt. Auf das »Dampfablassen« im Lachen, auf die Ventilfunktion.
Wir lachen, um auch für den Moment des »befreienden Lachens« den gesellschaftlichen und moralischen Druck aufzuheben, der auf uns als Mitglieder von Familie, Sprache, Gemeinschaft lastet. Das ist gut –und ebenso gefährlich. Wie gefährlich, zeigen repressive Gesellschaften, Staaten, Kirchen, wenn sie den Druck des Witzes, seine Explosion im Gelächter fürchten. Es wäre so, als bestünde die Gefahr, dass der Karneval (die fünfte Jahreszeit, die des Spaßes, Gelächters, des Außer-Rand-und-Band-Seins) zur komischen Revolution würde – eine Spaßpartei, die eine Mehrheit erobert. Da sei Gott vor und der Ernst!
Lachen befreit, und Lachen macht handlungsunfähig, es fesselt uns – nirgends ist das so krass beschrieben wie in dem Barockroman Simplicius Simplicissimus von Grimmelshausen im Eingangskapitel: Da wird der naive kindliche Held Zeuge, wie die Schweden seinen Vater foltern: indem sie seine nackten Füße mit Salz bestreuen, ihn fesseln, eine Ziege das Salz ablecken lassen und ihn dabei in ein quälendes, nicht enden wollendes Lachen treiben. Lachen ist wie der Schwedentrunk eine Foltermethode, um die Wahrheit aus dem Opfer herauszukitzeln: nämlich die, wo er seine Schätze vergraben hat, an die die Soldateska herankommen will.
Auch wenn Kinder sich beim Kämpfen kitzeln, setzen sie auf die Entkräftung des Lachens, sie wollen den Gegner schwächen, außer Gefecht setzen, besiegen.
Ein Witz aus dem Burenkrieg ist wie ein Echo auf diesen Tatbestand:
Ein Kriegsteilnehmer erzählt auf einer Teegesellschaft in London, wie er während des Buschkriegs drei Tage von einem Zulu-Speer verwundet auf dem Steppenboden bei brennender Sonne in der Hitze gelegen habe.
»Das muss doch sehr schmerzhaft gewesen sein?«, fragt die Dame des Hauses teilnahmsvoll.
»Nur, wenn ich lachen musste«, erwidert der Burenkriegsveteran.
Wer je mit gebrochenen Rippen darniedergelegen hat, weiß, dass neben dem Husten das Lachenmüssen die schmerzhafteste Erfahrung ist. Werden dem Kranken Witze erzählt, wirkt das wie Kitzeln, wie Reizhusten oder gar Niesen – eben schmerzhaft – durch das Lachen.
In der Gesellschaft ist das Lachen der Lohn des Komikers, des Witzbolds – wie der Beifall für den Pianisten, den Schauspieler, den Trapezkünstler. Der Beifall symbolisiert, sozusagen stellvertretend, eine Umarmung, ein kollektives In-den-Arm-Nehmen des Künstlers durch sein Publikum, sein Auditorium. Das Gleiche gilt für das Lachen, es schließt ein, umarmt, es ist, als ob sich alle bei den Händen nähmen, es ist (im schlimmsten Fall) dem Schunkeln auf dem Oktoberfest ähnlich, wo sich auch alle unter Alkoholgenuss »gemeinmachen«. Der Witzeerzähler tritt seinen Zuhörern zu nahe, und sie bedanken sich für die im Lachen sanktionierte Verletzung ihrer Intimsphäre durch gemeinsames Lachen.
Wer etwas vereint, etwas gemein(sam)macht, zur geschlossenen Gesellschaft, zur einigen Gemeinschaft, der schließt auch andere aus, andererseits.
Henri Bergson hat in seinem bahnbrechenden Essay Das Lachen. Über die Bedeutung des Komischen analysiert, dass Komik nur in geschlossenen Systemen funktioniert. Andere fühlen sich dann (ebenso logisch) ausgeschlossen. Wenn man zum Beispiel in einem Restaurant, in einer Bar, in einer Hotelhalle oder einem Zugabteil, einer geschlossenen Gruppe beim Lachen zuhört, klingt das auf einmal nicht einnehmend, solidarisch, sondern abstoßend, ausschließend. Wer allein dem Lachen von Skatrunden, von Fußballfans, von Klassenreisenden zuhört, auf den wirkt das Lachen grundlos albern, gemein enthemmt, ja abstoßend. Man kommt sich umso verlassener vor, je ausgelassener die anderen sind bei ihrem Jägerlatein, ihren Zoten, ihrer Schadenfreude.
Ein Beispiel für Witze, die absichtlich andere aussortieren und sich über sie lustig machen, sind natürlich die Schwellenangstwitze über Neureiche oder Kulturbanausen. Gut, dass wir nicht sind wie jene, will das höhnende Lachen dazu sagen.
Ein preußischer Offizier kommt in die Oper. Wagners Lohengrin steht auf dem Programm. Er hat nicht mitbekommen, dass es eine Programmänderung gegeben hat.
Er sitzt also und lauscht, rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her, bis es ihn nicht mehr hält und er flüsternd seinen Nachbarn fragt: »Wann kommt denn endlich der Schwan?«
Der Nachbar sagt: »Überhaupt nicht. Das Programm wurde geändert. Das hier ist Figaros Hochzeit, nicht Lohengrin.«
»Ach«, sagt der Offizier. »Dann kann ick ja jehen, da kenn ick jede Note.«
Oder im Schauspielhaus: Ein Zuschauer sagt zu seinem Nachbarn: »Heute ist die Akustik nicht gut.«
Der andere, nach einer Weile: »Jetzt höre ich’s auch!«
Beim Tanzen: Die Komtesse versuchte es mit Konversation. Sie fragt den sie führenden Leutnant: »Kennen Sie Ibsen?«
»Nee, wie tanzt man det?«
Schon Henri Bergson hat Antwort auf die Frage gesucht: »Was haben die Grimasse des Clowns, ein Wortspiel, eine Verwechslung in einem Schwank und eine geistvolle Lustspielszene miteinander zu tun?« Das Buch Über das Lachen erschien Anfang des 20. Jahrhunderts, und der Autor war von dem Phänomen Mensch und Technik, Mensch und Maschine fasziniert. Er entdeckte den Dreierschritt der Komik, der sich in zahllosen Witzen finden und wiederfinden lässt. Es ist das System der Dialektik, das sich in einem Dreierschritt vollzieht: These, Antithese, Synthese. Nur dass im Witz statt der Antithese eine Volte folgt, die alles witzig macht, wie folgender Witz belegt:
Karl zu einem Bekannten: »Kommst du heute Abend auch zu meiner Sexparty?«
»Klar, wie viele kommen denn?«
»Wenn du deine Frau mitbringst, sind wir zu dritt!«
Und er entdeckte die Mechanik der Komik, die sich wohl am besten und buchstäblich am augenfälligsten an den grandiosen Slapstickszenen von Chaplins Modern Times demonstrieren lässt.
So, wenn Chaplin in der Fließbandszene stundenlang monoton und immer schneller zweihändig mit einem Schraubenschlüssel Muttern an Schrauben festziehen muss – bis die Bewegung schluckartig in seine Körpermechanik übergeht, sodass er konvulsivisch weiterzuckt und der Körper wie von einem Schluckauf geschüttelt wird, als das Band stehen bleibt. Da naht eine Vollbusige, die schwarze Knöpfe wie Schrauben auf ihrem Kleid in Busenhöhe hat – sofort eilt er herbei und will den Schraubenschlüssel ansetzen.
Oder die Szene auf der Straße: Als ein Auto vom Straßendienst eine rote Fahne zur Kennzeichnung einer Unfallstelle verliert, Chaplin hilfsbereit hinterherrennt, die rote Fahne aufhebt und sie in Richtung Chauffeur schwenkt, um ihn auf seine verlorene Fahne aufmerksam zu machen – rasch sammelt sich hinter dem das rote Fähnchen schwenkenden Chaplin eine Menschenmenge: zu einer politischen Demonstration.
Wie hier ein mechanisches Missverständnis quasi eine Revolution auslöst – das zeigt die explosive Kraft des komischen Missverständnisses. Der Schluss, die Pointe ist so falsch, dass sie letztlich wahr und richtig ist. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode, heißt es im Hamlet. Der Witz hat Wahnsinn als Methode.
SCHLECHTE WITZEERZÄHLER
Dies ist ein kurzer Witz, ein sehr kurzer Witz:
Ein Elefant sieht einen nackten Mann und sagt: »Armer Kerl, wie willst du je satt werden?«
Nicht komisch? Vielleicht doch zu kurz erzählt? Ich mache noch einen Versuch:
Ein Elefant begegnet zum ersten Mal einem nackten Mann am Strand und sagt: »Armer Kerl, wie willst du mit diesem Rüssel je satt werden?«
Jetzt ist er eindeutig zu lang erzählt. Der Rüssel muss unbedingt wieder aus dem Witz. Wenn Sie nicht lachen, versuche ich Ihnen jetzt den Witz zu erklären. Sie werden dann erst recht nicht lachen, aber sei’s drum! Weil man nach erklärten Witzen nicht (mehr) lacht. Es ist der Witz einer falschen Analogie, eines Analogie-Kurzschlusses. Der Elefant, dessen Rüssel sein wichtigstes Greifwerkzeug zur Ernährung ist, mit dem sich der Riese das Gezweig abreißt und in den Mund schiebt, denkt: »Mein Gott, hat der Mann einen kleinen Rüssel.« Der Elefantenrüssel dient ihm zur Nahrungsaufnahme; was er für den menschlichen Rüssel hält, dient in Wahrheit der Vermehrung. Der Witz pointiert ein Missverständnis. Er empfindet Schadenfreude über ein zu kleines Organ, gehört also zu den phallokratischen Witzen, aber hier wird die Schadenfreude zum Witz, weil sie sich irrt. Zum